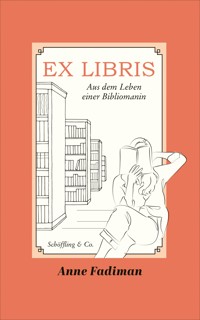
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anne Fadiman lebt das Leben einer echten Bibliomanin: Zum ersten Mal von Sex erfuhr sie aus Fanny Hill, das sie in der Bibliothek ihres Vaters fand. Ihr Ehemann schenkte ihr eines Geburtstags ganze 10 Kilo staubiger alter Bücher. Und einmal verschlang sie sogar vor lauter Verzweiflung die Gebrauchsanweisung zum 1974er Toyota Corolla ihrer Mitbewohnerin, weil es das einzige Buch in der Wohnung war, das sie noch nicht auswendig kannte. Ex Libris verbindet Anekdoten über bekannte Schriftsteller*innen und Bücher mit persönlichen Geschichten aus Fadimans unheilbar bibliophiler Familie. Sie schreibt über das Vermischen von Bibliotheken beim Zusammenzug mit einem geliebten Menschen, über Bandwurmwörter, ihre familiär vererbte ›Korrektor*innenmentalität‹ und die Unwiderstehlichkeit von Antiquariaten. Eine herrlich unterhaltsame Liebeserklärung an das Lesen und das Leben mit Büchern in 17 Kapiteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Vorwort
Wenn Bibliotheken heiraten
Wortungeheuer und Bandwurmwörter
Mein Kuriositätenkabinett
Tun Sie das keinem Buch an
Wahre Weiblichkeit
Worte auf dem Schmutztitel
Du bist dort
Das Innen-Problem
Erbsenzähler und Korrekturkoryphäen
Ewige Tinte
Der literarische Vielfraß
Nichts Neues unter der Sonne
Der katalogische Imperativ
Die Schlösser meiner Ahnen
Mitten im Wahnsinn
Das Bücherimperium des Premierministers
Prosa aus zweiter Hand
Lektüreempfehlungen
Danksagung
Autor:innenporträt
Übersetzer:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Widmung
Für Clifton Fadiman und Annalee Jacoby Fadiman, denen ich die Schlösser meiner Ahnen verdanke
Vorwort
Als der irische Romancier John McGahern ein kleiner Junge war, schnürten seine Schwestern einen seiner Schuhe auf und zogen ihn ihm aus, während er las. Er rührte sich nicht. Sie setzten ihm einen Strohhut auf. Keine Reaktion. Erst als sie den Stuhl wegzogen, auf dem er saß, begann er, seinen eigenen Worten zufolge, »aus dem Buch zu erwachen«.
»Erwachen« ist genau das richtige Verb; es gibt diese besondere Spezies von Kindern, die aus einem Buch erwachen wie aus dem abgrundtiefsten Schlummer und sich mühsam durch die Bewußtseinsschichten einer Realität entgegenarbeiten, die ihnen weniger real erscheint als der Traumzustand, aus dem sie gerissen wurden. Ich war ein solches Kind. Später, als Teenager und unter Thomas Hardys Einfluß, konnte ich mich nicht verlieben, ohne das Objekt als Damon oder Clym einzuordnen. Noch später lag ich mit meinem Ehemann (einem Clym) in unserem Bett, das ein Gebirge von Büchern bedeckte, und hoffte, die Ankunft unseres ersten Kindes würde Kittys Niederkunft in Anna Karenina gleichen, während ich insgeheim eine Ähnlichkeit mit der Mrs. Thingummys in Oliver Twist befürchtete.
Ex Libris begann ich zu schreiben, als mir auffiel, wie befremdlich es ist, daß über Bücher oft so geschrieben wird, als handele es sich um Toaster. Ist diese Marke besser als jene Marke? Ist dieser Toaster für 24,95 wirklich das Supersonderangebot? Kein Wort darüber, was ich in zehn Jahren für meinen Toaster empfinden werde, nichts über die zärtlichen Gefühle, die ich meinem alten Toaster vielleicht noch entgegenbringe. Diese Vorstellung von Lesern als Verbrauchern – der auch ich mit so mancher Rezension Vorschub geleistet habe – läßt völlig außer acht, was mir das Wichtigste am Lesen zu sein scheint: nicht ob man ein neues Buch erwerben will, sondern wie man die Beziehung zu den alten Büchern aufrechterhält, deren Textur und Farbe und Geruch uns so vertraut geworden sind wie die Haut unserer eigenen Kinder.
In Der gewöhnliche Leser schreibt Virginia Woolf, die ihren Buchtitel einer Stelle Samuel Johnsons Life of Gray entlehnt hat, von »all jenen Räumen, zu bescheiden, um den Namen Bibliothek zu verdienen, doch voller Bücher, und in denen das Geschäft des Lesens von Privatpersonen betrieben wird«. Der gewöhnliche Leser, so sagt sie, »unterscheidet sich von Kritikern und Gelehrten. Er ist weniger gebildet, und die Natur hat ihn weniger freigebig begabt. Er liest zu seinem eigenen Vergnügen und nicht unbedingt, um Wissen zu vermitteln oder die Meinung anderer zu korrigieren. Vor allem aber leitet ihn das instinktive Bestreben, eigenhändig aus allem, was ihm zufällig in die Finger gerät, etwas Ganzes zu gestalten«. Das vorliegende Buch ist das Ganze, das ich aus dem Tausenderlei, das mir zufällig in die Finger geraten ist und sich auf meinen durchgebogenen Bücherregalen häuft, zu gestalten versucht habe.
Die vorliegenden Aufsätze habe ich im Lauf von vier Jahren geschrieben. Sie sind in der Reihenfolge ihres Entstehens angeordnet – mit Ausnahme der beiden letzten, die den Platz tauschen mußten. Umstände habe ich so belassen, wie sie damals waren. Im Verlauf dieser Jahre wurde mein Sohn geboren, meine Tochter lernte lesen, mein Mann und ich wurden vierzig, meine Mutter wurde achtzig, mein Vater neunzig. Unsere Bücher jedoch – selbst die darunter, die lange vor unserer Geburt gedruckt wurden – sind alterslos geblieben. Sie haben das Vergehen der Zeit aufgezeichnet, und weil sie uns an all die Gelegenheiten erinnern, bei denen sie gelesen und wiedergelesen wurden, spiegeln sie auch das Vergehen der letzten Jahrzehnte wider.
Bücher haben unsere Lebensgeschichte geschrieben, und indem sie sich auf den Bücherregalen (und auf den Fensterbänken und unter dem Sofa und auf dem Kühlschrank) ansammelten, wurden sie selbst zu Kapiteln darin – was sonst?
Wenn Bibliotheken heiraten
Vor einigen Monaten beschlossen mein Mann und ich, unsere Bücher zu mischen. Wir kannten einander seit zehn Jahren, lebten seit sechs Jahren zusammen und waren seit fünf Jahren verheiratet. Unsere disparaten Kaffeebecher bewohnten einträchtig das Küchenregal, wir trugen die T-Shirts des anderen und seine Socken, wenn Not am Mann war, und unsere Schallplattensammlungen hatten sich schon vor langem ohne Zwischenfälle miteinander vereinigt, so daß meine Josquin-Desprez-Motetten sich an Georges Worst of Jefferson Airplane schmiegten, zur beiderseitigen Bereicherung, wie uns scheinen wollte. Unsere Bibliotheken jedoch waren säuberlich getrennt geblieben – meine weitestgehend im Nordteil unseres Lofts beheimatet, die meines Mannes im Südteil. Wir fanden es beide unsinnig, daß meine Ausgabe von Billy Budd viele Regalmeter von seinem Moby-Dick getrennt schmachten mußte, doch keiner von uns hatte bisher einen Finger gerührt, um sie zusammenzubringen.
Wir hatten in diesem Loft geheiratet, im vollen Bewußtsein der Quarantäne, die unsere Melville-Ausgaben erduldeten. Einander Liebe und Treue zu geloben, in guten wie in schlechten Zeiten, das war nicht weiter problematisch, aber problematisch wäre es zweifellos gewesen, wenn die Eheschließung die Aufforderung beinhaltet hätte, unsere Bibliotheken zu vermählen und Duplikate wegzuwerfen. Das wäre in der Tat ein Gelöbnis von solcher Tragweite gewesen, daß es die Hochzeit höchstwahrscheinlich überaus demütigend abgebrochen hätte. Wir waren Schriftsteller und betrachteten unsere Bücher mit Gefühlen, wie sie andere Leute wahrscheinlich ihren alten Liebesbriefen entgegenbringen. Bett und Zukunft zu teilen, das war ein Kinderspiel, verglichen mit der Herausforderung, meine Ausgabe der Gesammelten Gedichte von W. B. Yeats zu teilen, aus der ich »Under Ben Bulben« am Grab des Dichters auf dem Friedhof von Drumcliff laut vorgelesen hatte, oder Georges Ausgabe der Ausgewählten Gedichte von T. S. Eliot, die ihm in der neunten Klasse sein bester Freund Rob Farnsworth geschenkt und mit der Widmung »Alles Gute wünscht Dir Gerry Cheeves« versehen hatte. (Gerry Cheeves war nicht nur einer der Spitznamen Robs, sondern auch der Name des Torhüters der Boston Bruins, und die Widmung ist möglicherweise ein Unikat, indem sie erstmals in der Geschichte T. S. Eliot mit dem Eishockeysport in Verbindung bringt.)
Erschwerend für die Vereinigung unserer Melvilles machten sich zudem gewisse grundlegende charakterliche Unterschiede bemerkbar. George gehört zur Spezies der Anhäufer, ich zu jener der Unterteiler. Seine Bücher lebten in demokratischer Gemeinschaft, vereint unter der allumfassenden Flagge der Literatur. Manche waren vertikal eingeordnet, andere horizontal, und manche waren allen Ernstes hinter anderen Büchern versteckt. Meine Bücher waren nach Nationalität und Sujet balkanisiert. Wie die meisten Menschen mit ausgeprägter Toleranz für Unordnung hat George ein tiefverwurzeltes Vertrauen in dreidimensionale Gegenstände. Wenn er etwas benötigt, vertraut er darauf, daß es sich einfinden wird, was es in den meisten Fällen auch tut. Ich hingegen bin davon überzeugt, daß Bücher, Landkarten, Scheren und Tesafilmabrollgeräte allesamt unzuverlässige Landstreicher sind, die sich in alle vier Winde verstreuen, wenn sie nicht sorgsam hinter Schloß und Riegel gehalten werden. Meine Bücher kennen daher nur das Kasernenleben.
Nach fünf Ehejahren und einem Kind gelangten George und ich schließlich zu der Ansicht, daß wir die notwendige Reife für die tiefgreifendere Vertrautheit einer zusammengeführten Bibliothek erreicht hatten. Nach wie vor hatten wir keinerlei konkrete Vorstellung, wie eine Synthese aus Georges Naturgarten und meinem Barockgarten aussehen sollte. Meine Gartenbautechnik setzte sich durch, zumindest fürs erste, unter Berücksichtigung des Gesichtspunkts, daß George seine Bücher finden konnte, wenn sie nach meinem System geordnet waren, während ich keine Chance hätte, meine unter seinem System ausfindig zu machen. Wir einigten uns darauf, die Bücher nach Themen zu sortieren – Geschichte, Psychologie, Natur, Reisen und so fort. Die Literatur sollte nach Ländern unterteilt werden. (Falls George dieses Vorhaben für übertrieben erbsenzählerisch hielt, war er zu dem Zugeständnis bereit, daß es ein wesentlich besseres System war als das, von dem Freunde uns erzählt hatten. Freunde dieser Freunde hatten ihr Haus für einige Monate an einen Innenarchitekten vermietet. Als sie zurückkehrten, mußten sie feststellen, daß ihre gesamte Bibliothek nach Farbe und Größe umsortiert worden war. Kurz darauf hatte der Innenarchitekt einen tödlichen Autounfall. Ich muß gestehen, daß an dem Abend, an dem uns diese Geschichte erzählt wurde, jedermann am Tisch zu der Ansicht neigte, dies sei ihm recht geschehen.)
So viel zu den Grundregeln. Doch Schwierigkeiten stellten sich ein, als ich mein Vorhaben publik machte, englische Literatur chronologisch zu ordnen, amerikanische hingegen alphabetisch nach Autorennamen. Meine Begründung dafür lautete in etwa: Unsere Sammlung englischer Bücher umfaßte sechs Jahrhunderte, und eine chronologische Ordnung würde uns erlauben, mit eigenen Augen zu sehen, wie die Literatur sich in ihrer ganzen Pracht allmählich entfaltete. Die viktorianischen Schriftsteller waren untrennbar verbunden, und sie voneinander zu sondern wäre nichts anderes, als eine Familie auseinanderzureißen. Außerdem ordnete Susan Sontag persönlich ihre Bücher chronologisch. Sie hatte in einem Interview mit der New York Times gesagt, die Vorstellung, Pynchon neben Plato im Regal zu erblicken, wäre ihr ein Greuel. Bitte sehr! Unsere amerikanischen Bücher wiederum entstammten weitgehend dem 20. Jahrhundert und manche so neuer Zeit, daß eine chronologische Ordnung wahrhaft talmudische Haarspalterei erfordert hätte. Folglich war das Alphabet die einzige Rettung. Irgendwann gab George nach, doch eher um des lieben Ehefriedens willen als aus wahrer Überzeugung. Ein besonders gravierender seelischer Tiefschlag ereignete sich, als er damit beschäftigt war, meinen Shakespeare vom einen Regal zum anderen zu transferieren, und ich ihm zurief: »Achte bitte darauf, die Stücke wieder in chronologischer Reihenfolge einzusortieren!«
»Soll das etwa heißen, daß jeder einzelne Autor chronologisch geordnet wird?« sagte er fassungslos. »Aber Shakespeares Stücke lassen sich doch gar nicht eindeutig datieren!«
»Na ja«, sagte ich großspurig, »wir wissen jedenfalls, daß er Romeo und Julia vor dem Sturm geschrieben hat. Und das sähe ich gern in unserem Bücherregal widergespiegelt.«
George sagt, es sei dies einer der seltenen Momente gewesen, in denen er eine Scheidung ernsthaft in Betracht gezogen habe.
Unser Büchertransfer über die Mason-Dixon-Grenze hinweg, die meine Nordstaatenregale von Georges konföderierten Regalen trennte, nahm etwa eine Woche in Anspruch. Jeden Abend legten wir Bücher auf dem Fußboden aus, um sie miteinander zu verflechten, bevor sie in die Regale kamen, was bedeutete, daß wir eine Woche lang über Hunderte Bände hüpfen mußten, wenn wir uns zwischen Bad, Küche und Schlafzimmer bewegten. Wir berührten – nein, streichelten – im Wortsinn jedes Buch, das wir besaßen. Manche trugen Widmungen einstiger Geliebter. Manche trugen Widmungen von uns beiden. Manche waren wie Ausschnitte aus Zeitreisen: Mein Lexikon der britischen Literatur enthielt eine Aufstellung von Dichtern, die Gegenstand der Abschlußprüfung im Jahr 1979 gewesen waren; eine Postkarte, frankiert mit einer Zehn-Cent-Briefmarke, fiel aus Georges Ausgabe von Kerouacs Unterwegs.
Während unsere Bücherstapel sich auf dem Boden ausbreiteten, führten wir hitzige Debatten nicht etwa darüber, welche Bücher zusammengehörten, sondern darüber, wohin sie gehörten. Bis zu Georges Einzug hatte ich neun Jahre lang allein in dem Loft gewohnt, und die amerikanische Literatur hatte sich immer an der prominentesten Stelle befunden, der Wand gegenüber der Eingangstür. (Am anderen Ende der Werteskala befand sich ein kleiner Bücherschrank mit Tür, rechts neben meinem Schreibtisch, in dem sich das Verzeichnis der Postleitzahlen und Die Scarsdale-Diät von A bis Z diskret verborgen hielten.) George war der Ansicht, daß dieser Ehrenplatz der englischen Literatur gebührte. Falls ich damit einverstanden sein sollte, mich der übrigen Welt als Anhängerin A. J. Lieblings zu präsentieren und nicht etwa Walter Paters, dann wäre das gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, daß die Akademikerin, die zu werden ich einmal beabsichtigt hatte, für alle Zeiten der Journalistin, zu der ich geworden war, den Platz geräumt hatte. Da ich einsehen mußte, daß daran nicht zu rütteln war und daß außerdem die Wand gegenüber der Eingangstür meinen Mann nicht weniger repräsentieren sollte als mich, gab ich nach, doch mit einem Kloß im Hals.
Für die Regale in der Nähe unseres Betts erfanden wir eine neue Kategorie, die der Bücher von Freunden und Verwandten. Die Idee übernahm ich von einer befreundeten Schriftstellerin (die jetzt unter dieser Kategorie zu finden ist), die sie mit den Worten kommentiert hatte, es gebe ihr ein Gefühl der Wärme, so viele Menschen, die sie liebe, in so enger Gemeinschaft zu wissen. George hegte anfänglich Bedenken. Er hatte den Argwohn, es könne vielleicht als kränkend ausgelegt werden, wenn Mark Helprin aus dem Kanon der amerikanischen Literatur ausgeschlossen wurde, in dem er zuvor alphabetisch neben Ernest Hemingway geruht hatte, um gezwungenermaßen zum Bettgenossen von Peter Lerangis zu werden, der unter weiblichem Pseudonym sechzehn Jungmädchenbücher verfaßt hatte. (Schließlich freundete George sich doch mit dem Gedanken an und sagte sich, daß Mark und Peter einander möglicherweise eine Menge mitzuteilen haben könnten.)
Die härteste Prüfung erwartete uns am Ende der Woche, als wir die Dubletten sichteten und entscheiden mußten, welche Exemplare wir behalten wollten. Mir wurde klar, daß wir beide zusätzliche Exemplare unserer Lieblingsbücher gehortet hatten, »nur zur Sicherheit«, falls wir uns eines Tages trennten. Wenn George seine zerlesene Ausgabe der Fahrt zum Leuchtturm in den Papierkorb warf und ich meiner intimrosa Taschenbuchausgabe von Ehepaare ade sagte, die ich als Teenager so eifrig gelesen hatte (in einem Alter, in dem Updikes Erkundungen der Vielschichtigkeit der Ehe unsereinem unvorstellbar exotisch vorkamen), daß sie sich in ein Triptychon aufgespalten hatte, dem ein Gummiband Einheit verlieh – ja, dann hätten wir gar keine andere Wahl als zusammenzubleiben. Dann hätten wir alle Brücken hinter uns abgebrochen.
Wir besaßen jeweils an die fünfzig Dubletten. Wir entschieden uns dafür, gebundenen Ausgaben vor Taschenbüchern den Vorzug zu geben, es sei denn, die Taschenbücher enthielten Eintragungen, die uns wichtig waren. Wir behielten mein Middlemarch, das ich als Achtzehnjährige gelesen hatte und in dem sich meine ersten Gehversuche als Literaturkritikerin verzeichnet finden (auf Seite 37: »Grrr«, auf Seite 261: »Blödsinn«, auf Seite 294: »Iiiih«), Georges Zauberberg, mein Krieg und Frieden. Liebende Frauen war Anlaß zu einer nachgerade qualvollen Auseinandersetzung: George hatte das Buch als Sechzehnjähriger gelesen. Er war nicht davon abzubringen, daß jede neuerliche Lektüre nur möglich sei unter Verwendung seines Original-Bantam-Taschenbuchs mit der psychedelischen Umschlaggestaltung unter Verwendung einer nackten und einer halbnackten Frau. Ich hatte es als Achtzehnjährige gelesen. In jenem Jahr hatte ich kein Tagebuch geführt, aber ein Tagebuch benötigte ich nicht, um mich daran zu erinnern, daß es das Jahr war, in dem ich meine Jungfräulichkeit verloren hatte, wie sich unschwer den Kommentaren entnehmen ließ, die ich in mein Viking-Taschenbuch geschrieben hatte (Seite 18: »Gewalt als Ersatz für Sex«, Seite 154: »sexuelle Qualen«, Seite 159: »sexuelle Macht«, Seite 158: »Sex«). Was blieb uns anderes übrig, als gemeinsam das Handtuch zu werfen und beide Ausgaben zu behalten?
Nach einem letzten Kraftakt weit nach Mitternacht hatten wir es geschafft. Unsere Dubletten sowie an die hundert zusätzlich unter Schmerzen ausgesonderte Ausschußtitel warteten ordentlich gestapelt darauf, einer karitativen Organisation zugeführt zu werden. Verschwitzt und außer Atem küßten wir uns unter unseren triumphal vereinigten Melvilles.
Unsere Bibliothek war nun in tadelloser Ordnung, doch ein wenig steril, ganz ähnlich meinem Leben, bevor ich George kennengelernt hatte. Und so kam es, daß im Lauf der Wochen Georges Stil auf nicht ganz unwillkommene Weise nach und nach Oberhand zu gewinnen begann. So wie die übertrieben rechtwinklige Anlage eines neuen Hauses durch Hinzufügen einiger vom Wind gezauster Unkräuter hier und eines umgefallenen Dreirads dort gemildert wird, so milderten die vereinten Kräfte der Entropie und meines Mannes, die einander eng verwandt sind, die Makellosigkeit unseres neuen Systems. Unsere Nachttische wurden unter unsortierten neuen Büchern begraben. Die Shakespeare-Bände suchten sich wieder ihre eigene Ordnung. Eines Tages fiel mir auf, daß es der Ilias und Gibbons Verfall und Untergang des Römischen Reiches irgendwie gelungen war, sich in die Rubrik der Bücher von Freunden und Verwandten einzuschmuggeln. Mit diesem Sachverhalt konfrontiert, kreuzte George die Finger und sagte: »Na und? Gibbon und ich waren schon immer so dicke Freunde.«
Vor wenigen Wochen, als George verreist war, wollte ich Meine Reise mit Charley wiederlesen. Ich begab mich mit der Ausgabe ins Bett, die ich in dem Sommer, als ich siebzehn wurde, zum erstenmal gelesen hatte. Ich machte es mir mit den vertrauten zerknitterten Seiten meines alten Taschenbuchs bequem, auf dessen Umschlag Steinbeck im Schneidersitz neben seinem Pudel sitzt, und gelangte zu Seite 192. Und dort stand am Rand einer Stelle über das Aussterben der Redwood-Wälder Kaliforniens in einer jüngeren Version der Handschrift meines Ehemanns – einer Handschrift, die ich immer und unter allen Umständen wiedererkennen würde – die kummervolle Bemerkung: »Warum zerstören wir die Umwelt?«
Offenbar hatten wir identische Ausgaben besessen und Georges Ausgabe behalten. Meine Bücher und seine Bücher waren unsere Bücher geworden. Wir waren tatsächlich verheiratet.
Wortungeheuer und Bandwurmwörter
Als mein älterer Bruder Kim und ich Kinder waren, erzählte unser Vater uns Geschichten von einem Buchwurm namens Wally. Wally, ein munterer kleiner Wurm mit einer roten Baseballkappe, war kein platonischer Bücherliebhaber, sondern ein Bücherfresser. Die einsilbigen Wörter, auf die er in den meisten Kinderbüchern traf, boten seiner Gefräßigkeit nicht genügend Nahrung, und deshalb verlegte er sich auf Wörterbücher, die ihm reichhaltigere Kost versprachen. In Wally, der Wortwurm, einer Chronik verschiedener lexikographischer Abenteuer unseres Helden, die mein Vater für uns verfaßte, als ich elf war, ließ Wally sich so kalorienreiche Leckerbissen schmecken wie Syzygium, Ptisane – das sich einzuverleiben wahren Ptodesmut erforderte, bis Wally auf die Idee kam, das P wegzulassen – und sesquipedalis, was nicht nur »anderthalb Fuß lang« bedeutet, sondern auch die scherzhafte Bezeichnung für sehr lange Wörter ist. Von Wallys Beispiel angefeuert, wetteiferten Kim und ich jahrelang darum, das längste Wort zu finden. Kim gewann mit Paradimethylaminobenzaldehyd, dem Namen einer übelriechenden Chemikalie, den wir zu der Melodie von »The Irish Washerwoman« zu skandieren pflegten.
Eine der größten Enttäuschungen des Erwachsenwerdens bestand für mich darin, daß es mit zunehmendem Alter zunehmend schwerer wird, einen wallyhaften Grad sesquipedalischer Sättigung zu erlangen. Es gibt einfach nicht genug neue Wörter. Zumindest dachte ich das bis zum letzten Sommer, als mir ein Buch mit dem Titel The Tiger in the House in die Hände fiel, das der Romancier und Jazzkritiker Carl Van Vechten 1920 geschrieben hatte; Van Vechten pflegt einen Stil, den man vielleicht nicht unbedingt bombastisch nennen muß, aber zweifellos als effektvoll bezeichnen kann. Der Gegenstand des Buchs sind Katzen – Katzen in Literatur, Geschichte, Musik, Kunst und so fort. Ich arbeitete gerade selbst an einem Artikel über Katzen und hatte mehrere neuere Bände Katzenliteratur gelesen, die sich nicht sonderlich voneinander unterschieden. Die Verfasser oder Herausgeber dieser Bücher unterstellten ihren Lesern allesamt eines: daß diese sich für Katzen interessierten. Van Vechten hingegen unterstellte, daß seine Leser mit der klassischen Mythologie und mit der Bibel eingehend vertraut waren, daß sie Noten lesen konnten (er hatte einen Teil der Partitur von Domenico Scarlattis Katzenfuge abgedruckt) und daß sie Hunderte Schriftsteller, bildende Künstler und Komponisten kannten, die er nur mit Nachnamen erwähnt, als wären Sacchini und Teniers jedermann mindestens so geläufig wie Bach oder Rembrandt.
Was mich am meisten faszinierte und zugleich am meisten beschämte, war Van Vechtens Wortschatz. Ich konnte mich nicht entsinnen, wann ich zum letztenmal zuvor so viele unbekannte Wörter zu sehen bekommen hatte. Gegen Ende der Lektüre hatte ich zweiundzwanzig Wörter notiert. Ich hatte nicht nur keinerlei Vorstellung von ihrer Bedeutung, sondern auch keine Erinnerung daran, sie je zuvor gesehen zu haben. Sie hätten genausogut Altnorwegisch sein können. Hier die Liste: Monophysit, mephitisch, Câlineries, Diapason, Grimoire, adapertilis, retromingent, Perllan, kupellieren, Adyton, Sepoy, Subhadar, paludisch, apozemisch, Kamorra, ithyphallisch, Alkalde, Aspergill, Agathodaimon, Kakodaimon, goetisch und Opopanax. Diese Wörter verlangten nicht nach einem Wortwurm, sie verlangten nach einer Anakonda des Wortes.
Carl Van Vechten, der heute besser als Leitfigur der Harlem-Renaissance bekannt ist denn als Katzenfreund, schrieb seinen literarischen Salonkorrespondenten Briefe auf Papier mit dem Motto »Ein bißchen zuviel ist mir gerade genug«. Seine Vorliebe für exzentrisches Vokabular (neben der Vorliebe für alles Exzentrische) war so berühmt wie berüchtigt. Dennoch bezweifle ich, daß sein Buch mehrere Auflagen erlebt hätte, wenn obengenannte Wörter seinen ursprünglichen Lesern ähnlich unverständlich gewesen wären wie mir. Ich vermute eher, daß für einen gebildeten Durchschnittsleser der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts diese Liste schwierig, aber nicht unlösbar war. Viele dieser Leser hatten Griechisch und Latein gelernt, was ihnen die etymologische Entzifferung der Hälfte dieser Wörter ermöglichte, und manche Wörter, die in unseren heutigen Ohren knirschende Archaismen sind, hatten damals noch keinen Staub angesetzt. Sepoy und Subhadar dienten der britischen Verwaltung in Indien, der eine als Soldat, der andere als Statthalter. Die Kamorra, die Mafia Neapels, überfiel Touristen am hellichten Tag. Aspergille, nämlich Weihwasserwedel, wurden bei der katholischen Messe freigebig verwendet, und man wusch sich mit Seife, die man aus dem Harz einer Pflanze der Mittelmeerländer gewann, das als Opopanax oder Opoponax bezeichnet wurde.
Wehmütig der untergegangenen Welt gedenkend, die Van Vechtens Wörter heraufbeschworen hatten, probierte ich sie an meiner Familie aus, denn ich wollte feststellen, ob sie anderen einstigen Anhängern Wallys mehr sagten als mir. (Lesern, die es nicht ertragen, sich auf die Folter spannen zu lassen, sei verraten, daß alle Wörter, die nicht im Verlauf des Artikels erklärt werden, am Fuß von Seite 37 ihre Auflösung finden.) Ich begann Geschmack an der Sache zu finden und spielte mit dem Gedanken, meine Freunde dem tödlichen Quiz zu unterziehen, doch mein Lektor, den es keineswegs danach gelüstete, Opfer dieses Spiels zu werden, äußerte die freundliche Warnung: »Übertreib es nicht, Anne. Nicht jeder kann sich für Tests so begeistern wie du.«
Da hatte er nicht unrecht. In meiner Kindheit und Jugend war meine Familie nicht nur steter Quell von Bandwurmwörtern, sondern jegliche Form geistiger Wettkämpfe war uns ein heiliges Sakrament, gewissermaßen eine Art Weihwasser, die es bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mit dem größtmöglichen Aspergill zu verteilen galt. Als ich den Film Quiz Show sah, wand ich mich förmlich auf meinem Sitz, weil die literarische Gewächshausmentalität des Van-Doren-Haushalts mir gar so vertraut vorkam. Wie die jungen Van Dorens wurden auch die jungen Fadimans regelmäßig aufgefordert, literarische Zitate zu identifizieren. Während meine Mutter unterwegs zu einem Restaurant den hupenden Verkehrsstau auf einem Freeway in Los Angeles meisterte, murmelte mein Vater: »›Auf einer Ebene im Dunkeln, / Voll des Gewirrs und des Gelärms von Flucht und Kampf‹ – Quelle?« Und Kim und ich quiekten wie aus einem Mund: »Matthew Arnold: ›Dover Beach‹!«
Seinen Höhepunkt erreichte unser Wettkampffieber jeden Sonntagnachmittag, wenn wir uns für unsere wöchentliche Runde des G. E. College Bowl





























