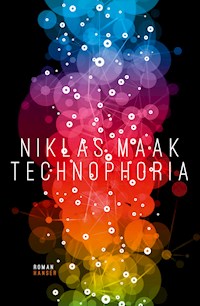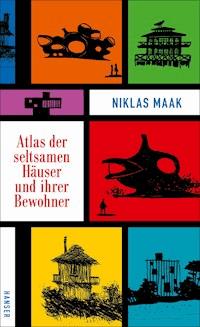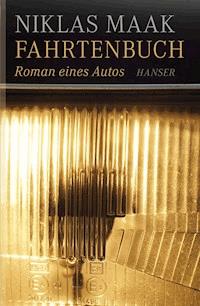
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Auf einem Schrottplatz liegt das Wrack eines Mercedes 350 SL, Baujahr 1971. 350.000 Kilometer ist das Auto laut Tacho in vierzig Jahren gefahren, zehn Besitzer verzeichnet der Fahrzeugbrief. Ein Arzt fuhr ihn und ein italienischer Einwanderer, eine Studentin, ein junger Türke und ein gescheiterter Manager - Menschen, die sich nie kennenlernten, die nur der große Mercedes verband, der ihr Leben ändern sollte. Niklas Maak erzählt die Geschichte der zehn Fahrerinnen und Fahrer und zugleich auch die Geschichte von vier Jahrzehnten Bundesrepublik: die Geschichte eines Landes, seiner Träume und Abgründe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Niklas Maak
FahrtenbuchRoman eines Autos
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23833-6
© 2011 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Inhalt
Prolog5
1971 Amerika7
1980 Der Brief59
1982 Das Eis89
1986 Die Angst103
1990 Der Osten139
1993 Snob173
1994 Die Russen187
1999 Biskaya221
2001 Die Mitte251
2008 Die linke Spur303
Epilog359
Prolog Der Fahrzeugbrief
Der Wagen stand bei einem Schrotthändler im Norden der Stadt, in einer Lache aus feuchter Erde und Öl. Durch einen Aufprall war die Motorhaube zerstört worden, sie hing aufgerissen an einem Scharnier wie der Schnabel eines seltsamen Urvogels; wo einmal die Vorderräder gewesen waren, schleiften die Kotflügel im Dreck. Die Fahrertür stand offen, innen roch es nach warmem Plastik und Leder und Benzin. Die Tachonadel war ausgeblichen, auf dem Holzfurnier neben dem Schalthebel hatten Getränkeflaschen dunkle Ränder hinterlassen, der Teppich im Fußraum war mit feinen Tierhaaren übersät: Offenbar hatte hier einmal ein Hund gelegen.
Im Handschuhfach befanden sich eine alte Europakarte – Deutschland war noch geteilt, in Frankreich gab es keine Autobahnen –, ein hellblaues Serviceheft, ein kaum mehr lesbares Parkticket und ein Foto, das eine Frau am Heck des Mercedes zeigte. Die Ledersitze waren abgewetzt, im Polster des Beifahrersitzes klaffte ein Riss. Im Serviceheft hatte jemand handschriftlich Modell und Baujahr des Wagens notiert: Mercedes 350 SL, 1971.
Der Händler saß vor seinem Container in der Sonne. Er trug ein feingeripptes Unterhemd. Seine Tätowierungen – der Name Kati, ein Herz und ein Totenkopf – mussten schon älter sein, oder der Mann hatte in letzter Zeit viel trainiert, jedenfalls waren Schriftzug und Herz seltsam in die Breite gezogen. Er stand auf, warfseine Zigarette in den Matsch und trat auf den Stummel, bis er versunken war. Dann wusch er sich die Hände, aber das brachte wenig; das Öl saß so tief in den Poren, dass es zum Bestandteil seiner Haut geworden war.
Neben dem Container standen Kisten mit Außenspiegeln, alten Leichtmetallfelgen, Kopfstützen und Stoßstangen, die er von den Unfallwagen abmontiert hatte und als Ersatzteile nach Afrika, in die Ukraine und in den Libanon verkaufte. Er deutete auf einen Aktenordner, in dem ein paar Fahrzeugbriefe aus den frühen siebziger Jahren hingen. In den Briefen standen die Namen der Besitzer, ihre Adressen und das Zulassungsdatum. Ein deutscher Name, ein italienischer, Adressen in Hamburg, Starnberg, Leumnitz und Berlin.
Der Fahrzeugbrief ist die kürzeste Form einer Erzählung, das Skelett einer Handlung, der Schlüssel zu den Geschichten der Fahrer. Am 3. November 1971 verlässt der Wagen die Fabrik in Stuttgart Untertürkheim, nach 327.000 Kilometern ist er ein Unfallwrack. Was geschah in dieser Zeit, auf dieser Strecke? Wer waren die Fahrer, was passierte auf diesen Sitzen, welche Geschichten findet man, wenn man den Namen im Fahrzeugbrief folgt, und welche Geschichten werden mit diesem Wrack verschwinden?
Es gibt nicht viele Anhaltspunkte für eine Suche: den Brief, die Adressen, ein Serviceheft, in dem die Postleitzahlen, wenn man zurückblättert, irgendwann vierstellig und die benutzte Tinte blasser werden. Einige der Fahrer leben noch, einige sind gestorben oder verschwunden, und nur ein paar Nachbarn erinnern sich noch an sie. Manche wollen, dass ihre Geschichten erzählt werden. Andere verlangen, dass Namen, Wohnorte, Berufe geändert werden. Es sind Menschen, die sich nie kennenlernten, Ärzte und Studenten, Italiener, Türken und Amerikaner; sie fuhren nacheinander einen Mercedes, der Beulen und Kratzer bekam, Öl verlor, in Unfällen demoliert, durch Schneewehen geprügelt, tiefergelegt, zerkratzt, umlackiert, dabei immer billiger und schließlich wertlos wurde. Was die Fahrer verband, war die Hoffnung, dass der Mercedes ihr Leben ändern könnte.
1971 Amerika
Kilometerstand 000.000
»Wissen Sie, ich glaube nicht an das Schicksal. Ich bin Arzt. Ich glaube an die Medizin. Von meiner Exfrau höre ich nichts mehr, sie ist mit ihrem Mann nach Australien ausgewandert. Ihr gemeinsamer Sohn hat dort eine Firma. Vielleicht ändern Sie meinen Namen und ihren, wenn Sie das aufschreiben – obwohl ich nicht glaube«, sagt er, »dass sie das hier lesen wird, und wenn doch, macht es auch nichts. Schließlich bin ich der Idiot in dieser Geschichte und nicht sie.«
Aber wie hatte es begonnen? Was war damals passiert? Wie kam es, dass er Phyllis kennenlernte und seine Frau verschwand und die Dinge den Lauf nahmen, den sie nahmen?
Es gibt ein Foto von ihm aus dem Winter des Jahres 1972, das ihn vor seinem Haus zeigt.
Es war, sagt er, kalt an diesem Tag; die Kälte war über Nacht gekommen, eine Kälte, die die Felder mit einem weißen Rauhreif überzog und das Wasser in den Pfützen und in den Furchen des Feldwegs gefrieren ließ.
Er war zeitig aufgestanden. Er hatte, wie jeden Morgen, einen Kaffee gekocht und das Radio angeschaltet und war dann mit einer Schachtel Ernte 23 auf die Terrasse getreten. Am Südrand des Hochs über Skandinavien floss Kaltluft nach Deutschland. Die Tageshöchsttemperaturen lagen um den Gefrierpunkt. Bei der Mission Apollo 17 hatten sie, hieß es im Radio, am Mondkrater Shorty orangefarbene Kügelchen aus einem glasähnlichen Material gefunden.
Hinten am Waldrand hing der Reif in den Bäumen, die Luft war klar und kalt und brannte ihm im Gesicht. Die Terrasse war vereist, und das, was von den Büschen, die im Sommer in hellen Rosafarben blühten, übriggeblieben war, stand schockgefroren an der Auffahrt. Er zündete sich eine Zigarette an; seine Finger waren klamm von der Kälte.
Der Mercedes stand vor dem Haus. Er hatte sich den Wagen im vergangenen Winter gekauft, nachdem er neun Jahre lang einen Ford gefahren hatte. Er wusste nicht genau, ob es wirklich an dem Ford lag, dass es ihm nicht gutging, dass er schlecht schlief und unkonzentriert war, es konnte auch sein, dass es an dem vielen Kaffee lag, den er trank, oder an der Arbeit oder am Zustand seines Hauses, eines Bungalows, dessen Farbe langsam abblätterte und der dringend renoviert werden musste. Ingrid, seine Frau, kam in letzter Zeit immer sehr spät nach Hause und verbrachte die Wochenenden mit irgendwelchen Freundinnen von früher bei anderen Freundinnen von früher in anderen Städten, aber er hatte sich dafür entschieden, dass sein Unwohlsein, das ihn vor allem am Abend überkam, wenn die Sonne hinter der Hecke des Gartens versank und alles für zwanzig Minuten in ein fahles, schließlich verlöschendes Licht tauchte, daher rührte, dass er keinen Mercedes fuhr, obwohl er schon immer einen haben wollte und sich auch längst einen leisten konnte.
Also hatte er, Hans Joachim Bellmann, damals knapp vierzig Jahre alt, Arzt, 1971 einen Mercedes 350 SL bestellt, alpinweiß, mit dunkelblauen Ledersitzen, und dieser Wagen stand jetzt, an diesem Wintertag des Jahres 1972, vor seinem Haus, vor dem Schlafzimmerfenster.
Die Gardinen des Schlafzimmers waren nie zugezogen, und als er an diesem Morgen ums Haus ging, sah er, dass seine Frau noch schlief. Ihr Haar, das sie am Tag zu einer Pyramide aufsteckte, floss über das Kopfkissen und ihren rechten Arm. Sie war nicht wirklich blond; sie färbte ihr Haar, ihr Haaransatz war dunkel und hatte einen grauen Schimmer.
An der Decke des Schlafzimmers hatte sich ein gelber Fleck gebildet, ein Wassereinbruch. Die vergangenen Winter hatten dem Haus zugesetzt; die Stahlprofile der Pergola begannen zu rosten, das Dach würde er neu teeren lassen müssen.
Der Wagen passte nicht in die Gegend. Die Nachbarn fuhren Volkswagen oder mittelgroße Limousinen von Opel, einer hatte auch einen Mercedes, aber das kleine Modell, einen mattgrünen 220er, ein sozialverträgliches Auto, das allenfalls schüchternen Reichtum andeutete (ein paar Mark mehr als der Nachbar verdiene ich, teilte dieses Auto mit, aber auch ich gehe ins Freibad, stelle mich an der Kasse hinten an, finde die Erhöhung der Heizölpreise unverschämt und tanke vor den Feiertagen, wenn das Benzin ein paar Pfennige günstiger ist).
Sein Wagen war anders. Er war eine Provokation, eine chromglänzende Demütigung der sechs hinter ihm geparkten Kleinwagen, die zusammen nicht so viel kosteten wie dieses Auto. Der große Mercedes mit seinen Nebelscheinwerfern, dem mächtigen, verchromten Bug, dem gigantischen, wie die Mündung einer Waffe in den Kühler eingelassenen Stern, mit den rotglühenden Rückleuchten, dem außerirdischen Donnern seines Achtzylinders, stammte aus einer anderen Welt. Der Wagen ignorierte alles, was den Nachbarn wichtig war: Für eine Familie war in dem Zweisitzer kein Platz, und wo die anderen Autos ein festes Dach über dem Kopf hatten, war hier nur ein Stoffverdeck. Alles an diesem Ding deutete darauf hin, dass es gemacht war, um dem zu entkommen, worauf sie hingearbeitet hatten.
Die Nachbarn sprachen ihn nicht an, wenn er ausstieg, aber er wusste, was sie redeten. Die Männer betonten, dass der Wagen unkomfortabel und im Falle eines Überschlags lebensgefährlich sei. Die Bäckersfrau schüttelte den Kopf: Was der Arzt denn jetzt so etwas nötig habe. Die Kundinnen pflichteten ihr bei, nur die Frau des Lebensmittelchemikers, der vorn an der Kreuzung in einem alten Walmdachhaus mit Sprossenfenstern wohnte, schaute dem neuen Cabrio immer lange nach, als sehe sie in ihm die Möglichkeit eines anderen, weniger vergitterten Lebens.
An dem Tag also, an dem das Foto entstand, ließ Bellmann den Motor in der Garagenauffahrt länger als nötig warm laufen, schaltete das Becker-Mexico-Kassettenradio an und wieder aus, verfolgte, wie die elektrische Antenne hinten neben dem Kofferraum aus dem Blech fuhr und wieder versank, klappte das Handschuhfach auf, in dem Ingrids alte Hasselblad lag, drehte an den kugelförmigen Lüftungsdüsen, schaltete den Automatikwählhebel von D auf P, trat aufs Gas, hörte dem Achtzylindermotor zu, sah, wie die orangefarbene Nadel des Drehzahlmessers auf viertausend Umdrehungen stieg, und betrachtete sein Gesicht im Rückspiegel – ein Anblick, der ihn ernüchterte. Jahrelang hatte er eine Frisur wie Chuck Berry gehabt, eine abenteuerliche Tolle, die beim Tanzen auf und ab wippte, ein Helm eher als eine Frisur, aber seit einigen Jahren gingen ihm die Haare aus; er bekam eine Stirnglatze.
Er fuhr fünf Minuten den Feldweg hinab, bis er die Telefonzelle an der Straße erreicht hatte. Es war sechs Uhr morgens, Mitternacht bei ihr. Er stand jetzt allein hier, auf einem Acker in einem gelben Kasten, hielt den modrig, nach dem kalten Atem zahlloser Raucher riechenden Hörer in der Hand und hörte die Aufzeichnung ihrer Stimme, die ihm mitteilte, dass sie nicht da sei. Sie hatte einen Anrufbeantworter, in New York hatten jetzt viele so ein Ding. Im Hintergrund hörte er das Heulen der New Yorker Sirenen auf dem Band, dann ihre metallisch klingende Stimme, Hello, this is Phyllis, you can leave a message after the beep.
Weil es Sonntag war und er nichts zu tun hatte, verbrachte Bellmann den Tag damit, durch die Gegend zu fahren. Er sah sich die Schaufenster in der sonntäglich leergefegten Mönckebergstraße an und traf einen Freund zum Mittagessen. Auf dem Rückweg kamen ihm die Nachbarn entgegen; sie fuhren mit ihrem Opel Rekord zur Kirche, wie jeden Sonntag, sie waren gläubige Menschen: Als er ihren Wagen passierte, sah er die offenstehenden Münder der drei Kinder hinten und der Eltern am Seitenfenster, offenbar sangen sie gemeinsam ein Lied, während der Vater den Opel steuerte. Straßenbahnen ratterten vorbei, das Licht ihrer Scheinwerfer fiel auf das nasse Kopfsteinpflaster, und für einen Moment sah er die reglosen Fahrgäste, die ins Leere starrten – vom Leben zerzauste Menschen, die abends Hühnchenklein aßen und sich Geschichten aus Russland erzählten oder versuchten, diese Geschichten zu vergessen. Das Einzige, was nicht hierher passte, waren er und sein Mercedes, der weiß wie Neuschnee in der Kälte leuchtete.
Er fuhr vorbei an Klärbecken und Gasometern und Überlandleitungsmasten bis zum Ölhafen, vorbei an Türmen aus Beton und Stahl mit Röhren und Schloten und Leitungen, dem komplizierten metallischen Herzen der Stadt; er sah die Fernsehantennen wie Gestrüpp auf den Häusern wuchern, Peitschenmasten rasten vorbei, Schienen glänzten, er drehte das Radio auf – es kam, jedenfalls hat er das so in Erinnerung, »Glad All Over« von den Dave Clark Five –, und obwohl ein scharfer Wind vom Hafen in die Straßen zog, öffnete er das Verdeck und fuhr, vorbei an den Hafenkränen, über die Brücken, auf die Schnellstraße.
Er fotografierte sein Auto. Auf diesen Bildern sieht man: den Mercedes und einen Bugsierschlepper, der mit flachgelegtem Schornstein durch einen Kanal fährt. Die Sonne, die im braunen Dunst verschwindet. Die Schornsteine der Kupferhütte, einen alten Deutz-Lastwagen, das Vorkriegsmodell. Schienen, die im Gegenlicht glitzern. Kinder, die im Morast spielen. Die Stahlgerippe der Hüttenwerke. Frauen mit geblümten Gummischürzen und dicken Oberarmen. Die weiße Wäsche vor den rußigen Reihenhäusern, wie ein Protest gegen das Braune und Graue hier. Das matte Licht der Gaslaternen. Arbeiter mit scharf gezogenen Scheiteln. Einen jungen, akkurat gekleideten Mann mit einem Aktenkoffer – vielleicht sein erster Arbeitstag; er schaut aus seinem Anzug heraus wie aus einem Hotelzimmer. Eingewachsene Ruinengrundstücke. Eine Straßenbahn mit einer Werbeaufschrift – »Waren Sie diese Woche schon bei C&A?«. Einen Mann, der an der Bude ein Bier trinkt und einem Jungen mit der Hand über den Kopf fährt, dahinter die Hochhäuser …
Dort also stand er, mit seinem Mercedes, im Stau vor den neuen Wohntürmen, die sie hinter den Brücken gebaut hatten, und sah Hunderte von erleuchteten Fenstern, hinter jedem Fenster ein Mensch, eine Geschichte, eine unbekannte Person.
Diese Menschen kamen aus kleinen Dörfern, hatten eine diffuse Vorstellung vom Glück, zogen in die Türme, suchten einen Job, rasten mit zu kleinen Autos über Autobahnen, gerieten ins Schleudern, betranken sich in winzigen Wohnungen, gingen im Hafen aus, gründeten Familien, kauften Weihnachtsbäume, aßen Bratwurst und falschen Hasen, versuchten zu vergessen, tanzten mit Fremden, schliefen mit den Falschen, ließen Sachen in fremden Wohnungen liegen, hockten an quadratischen Fenstern und hörten traurige und wütende Lieder und hofften und starrten in die Nacht, die ihnen aus Tausenden anderer Fenster entgegenleuchtete. Und sie bekamen Bauchschmerzen, Blinddarmentzündungen, Juckreiz, sie brachen sich Arme und Beine und das Nasenbein. Und dann kamen sie zu ihm.
Was sah er, als er damals im Stau stand? Autos, in denen Paare saßen, die Beifahrer und Beifahrerinnen links von ihm zum Greifen nah, keine zwei Meter entfernt.
Natürlich ließ Bellmann nie das Fenster herunter, und nie sprach er jemanden an (es ist, anders als im Café, fast unmöglich, sich in einem Stau kennenzulernen), aber das, was er vor und neben sich hinter Auto- und Wohnungsfenstern erahnte oder sah, setzte den Gedanken in ihm fest, dass es neben seinem eigenen Leben dort draußen noch Hunderte, Tausende anderer Leben gab, in die er einfach einsteigen könnte wie in das Auto eines Fremden.
Als er an diesem Tag nach Hause kam, war es dunkel. Er öffnete den Kühlschrank und machte sich einen Drink. Draußen trieben ein paar Schneeflocken vorbei, im Wohnzimmer roch es nach Holz und Wärme, ein paar verkohlte Scheite lagen im Kamin; offenbar hatte Ingrid, bevor sie gegangen war, ein Feuer gemacht.
Er hatte Phyllis im Krankenhaus kennengelernt. Sie war Ärztin, ein paar Jahre jünger als er und über irgendein Austauschprogramm nach Deutschland gekommen. Jetzt war sie, wegen Thanksgiving und einer Hochzeit, einen Monat lang in New York.
Er machte sich, nachdem er, wie er erst jetzt merkte, seinen ersten Drink in einem Zug ausgetrunken hatte, noch einen zweiten und schaute sich in seinem Haus um wie ein erstaunter Archäologe. Im Foyer schwebten drei angriffsbereit aussehende, helmförmige Plastiklampen. An der Wand hingen Bilder mit abstrakten roten Formen auf gelbem und braunem Grund, Werke eines befreundeten Malers, daneben Familienfotos: seine Mutter in Neapel mit einem italienischen Strohhut auf dem Kopf; Ingrid auf einem Pferd, Ingrid auf einem Sofa, Ingrid auf einer norditalienischen Steinmauer, er selbst auf dem Campo dei Fiori (Eistüte in der Hand, schwarze Sonnenbrille, Chefarztlächeln); Ingrid in einem leichten sandfarbenen Sommerkleid, aufgenommen bei ihrer Hochzeitsreise auf einem Vaporetto in Venedig, 1962. Als die Schiffe mit den russischen Atomraketen Kurs auf Kuba nahmen, als die Welt um ein Haar mit einem gigantischen Knall in die Luft geflogen wäre und die Bundesregierung Toastbrot und Wurst für mehrere Monate in ihrem Atombunker irgendwo bei Bonn einlagern ließ, saßen er und Ingrid auf einem verrosteten Kahn und fuhren von San Marco hinüber zum Hotel des Bains und hatten allerbeste Laune.
Etwas war in diesem Haus nicht in Ordnung. Die Wand hatte seltsame Flecken. Die Fotos waren, bei genauem Hinsehen, ausgebleicht. Dort, wo die Mittagssonne auf eines der Bilder fiel, war nur noch ein Schatten zu sehen; dieser Schatten war einmal er gewesen.
Er drehte sich um und betrachtete die Fensterscheiben. Ingrid hatte aus schwarzem Papier die Silhouetten von Vögeln ausgeschnitten und an die große Panoramascheibe geklebt, damit keine echten Vögel dagegenflogen, aber jetzt fielen die Schatten der falschen Vögel auf den Boden und auf das Sofa, so, als kreisten Geier an der Decke seines Wohnzimmers. So war das Wohnzimmer nicht bewohnbar. Er riss zwei Pappvögel von der Scheibe und stellte fest, dass sie mit Uhu auf die Fenster geklebt worden waren. Pappvögel, mit Uhu direkt auf die Scheibe geklebt!
Er verließ, leicht schwankend, mit einem dritten Drink in der Hand, das Wohnzimmer und betrat den Flur. Dort stand, zwischen einem polierten Stahltisch und einer orangefarbenen Stehlampe, etwas, das hier nicht hingehörte, ein schiefer, uralter Bauernstuhl, ein wackeliges Ding mit einem in die Lehne gesägten Herz und einem abgeschabten roten Kissen, das mit Fäden an der Rückenlehne befestigt war. Der Stuhl stand dort wie ein stummer Vorwurf, ein Immigrant unter den vier eleganten weißen Plastikblasen, die als moderne Möbelfamilie das Wohnzimmer besiedelten. Nur seine Mutter konnte diesen Stuhl so vorwurfsvoll in den Flur stellen.
Seine Mutter bewohnte ein Zimmer am Ende des Korridors. Es war im Stil einer Bauernstube des 19. Jahrhunderts eingerichtet und wurde von ihr energisch gegen alle Modernisierungsversuche verteidigt. Seine Mutter mochte den Bungalow nicht. Das Haus hat ja kein Dach, sagte sie, als sie ihn zum ersten Mal betrat, und die Antwort, dies sei ein Bungalow, und ein Dach habe er schon, nur eben ein flaches, ließ sie nicht gelten. Auch die Nachbarin, eine blutarme Person, die bei Regen eine Plastikfolie über den Kopf zog, damit ihre Frisur keinen Schaden nahm, beklagte bei jeder Gelegenheit das schachtelartige Aussehen des Nachbarhauses, das mit seiner ausgefallenen Form Unordnung in die Siedlung bringe.
Er musste jetzt rauchen. Er öffnete eine neue Schachtel Ernte 23 und ging ein paar Schritte durch den Garten. Die Bäume am Zaun wuchsen in einem unsympathischen Durcheinander in die Höhe. Die Kühe, die hinter dem Zaun weideten, hatten, als die Pflanzen noch klein waren, die Äste weggefressen; mit den Bäumen waren auch die Bisswunden gewachsen und bildeten jetzt unschöne Löcher in der Silhouette. Die Bäume waren ein Ärgernis, sie standen krumm und unentschlossen dort, als wären sie unter Alkoholeinfluss gewachsen; man müsste, dachte er, die Bäume absägen. Er hatte sie schon öfter entfernen lassen wollen, aber seine Frau war abergläubisch, außerdem würde er ohne die Bäume wiederin die Gesichter der Kühe schauen müssen, die, als die Bäume klein waren, stundenlang am Zaun standen und in sein Wohnzimmer starrten, als sei sein Leben eine Unterhaltungssendung für Nutztiere.
Der Sommer, in dem er seinen Mercedes bestellt hatte, der Sommer 1971, war der heißeste und trockenste Sommer seit Jahrzehnten gewesen. Die US-Armee versuchte vergeblich, in Kambodscha den Versorgungsweg der nordvietnamesischen Truppen zu zerschlagen, der Fernseh-Delfin Flipper starb an Herzversagen, auf Antrag der SPD diskutierte der Bundestag die Liberalisierung der Gesetzesvorschriften für Pornografie, in Düsseldorf gründeten dreihundert FDP-Mitglieder unter Leitung des ehemaligen Waffen-SS-Mitglieds Siegfried Zoglmann die »Deutsche Union«. Es war der Sommer, in dem der Diktator Nicolae Ceauşescu von Gustav Heinemann das Bundesverdienstkreuz überreicht bekam und die mutmaßliche, gerade mal zwanzigjährige Terroristin Petra Schelm in Hamburg erschossen wurde. In London demonstrierten dreißigtausend Menschen gegen »moralische Verschmutzung« und für »Reinheit, Liebe und geordnetes Familienleben«, das größte Radioteleskop der Welt empfing Signale aus zwölf Milliarden Lichtjahren Entfernung, mit denen aber keiner etwas anfangen konnte. Es war offensichtlich einiges durcheinandergeraten in der Welt, und dieses Durcheinander, so kam es Bellmann jedenfalls vor, schien auch auf sein Privatleben überzugreifen.
In diesem Sommer war seine Frau oft ausgegangen und schließlich für ganze Tage verschwunden. Tagsüber war es heiß; einige Bäche waren über die Monate ausgetrocknet, in den Küchen brummten die Sommerfliegen, nachmittags gab es Wärmegewitter; die Höchsttemperaturen, teilte eine schnarrende Stimme im Radio mit, lagen bei dreißig Grad. Er bestellte sich den Mercedes; im Dezember wurde er ausgeliefert, im Frühjahr fuhr er zum ersten Mal offen, dann kam der Sommer 1972, aber von diesem Sommer bekam er wenig mit.
Die Tage verbrachte er im Neonlicht seines Sprechzimmers im Krankenhaus, wo ihn ein Lamellenvorhang und die Blätter eines unkontrolliert wuchernden Gummibaums von der Außenwelt abschirmten. Am Abend stieg er nur kurz in den Pool, der den hinteren Teil des Gartens in ein flimmerndes, blaues Licht tauchte; die meiste Zeit verbrachte er in seinem Atombunker.
Der Atombunker lag unten im Keller des Bungalows. In dem Jahr, in dem das Haus gebaut wurde, war das Schutzbaugesetz erlassen worden, und er hatte, entsprechend den »Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen des Bundes bei Errichtung von Hausschutzräumen« zweihundertzwanzig Mark pro Schutzplatz bekommen, was bei sechzehn Plätzen nicht einmal viertausend Mark machte – aber Ingrid hatte einen Atombunker haben wollen.
Man musste zwei Kilometer vom Explosionsherd der Atombombe entfernt sein, um hier einen Atomschlag zu überleben, aber es erschien ihm unwahrscheinlich, dass die Bombe direkt über diesem kleinen Vorort der Stadt gezündet würde (andererseits konnte man nie wissen, die Russen hatten wenig Erfahrung mit Atombomben, und besondere Lenkpräzision war, wie man an ihren Autos erkennen konnte, die sie neuerdings nach Deutschland importierten, nicht ihre Stärke). Sein Bunker hatte drei Atü Druckresistenz; die Firmen H. Anders KG und Friedrich Frank hatten auch Schutzräume im Programm gehabt, die höherem Druck standhielten, aber das erschien ihm unsinnig. In einem solchen Atombunker wäre man zwar strahlensicher untergebracht und dank einer sechzig Zentimeter dicken Betondecke auch vor der Hitzewelle geschützt, die nach der Explosion entstehen würde, wie der Hersteller des Bunkers, die Firma Schmitt in Kelkheim im Taunus, versprach. Andererseits würde die Druckwelle im Boden eine Art Erdbeben auslösen; bei einem Luftstoß von drei Atü beträgt die Beschleunigung in weichem Boden 1,5 Meter pro Quadratsekunde, der Bunker würde also aus seiner Position gebracht, der Eingang verschüttet, die Lüftungsanlage abgeknickt werden, und in diesem Fall wäre die Frage der Hitzeresistenz auch nicht weiter interessant. Zwar hatte ein Herr Doktor Ehm vom Bundesbauministerium in einer Erklärung ein solches Szenario als unwahrscheinlich bezeichnet – die Bodenbewegungen seien, wenn man nicht direkt unter dem Detonationspunkt der Bombe wohne, nur minimal –, aber Bellmann war in diesem Punkt skeptisch. Man musste realistisch bleiben.
Der Bunker versperrte einen ganzen Kellerraum; der Keller war nicht zu nutzen, weil dort eingeschweißte Notversorgung aus dem Jahr 1967 und eine unbenutzte, originalverpackte italienische Trockentoilette lagerten (»Latrina a secco, un assortimento per otto persone«), und weil Bellmann nicht mehr mit einem Atomkrieg rechnete, hatte erbeschlossen, den Bunker zu einer Kellerbar umzubauen.
Die Wochenenden dieses Sommers hatte er damit verbracht, einen Tresen zu zimmern und eine Kiefernholzvertäfelung an den Wänden des Bunkers anzubringen, was keine leichte Aufgabe war; Täfelungen waren für Bunker nicht vorgesehen. Die Holzbretter flammte er mit einem Bunsenbrenner; er hielt die Gasflamme so dicht an das weiche, frische Holz, bis es dunkel wurde und aussah wie eine der Bars in den Western, die er manchmal im Kino anschaute. Dann montierte er zwei Saloon-Türen hinter die Atomschleuse, schraubte ein altes Wagenrad hinter den Tresen und klebte auf den Kasten der Trockentoilette ein Plakat, das seine Frau zeigte. Über ihren Kopf hatte er mit Letraset-Buchstaben das Wort »Wanted« geschrieben.
Als die Bar fertig war, räumte er die Schallplatten in den Keller. Er besaß alles von Bill Haley, alles von Chuck Berry und Gene Vincent und fast alles von Elvis, dazu einhundertfünfzig Singles und vierundachtzig Langspielplatten von Fats Domino, Little Richard, La Vern Baker, Scotty Moore und Eddie Cochran. Während er das Holz seiner Kellerbar mit dem Bunsenbrenner flambierte, hörte er »That’ll Be the Day« von Buddy Holly oder »Teenager in Love« von Dion DiMucci – Buddy Holly war damals schon lange tot, DiMucci lebte noch, sagt Bellmann, weil er am 3. Februar 1959 nicht in das Flugzeug gestiegen war, mit dem Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper abgestürzt waren.
DiMucci lebte noch, aber im Sommer des Jahres 1972, als Deep Purple mit dem Album Machine Head die Hitparaden anführte und Christian Anders monatelang den Platz eins der Singlecharts mit »Es fährt ein Zug nach Nirgendwo« besetzte, interessierte sich niemand mehr für ihn. Bellmann hatte eine böse Ahnung, dass es ihm prinzipiell ähnlich ergehen könne wie DiMucci; andererseits war er Arzt und kein Rockstar, und Ärzte brauchte man immer.
Er liebte Amerika. Er war zwar noch nie in Amerika gewesen, aber er hatte eine genaue Vorstellung davon, wie es dort aussehen musste – vor seinem Haus hatte er einen amerikanischen Briefkasten angebracht, auf dem »Mail«stand (er bestand nur aus einem abgeschnittenen Rohr, und es gab Postboten, die damit nichts anfangen konnten und die Briefe stattdessen umständlich zwischen die Latten des Gartentores klemmten). Sein Autoradio war so eingestellt, dass, wenn er den Motor anließ, automatisch der amerikanische Soldatensender AFN lief. Sein Haus hatte ein Flachdach und breite Fenster; es gab einen großen, hellblauen Swimmingpool und Palmen, die im April auf die Terrasse gestellt und Ende September in die beheizte Garage getragen wurden. Das Haus war Amerika: der Kamin sein Lagerfeuer, der Pool seine Quelle, das flache Betondach sein Zelt, das Auto neben dem Pool sein Pferd. Nichts erinnerte auf diesem Grundstück an Norddeutschland bis auf die grünen Spuren, die das Moos der Kiefern an der Dachrinne und an der Nordwand des Hauses hinterlassen hatten – aber Moos gab es schließlich auch in Amerika.
Er hatte mehrmals versucht, einen deutsch-amerikanischen Ärzteclub zu gründen, aber die Briefe, die er an verschiedene Fakultäten geschickt hatte, waren größtenteils unbeantwortet geblieben. Das einzige Resultat des ehrgeizigen Plans waren die regelmäßigen Besuche von Walter Hancock, einem alleinstehenden Militärarzt, der nach dem Krieg mit einer Einheit der US-Armee in die Gegend gekommen war. Hancock kam gerne zu ihnen; das Haus erinnerte ihn an seine Heimat, und er mochte die Art, mit der Ingrid sich um ihn kümmerte wie um ein zugelaufenes Tier, das dringend ihrer Pflege bedurfte. Je häufiger Hancock kam, desto schweigsamer wurde er. Er verfolgte höflich Bellmanns Theorien zur Lage der Welt, putzte hin und wieder seine dicke Brille und genehmigte sich vier bis fünf Scotch, bevor er am Pool vorbei zur Auffahrt torkelte und sich in seinen Chevrolet fallen ließ.
Manchmal besuchten sie ihn. Dann kam es vor, dass sie eigenmächtig Schallplatten auflegten oder die vom Gastgeber nicht grundlos leise eingestellte Musik ungefragt aufdrehten, und wenn sie bei gutem Wetter in seinem Garten sitzen mussten, bekamen sie einen gehetzten Gesichtsausdruck, wippten ungeduldig mit dem Fuß und trommelten mit den Fingern Basslinien auf den Tisch; ihr eigentlicher Zustand war die ständige Bewegung.
Sie hatten sich beim Tanzen kennengelernt – nicht im Norden, wo sie später lebten, sondern in Mannheim. Bellmanns Vater war im Krieg gefallen, jedenfalls hatte seine Mutter ihm das erzählt. Er selbst hatte keine Erinnerung an ihn, beziehungsweise war das, was er für seine Erinnerung hielt, nur die verinnerlichte Betrachtung der wenigen Fotografien aus dem Jahr 1940, die ihn mit seiner Mutter und seinem Vater zeigten. Die Mutter bewahrte sie in einem schweren Album auf, dessen erste fünf Seiten einen hochgewachsenen, blonden Mann in Wehrmachtsuniform zeigen, der seinem Sohn, der auf einem Schaukelpferd sitzt, die Hand auf die Schulter legt. Auf den weiteren Bildern sieht man den Vater mit der Mutter, einer blassen, stämmigen, auf eine handfeste Art hübschen Frau mit einer Stupsnase und feinen braunen Locken. Sie schlingt ihre Arme um die Hüften des Mannes; sie trägt eine Spange im Haar, der Vater schaut, wie auf allen Fotos, streng hinter einem markanten Kinn hervor und lacht nicht.
Die restlichen Seiten des Albums sind leer, nur auf der hinteren Seite liegt ein getrocknetes Kleeblatt. Bellmanns Vater, erzählte ihm die Mutter, sei 1941 bei Kämpfen an der Ostfront gestorben. Später erfuhr er, dass sein Vater bei einer Truppenverlegung aus dem Zug gestürzt war. Er erfuhr auch, dass dort, wo sein Vater war, ein Massaker stattgefunden hatte.
Seine Mutter heiratete nie wieder. Nach dem Krieg arbeitete sie in einem Kolonialwarenladen an einer stark befahrenen Kreuzung in der Innenstadt von Mannheim und zog ihren Sohn allein groß. Die Amerikaner, die ihn manchmal vor der Tür ihrer kleinen Wohnung absetzten, würdigte sie keines Blickes. Er konnte sich nicht erinnern, dass er seine Mutter einmal hatte lachen sehen.
Ihr Haar war früh grau geworden, sie schwieg viel und saß oft bekümmert über Abrechnungen und Belegen, die sie spätabends, nach der Arbeit, auf der Wachstuchdecke des Küchentisches ausbreitete. Jeden Samstag machte sie ihm einen Kuchen aus Keksen und Fett und Kakao, den sie Kalten Hund nannte. Sie aßen ihn am Sonntagnachmittag. Manchmal kam ein Onkel mit einem rötlichen, hageren Gesicht, der nach Rasierwasser roch, auf einen Kaffee vorbei; manchmal, wenn sie allein waren, zündete sie eine Kerze an und las ihm Geschichten aus Tausendundeiner Nacht vor.
Das Haus, in dem sie wohnten, stand in der Nähe der amerikanischen Kasernen. Schon damals liebte er die Amerikaner und ihre breiten, verchromten Autos, ihre Uniformen und ihre Musik. Er war ein pummeliges Kind mit mortadellaweichen Armen, und er war oft krank. Der Schularzt sagte, der Junge müsse Sport treiben, mehr an die frische Luft, mit anderen Kindern spielen, aber dazu hatte er keine Lust.
Dann passierte etwas Erstaunliches: Die Pubertät verschob seinen Babyspeck so vorteilhaft, dass er zu einer Zeit, als seine Klassenkameraden, überrascht vom plötzlichen Einschlag der Wachstumshormone, noch dürr, ungelenk und windschief im Raum standen, aussah wie eine verkleinerte Ausgabe von Marlon Brando. Er begann, Lederjacken zu tragen, lungerte vor Eisdielen herum, stopfte Unmengen an Geld in Jukeboxes und trug Jeans, die im Schritt spannten – sein Onkel sprach von »Nietenhosen«, was auch und vor allem als moralisches Verdikt zu verstehen war.
Ein paar Jahre später belegte Bellmann einen Rock-’n’-Roll-Kurs und kaufte sich von dem Geld, das er während eines langen Sommers in einer Schraubenfabrik verdient hatte, einen Motorroller mit verchromten Außenspiegeln. Im darauffolgenden Jahr wurde er nicht nur ein Meister des Kick-Ball-Change, sondern gewann zum Erstaunen seiner wenigen Freunde einen Tanzwettbewerb nach dem anderen.
Was Bellmann beim Tanzen veranstaltete, war atemberaubend. Seine Beine ratterten wie führerlose Presslufthämmer über das Parkett, seine Tolle wurde zu einem dunklen Tornado, seine Knie rasten wie bissige Hunde umeinander; die Mädchen kicherten, wenn sie ihn tanzen sahen, und wurden rot, wenn er sie aufforderte; die Jungen aus seiner Klasse standen in gestärkten Hemden und grauen Flanellhosen am Rand und kochten vor Wut; sie wussten, sie würden nie tanzen können wie er, und erklärten das Tanzen deshalb zur Mädchensache.
Auch seine Mutter hielt von der Tanzerei nicht viel, freute sich aber, dass ihr Sohn nicht mehr den ganzen Tag in seinem Zimmer saß; wenn er abends nach Hause kam, küsste sie ihn auf die Stirn und machte ihm Kartoffelsuppe mit Wurststücken und eine Nachspeise, die sehr chemisch schmeckte.
Dann lernte er Ingrid kennen. Sie kam aus Ludwigshafen, und seit sie ihre beachtlichen Haarmengen hatte bleichen lassen, nannte man sie die Marilyn von Mundenheim. Schwärme hoffnungsvoller, unausgeglichener junger Männer verfolgten sie auf ihren Motorrollern, und wenn sie schließlich mit ihrer Vespa die Villa ihres Vaters erreichte und sich ein letztes Mal umdrehte, schaute sie in eine von unduldsamem Zweitaktknattern unterlegte Armada schwarzer Sonnenbrillen.
In den Cafés, im Rialto oder im Excelsior, war Ingrid fast nie anzutreffen, weil sie entweder zu Hause oder mit den amerikanischen Soldaten unterwegs war, und so blieb den Jungen nichts anderes übrig, als sie aus der Ferne zu betrachten. Wenn sie im Freibad ihre Beine eincremte und dann wie eine Lenkrakete vom Fünfmeterturm senkrecht hinunter ins Wasser schoss, dann war das ein Ereignis, über das auf den Schulhöfen der Stadt noch wochenlang in allen Details geredet wurde: Der Schwung ihrer Hüften beim Betreten des Sprungbretts, die Sommersprossen auf ihrem Dekolleté, die einer Sternenkonstellation ähnelten, die blonden Härchen auf ihren Unterarmen, die Narbe an ihrer rechten Wade – wie Weltraumforscher anhand unscharfer Fotos die Oberfläche eines unbekannten Planeten sondieren, wurde jedes Detail ihres Körpers in zermürbenden Sitzungen besprochen, in der Hoffnung, ihrem Geheimnis näherzukommen. Auf den Fotos von damals sieht man ein lächelndes Mädchen; ihre Haare fallen über die dunklen Augen und auf die braungebrannten Schultern wie ein seltsames, von innen glühendes Gegenlicht.
Damals war Bellmann sehr dünn; er trug eine gigantische, mit verschiedenen Ölen penibel gepflegte Tolle, die etwa zehn Zentimeter über die Stirn hinaus in die Luft ragte wie bei einem Einhorn; wenn sie tanzten, wippte sie ihm ins Gesicht, und morgens, beim Aufstehen, hing sie wie ein durcheinandergeratener Zopf über seinem linken Auge. Er trug jetzt meistens weiße T-Shirts, in denen er auch schlief, und darüber eine schwere amerikanische Lederjacke. Sie war oft bei ihm, obwohl sie mit dem fröhlichen Bekenntnis, nicht kochen zu können und es auch nicht lernen zu wollen, den ewigen Groll seiner Mutter auf sich gezogen hatte. Er ertanzte mit ihr sämtliche Medaillen, die die junge Rock-’n’-Roll-Gemeinde seiner Stadt zu vergeben hatte, absolvierte in einer atemberaubend kurzen Zeit ein Medizinstudium und bekam eine gut bezahlte Stelle im städtischen Krankenhaus. Einen Sommer später heirateten sie. Bei ihrer Hochzeit sang sie »To Know Him Is To Love Him« von den Teddy Bears, und in den Bänken des Standesamtes weinten Verwandte, Freunde und Sitzengelassene vor Rührung oder Wut.
Ihr Vater gab ihnen Geld. Sie kauften einen großen alten Ford und fuhren nach Neapel in die Flitterwochen, tranken reichlich Whisky und hörten Musik, die nach Schweiß und nach Metall klang. Drei Jahre später nahm Bellmann eine Stelle in einem Krankenhaus im Norden an. Er operierte und schnitt und renkte ein und machte Karriere in seiner Abteilung. Ihr Vater kaufte ihnen den Bungalow am Stadtrand, Ingrid richtete ihn ein: bestellte die Universal-Vollkunststoffküche Gloria eins mit Lagopal-Arbeitsplatten, ließ einen Pegulan-Fußboden verlegen, kaufte einen Hailo-Bügeltisch mit feuerhemmender Dreischichtauflage, eine Constructa-K6-Super-Waschmaschine, drei Airborne-Sessel und einen Ratgeber mit dem Titel Vorbildlich wohnen; er hat das Buch immer noch. »Drei Dinge«, erklärt der Autor in seiner Einleitung, »spielen bei einem Sitzmöbel eine große Rolle: Die Form spricht das Auge und das Stilgefühl an; der Sitzkomfort wird vom Genießer für das Wichtigste gehalten. Und: Was die Form verspricht, muss die Polsterung halten. Hier zu sparen lohnt sich nicht. Ein Stoff muss kräftig sein, er muss unter den prüfenden Fingerspitzen einen vertrauenerweckenden Eindruck machen. Kenner schwören auf Leder, weil es bei vernünftiger Behandlung ein Leben lang – und länger – hält. Und weil es mit zunehmendem Alter immer schöner wird.« Und länger, wiederholte Bellmann: Wenn er tot wäre, würde dieser Sessel noch da sein und immer noch schöner werden, ein wunderschöner, von seinem Besitzer verlassener Sesselgreis auf sinnlosen silbernen Rollen, eingesackt in eine Flokatiwolke.
Sie ließen einen Pool in den Garten graben und trieben, während die Musik durch die offenen Schiebetüren des Wohnzimmers dröhnte, ein paar Sommer lang auf Luftmatratzen in der Sonne, schauten in den Himmel und betrachteten die Reflexionen des Lichts auf dem Grund und wurden so dunkelbraun wie der karbolineumgetränkte Jägerzaun des Nachbarn. Tagelang verließen sie den Pool nur, um sich einen Drink zu holen oder die Langspielplatten umzudrehen; der Arm des Plattenspielers war nach ein paar Jahren weiß und brüchig vom Chlor.
Es ist vor allem ein Geruch, an den er sich später erinnert. Wenn es geregnet hatte, war die Luft schwer, und die Sonne brach sich in den Zweigen. Er schaute ihr dabei zu, wie sie sich am Pool ihre Nägel lackierte. Das Abendlicht fiel auf die Wasseroberfläche, und die Reflexe zuckten über die Scheiben des Hauses. Sie trug einen weißen Badeanzug, und der metallische Geruch des Nagellacks mischte sich mit dem Chlordunst des Pools und der Luft, die den Geruch des feuchten Heus über die Wiesen trug.
Wenn er spät aus dem Krankenhaus kam, setzten sie sich aufs Sofa und tranken Dujardin. Er ging früh zu Bett und schlief schnell ein, sie blieb wach und las in ihren MagazinenArtikel über den Schah von Persien, der in St. Moritz Skiurlaub machte, oder über die neuen Modefarben Mint und Azur. Wenn sie nicht las, schaute sie fern, Hans Rosenthals neue Show oder Kriminalfilme; manchmal schlief sie auf der Couch ein und wachte erst vom Pfeifton des Sendezeichens auf.
Dann, 1969, zog seine Mutter zu ihnen. Sie bekam ein großes Zimmer und ein eigenes Bad. Zum ersten Mal in ihrem Leben wohnte sie in einem Haus mit Garten, keinem kleinen Notgemüsegarten mit illegalen Kaninchenställen und Kartoffeln und Suppenkraut, sondern einem Park mit Rhododendren und Magnolien und einem hellblauen Swimmingpool.
Hier saß sie, einerseits stolze Mutter des angesehenen Herrn Doktor Bellmann, andererseits auch Erzeugerin des lautesten Rockers der Stadt, ratlos zwischen Flokatis und Plastikschalensitzen herum und staunte und litt. Das Haus, das kein Haus war, das Haus ohne Dach, das Rockerhaus, machte sie verrückt. Sie konnte die Tür abschließen und sich in ihrem Zimmer verbarrikadieren, in das sie mitsamt ihren alten Möbeln eingezogen war; da war das alte, knackende Holzbett mit dem gedrechselten Giebel, der Nähtisch, das knarzende Sofa ihrer Großtante, auf dem sie nachmittags ihren Kaffee nahm und von den langen Sommern ihrer Jugend träumte. Sie konnte die erschreckend moderne Welt, die ihr Sohn um sie herum errichtet hatte, ausblenden – aber nicht die Musik überhören, die tags und auch abends durch die dünnen Wände drang, und so saß sie in ihrem Bauernmöbelversteck und strickte Winterstrümpfe für ihren Sohn und hörte, tagein, tagaus, bis ihr der Kopf dröhnte, Bobby Vee und Little Richard und Chris Montez und Betty Everett und Chubby Checker. Sie versuchte, all das zu verdrängen. Sie versuchte, sich einzureden, die Frau tue dem Jungen (sie sagte immer: mein Junge) gut, bringe Stabilität in sein Leben, aber wenn sie ehrlich war, konnte sie keine Anzeichen von irgendeiner Stabilität erkennen, mal abgesehen davon, dass der Junge nicht, wie ihr Schwager es noch in Mannheim prophezeit hatte, in der Gosse gelandet war, sondern eine erstaunliche Karriere gemacht hatte, nicht zuletzt auch dank des Geldes, das seine Frau von zu Hause mitbrachte …
Trotzdem. Bellmanns Mutter verschanzte sich, soweit es ging, in dem ihr zugeteilten Bauernkatenreservat, aber manchmal waren Expeditionen ins Wohnzimmer unvermeidlich, und dann lief sie, wie eine mittelalterliche Bäuerin, mit kurzen, festen Schritten ratlos über die Flokatis durch die seltsame Welt, in die man sie verpflanzt hatte und in der die böse Königin Ingrid regierte.
Als Bellmann Ingrid kennengelernt hatte, war sie sechzehn; als er sie heiratete, war sie vierundzwanzig, und die Jahre, die dazwischenlagen, waren die hysterischsten des gesamten Jahrhunderts: Zwar wurden die Trümmer des Krieges unter einer meterdicken Schicht aus Sahnetorten und Pastellfarben und Bergromantik begraben, aber es wurde nichts mehr normal, im Gegenteil; die mit zahlreichen Hilfsmitteln zum Glänzen gebrachten Frisuren erreichten die Höhe schwarzlackierter Helme, die Art zu tanzen wandelte sich vom eng verklammerten Nachkriegsgeschiebe zu einem durchgedrehten Zucken und Schlenkern, den Autos wuchsen zentnerschwere Chromgeschwüre und gigantische Haifischflossen, die Tische schwangen sich wie vom Wahnsinn befallene Urwaldboas durch die Wohnzimmer – und während die Amerikaner den Schulkindern allen Ernstes beibrachten, dass man bei kommunistischen Atomangriffen unbedingt unter den Tisch kriechen und ein Buch über den Kopf halten müsse (»duck and cover«), machten Ingrid und er das Beste aus der lebensbedrohlichen Situation: Sie feierten, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor.
Hans Joachim und Ingrid Bellmann hatten eine tiefsitzende Angst vor dem großen Atomschlag – eine Angst, die sie nur bei den zahllosen Festen, die sie am Pool veranstalteten, vollständig vergessen konnten und die sofort, wenn es still wurde, wieder zwischen den hellen Plastikschalen und den polierten Teakmöbeln hervorkroch, weswegen sie viel und gern feierten.
Ein paar alte Fotos zeigen die beiden auf einem Fest unter japanischen Lampions; Ingrid trägt silbern funkelnde Stilettos und einKleid mit Metallpailletten, ihre Haare glühen platinblond, ihre Beine sind dunkelbraun von den Sommernachmittagen am Pool, und unter ihren Augen scheint, soweit man es auf dem Foto erkennen kann, ein Schatten zu liegen, aber vielleicht sind es auch nur Sommersprossen.
Hinter ihnen der Tumult einer fortgeschrittenen Cocktailparty: verrutschte Frotteekleider, Hemden mit Schweißflecken, sich auflösende Frisuren – Paare treiben im schleifenden Takt eines Dusty-Springfield-Songs über die Tanzfläche, Männer schwitzen in ihren Pullundern, Frauen tanzen barfuß im Wohnzimmer, im Garten gießt ein Dicker einem anderen, der im Gras liegt, Wodka in den geöffneten Mund, im Pool treibt ein Damenschuh, an dessen Hacke jemand das Ende eines Schlipses gebunden hat, in der Hollywoodschaukel liegen zwei kompliziert Verknotete, und die Musik umhüllt sie wie ein Hauch von Wahnsinn.
Er erinnert sich an dieses Fest: Es war spät im Sommer. Auf den Feldern hatte die Maisernte begonnen, am Horizont verschwanden die Mähdrescher in trockenen Staubwolken und auf den Straßen lagen Erdbrocken, die aus dem Profil der Traktorenreifen gefallen waren; die Kinder bewarfen sich damit.
Sie fuhren zum Getränkehändler, um kaltes Bier zu holen. Sie saß auf dem Beifahrersitz; in der rechten Hand hielt sie ein halbleeres Cocktailglas und eine Zigarette, ihre linke hatte sie in seinen Nacken gelegt; im Rückspiegel sah er die Gänsehaut auf ihrem Arm. Bevor sie zurückfuhren, tranken sie ein Bier auf dem Parkplatz des Supermarkts und dann noch eins während der Fahrt. Er fuhr scharf nach rechts in einen Feldweg, sie machte ihren Gurt los, und die Schnalle ihres Schuhs schrammte über das Polster des Beifahrersitzes; später sah er, dass an einer Stelle ein Schlitz im dunklen Leder klaffte.
Noch Jahre später erzählte ein Nachbar gern, dass es bei diesem Fest, als er gegen zehn Uhr eintraf, keine einzige Flasche Bier mehr gegeben habe, nur seltsame, im Dorf nie gesehene Mischgetränke, die von einem eigens bestellten Barkeeper in der Küche angerichtet und auf Silbertabletts serviert wurden. Die letzten Gäste gingen gegen fünf Uhr morgens. Bellmann begann danach, die Verwüstungen der Nacht zu beseitigen, Ingrid war losgefahren, frische Brötchen zu holen, so machten sie es immer nach ihren Festen: ein Frühstück am Ende der Nacht. Erst dann gingen sie ins Bett, während seine Mutter, die schon munter war, im Wohnzimmer die Trümmer und den Müll aufsammelte.
Sie feierten, so oft es ging. An warmen Sommerabenden hörte man die Musik, die aus hohen Boxen in den Garten drang, noch weit unten im Dorf, bis tief in die Nacht rollten Limousinen auf die Wiese neben ihrem Haus, und manchmal tauchte auch die Polizei auf. Die letzten Gäste verschwanden erst gegen Morgen, wenn die Bauern schon mit ihren Traktoren aufs Feld fuhren, und mehr als einmal wären die barfüßigen Frauen und die torkelnden Männer, die frühmorgens mit ihren Wagen Bellmanns Auffahrt verließen, fast mit einem Mähdrescher zusammengestoßen. Manchmal gaben die Bellmanns den Kindern der Bauern Geld, um ihnen beim Vorbereiten oder beim Aufräumen zu helfen, und die Jungen berichteten Ungeheuerliches: von Menschen, die früh am Morgen im Anzug in den Pool gesprungen waren; von schimmernden, engen Kleidern; von Zigarrenqualm, der so dicht im Wohnzimmer stand, dass man denken musste, es brenne dort; von Schalentieren, die lebend aus ihrem Panzer geschlürft wurden; von Nackten, Kreischenden, die sich ins Gras warfen, und einem Betrunkenen, der die gläserne Schiebetür des Wohnzimmers nicht gesehen und sich eine Gehirnerschütterung geholt hatte. Einmal raste ein Gast mit seinem Auto mitten durch die Hecke in den Garten; Bellmann ließ das Loch zupflanzen, aber die neue Hecke hatte hellere Blätter; im Sommer erinnerte ein giftgrüner Fleck an den Unfall.
Sie feierten zehn Jahre lang, als wäre jedes Fest das letzte ihres Lebens, und als nach zehn Jahren die Welt immer noch nicht in die Luft geflogen war, begann der Frieden sie ratlos zu machen.
Die Feste wurden seltener. Das Aluminium der Fensterrahmen lief an, der Lack blätterte von der hölzernen Pergola, und der Stoff der Sommermöbel begann auszubleichen. Ingrid richtete sich zu Hause ein Büro ein und übersetzte Betriebsanleitungen für große Firmen, trieb auf der Luftmatratze durch den Pool und las Biographien bedeutender Personen. Wenn er spät heimkam, lagen ein aufgeweichter Napoleon und eine zerknickte Marie Curie am Beckenrand, und sie kamen ihm vor wie ein stummer Vorwurf.
Sie ließ sich ihre Haare kurz schneiden und verschwand für ganze Tage. Beim Bäcker begannen die Nachbarn zu reden. Die Frau des Doktors, raunten sie einander mit dem Schauer der Davongekommenen zu, habe eine Affäre mit demamerikanischen Arzt, der sie so oft besuche.
Bellmann verbrachte seine Zeit im Krankenhaus, in Schallplattenläden oder im Bunker. Jeden Morgen fuhr er um halb sieben rückwärts aus der Garage, rollte an der verglasten Fassade entlang und gab Gas, und am Seitenfenster rasten die Fensterrahmen des Hauses vorbei wie die Bilder eines Films, den man zurückspult: das Wohnzimmer, das Zimmer der Mutter mit den Rüschengardinen, das Zimmer seiner Frau, dann der lange, grüne Abspann der Buchenhecke.
Um kurz vor sieben fuhr er auf den für ihn reservierten Parkplatz vor der Klinik und nahm den Aufzug in den vierten Stock. Derscharfe Geruch von Desinfektion und Reinigungsmitteln, das mattglänzende, grüngraue Linoleum, das Brummen und Flackern der Neonröhren, sein eigenes mattes Spiegelbild, das sich in den nachtblinden Fensterscheiben spiegelte – dann das scheppernde Transistorradio in der Teeküche, das röchelnde Geräusch der Thermoskanne, der Kaffee, den die Oberschwester immer um fünf Uhr kochte, die Frühbesprechung, der OP-Plan: So begannen seine Tage. Am Vormittag operierte er, analysierte mit seinen Studenten die Röntgenbilder offener Frakturen und telefonierte mit der Anästhesie. Nachmittags folgten die Visiten und die Notfälle, bei denen er aushalf. Er war lange in der Unfallchirurgie, später spezialisierte er sich auf plastische Chirurgie. Er hatte, erzählt er, einige Zeit bei dem berühmten Mediziner Alfred Rehrmann in Düsseldorf verbracht und nach einer zusätzlichen anästhesiologischen Ausbildung erst in einer Abteilung für Verbrennungsfälle, dann in einer für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie gearbeitet, wo er die Spätschäden schlecht versorgter Kriegsverletzungen und Kiefergaumenspalten zu sehen bekam, Unfälle und Brüche aller Art, ein Schreckenspanoptikum, das er in möglichst ansehnliche Gesichter zurückverwandelte.
Von Zeit zu Zeit schnitt er die Hecke, die das Grundstück von der Straße trennte; der hellgrüne Fleck wucherte allmählich zu. Einmal in der Woche begleitete er seine Mutter in ein Café in der Stadt. Sie saßen nebeneinander im Mercedes und wechselten kein Wort, auch später im Café nicht. Er las eine Zeitung oder schenkte ihr Tee nach, sie rührte Zucker in ihre Tasse, putzte ihre Brille, lächelte unsicher und warf ihm hin und wieder einen Blick zu, in dem Enttäuschung, Sorge oder vielleicht auch Mitleid lagen. Meist schaute sie durch die Panoramascheibe in die sonntäglich leere Straße, an deren Rand, mit dynamisch schräggestellten Vorderreifen, der Mercedes parkte. Einmal stand er auf der Rückfahrt neben dem Opel der Nachbarn. Diesmal sangen sie nicht, und als die Ampel auf Grün schaltete, gab Bellmann leicht Gas. Der Nachbar versuchte, angefeuert von seinen Kindern, mit ihm mitzuhalten, der Opel gab ein dünnes Kreischen von sich, Bellmann winkte den Kindern mit der linken Hand zu und trat das Gaspedal durch, und während seine Mutter in den Beifahrersitz gepresst wurde, sah er im Rückspiegel das grimmige Gesicht des Opelfahrers und das seiner gestikulierenden Frau.
In dieser Zeit stellten Freunde des Paares einige Veränderungen fest. In Ingrids blondes Haar mischten sich graue Strähnen, und an ihren Mundwinkeln bildeten sich kleine Falten. Bellmann hatte sichtlich einen Bauch bekommen und trug jetzt öfter eine Brille, und seine einst beeindruckende Tolle wurde immer flacher und lichter, bis sie ganz verschwand. Es gab vielleicht im gesamten vergangenen Jahrhundert keinen schlechteren Zeitpunkt für Haarausfall: Zwischen 1966 und 1970 hatte sich die Weltgesamthaarmenge mindestens vervierfacht, nur auf Bellmanns Kopf schlug das Alter zu, ein Grund, warum er, anders als früher, nicht mehr gern den großen Rock-’n’-Roll-Hit »Lend Me Your Comb« hörte. Sie schliefen nicht mehr oft miteinander: Morgens wurde ihr schlecht davon, abends war sie zu müde. Sie begann, ungeschminkt zu frühstücken und erst mittags zu duschen;ihr Gesicht wirkte weicher und glanzloser. Seine Mutter ließ immer öfter ihre Zimmertür offen stehen; der säuerliche Geruch lange nicht gelüfteter Räume, ein Geruch von Hühnersuppe, Damenparfüm und Wolldecken, verschwitzten Nachthemden und altem Menschen, drang wie durch eine Körperöffnung in den Flur des Bungalows.
Manchmal traf er abends in einer Eckkneipe, in der es Astra und Bratwurst gab, einen Kollegen, mit dem er studiert hatte. Der Mann hieß Bernd Oberwald; er war ein stiller, besorgt schauender Mensch, der in einem anderen Krankenhaus als Oberarzt arbeitete. Den ganzen Tag lang lief er gehetzt durch die Gänge, schaute nach Patienten, operierte und befühlte sie und schüttelte dabei oft den Kopf, als verzweifelte er angesichts der Fehlerhaftigkeit der Schöpfung. Nur am Wochenende, wenn er keinen Dienst hatte, fand er Ruhe und wirkte entspannt. Er angelte gern. Nach Stunden reglosen Wartens zog er dann einen zappelnden Karpfen aus dem Wasser, drückte ihn auf den Holzboden seines Ruderbootes und schlug ihm mit dem Griff seines Messers auf den Kopf und stach ihm in die Herzkammer, wobei er wieder den traurigen, ernsten Gesichtsausdruck bekam, den auch seine Patienten kannten.
Manchmal tauchten, auf lautlosen Kreppsohlen über den Gehweg schleichend, die Nachbarn auf. Sie waren erst vor kurzem in die Gegend gezogen und wanderten nun, auf der Suche nach neuen Freunden, mit Weinbrandflaschen und vielfarbigen Blumensträußen bewaffnet, die sommerlich leere Vorortstraße entlang. Einmal bat Bellmann sie ins Haus, wo sie mit großer Selbstverständlichkeit Blumenvasen verrückten und Lampen ein- und ausschalteten, als sei es ihre Aufgabe, das ordnungsgemäße Funktionieren der nachbarlichen Lichtquellen zu prüfen. Während Bellmann einen Kaffee aufsetzte, wanderte das Paar ziellos, wie mäßig interessierte Museumsbesucher, im Haus herum, bis die Frau mit einem Lachen, das große Zähne entblößte, der Tischlampe im Wohnzimmer einen leichten Schlag versetzte, aufjubelnd: »Die haben wir auch! Im Badezimmer!«
Manchmal blieb der Postbote auf eine Zigarette. Bellmann mochte ihn gern, er war in etwa so alt wie er und kannte sich mit amerikanischer Musik aus. Sie saßen dann, während das Postfahrrad mit den überfüllten Kunstledertaschen am Garagentor lehnte, auf der Terrasse oder im Atombunker an der Westernbar, Bellmann hielt ihm die Zigarettenschachtel hin, und sie redeten über Schallplatten, die sie sich gekauft hatten; dieser Mann, sagt Bellmann, war ein guter Freund. Einmal tauchte der Postbote morgens mit seinem Fahrrad auf, als Bellmann, der an diesem Tag freigenommen hatte, gerade mit ein paar Gästen die letzten Reste aus den Flaschen in die Gläser goß und Schwarzbrote mit Rollmops und Mayonnaise servierte; sie hatten die Nacht durchgefeiert und bestaunten jetzt den frischgewaschenen dünnen Mann mit der Umhängetasche wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Bellmann nötigte ihn, einen Wodka mitzutrinken. Sie legten irgendetwas von Eddie Cochran auf und tranken weiter, und jedes Mal, wenn der Postbote mit einer unsicheren Handbewegung auf die Ledertasche deutete, aus der die nach Straßen sortierten Briefe vorwurfsvoll herausragten, drückte ihn irgendeine schnapsschwere Hand zurück in die Kissen, und eine andere reichte ihm ein gut gefülltes kleines Glas.
Gegen zehn Uhr war auch der Postbote vollkommen betrunken, und weil er beim Versuch, sein Fahrrad zu besteigen, zweimal umfiel, wurde der Mercedes aus der Garage gefahren, was erstaunlicherweise gelang, drei Männer und eine Frau bestiegen das Auto, Bellmann steuerte angemessen langsam die Hauptstraße entlang, und an jeder Kreuzung schleuderte der Postbote aus dem fahrenden Wagen ein Paket mit Briefen in den erstbesten Vorgarten. Es war Mittag, als Ingrid und er ins Bett gingen, und Abend, als sie aufstanden.
Manchmal verbrachte Bellmann ganze Tage in seinem Bunker; wenn er wieder auftauchte, erschien ihm die draußen im Tageslicht dörrende Welt seltsam und absurd.
Dann kam Phyllis zurück. Er traf sie zufällig auf dem Parkplatz vor der Abteilung für Innere Medizin, sie war mit einem Typen aus der HNO-Abteilung auf dem Weg in die Kantine, einem dünnen, geschmeidig gehenden Menschen mit wolligem Haar, der leise und sehr schnell redete und allgemein als gutaussehend galt. Bellmann mochte ihn nicht; er hatte sich einmal mit ihm auf dem Flur angebrüllt, vor den älteren Kollegen, die die Streitenden auseinanderbringen mussten, es ging um eine Ausdehnung der HNO-Kompetenzen in den Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Bellmann hatte darauf bestanden, dass die gesamte Traumatologie in seiner Abteilung verblieb. Seither redete der Kollege nicht mehr mit ihm und bog hektisch in irgendeinen Raum ab, wenn er ihn sah. Wenn eine Kollision nicht zu vermeiden war, grüßte er Bellmann scheinheilig, wobei er die Augenbrauen kurz anhob und den Namen Bellmann wie etwas Absonderliches hervorstieß, dessen bloße Aussprache ihn einige Überwindung kostete. Bellmann wusste, dass der Mann versuchte, die Mittel für plastische Gesichtschirurgie unter die Kontrolle seiner Abteilung zu bekommen, zumindest die Nasen und die Ohren, ein klassischer Fall von Selbstüberschätzung, die man bei den HNO-Leuten oft antraf und die ihn als ausgebildeten Chirurgen verbitterte. Aber der Typ kannte offenbar keine Selbstzweifel; er fuhrwerkte mit seinen penibel manikürten Händen in der Luft herum und redete auf Phyllis ein, die ärgerlicherweise herzlich lachte und ihn zu weiteren unansehnlichen Kapriolen ermutigte.
Phyllis war sehr dünn, sie hatte große, dunkle Augen und trug ihre Sonnenbrille ins Haar geschoben; die Bäume spiegelten sich in den schwarzen Gläsern und überschlugen sich, wenn sie den Kopf drehte, ein Bild, das er lange nicht vergessen konnte.
Die nächsten Nachmittage verbrachte er damit, in seinem Mercedes vor dem Krankenhaus zu warten, in der Hoffnung, sie würde aus dem Haus kommen, um dann wie zufällig vorzufahren und ihr anzubieten, sie irgendwohin zu bringen. Als sie schließlich auftauchte, kam sie nicht allein, sondern zusammen mit einer dicken Anästhesistin. Bellmann steuerte den Wagen so zufällig wie möglich um die Kurve, bremste scharf und fragte, ob jemand mitfahren wolle. Die Dicke stieg erfreut ein.
Trotzdem gelang es Bellmann am kommenden Tag, sich mit Phyllis zu verabreden, was ihn mit einer Mischung aus Euphorie, schlechtem Gewissen, Unruhe und Sentimentalität erfüllte. Er kaufte seiner Frau einen gigantischen Blumenstrauß, besorgte im Reisebüro eine Broschüre über die Vereinigten Staaten (sie wollten immer gemeinsam nach Florida fliegen) und hielt an der nächsten Telefonzelle. Eine Viertelstunde lang hockte er in der Zelle und starrte auf ein ausgeblichenes Terroristenfahndungsplakat. Genau genommen ähnelte Phyllis der Terroristin Petra Schelm ein wenig, aber diesen Gedanken verdrängte er; sie erinnerte ihn an jemand anders, aber er wusste nicht, an wen. Dann rief er Phyllis an, um ihr mitzuteilen, dass er einen Tisch reserviert habe (was nicht stimmte). Zu Hause überreichte er die Blumen, küsste seine Frau, die eine leicht ausweichende Bewegung machte, auf die Schulter und lud sie ins beste chinesische Restaurant der Stadt ein.
Zwei Tage später, am 25. Juni 1972, traf er Phyllis zu einem Mittagessen im Ratskeller. Sie trug ihr Haar in der Mitte gescheitelt, trotzdem fiel es ihr seltsamerweise asymmetrisch ins Gesicht (es muss an ihren Wirbeln gelegen haben, sagt Bellmann später). Wenn sie lachte, sah er ihre sehr schönen weißen Zähne, und auf ihrer Nase bildeten sich winzige, senkrechte Fältchen. Ihre rechte Augenbraue verlief höher als ihre linke (man könnte das operativ leicht korrigieren, dachte er, wenn man wollte); es gab ihr einen spöttischen Zug, egal, worüber sie sprach.
Er kam kaum dazu, etwas zu sagen. Sie aß fast nichts und redete ohne Pause, fuchtelte mit einem Stift vor seiner Nase herum, stellte ihm Fragen über Deutschland und das medizinische System, beklagte sich über die amerikanische Außenpolitik, erzählte von ihrer Ausbildung in einem Militärkrankenhaus bei Frankfurt; erzählte weiter, dass sie bei einem Konzert von Ravi Shankar und Eric Clapton im Madison Square Garden gewesen sei, einem Benefizkonzert für Bangladesch, und Bob Dylan, sagte sie mit vollem Mund, während sie ein Brötchen in der Mitte durchbrach, Bob Dylan sei auch dagewesen, und George Harrison, er habe ausgesehen wie Jesus, in einem hellen Sommeranzug.
Bellmann nickte. Er sprach nicht schlecht Englisch, aber je schneller sie wild gestikulierend auf ihn einredete, desto weniger verstand er. Er hatte Wein getrunken, das hätte er, dachte er, nicht tun sollen, er starrte auf ihre Bluse, bemühte sich aber sofort, ihr wieder in die Augen zu schauen, die manchmal zwischen den kleinen Lachfalten schmal wurden, und ihre Erzählung raste wie ein Orkan aus englischen Worten um seinen Kopf herum.
Man muss sich Bellmann vorstellen, wie er an diesem Junimittag im Ratskeller sitzt und lange nichts sagt, hin und wieder ihre Fragen beantwortet, Worte verwechselt, sich bei einfachsten Erklärungen verheddert; es ist nicht seine Sprache. Er weiß nicht, was er erzählen soll, also erzählt er, dass Borussia Mönchengladbach Deutscher Meister geworden sei (mein Gott – kann man sie mehr langweilen als mit diesem Kram? Aber er redet weiter über Fußball, als habe es ihm ein böser Dämon befohlen), und das liege an Lothar Kobluhn von Rot-Weiß Oberhausen, he is from the town where my father was born, you know, er sucht vergeblich nach einer Übersetzung für das Wort Bundesliga-Torschützenkönig, aber natürlich interessiert sie das nicht.
Sie fragt, wo er lebe.
»Outside the city. It is a modern house, like in America. With a pool, it’s nice in the summer.«
Sie sagt: »Suburbia« und legt ihm, als müsse er getröstet oder beruhigt werden, ihre Hand auf den Arm. Sie findet die Vororte grauenhaft. Sie möchte am Strand leben, mit vielen Freunden. Sie ist der Meinung, dass Lyndon B. Johnson ein Verbrecher ist. Sie findet, obwohl sie es nicht sagt, das Essen im Ratskeller grauenhaft (sie lässt drei viertel übrig, vor allem die Fleischstücke). Sie findet Elvis Presley langweilig. Sie findet, Frank Sinatra sei etwas für alte Suffköpfe in ihren Vorortbungalows. Sie findet, die Everly Brothers sähen beim Singen aus, als müssten sie sich übergeben. The Chordettes? Kennt sie nicht mal. Sie erzählt, dass ihr Vater, ein Versicherungsmakler, in einem Vorort von Atlantic City einen Wochenendbungalow mit Pool besitze, es sei ganz furchtbar langweilig dort, ruft sie und macht zum ersten Mal eine Pause. Und er, seine Familie, sein Vater?
Sein Vater. Was weiß er von seinem Vater? Er erinnert sich kaum. Also erzählt er von der Zeit im Krieg, dem Backsteinhaus in Gelsenkirchen, nicht weit von der Zeche Nordstern, ein rußigschwarzes Haus mit matten Fensterscheiben, vor dem ein paar schwarze Bäume standen, die auch im Sommer nie richtig grün wurden.
Sein Vater, sagt er, war Bergarbeiter. Er saß nach Feierabend mit einer braunen Bierflasche auf einer Bank, schaute durch rußige Wolken in eine matte Sonne und tätschelte ihm den Kopf. Er starb als einer der ersten. Er wollte nicht in den Krieg, sagte er.
Sie ist anders, als er sich Amerika vorgestellt hat. Sie ist die erste Amerikanerin, die er kennenlernt, und sie findet alles scheußlich, was er bisher für Amerika hielt. Sie demonstriert gegen Vietnam und raucht Hasch und findet die traurigen kleinen Bungalows mit der Doppelgarage und dem Swimmingpool und der amerikanischen Fahne und dem rauchenden Barbecue-Grill unmöglich. Sie hasst Dean Martin (Macho), Elvis (dick) und Dion DiMucci (Kitsch) – sie ahnt nicht, dass er von genau diesem Amerika immer geträumt hat. Das Chuckberryland. Die Bebopelulanation. Detroit, Memphis, die Motoren, die Bässe: die Rockstaaten von Amerika, James Dean, Lederjacken, Benzin. Mag sie nicht. Nicht einmal Coca-Cola mag sie; sie trinkt nur Tee.
Sie hat noch keine größeren Pleiten erlebt in ihrem Leben. Sie ist neugierig auf alles. Wenn sie redet, verwandelt ihr Gesicht sich in ein einziges Funkeln, als ob unter ihrer Haut winzige elektrische Explosionen stattfänden. Dr. Janischek aus der Radiologie, dem sie zu dieser Zeit ebenfalls begegnete, sagt später, sie habe eine seltsame Euphorie ausgestrahlt, eine Art Leuchten; zu allem habe sie eine entschlossene Meinung gehabt; habe insgesamt an die Menschen geglaubt; habe trotz ihrer Schönheit niemanden eingeschüchtert, sondern die Leute auf eine schwer beschreibbare Art durch ihre bloße Anwesenheit zu den erstaunlichsten Dingen ermutigt. Selbst wer nur kurz mit ihr redete, sagt Janischek, habe einen veränderten Lebensentwurf vor sich aufscheinen sehen und sich selbst in einem glanzvolleren Licht. Manche Leute seien allerdings süchtig nach diesem eigenartigen Effekt geworden und an Phyllis’ Verschwinden fast zugrunde gegangen, auch und besonders der Kollege Bellmann.
Bellmann hatte Mühe, sie zu verstehen. Er sah, dass sich ihr Mund bewegte, hörte ihre Stimme wie ein fernes Echo, den ganz Melodie gewordenen Fluss ihrer Sprache, der ihm nichts mehr sagte, und dann versank er in einem Tagtraum, in dem er sich mit ihr in seinem Mercedes auf der Autobahn irgendwohin fahren sah – stattdessen fuhr er sie nach Hause.
»Sie wohnte nicht allein«, sagt Bellmann, »das war so eine Altbauwohnung, die sie sich mit vier oder fünf anderen teilte.« Sie lud ihn auf einen Tee ein, und während sie, inzwischen barfuß, auf der Stelle wippend, in einem rostbraunen Topf Wasser kochte, tauchten ein paar Männer in der Küche auf. Einer trug einen Vollbart, der nahtlos in sein dichtes Brusthaar überging. Sein Kopf war komplett zugewuchert; nur Augen, Mund und Nase schauten aus dem Dickicht hervor. »Tag«, sagte er zu Bellmann und kratzte sich mit dem rechten Fuß am linken Knie. Alle Menschen in dieser Wohngemeinschaft waren barfuß; Bellmann empfand seine Schuhe plötzlich als unpassende, fast absurde Objekte. Am Küchentisch las einer ein Traktat. »Das ist der schöne Günther, er studiert Soziologie«, flüsterte Phyllis. Kurz darauf saß Bellmann mit einer dunkelbraunen Teetasse neben dem schönen Günther und diskutierte mit ihm über die Verhaftung von Ulrike Meinhof und Gerhard Müller und über Ceylon, das neuerdings Sri Lanka hieß – er wolle dorthin fahren, erklärte Günther, während er sich kompliziert unter der Fußsohle kratzte (es scheint hier eine Art von Fußpilz zu