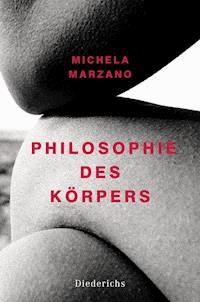23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Als Michela Marzano sich erstmals mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt, fällt sie aus allen Wolken: Sie stellt fest, dass ihr Großvater, nach gern bemühter Legende immer schon erklärter Gegner des Faschismus, seinerzeit einer der ersten Unterstützer Mussolinis war. Wie konnte es dazu kommen und welche Auswirkungen hatte diese unausgesprochene politische Prägung auf die nachfolgenden Generationen, auf Michelas strengen, patriarchenhaften Vater und letztlich auch auf sie selbst?
Ein schonungsloses Buch, ebenso persönlich wie politisch - und zugleich ein erhellender Exkurs über die Psychologie der Erinnerung und des Verdrängens, sei es persönlich oder universell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Als Michela Marzano sich erstmals mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt, fällt sie aus allen Wolken: Sie stellt fest, dass ihr Großvater, nach gern bemühter Legende immer schon erklärter Gegner des Faschismus, seinerzeit einer der ersten Unterstützer Mussolinis war. Wie konnte es dazu kommen und welche Auswirkungen hatte diese unausgesprochene politische Prägung auf die nachfolgenden Generationen, auf Michelas strengen, patriarchenhaften Vater und letztlich auch auf sie selbst? Ein schonungsloses Buch, ebenso persönlich wie politisch – und zugleich ein erhellender Exkurs über die Psychologie der Erinnerung und des Verdrängens, sei es persönlich oder universell.
Über die Autorin
Michela Marzano wurde 1970 in Rom geboren. Sie hat in Pisa studiert und lebt seit 1998 in Paris, wo sie an der Université Paris Descartes Moralphilosophie lehrt. Sie schreibt regelmäßig u.a. für La Repubblica und La Stampa und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, auf Deutsch zuletzt »ALLES, WAS ICH ÜBER DIE LIEBE WEISS: PHILOSOPHIE EINES GEFÜHLS«. Mit »STIRPE E VERGOGNA« war sie für den Premio Strega nominiert und erhielt den renommierten Premio Mondello.
Michela Marzano
Falls ichda war,habeichnichtsgesehen
Übersetzung aus demFranzösischen von Lina Robertz
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom
Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Eichborn Verlag
Titel der italienischen Originalausgabe:
»Stirpe e vergogna«
Die französische Fassung erschien unter dem Titel:
»Mon nom est sans mémoire«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by Michela Marzano – Mondadori Libri Spa / Rizzoli
This edition published in agreement with the Proprietor through
MalaTesta Literary Agency, Milan.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Anna Valerius, Köln
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Einbandmotiv: © Michela Marzano
© FinePic®, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4844-5
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
In Erinnerung an Arturo, meinen Großvater.
Aber auch für meinen Vater Ferruccio
und für meinen Bruder Arturo.
Für Jacques, der immer für mich da ist,
und für den kleinen Jacopo.
Und natürlich für Paola, meine liebe Mama.
Ich vergesse nie, dass auch die Vergangenheit im Flussist wie das Heute und dass alles, was einst gelebt hat,immer noch lebendig ist, sich verändert, sich umsetzt,sich bewegt, sich verwandelt, und dass die Wahrheit sichhundertmal am Tag widerspricht wie ein geschwätzigesDienstmädchen – was sie auch ist.
Blaise Cendrars
Erster Teil
Schande
Um wir selbst zu sein, müssen wir uns selbst haben;wir müssen unsere Lebensgeschichte besitzen oder sie,wenn nötig, wieder in Besitz nehmen. Wir müssenuns erinnern – an unsere Geschichte, an uns selbst.
Oliver Sacks
Eine Michela Marzano gibt es nicht. Geburtsurkunde, Reisepass, Personalausweis, Eheurkunde: Alle bescheinigen, dass die Person, die am 20. August 1970 in Rom geboren wurde, Maria Marzano heißt.
»Warum denn Maria?« Ich bin auf der Grundschule, einer privaten Schule, weshalb ich ein Formular ausfüllen muss – eine reine Formalität, aber notwendig, damit die Schuljahre vom Ministerium anerkannt werden – und mein Vater sagt, ich soll mit »Maria« unterschreiben. Meine Eltern nennen mich aber schon immer Michela, genau wie meine Freund:innen und die anderen Kinder in meiner Klasse. Sogar meine Lehrerin sagt Michela. Und jetzt behauptet mein Vater plötzlich, dass ich Maria heiße.
Als mein Vater nach meiner Geburt zum Standesamt ging, um mich anzumelden, ließ er meinen Namen so eintragen: »Maria« Komma »Michela« Komma »Rosa«. Eigentlich sollte ich wohl »Maria Michela« Komma »Rosa« heißen, sodass auf meinen Ausweisen nicht nur der Name Maria stehen würde, den ich zu Ehren der Jungfrau Maria bekam, weil meine Mutter nach langem Warten doch noch schwanger geworden war, sondern auch der Name Michela. Meine Großmutter Rosa nahm es gar nicht gut auf, dass ihr Vorname erst an dritter Stelle kam. »Schluss mit all den Rosas, Rosarias, Rosettas und Rosellas«, hatte mein Vater gesagt, worauf meine Mutter erst »Manuela« vorgeschlagen und meine Eltern sich schließlich auf »Michela« geeinigt hatten. Eine Manuela gab es in der Familie meines Vaters nämlich nicht, dafür aber einen Michele; den Vater meiner Großmutter, Doktor Michele Campo.
Mein Vater ging also zum Standesamt, um mich anzumelden, wurde allerdings von einem Freund begleitet, der ihn überredete, auch zwischen »Maria« und »Michela« ein Komma zu setzen, Doppelnamen würden nur zu Problemen führen. Das Ergebnis: Mein eigentlicher Vorname, Michela, taucht auf keinem offiziellen Dokument auf – der Name, den meine Eltern für mich ausgewählt haben, mit dem mich die Leute ansprechen, der auf meinen Büchern und unter meinen Artikeln steht und bei dessen Klang ich mich auf der Straße umdrehe. »Michela?« – ich bleibe stehen, sehe mich suchend um, halte Ausschau nach der Person, die mich gerufen hat. »Maria?« – ich gehe weiter, ohne innezuhalten, zucke nicht einmal zusammen. Maria? Wer soll das sein?
Das einzige Stück Papier in meinem Besitz, das bestätigt, dass ich nicht nur Maria, sondern auch Michela heiße, ist meine Taufurkunde. Nur mit meiner Taufurkunde bekomme ich bei der Post ein an Michela Marzano adressiertes Einschreiben ausgehändigt, ohne mich deshalb mit den Angestellten streiten zu müssen: »Woher sollen wir wissen, ob Sie diese Michela sind, wenn auf Ihrem Personalausweis Maria steht? Es könnte ja genauso gut Ihre Mutter, Ihre Schwester oder Ihre Tochter sein. Das müssen Sie schon verstehen …«
Doch eine Taufurkunde ist nicht rechtsgültig.
Für den Staat bin ich Maria.
Für den Staat gibt es Michela Marzano nicht.
»Und wie heißt du, Papa?« Ich habe mich dazu überreden lassen, das Dokument für die Schule mit »Maria« zu unterschreiben.
»Na, Ferruccio natürlich. Warum fragst du das?«
»Hast du keinen anderen Namen?«
»Meine Mutter wollte mich auch nach ihrem Vater Michele und ihrem Mann Arturo benennen, aber auf meinen Ausweisen bin ich nur Ferruccio Marzano.«
Als ich vierzig Jahre später in den Schreibtischschubladen meines Vaters krame, stoße ich auf einen Auszug aus dem Taufregister der kleinen Stadt Campi im Süden von Apulien, in der er geboren ist.
Es ist September 2019, knapp drei Wochen sind seit der Geburt von Jacopo, dem Sohn meines Bruders Arturo, vergangen, ich besuche meine Eltern in Rom. Viele Fragen beschäftigen mich, es gibt einiges, worüber ich mir endlich klar werden muss. Vor allem brauche ich Informationen, meine Erinnerung lässt mich im Stich. Die Geburt von Jacopo hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich fühle mich verloren. Warum habe ich keine Kinder bekommen? Auf einmal sind meine zwanzig Jahre Psychoanalyse wie weggeblasen.
Ich lege den Auszug aus dem Taufregister auf mein Bett. Einen Moment lang starre ich das Blatt reglos an. Dann gebe ich mir einen Ruck und vertiefe mich in das alte Dokument und seine schön geschwungene Kalligraphie:
Am sechsundzwanzigsten Dezember des Jahres 1936 wurde das am vierzehnten November 1936 geborene Kind von Arturo Marzano, Sohn von Ferruccio, und Campo Rosetta, Tochter des verstorbenen Michele, Eheleute der Gemeinde Campi, von dem hier unterzeichnenden Gennaro D’Elia, Pfarrer von Santa Maria delle Grazie, Campi, auf den Vornamen Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito getauft. Pate und Patin: Marzano Gino di Ferruccio und Malvani Virginia di Augusto.
Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito. Ich traue meinen Augen nicht. Aber dort steht es schwarz auf weiß: Mein Vater heißt nicht einfach Ferruccio, wie ich immer geglaubt habe. Neben dem Vornamen seines Großvaters mütterlicherseits, Michele, und dem Namen seines eigenen Vaters, Arturo, trägt Papa die Namen Vittorio, wie der damalige König Vittorio Emmanuele III., und Benito, wie Benito Mussolini.
Den Vornamen Vittorio kann ich gerade noch verstehen. Ich weiß, dass mein Großvater Abgeordneter der monarchistischen Partei war. Das gefällt mir zwar nicht unbedingt, trotzdem kann ich es halbwegs akzeptieren. Aber Benito? Das kann nicht sein, das muss ein Missverständnis sein. Warum sollte mein Vater denselben Vornamen haben wie der Duce? Monarchist ist schließlich nicht gleich Faschist.
Außer seiner Schwester, die »Tuccio« sagte, nennen alle meinen Vater immer nur Ferruccio. Ferruccio und nichts weiter, wie es auf seinem Personalausweis und seinem Diplom steht. Für die Studierenden an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität La Sapienza ist er Professor Ferruccio Marzano. Ferruccio heißt er auch auf seiner Eheurkunde und der Abschrift meines Eintrags im Geburtenregister. Überall nur Ferruccio, außer auf dem Taufregisterauszug. Ich versuche, mich selbst zu beruhigen. Vielleicht ist dem Pfarrer bei der Taufe ja ein Fehler unterlaufen. Kurz ziehe ich in Erwägung, nach Lecce zu fahren, um dort in den Archiven nachzuforschen, aber das Semester fängt bald an, ich habe keine Zeit, ich muss zurück nach Paris.
Ein paar Wochen später entdecke ich auf der Website des Archivs der Stadt Lecce, dass ich auch von Paris aus eine Abschrift von Papas Eintrag im Geburtenregister anfordern kann, ich muss dafür nur eine E-Mail an den Direktor schreiben. Ich gebe den Vornamen, den Nachnamen und das Geburtsdatum meines Vaters an, außerdem die Gemeinde, in der er geboren wurde, und bezahle die Kosten für die Fotokopie.
Zehn Tage später landet die Abschrift direkt in meinem Postfach, unter dem Betreff: Protokoll Nr. 3865 – Ferruccio Marzano.
Im Jahr neunzehnhundertsechsunddreißig, am: sechzehnten November, um: neun Uhr fünfunddreißig wurde: Arturo Marzano, Alter: neununddreißig, Staatsanwalt, bei mir: Giuseppe Guarino, im Rathaus vorstellig und teilte mir mit, dass von seiner Frau: Rosa Maria Campo am: vierzehnten November, um: elf Uhr vierzig, im Haus in der Straße: Via Vittorio Emanuele ein Kind mit dem Geschlecht: männlich geboren worden sei, das er mir zeigte und dem er folgende Vornamen gab: Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito.
Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito. Alles nacheinander. Ohne Komma. Genau wie auf dem Auszug aus dem Taufregister. Also müssten Papas Vornamen eigentlich immer zusammen auftauchen. Laut dem italienischen Gesetz kann man einen Vornamen nämlich nur dann weglassen, wenn er durch ein Komma abgetrennt ist. Warum also stehen die anderen Vornamen meines Vaters auf keinem offiziellen Dokument?
»Das ist wirklich merkwürdig«, sagt Jacques, mein Mann, als ich laut darüber nachdenke, was wohl mit den anderen Vornamen meines Vaters passiert ist. Sind sie nach dem Krieg verschwunden? Als die Schrecken des Faschismus ein Ende hatten und 1946 aus der Monarchie eine Republik wurde? Wir sitzen beim Abendessen und ich berichte ihm von meiner Entdeckung.
»Warum weiß ich nichts von den anderen Vornamen meines Vaters? Welches Geheimnis versteckt meine Familie? Was soll die ganze Geschichte?«
Nomen est omen, sagten die Römer:innen, weil sie der Meinung waren, der Name einer Person sage ihr Schicksal voraus. Welches Schicksal verbirgt sich hinter dem Namen meines Vaters? Und was bedeutet das für mein eigenes Schicksal?
Am nächsten Tag nehme ich meine Internetrecherche wieder auf. Nach und nach kommt etwas Licht ins Dunkel. Anscheinend wurden die italienischen Personenstandsbücher im Jahr 1954 umstrukturiert: Lautete die Formulierung in der Geburtsurkunde »dem er folgenden Vornamen gab«, dann durfte man alle seine Vornamen behalten, auch wenn der Name sich aus mehreren zusammensetzte; lautete die Formulierung jedoch »dem er folgende Vornamen gab«, dann fielen der zweite, dritte, vierte oder auch fünfte Vorname weg. Eine seltsame Lösung, die es meinem Vater aber ermöglichte, den mehr als lästigen Namen Benito zusammen mit seinen anderen Vornamen auf wundersame Weise verschwinden zu lassen.
»Siehst du, also doch keine Lügengeschichte«, sagt Jacques augenzwinkernd, nachdem ich ihn auf den neuesten Stand gebracht habe. »Nur das übliche italienische Chaos.« Jacques ist Rechtshistoriker, und da er sich mit der Mafia beschäftigt, kennt er die Geschichte Italiens ziemlich gut.
Trotzdem, die Sache ist komplizierter, als er denkt.
Also nochmal zurück zum Anfang.
Ich bin links und komme aus einer linken Familie, daran gab es nie einen Zweifel. Gut, im Jahr 1953 war mein Großvater Abgeordneter der monarchistischen Partei, aber nur aus Treue zum König und zu den Idealen des Risorgimento. Zu Hause sprachen wir oft darüber, mein Vater betonte gern, dass er sich früh von den Ansichten seines eigenen Vaters distanziert habe und seit seiner Jugend links eingestellt gewesen sei. Als überzeugter Sozialist war er vor dem Skandal der Mani-Pulite-Affäre um Bettino Craxi Wirtschaftsberater der Sozialistischen Partei Italiens. Und als mein Bruder und ich klein waren, brachte er uns die Partisanenlieder bei.
Ich weiß noch, wie mein Bruder Arturo mit fünf Jahren auf der Piazza della Balduina aus Leibeskräften Bandiera rossa sang und meine Mutter ihm schnell den Mund zuhielt und panisch sagte: »Psst, mein Schatz, sonst kriegen wir noch Ärger«. Es waren die »bleiernen Jahre«, und meine Mutter hatte allen Grund, Angst zu haben. Das Viertel in Rom, in dem wir lebten, zog damals viele junge Leute aus dem neofaschistischen Bürgertum an, die keine Hemmungen hatten, die »Linksextremisten« zu verprügeln. Ein paar Jahre später begegnete ich diesen Leuten erneut, im Pio IX, dem privaten Gymnasium, auf das mein Vater uns schickte, damit wir lernten, was harte Arbeit bedeutet. In der Schule war ich die »dreckige Kommunistin«, die in löchrigen Jeans herumlief und sich gegen die »faschistischen Scheißideen« der anderen wehrte, ich nervte und ich war komisch.
Mein Bruder war der, der keinen Fußball mochte und lieber mit den Mädchen spielte. Quér frocio de mmèrda!, »dreckiger Homo«, nannten ihn manche seiner Klassenkamerad:innen im römischen Dialekt. Was würden sie wohl sagen, wenn sie wüssten, dass auf der Geburtsurkunde unseres Vaters der Vorname ihres geliebten Benito steht?
Neuerdings behauptet mein Vater, er habe immer gewusst, dass er auch Benito heiße, und es nie geleugnet. Soweit ich weiß, war davon zu Hause aber nie die Rede.
Vielleicht erinnere ich mich nur nicht?
Handelt es sich bei der ganzen Sache um ein Familiengeheimnis oder habe ich der Bequemlichkeit halber jede Erinnerung daran aus meinem Gedächtnis gelöscht, um mich nicht mit dieser unangenehmen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen?
Jacopos Taufe soll Ende November in Pisa stattfinden. Ich komme einen Tag früher aus Paris, um ein bisschen mehr Zeit mit meinem Neffen zu haben. Weil meine Eltern bei meinem Bruder schlafen und in seinem Haus nicht auch noch für mich Platz ist, gehe ich ins Hotel. Seit ich dauernd durch ganz Italien reise, sind mir Hotels unerträglich geworden. Entweder ist es in den Zimmern zu kalt oder das Bett ist zu klein oder es ist zu laut oder die Fensterläden schließen nicht richtig, sodass morgens um sechs das Sonnenlicht hereinscheint oder, oder, oder. Ich kann mich mit Melatonin und Anxiolytika vollpumpen, soviel ich will – ich schlafe schlecht. Egal, sage ich mir, als ich im Hotel ankomme, es ist ja nicht für lang. Ich stelle mein Gepäck ab und mache mich so schnell wie möglich auf den Weg zu Arturo. Bestimmt ist Jacopo seit meinem letzten Besuch schon wieder ordentlich gewachsen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich ihn das erste Mal im Arm gehalten habe. »Hallo, mein Schatz«, flüsterte ich ihm ins Ohr. Sofort biss ich mir auf die Zunge und korrigierte mich. »So ein süßer Schatz«, sagte ich laut und musste schlucken. »Wie niedlich.« Doch insgeheim ballte ich die Hände zur Faust. Zum Glück hatte niemand etwas bemerkt.
Ich begrüße kurz meine Eltern, wasche mir die Hände und binde meine Haare zusammen. Doch kaum habe ich Jacopo auf dem Arm, protestiert mein Vater: »Pass auf seinen Kopf auf, Michela, ich bitte dich.«
Ich ignoriere ihn.
Doch dann wendet sich mein Vater an meinen Bruder: »Arturo, der Kleine weint, nimm du ihn doch bitte.«
Wieder ignoriere ich ihn.
Doch dann höre ich, wie mein Vater meine Mutter anfährt: »Michela weiß nicht, wie das geht, tu doch etwas, steh nicht so tatenlos herum!«
Jetzt kann ich ihn nicht länger ignorieren – und fühle mich plötzlich in meine Jugend zurückversetzt, in die Zeit, als ich mich auf die Aufnahmeprüfung für die Scuola Normale Superiore in Pisa vorbereitete. Eines Abends, als ich gerade ins Bett gehen will, höre ich, wie mein Vater flüsternd zu meiner Mutter sagt: »Mag ja sein, dass sie hart arbeitet, aber sie wird es nicht schaffen, sie hat nicht das Zeug dazu, die anderen sind einfach klüger als sie.«
Als ich abends ins Hotel zurückkehre, bin ich noch immer aufgewühlt und nervös. Ich nehme eine Dreivierteltablette Lexomil, rufe Jacques an und jammere ihm mindestens eine Stunde lang die Ohren voll. Aber es hilft alles nichts. Trotz Lexomil und der mehr oder weniger aufmunternden Worte von Jacques, der nicht versteht, was ich meinem Vater eigentlich vorwerfe, schaffe ich es nicht, mich zu beruhigen.
Irgendwann falle ich in einen leichten Schlaf.
Dann habe ich einen Albtraum, der meiner Nacht endgültig ein Ende bereitet. Ich sitze im Zug. Als ich glaube, an meinem Ziel angekommen zu sein, steige ich aus, doch auf dem Gleis muss ich feststellen, dass ich am falschen Bahnhof bin. Ich verstehe nicht, was los ist, normalerweise passiert mir so etwas nicht. Ich bin vollkommen orientierungslos, und nachdem ich ein paar Minuten reglos am Gleis verharrt habe, suche ich im Bahnhof nach Hinweisen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nicht einmal, wo ich hinwollte. Es ist mitten in der Nacht und ich sehe niemanden, der mir helfen könnte. Während ich in der Unterführung herumirre, höre ich plötzlich, dass mein Zug an Gleis acht angesagt wird. Ich stürze auf die Treppe zu, nehme mehrere Stufen auf einmal. Ich stolpere, rappele mich wieder auf. Falle hin. Und als ich endlich auf dem Gleis ankomme, ist es zu spät: Die Türen des Zuges schließen sich, und obwohl ich renne, renne, renne, fährt der Zug ab und wird schnell kleiner und kleiner.
Schweißüberströmt schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Vor meinem inneren Auge sehe ich noch immer das Bild des Zuges, der am Horizont verschwindet, und ich weiß, dass es nicht nur der Zug ist, den ich verpasst habe.
Mit meinem fünfzigsten Lebensjahr haben auch die Wechseljahre begonnen: Ich bin reizbar, schlafe schlecht, habe Hitzewallungen. Und dann bin ich dauernd so erschöpft. Das liegt am geringeren Östrogengehalt, erklärt mir meine Gynäkologin. Doch die medizinischen Erläuterungen und die Hormonersatzbehandlung helfen mir herzlich wenig. Das Problem sind nicht die Gewichtszunahme, die Kopfschmerzen oder die Vaginalbeschwerden. Mein Problem ist, dass es jetzt endgültig zu spät ist.
Ich habe ein besonders empfindliches Unterbewusstsein. Das hat auch meine Therapeutin gesagt, als ich vor ein paar Jahren einmal die Woche bei ihr im Büro aufkreuzte, um mich auf dem Diwan auszustrecken und ihr von meinen Träumen zu erzählen. Nur selten brauchte ich ihre Hilfe, um den Sinn eines Albtraums zu deuten; mein Unterbewusstsein war schon immer ein offenes Buch. Es ist also auch nicht gerade schwer zu erraten, dass der langsam in der Dunkelheit der Nacht verschwindende Zug ein Symbol für all die verpassten Chancen ist – würde ich einen Roman schreiben, könnte man mir vorwerfen, dass das Bild abgedroschen ist oder zu eindeutig, dass ich mir mehr Mühe geben könnte, um den Verlust sprachlich darzustellen, aber ich schreibe nun mal keinen Roman. Und in dem Albtraum aus der Nacht vor Jacopos Taufe habe ich genau das gesehen: einen Zug, der ohne mich abfährt, genau wie das Leben.
Wenn ich mir als Kind oder Jugendliche meine Zukunft ausgemalt habe, dann immer als Mutter, wie alle meine Freundinnen. Natürlich würde ich einmal Kinder haben. Wie könnte es anders sein? Damals, als ich noch zur Schule ging, verbrachte ich die Nachmittage mit der Nase in meinen Büchern und Heften, die Lehrerin würde schon merken, dass ich die Beste war, wenn ich mich nur anstrengte und meine Zeit nicht mit Klamotten und anderen Banalitäten verschwendete wie meine Mutter. »Ich bin nicht wie sie, Papa, glaub mir, ich werde dich nicht enttäuschen, versprochen«. Dann kamen die Jahre an der Scuola Normale Superiore in Pisa, eine Prüfung nach der anderen, bis zur Promotion. Dann zwanzig Jahre Psychoanalyse. »Glauben Sie, dass ich irgendwann eine Familie haben werde, dass auch ich Mutter sein kann?« Nie habe ich aufgehört, daran zu glauben. Ich musste nur Geduld haben. Die Dinge nicht überstürzen.
Als ich klein war, bin ich nachts oft schreiend aufgewacht. Ich hatte immer wieder den gleichen Albtraum. Darin kam mein Vater vor. Und ich. Wir stritten uns. Jedes Mal erwachte ich mit dem gleichen Schrei auf den Lippen: »Nein!« Wie oft ich am Tag »Nein« sagen wollte, aber es nicht schaffte, weil mein Vater stur auf seinem Standpunkt beharrte. Er ließ und ließ und ließ einfach nicht locker, bis ich irgendwann nicht anders konnte als klein beizugeben. Mein Vater musste immer das erste und letzte Wort haben. Ihm zu widersprechen war sinnlos. Selbst wenn er im Unrecht war, hatte er recht. Ich brauchte zwanzig Jahre Psychoanalyse, um zu verstehen, dass sich die Dinge niemals ändern werden, dass es an mir ist, nicht mehr auf die Bestätigung meines Vaters zu warten, und ihm selbst dann zuzustimmen, wenn er falschliegt.
Zwei verschiedene, eigenständige Leben. Wenn ich unabhängig werden und mich nicht länger sinnlos abmühen wollte wie eine Fliege, die unter einem Glas gefangen ist, dann musste ich mich damit abfinden, dass ich von meinem Vater niemals bekommen würde, worauf ich seit Ewigkeiten vergebens wartete. Es war Zeit, nach vorn schauen.
Warum konnte ich ihn an diesem Nachmittag nicht einfach ignorieren? Woher kam die riesige Wut, die in mir aufstieg, als er sagte: »Michela weiß nicht, wie das geht«? Und warum halten mich diese Gedanken vom Schlafen ab? Wer hat das Glas wieder über mich gestülpt und mich darin eingesperrt?
Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben, dass auch ich irgendwann Mutter werden würde.
Ich musste nur Geduld haben. Die Dinge nicht überstürzen.
Doch dann haben sich die Dinge von ganz allein überstürzt.
Mein Vater hört nicht auf, mich vor Promezio, dem Philippiner, der seit ein paar Jahren bei meinen Eltern putzt, Onorevole zu nennen. Ich habe ihm schon mehrmals gesagt, dass er damit aufhören soll, auch als ich tatsächlich noch Abgeordnete war. »Warum willst du unbedingt, dass die Leute mich mit meinem Titel ansprechen, Papa, das ist doch völliger Unsinn.« Heute ergibt es noch viel weniger Sinn als damals, weil ich mich schließlich gegen die Politik und für mein vorheriges Leben entschieden habe. Ich stelle mich ja auch nicht als Universitätsprofessorin vor, obwohl das meine Arbeit ist – ich bin Michela, sonst nichts, und das ist auch gut so. Außerdem bin ich sowieso grundsätzlich fürs Duzen …
Als ich klein war, habe ich mich dafür geschämt, dass mein Vater immer irgendeine Gelegenheit fand, zu erwähnen, dass er Professor war. In Italien ist das zwar nach wie vor ein prestigeträchtiger Titel, aber mein Vater verwendete ihn selbst dann, wenn es überhaupt keinen Grund dazu gab.
Einmal waren wir in den Ferien in Südtirol und Papa wollte mit uns nach Österreich fahren. Der Grenzbeamte sagte, der Personalausweis meines Vaters sei abgelaufen und er könne uns nicht einreisen lassen. Mein Vater reagierte überrascht: »Aber ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität La Sapienza in Rom«, sagte er stolz. Warum muss er jetzt wieder davon anfangen, dachte ich und wurde rot. Warum muss er uns alle dauernd blamieren? Der Grenzbeamte verzog keine Miene und sagte: »Ich verstehe, Herr Professor, aber deshalb kann ich Sie trotzdem nicht passieren lassen.«
»Das ist eine Frage der Generation«, meint Jacques, als ich ihm davon erzähle. »Damals hatten Titel noch einen anderen Stellenwert.« Aber ist es im Falle meines Vaters wirklich nur eine Frage der Generation?
Meine Mutter hatte es geschafft, meinen Vater zu einem Besuch beim Kardiologen zu überreden: »Nur ein Kontrolltermin, Ferruccio, du bist über achtzig, meinst du nicht, du solltest dich mal untersuchen lassen?« Mein Vater zögerte die Sache immer wieder hinaus, aber irgendwann gab er nach. Bevor die Ärztin meinen Vater abhörte, fragte sie ihn nach seinem Namen. »Haben Sie Marzano gesagt? Wie Michela Marzano?«
Meine Mutter konnte sich nicht verkneifen zu sagen: »Das ist meine Tochter! Kennen Sie sie?«
»Ich lese jedes Wort von ihr.«
Meine Mutter war gerührt. Ja, Michela, das war ihre liebe Tochter. Mein Vater dagegen schwieg verärgert. Dann sagte er: »Ich schreibe auch. Ich bin Universitätsprofessor.«
Mitglied der National-Faschistischen Partei seit: 15. 05. 1919
Mit meinem Handy habe ich Fotos von Großvaters Parteibuch gemacht, bevor ich den Schaukasten mit den Kriegsauszeichnungen an seinen Platz zurückstellte. In Paris habe ich die Fotos ausgedruckt und in die Mappe gesteckt, in der ich Zeitungsartikel, Dokumente, Schmierpapier und Notizen aufbewahre.
Ich habe lange überlegt, bevor ich beschlossen habe, ein Buch über die Geschichte meines Großvaters und meiner Familie zu schreiben. Es scheint mir die einzige Möglichkeit, mit meiner Vergangenheit ins Reine zu kommen, die Puzzleteile meines Lebens zusammenzusetzen. Aber seit fast zwei Wochen sitze ich nun, wenn ich von der Uni nach Hause komme, tatenlos und ohne irgendwas zu schreiben vor der geöffneten Mappe und starre auf die Fotos und Notizen. Ich bleibe an dem Datum hängen, an dem mein Großvater der faschistischen Partei beigetreten ist, dem 15. Mai 1919. Was hat ihn nur zu dieser Entscheidung bewogen?
An jenem Tag ist der Krieg seit etwa sechs Monaten vorbei, vor genau vierundfünfzig Tagen hat Mussolini in Mailand seine Partei gegründet. Der Duce wird von einem tief verwurzelten Hass auf die Regierung und den Bolschewismus angetrieben, er will das politische Klima der Kriegsjahre bewahren. Doch als er am 23. März 1919 im Saal des Industrie- und Handelsverbands auf der Piazza San Sepolcro seine Kampfbünde gründet, sind nur eine Handvoll Leute zugegen. »Niemals würden die Italiener die Dummheit der Regierung unterstützen und die Sabotage des Friedens riskieren«, schreibt Mussolini in der von ihm gegründeten Zeitung Il Popolo d’Italia. »Nein, wir nehmen es uns heraus, Aristokraten und Demokraten zu sein, Konservative und Progressive, Reaktionäre und Revolutionäre, Legalisten und Illegalisten, je nach dem jeweiligen Kontext, je nach den Umständen, unter denen wir handeln, und dem Ort, an dem wir leben. Jawohl!«
Im Laufe des Frühjahrs 1919 bemüht sich die liberale Regierung Italiens vergeblich, die wachsende Unzufriedenheit der Kriegsheimkehrer und die Erwartungen des Kleinbürgertums und des gehobenen Mittelstands einzudämmen. Trotzdem laufen die Dinge nicht so, wie Mussolini gehofft hatte. Er war sich sicher gewesen, endlich freie Bahn zu haben, doch seiner Partei gelingt der Durchbruch noch immer nicht. Am 31. Dezember 1919 hat sie gerade mal 870 unglückselige Mitglieder. Darunter auch mein Großvater.
Mitglied in der National-Faschistischen Partei seit: 15. 05. 1919
Was wollte Großvater in diesem verzweifelten Haufen aus Faschist:innen der ersten Stunde? Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was mag in seinem Kopf vorgegangen sein? Hatte seine Entscheidung, der faschistischen Partei beizutreten, vielleicht ein anderes, ein persönliches Motiv, richtete er sich damit gegen jemanden? Eigentlich kann sich von den absurden Reden des Duce doch nur blenden lassen, wer eine große Wut in sich trägt, oder? Und Großvater war im Krieg gewesen, er bekam die Nachwirkungen am eigenen Leib zu spüren. Aber warum ausgerechnet er, warum gehörte er von all den Kriegsheimkehrern zu den wenigen, die der faschistischen Bewegung von Anfang an folgten? Steckte der Wunsch nach sozialem Aufstieg dahinter? Die Schande seiner Herkunft? Wollte er sich von seinen Wurzeln lossagen? War es Unzufriedenheit? Ehrgeiz? Rachsucht?
Es gelingt mir nicht, diese Gedanken beiseitezuschieben und zu schreiben. Jeden Abend fahre ich meinen Computer hoch, öffne den Ordner mit dem Namen »Meine Geschichte«, lese, was ich geschrieben habe, ändere ein Komma, ein Wort, einen Satz. Dann betrachte ich wieder die Fotos von Großvaters Parteibuch, das Beitrittsdatum – und sofort ist die Schreibblockade wieder da.
Ich habe keine Antworten auf die Fragen, die auf mich einstürzen. Es gibt weder Briefe noch Fotos, geschweige denn Tagebucheinträge. Ich habe nichts. Niemand kann mir helfen. Die Zeit scheint jede Spur verwischt zu haben. Ich muss mich wohl oder übel damit abfinden, dass mein Vater anscheinend nie versucht hat, mehr über Großvaters faschistische Vergangenheit herauszufinden. Und damit, dass ich keine einzige Seite zustande bringen werde, selbst wenn ich immer wieder beharrlich meinen Ordner öffne.
»Denk dir etwas aus«, rät mir Jacques. »Lass deiner Fantasie freien Lauf.«
»Aber das ist doch kein Roman! Es ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Familie. Mich interessiert die Wahrheit.«
»Hast du nicht selbst gesagt, dass die historische und die persönliche Wahrheit oft meilenweit auseinanderliegen?«
Vor zwei oder drei Jahren geisterte mir ein paar Monate lang die Idee durch den Kopf, einen Roman über Simone Touseau zu schreiben, die »Geschorene von Chartres«. Als ihr am 16. August 1944 die Haare abrasiert wurden, war sie gerade mal dreiundzwanzig Jahre alt. Das berühmte Foto von Robert Capa zeigt sie mit ihrer Tochter Catherine auf dem Arm, umgeben von Männern, Frauen und Kindern, die sie anschreien, sie verhöhnen, Steine nach ihr werfen. Wer war diese Frau wirklich? Und was ist aus ihrer Tochter geworden?
Ich hatte vor, zu erzählen, wie sich Simone nach und nach aufgab, wie der Alkohol und die Depressionen sie umbrachten, während sie hartnäckig alle Vorwürfe von sich wies: Ja, sie war die Geliebte von Erich Göz gewesen, dem Vater ihres Kindes; ja, sie hatte einen Deutschen geliebt; aber nein, ihre Nachbarn hatte sie nicht verraten. Ich wollte Simones Tochter Catherine zu Wort kommen lassen, in der ersten Person – offenbar hatte Catherine eines Tages beschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu versuchen, und anscheinend hatte sie ihren Kindern nie erzählt, was ihrer Mutter widerfahren war.
Ich hatte schon mit den Recherchen begonnen, verschiedene Archive besucht und jede Menge Notizen gemacht. Doch dann ließ ich von einem Tag auf den anderen alles fallen. Mir war klar geworden, dass ich nicht das Recht dazu hatte, diese Geschichte zu erzählen. Selbst mit anderen Namen, selbst wenn ich meine Geschichte daraus machte – ich würde Simone und ihrer Tochter unrecht tun. Jeder Autor, jede Autorin weiß, dass ein Buch immer auch der Versuch ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen, dass man sich mit den eigenen Dämonen konfrontiert, die eigene Angst und Scham in das Erzählte projiziert. Können wir uns anmaßen, das Leben einer anderen Person als Inspiration zu nutzen, einer Person, die noch dazu tot ist und ihre eigene Sicht auf die Dinge nicht mehr schildern, und, wenn nötig, ihre Ehre verteidigen kann?
Aber darf ich dann die Geschichte meines Großvaters erzählen? Was ist seine Sicht auf die Dinge? Wer könnte sein Vermächtnis verteidigen und seinen Namen reinwaschen, wenn ihn seine eigene Enkelin in den Dreck zieht, ihn verrät? Was habe ich mir dabei gedacht, als ich die ersten Seiten dieses Buches schrieb? Dass ich die Vergangenheit meines Großvaters objektiv erzählen und die Puzzleteile nach und nach zusammensetzen, nur vielleicht das eine oder andere Detail korrigieren würde, weil man sich ja in einem Roman alles erlauben darf? Nein, das war nicht meine Absicht. Niemand hatte mir die Erlaubnis gegeben, diese Geschichte zu schreiben. Konnte ich sie mir selbst erteilen? Oder war ich so naiv gewesen, zu glauben, dass sich die Wahrheit von ganz allein schreiben würde, dass ich die einzelnen Elemente nur zusammenzufügen brauchte? Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Mitglied in der National-Faschistischen Partei seit: 15. 05. 1919
Mein Großvater war einer der ersten Faschisten gewesen.