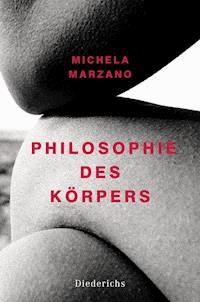23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Anna, Italienerin und in Paris lebend, arbeitet als Journalistin beim Radio und unterrichtet parallel an der Uni. In den Nachwehen von #MeToo beginnt sie, über ihre eigenen Erfahrungen mit Machtverhältnissen und Sexualität nachzudenken, und darüber, was dies mit ihrem anerzogenen Rollenverständnis als Frau zu tun haben könnte.
So brillant wie zugänglich geschrieben, hält dieser Roman keine einfachen Antworten bereit. Stattdessen stellt er viele kluge Fragen, denen es gelingt, ein inzwischen allgegenwärtiges Thema unkonventionell und aus ethischer Perspektive zu beleuchten - und so auch den Leser:innen erhellende neue Perspektiven aufzuzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatERSTER TEILZitat123456789101112131415161718192021222324ZWEITER TEILZitat12345678910111213141516171819202122232425DRITTER TEILZitat123456789101112131415161718192021222324DANKSAGUNGANMERKUNG DER AUTORINZITATNACHWEISEÜber dieses Buch
Anna, Italienerin und in Paris lebend, arbeitet als Journalistin beim Radio und unterrichtet parallel an der Uni. In den Nachwehen von #MeToo beginnt sie, über ihre eigenen Erfahrungen mit Machtverhältnissen und Sexualität nachzudenken, und darüber, was dies mit ihrem anerzogenen Rollenverständnis als Frau zu tun haben könnte.
So brillant wie zugänglich geschrieben, hält dieser Roman keine einfachen Antworten bereit. Stattdessen stellt er viele kluge Fragen, denen es gelingt, ein inzwischen allgegenwärtiges Thema unkonventionell und aus ethischer Perspektive zu beleuchten – und so auch den Leser:innen erhellende neue Perspektiven aufzuzeigen.
Über die Autorin
Michela Marzano wurde 1970 in Rom geboren. Sie hat in Pisa studiert und lebt seit 1998 in Paris, wo sie an der Université Paris Descartes Moralphilosophie lehrt. Sie schreibt regelmäßig u.a. für La Repubblica und La Stampa und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, auf Deutsch zuletzt »ALLES, WAS ICH ÜBER DIE LIEBE WEISS: PHILOSOPHIE EINES GEFÜHLS«. Mit »STIRPE E VERGOGNA« war sie für den Premio Strega nominiert und erhielt den renommierten Premio Mondello.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der italienischen Originalausgabe:»Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Michela Marzano – Mondadori Libri Spa/Rizzoli
This edition published in agreement with the Proprietor through
MalaTesta Literary Agency, Milan.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Lektorat: Anna Valerius, Köln
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde nach einem Design von:
Illustration: © Diego Fernandez; Designer: Laura Dal Maso/theWorldofDOT
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6460-5
eichborn.de
Für alle, die glauben, alles hat seine Zeit, Zerreißen und Flicken, Schweigen und Sprechen, Lieben und Hassen. Dieses Buch ist für euch.
Wo nichts am rechten Platz liegt, da ist Unordnung. Wo am rechten Platz nichts liegt, ist Ordnung.
BERTOLT BRECHT
ERSTER TEIL
#QuellaVoltaChe
Welche Worte fehlen euch noch? Was wollt ihr sagen? Wie sieht sie aus, die Tyrannei, deren Zumutungen ihr täglich aufs Neue schluckt und die ihr zu verinnerlichen versucht, bis sie euch, noch immer schweigend, krankmacht und tötet?
AUDRE LORDE
1
Ich heiße Anna: kein H am Anfang, keins am Ende, einfach nur AN-NA, so einfach, dass man es von hinten wie von vorn lesen kann, ohne dass sich etwas ändert. Aber schweifen wir nicht ab, ich heiße also Anna, und was Sie hier vor sich haben, ist meine Geschichte. Die wahre Geschichte, darum erwarten Sie keine unbeschwerte Kindheit oder glückliche Ehe, denn so ist das Leben nicht; Romane, die sind vielleicht so, aber das hier ist kein Roman. Wobei. Jedes Leben ist irgendwie auch ein Roman, aber die Schreibenden beschönigen ihn, schleifen die Ecken und Kanten ab. Das hier ist die wahre Geschichte von Anna, die beschlossen hat zu sagen, dass sie die Nase voll hat.
Früher oder später kommt man an den Punkt, an dem man Klarheit schaffen muss, und zumindest für mich ist dieser Punkt jetzt da. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich auf die fünfzig zugehe, oder daran, dass Frauen seit einigen Jahren »freier sprechen«, wie man hier in Frankreich sagt, auch wenn die Freiheit noch in weiter Ferne liegt – aber immerhin versuchen sie es! Oder auch nicht, wer weiß das schon so genau. Der Punkt ist: Für mich ist es so weit, egal, welche Konsequenzen das hat, und sogar egal, was er davon hält. Ohnehin tue ich es ja auch für ihn, auch in der Liebe muss man früher oder später alles auf eine Karte setzen.
Obwohl wir schon seit fünfzehn Jahren zusammenleben, hat er noch immer keine Ahnung, wie ich wirklich bin, hat es womöglich nie auch nur geahnt, denkt vielleicht bloß, ich sei schräg, aber das ist ja nicht schlimm, eine Journalistin darf ruhig schräg sein. Und ich bin müde, das weiß er dann doch, jede Woche placke ich mich ab, im Funkhaus, bei Reportagen, auf Dienstreisen, fast bis zum Kollaps, so stark ich auch sein mag, denn ja, diese Anna, die ist zäh, die lässt sich nicht unterkriegen, wenn die umfällt, steht sie sofort wieder auf!
Seien wir ehrlich: Er liebt mich. Wobei.
Er liebt die »Frau mit Eiern in der Hose«, obwohl er das nie so ausdrücken würde – und ich eigentlich auch nicht, schließlich leben wir ja nicht mehr in den Achtzigern, als die Frauen im Namen der Gleichheit noch die Männer nachgeahmt haben.
Doch auch wenn er sich gewisse Begriffe verkneift, liebt er nun mal Anna, die Starke: die Anna, die tapfer zur Arbeit geht, obwohl er sie am Abend zuvor noch aus der Notaufnahme abgeholt hat, aber so ist sie eben, ein bisschen schräg. Als er sie zum ersten Mal gesehen hat, war sie im Fernsehen, und alle droschen auf sie ein. Was hat denn diese Trulla bloß für ein Problem mit Pornos? Noch nie was von sexueller Befreiung gehört, oder was? Und Anna ist standhaft geblieben, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wobei. Hinterher, in der U-Bahn, da sind mir schon die Tränen gekommen, aber die hat er nicht gesehen, vor der Kamera war gar nichts, da habe ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin standhaft geblieben.
Seien wir ehrlich: Nicht mal er weiß, wie kaputt ich innerlich bin.
Er hat keinen Schimmer, dass ich, als die mich im Fernsehen als arme Irre von vorgestern abgestempelt haben, gerade in einer Affäre mit einem verheirateten Mann steckte: Jedes Wochenende wie auf Kohlen auf ein Lebenszeichen warten, Trost-Sex mit Fremden, wie schaffen die anderen das bloß, dass sie immer respektiert werden?
Seien wir ehrlich: Mit Scham lebt es sich leichter, wenn man sich schon in der Kindheit dagegen wehrt, als wenn man sich fügt und den Krieg von Anfang an gegen sich selbst führt – ach, wie schön wäre das gewesen, wenn ich ein dickeres Fell gehabt hätte, wenn alles an mir abgeprallt wäre wie an ihm oder an meiner Mutter. Aber was soll ich dagegen tun, dass ich nun mal ein Schwamm bin? Was soll ich tun, wenn ich nicht die bin, für die man mich hält, wenn tief in mir diese Stimme schreit, die ich immer sofort unterdrücke, weil es, sobald ich die Wut doch mal rausließe, jede Menge Tote und Verletzte gäbe?
Aber jetzt: Runter mit der Maske! Schluss mit Lügen, Schluss mit den Märchen, jetzt wird sie endlich erzählt, diese Geschichte, die ich schon so viele Jahre unter den Teppich kehre, obwohl ich nachts manchmal schweißgebadet aufwache und dann den ganzen Tag im Bett bleibe, nein, heute nicht, heute geht gar nichts, kannst du dich bitte drum kümmern? Einkaufen, Putzhilfe, Rechnungen, Blumen gießen, ich pack das heute nicht, ich hab Kopfweh, mir ist schlecht, du weißt doch, wie das bei mir ist, wenn ich meine Tage habe.
Runter mit der Maske. Ich bin nicht immer nur nett und vernünftig. Wobei.
Nett und vernünftig bin ich schon, und wenn ich mir Mühe gebe, bekomme ich sogar ganz brauchbare Ratschläge hin.
Aber ich bin auch verlogen. Kaputt. Und schuldig.
Zum Beispiel, wenn ich ihnen gegenüber nachgebe. Was nicht dasselbe ist wie einwilligen. Aber wann und wie erklärt man sich tatsächlich einverstanden? Wie lernt man das?
2
Stellen Sie sich ein elfjähriges Mädchen vor.
Einen roten Haarreif und eine Hose mit Schottenkaros.
Es ist 1985, und Anna ist in der Schule: erste Reihe, Tintenkleckse auf den Fingern, die Ohren gespitzt, während der Mathematiklehrer die Mengenlehre erklärt.
Der Lehrer ist so um die vierzig. Er wendet der Klasse den Rücken zu, hat eine Hand in der Tasche vergraben und schreibt mit der anderen an die Tafel: A ⊂ B.
Kann mir jemand sagen, was das Zeichen zwischen dem A und dem B bedeutet?, fragt er die Klasse und dreht sich um. Langsam geht er durch die Reihen, dann macht er kehrt, geht zurück zum Pult, stellt einen Fuß auf das Podest und sieht die Kinder herausfordernd an.
Schweigen.
Der Lehrer setzt ein sarkastisches Schlaumeiergrinsen auf: Wisst ihr das nicht, weil ihr selber zu unfähig seid, oder weil eure Grundschullehrerin unfähig war?
Stellen sie sich vor, wie der Mann noch einen Augenblick abwartet und schließlich genervt herunterbetet: A ist Teilmenge von B, folglich gehören alle Elemente der Menge A gleichzeitig zur Menge B. Fragen?
Schweigen.
Gut. Wer kann mir dafür jetzt ein Beispiel geben?
Schweigen.
Wie viele von euch bilden die Teilmenge »unfähig« der Menge »Klasse«? Die Lehreraugen blitzen.
Stellen Sie sich vor, wie er erneut durch die Reihen geht, einem Schüler nach dem anderen direkt in die Augen sieht – nur den Jungs, die Mädchen ignoriert er –, dann aber plötzlich vor einer Brünetten stehen bleibt und sie zur Tafel schickt. Und wie er ihr, kaum dass sie aufgestanden ist, mit schräg gelegtem Kopf hinterherschaut.
Stellen Sie sich vor, wie Anna aufatmet: Schwein gehabt, heute hätte ihr das gar nicht gepasst, so rot zu werden wie Federica jetzt, Professore Donnos Blick ist allen Mädchen unangenehm, wieso glotzt der sie bloß immer so an? Einmal, in der Pause, hat Anna das Francesca gefragt, von der Federica allerdings meint, dass Donno sie sowieso nie anschaut: Francesca hat eine Zahnspange, darum lässt er sie in Ruhe.
Stellen Sie sich vor, wie Donno auf seinem Stuhl sitzt und die Klasse auffordert, die Biologiebücher aufzuschlagen.
Stellen Sie sich vor, wie er das elfjährige Mädchen jetzt, wo alle die Nasen in das Kapitel über Zelltheorie stecken, ans Pult ruft und sie bittet, einen Abschnitt vorzulesen. Und wie Anna gehorcht, wie sie direkt neben dem Lehrer steht.
Stellen Sie sich vor, wie sie liest: »Die Zelltheorie besagt, dass der Unterschied zwischen Lebewesen und unbelebten Dingen in der Existenz von Zellen besteht.«
Stellen Sie sich vor, wie der Lehrer dem kleinen Mädchen langsam die Hand in die Hosentasche schiebt.
Stellen Sie sich vor, wie Anna dabei »Leberwesen« liest statt »Lebewesen«.
Stellen Sie sich vor, wie die Klasse in Gelächter ausbricht.
3
Schon als Kind hatte ich das Bedürfnis, mich schön zu fühlen. Wobei. Nicht unbedingt schön, aber sexy. Wobei. Nicht unbedingt sexy, aber imstande zu verführen. Genau: verführerisch. Wobei.
Es gab auch lange Phasen, in denen ich versucht habe, mich unsichtbar zu machen, in denen ich nach meinem Können beurteilt werden wollte, das sagte ich mir zumindest oft als Jugendliche: Zeig, was du kannst!, ganz wie es meine Mutter predigte, die womöglich bereute, dass sie nicht mehr arbeiten ging, auch wenn sie das nie so sagte. Hör nicht auf die anderen, Anna!, mahnte sie immer, hör lieber auf deine Mutter, die meint’s gut mit dir, nur auf deinen Kopf kommt’s an, darauf, was du denkst und tust.
Es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich wirklich an Gleichberechtigung geglaubt habe. An eine Gleichberechtigung, die unabhängig vom Geschlecht entlohnt, die sich weder für Make-up noch für lange Beine interessiert und der egal ist, ob man leicht zu haben ist oder auf seinen Ruf achtet – an eine Gleichberechtigung, die Äußerlichkeiten ignoriert und Männer und Frauen auf dieselbe Stufe stellt.
Es gab lange Phasen, in denen ich den ganzen Tag gebüffelt habe, denn nur so bringt man’s zu was im Leben, Töchterchen, also ab auf deine vier Buchstaben und ran an die Bücher!
So Phasen eben.
Bis ich mich dann Hals über Kopf in das Bedürfnis gestürzt habe, gesehen und gehört zu werden – tja, Mama, nichts zu machen, ich bin nun mal verkorkst zur Welt gekommen. Wobei. Bin ich das? Oder bin ich erst dazu geworden? Bin ich schuldig oder unschuldig?
Heutzutage ist die Unschuldsvermutung groß in Mode, und davon sollte doch auch ich was haben. Trotzdem: Wieso hat Donno ausgerechnet mich ans Pult gerufen? Warum sind manche Dinge mir ständig passiert und meiner Mutter nie?
Wenn es etwas gibt, das meine Mutter seit jeher charakterisiert, dann, dass sie sich nie auch nur den kleinsten Fehltritt leistet. Niemand würde jemals auch nur ansatzweise glauben, etwas in ihr könnte zu Bruch gehen, es gäbe da irgendwo einen Knacks, einen Sprung, eine Möglichkeit, in ihre Rüstung einzudringen. Bei mir war das Gegenteil der Fall, ich bestand bloß aus Rissen und Sprüngen, und jeder konnte jederzeit hinein, wieso war meine Mutter immer so perfekt und ich so ein Totalausfall? Was habe ich falsch gemacht, Mama?
Natürlich habe ich sie das niemals in echt gefragt. Als hätte ich meiner Mutter je erzählt, wie der Friseur – ihr Friseur, Alberto, zu dem sie schon seit Jahren ging, weil er »der allerbeste« war – mir ins Ohr geflüstert hatte, ich sei sexy, und wie ich knallrot anlief, zu ihr rüberlinste, nein, sie hatte zum Glück nichts bemerkt, dabei hatte ich diesmal wirklich nichts gemacht. Du bist jetzt dreizehn, Anna, hatte sie gesagt, da kannst du nicht mehr so zerzaust rumlaufen, Alberto kriegt das hin, wirst sehen, der kennt sich aus. Aber womit kannte Alberto sich da eigentlich aus? Wie kam er auf die Idee, einem kleinen Mädchen zu sagen, es sei sexy, während ihre Mutter danebensaß, und bei ihm zu Hause eine Tochter im selben Alter?
4
Mama, heute hat Professore Donno mich ans Pult gerufen.
Meine Mutter war mit dem Haushalt beschäftigt.
Moment, ich muss nur schnell den Herd abstellen, dann bin ich bei dir, sonst brennt mir noch die Soße an, was hast du gesagt?
Meine Mutter war zu Hause permanent beschäftigt; mein Bruder und ich waren noch klein, und Papa kam immer erst spät von der Arbeit. Zum Putzen kam eine Dame vorbei, aber die Küche war das Reich meiner Mutter, und mit der Arbeit dieser Frau war sie ohnehin nie zufrieden, sie hatte einen veritablen Ordnungsfimmel, wollte alles unter Kontrolle behalten, ertrug nicht die kleinste Kalkspur auf den Wasserhähnen, nicht das winzigste Staubkorn auf dem Teppich oder dem Tafelsilber. Das Haus ist unser Spiegelbild, sagte sie immer, das zeigt, wer wir sind, wenn es sauber und ordentlich ist, heißt das, wir sind sauber und ordentlich, und jetzt räum endlich dein Zimmer auf, meine Güte, Anna, wie sieht’s in deinem Schrank schon wieder aus!
Ähm, also, ich wollte sagen, als ich in der Stunde vorgelesen hab … Ich weiß nicht richtig, wie ich das erklären soll, aber
Moment mal, Anna, was treibt denn dein Bruder da schon wieder, was ist das für ein Krach, hörst du das auch?
Schon eilte sie in Alessios Zimmer, und ich stapfte hinterher.
Alessio, was soll das denn? O Freundchen, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt! Du räumst jetzt sofort die Legosteine in die Kiste und bringst die Kegel zurück, im Haus wird nicht gekegelt! Dann wandte sie sich wieder mir zu: Also, was wolltest du sagen?
Ähm, ich hab vorgelesen, und er hat mir die Hand in die Tasche gesteckt.
Wie, Anna? Wer hat was wohin gesteckt?
Ach nein, Mama, vergiss es, ich hab das falsch erzählt. Tut mir leid.
5
Bin ich geflohen? Vielleicht. Zumindest erkläre ich mir heute so meine Entscheidung, nach Paris zu ziehen, wo meine Großmutter herstammte, obwohl ich mir geschworen hatte, nach den desaströsen Praktikumsmonaten am Method Acting Center nie mehr dorthin zurückzugehen: Ich bin vor mir selbst geflohen. Wobei. Zumindest wollte ich ein paar tausend Kilometer zwischen mich und diese Idiotin bringen, die alles glaubte, was Männer ihr sagten, die sie ins Bett kriegen wollten. Aber dann habe ich Anna doch mitgebracht, tief im Gepäck verstaut. Auch in einem anderen Land kann man sich selbst nicht entkommen.
Es war alles nicht ganz so gelaufen, wie ich als Kind gehofft hatte, wie meine Mutter es sich vorgestellt hatte, die so stolz auf ihre Klassenbeste gewesen war, auch wenn die sich nach der Schule gleich für Geisteswissenschaften eingeschrieben hatte, ach Gott, was macht man damit überhaupt, kannst du nicht Jura studieren wie dein Vater und später bei ihm in der Kanzlei einsteigen? Oder Ärztin werden, Medizin fandst du doch mal so toll, Jura oder Medizin, da stehst du immer gut da, aber Geisteswissenschaften? Und hinterher, wie soll’s dann weitergehen? Wenn du schreiben willst, von mir aus, aber das kannst du ja auch nebenbei machen, wenn du eine richtige Arbeit hast, vom Schreiben kann heutzutage kein Mensch leben – wie, Journalistin? Das ist doch keine richtige Arbeit! Wart’s ab, du endest noch wie ich, nach der Hochzeit hab ich alles aufgegeben, und jetzt? Du weißt, was dein Vater immer über mich sagt, oder? Obwohl ich ja schon gern mal wüsste, was er gemacht hätte, wenn ich mich nicht um den Haushalt, euch Kinder, seine Geschäftsessen und die Ferien gekümmert hätte.
Es war alles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können. Aber nicht aus den von meiner Mutter genannten Gründen. Wobei. Dass vom Schreiben keiner leben kann, stimmte wahrscheinlich, aber das war nicht das Problem, das Problem war ich, die ich zunehmend den Glauben an mich selbst verloren, tausend Dinge angefangen und dann wieder geschmissen hatte, Malen, Theater, sogar die Filmhochschule, ich, die sich auf diverse mehr oder weniger unmögliche Affären mit miesem Anfang und noch mieserem Ende eingelassen hatte, falsche Masken, falsche Abenteuer, aber wirklich falsch war letzten Endes vielleicht doch nur ich selbst. Wäre ich doch nur wie meine Mutter gewesen, langweilig, okay, besonders witzig war sie nie, aber eben immer aufgeräumt, immer vernünftig, und außerdem, entschuldige mal, Papa, wenn sie wirklich so abgetakelt ist, wie du immer sagst, wieso bleibst du dann bei ihr? Ist doch klar, dass du sie nicht verlässt, natürlich hältst du an ihr fest! Mein Vater hatte sich ganz bewusst eine wie meine Mutter ausgesucht, das exakte Gegenteil seiner eigenen Mutter, die ihren Mann mit ihren Launen in den Wahnsinn getrieben hatte, eitel und chronisch miesepetrig wie sie war, ich will dies, ich will das, eine Pfeife bist du, ein Versager.
Als ich nach Frankreich kam, war ich frisch verheiratet.
Nein, geliebt habe ich ihn nicht. Ich weiß schon, dass Sie das gleich fragen wollten, aber die Antwort ist simpel: Ich habe ihn nicht geliebt. Genau genommen hat er mir nicht mal gefallen. Meine beste Freundin Carlotta sprach deshalb kein Wort mehr mit mir. Das hält doch eh nicht!, hatte sie gesagt und einfach aufgelegt, als ich ihr am Telefon erzählte, dass ich heiraten würde, und nein, ich würde nicht noch mal darüber nachdenken, würde nicht mal mehr den Abschluss an der Filmhochschule machen, obwohl ich ihr versprochen hatte, mir das gut zu überlegen. Auch meine Mutter dachte, es würde nicht halten, behielt das damals allerdings für sich, denn mich zur Vernunft bringen zu wollen schien ihr ohnehin aussichtslos, das Kind ist doch genauso störrisch wie sein Vater!
Mein Mann war völlig anders als die Männer, die ich zuvor geliebt hatte, obwohl auch er verschlossen war, verschlagen sogar, aber immerhin war er da, war zur Stelle. Als ich am Knie operiert wurde, wich er nicht von meinem Bett, ganz im Gegensatz zu Massimo, der sich, als ich im Jahr zuvor im Krankenhaus gewesen war, nicht mal die Mühe gemacht hatte, mich zu besuchen, die Arbeit, meinte er, und dann ist er mit seiner Ex verreist, na ja, du konntest ja wohl schlecht, mit deinen Krücken, oder? Aber zurück zu meinem Mann, der mir die ganze Nacht die Hand hielt und nach nur einem Monat einen Antrag machte. Er lehrte an der Universität, stellen Sie sich vor, ein Italiener als Professor in Paris! Im Gegensatz zu mir, die ich dank meiner Großmutter mit Französisch aufgewachsen bin, war diese Sprache für ihn keine zweite Haut.
Er muss wirklich was Besonderes sein, das hatte ich bereits gedacht, als wir uns kennenlernten. Ich war vierundzwanzig, mein Leben war schon damals ein einziges Tohuwabohu, und mir war ziemlich gleichgültig, was Carlotta von seinem trüben Blick und seinen ewig verschwitzten Händen hielt: Ist dir schon mal aufgefallen, dass er einem nie in die Augen schaut? Hast du bemerkt, wie er beim Sprechen pausenlos an seinem Krawattenknoten rumfummelt?
Als ich nach Paris kam, kannte ich dort keine Menschenseele. Meine Großmutter war gleich nach der Schule von dort weg. Nachdem sie meinen Großvater kennengelernt hatte, war sie nach Rom gezogen und fuhr nur noch selten nach Frankreich; wenn meine Mutter sie mal mitschleifte, zog sie immer eine Schnute. Sie war die einzige Tochter zweier Einzelkinder, liebte Croissants und Camembert, ihr Lieblingsfilm war Carnés Die Kinder des Olymp, und kein Schriftsteller der Welt konnte mit Proust mithalten, aber all das zählte nichts, sagte sie immer, Paris war dreckig, die Pariser unerträglich, niemand wusste sich mehr zu benehmen, und überhaupt, mein Kind, in Italien lebt es sich einfach viel besser. Diese Abneigung gegen Frankreich habe ich nie verstanden: Wenn ich sie danach fragen wollte, wechselte sie jedes Mal schnell das Thema, nicht einmal meine Mutter wusste, was es damit auf sich hatte, und dann ist sie gestorben, meine Großmutter, und die Sache war erledigt.
Ich kannte keine Menschenseele in Paris, und ich fühlte mich verloren. Nicht mal John lebte noch dort, ein Typ, mit dem ich mich angefreundet hatte, als ich für das Praktikum hergekommen war: Er war zurück in England und hatte einen Glanzstart in seine Bühnenkarriere hingelegt, erst mit kleineren Truppen, dann am National Theatre, als Ensemblemitglied der Royal Shakespeare Company.
Auf die erste Ohrfeige von meinem Mann habe ich gar nicht reagiert.
Sie kam völlig unerwartet, mitten auf der Straße, was hätte ich da sagen oder tun können? Was sollten die Leute denken? Zumal ich es ja sogar einsah, als er mir erklärte, die Weise, wie ich diesen Mann angelächelt hatte, sei peinlich, unverschämt gewesen: Ich musste aufpassen, wie ich mich vor anderen Männern benahm, das war eine Frage des Respekts ihm gegenüber. Er wollte, dass ich ihm Hausmannskost kochte, am Sonntag mit ihm in die Kirche ging und ihn nicht wegen eines getrennten Kontos nervte, schließlich liebte er mich, wir waren eine Familie, was brauchte ich da ein eigenes Konto?
Als er mich an die Wand gepfeffert hat, habe ich die Zähne zusammengebissen. Er war betrunken, ich hatte Angst. Ich lag am Boden, hatte mir wehgetan, wollte ihm aber nicht die Genugtuung geben, mich weinen zu sehen. Ich schickte eine Mail an Carlotta, nur drei Worte, in der Hoffnung, sie würde sich melden: Du hattest recht. Nach dem Senden löschte ich die Nachricht umgehend – hätte mein Mann sie gelesen, wäre er gleich wieder durchgedreht. Und wirklich, als Carlotta versuchte, mich anzurufen, hat er sofort aufgelegt, unter keinen Umständen sollte ich mit der reden, was bildete ich mir eigentlich ein?
Wochenlang suchte ich nach halbwegs plausiblen Ausreden, allein aus dem Haus zu gehen, doch er bestand stets darauf, mich zu begleiten, und ich hatte in der achtundzwanzig Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung mit per Vorhang abgetrenntem Bad und dem Bett direkt neben dem Wandschrank das Gefühl, ich würde ersticken.
Ich war noch kein halbes Jahr verheiratet und träumte nachts schon von Massimo. Ich träumte, er käme mich holen, würde sagen, ich sei die Frau seines Lebens, immer dasselbe Drehbuch – bis mein Mann mich aufweckte, um mit mir zu schlafen, und ich mir Nase und Augen zuhielt: Eheliche Pflichten, was für ein Krampf! Ich erstickte.
Ein paar Monate später, als er nachmittags wegmusste, bin ich durch die Tür gegangen und nie mehr zurückgekehrt. Carlotta wollte, dass ich wieder nach Rom käme, wohnen könne ich erst mal bei ihr, meine Familie müsse gar nichts erfahren.
Aber ich wollte nicht zurück nach Italien, sondern allein auf die Beine kommen. Ich fand eine bezahlbare Einzimmerwohnung im Banlieue Saint-Denis und ein Praktikum in der Maison de la Radio. Doch die alte Anna war in voller Pracht zurück, und ich benahm mich wieder ganz genau wie damals, als ich alles geglaubt hatte, was mir Männer erzählten, die mich ins Bett kriegen wollten, wie schaffen die anderen das bloß, dass sie immer respektiert werden?
Trotzdem war ich, als ich durch ein paar Zeitschriften für Teenager blätterte, zutiefst empört über die Ergebniskategorien der Psychotests: super-extra-salope, wörtlich »Megaschlampe«, und in der Charakterisierung ein »Herzlichen Glückwunsch«, denn warum sollte man verliebt sein, um mit einem Kerl ins Bett zu gehen, Sex ist Selbstzweck, und wer das nicht weiß, hat keine Ahnung von Freiheit; ringarde, alte Jungfer, wie, willst du keinen Spaß haben? Glaubst du wirklich, Unschuld sei angesagt?
Und ich, was bin ich? Das fragte ich meine Therapeutin.
Seit meiner Trennung ging ich jede Woche zu ihr. Anfangs nur montags, dann montags und mittwochs, dann auch am Freitag.
Salope oder ringarde? Schlampe oder alte Jungfer? Diese Worte hätte ich vor ihr natürlich nie in den Mund genommen. Selbst heute fällt es mir noch schwer, gewisse Wörter auszusprechen; sie aufzuschreiben ist leichter, da wirken sie weiter entfernt. Aber was die Männer angeht: Ging ich mit denen nun ins Bett, weil ich frei war, oder hielt ich mich für frei, weil ich mit ihnen ins Bett ging? Liebte ich sie, oder redete ich mir das nur ein?
Hm.
Jedenfalls tat es mir jedes Mal weh, wenn einer hastig in seine Klamotten schlüpfte: Sehen wir uns denn mal wieder? Klar. Okay, und wann? Kann ich noch nicht sagen, ist kompliziert, verstehst du sicher, aber ich melde mich, wir hören uns, ist doch nicht schlimm, wenn wir erst mal ein paar Wochen ins Land gehen lassen, oder?
Es tat weh, und ich fühlte mich immer schmutziger.
6
Dass Missbrauchsopfer sich schmutzig fühlen, kommt oft vor. Wenn alle, die sexuelle Gewalt oder Belästigung erlebt haben, egal, ob jung oder weniger jung, dünn oder weniger dünn, lesbisch oder hetero, die Menge Q bilden, dann ist eine beachtliche Teilmenge von Q fest überzeugt, selbst daran schuld gewesen zu sein.
Denken wir noch einmal an die Elfjährige, die Sie sich vorhin vorgestellt haben und die 1985 in die sechste Klasse einer privaten Mittelschule im Zentrum von Rom ging. Gehört auch sie zur Menge Q? Was dachte sie, als Professore Donno ihr die Hand in die Tasche schob? Fühlte sie sich schmutzig? Und dann? Wie ging es weiter?
Stellen Sie sich vor, Anna ist inzwischen fünfzehn.
Stellen Sie sich vor, Donno ist zwar nicht mehr ihr Lehrer, unterrichtet aber an der Schule, deren Oberstufe sie jetzt besucht.
Stellen Sie sich vor, Annas Mutter hat beschlossen, sie zur Nachhilfe zu ihm zu schicken: Wenn wir dir einen Computer kaufen sollen, musst du erst mal Informatik lernen! Stellen Sie sich also vor, Annas Mutter erwartet, dass ihre Tochter algorithmische Prozesse und Programmiersprachen beherrscht, dass sie sich in die genauso reinkniet wie in Griechisch und Latein, und dass sie die Chance (die Chance?) ergreift, eine Methode zu erlernen, mit der sie später auch Probleme in anderen Bereichen bewältigen kann. Stellen Sie sich außerdem vor, dass sich Anna für das Zusammenspiel von Daten und Algorithmen gar nicht wirklich interessiert, ja, dass es ihr ungeheuer schwerfällt, aus Integralen, Exponentialfunktionen und Logarithmen schlau zu werden, und sie im Grunde bloß die Frage beschäftigt, ob Donno sie noch immer attraktiv findet – denn das steckte doch wohl hinter dem, was ihr mit elf passiert ist, oder?
Stellen Sie sich das mal vor.
Ich erzähle Ihnen inzwischen, was passiert ist.
Allem Anschein nach ist Annas Leben ganz okay, auch wenn es nicht immer leicht ist, oder zumindest nicht so leicht, wie Anna es bei ihren Altersgenossinnen annimmt. Die schminken sich, gehen aus und haben feste Freunde. Anna nicht. Sie schminkt sich nicht und hat auch keinen Freund. Vor ein paar Jahren hatte sie einen: Paolo. Aber das ging schnell auseinander, vielleicht fand sie ihn doch nicht so toll, oder er hat selbst Schluss gemacht, da war sich Anna nicht mehr ganz sicher, wenn jemand danach fragte, sagte sie nur, sie verstehe selbst nicht, was in den Sommerferien passiert sei. Als die Schule wieder anfing, war es jedenfalls aus. Nein, nein, gelitten hat sie nicht, sie war ja nicht verliebt. Wobei. In Wahrheit war die Sache komplizierter, aber sie sagte trotzdem, sie hätte nicht gelitten, zumindest damals nicht. Später, da schon, ja. Später war sie oft unglücklich verliebt, weil die Jungs einfach nicht auf sie standen. Wobei.
Im Grunde wusste sie gar nicht, ob die Jungs auf sie standen. Sagen wir mal: Zumindest standen nicht die Jungs auf sie, auf die sie selbst stand. Aber standen die nicht auf sie, weil sie nicht hübsch war, oder fühlte sie sich nur hässlich, weil die nicht auf sie standen? Oder gefiel sie ihnen anfangs, tat oder sagte dann aber immer was Falsches? War sie zu langweilig? Zu kompliziert?
Hm. Anna grübelte viel, aber vergebens. Und als Professore Donno sich dann neuerlich für sie interessierte, fühlte sie sich wieder schön. Wobei. Nicht unbedingt schön, aber wichtig. Er stand auf sie: ein reifer, ein richtiger Mann, nicht so ein verpickelter Teenager, der sich für toll hielt, weil er auf dem Klo heimlich rauchte. Dieser Mann erkannte, dass sie etwas Besonderes war. Und als sie dann eines Tages zu ihm zum Unterricht kam und sagte, sie hätte die Nase voll davon, sich minderwertig zu fühlen, sie wäre am liebsten ein Computer, der nie leidet, nichts fühlt, nur sein Ding macht, 0000, 0010, 0011, und als er ihr daraufhin eine Hand auf den Schenkel legte – was willst du denn als Maschine, so ein Computer hat keinen Körper, empfindet nichts, spürst du, wie warm meine Hand ist? –, da war sie sofort entflammt.
Und dann?
Dann treffen Anna und Professore Donno sich regelmäßig. Heimlich, klar. Ihren Freundinnen erzählt Anna kein Wort, und ihrer Mutter sowieso nicht. Niemand weiß, was in ihr vorgeht. Auch nicht, als er ihr die Hose aufknöpft und eine Hand hineinschiebt und sie zwar denkt, dass ihr das viel zu schnell geht, sie das aber nicht zu sagen wagt: Sie wird nur rot und schweigt.
Weißt du eigentlich, wieso ich mit Frauen meines Alters nichts anfangen kann?, fragt er sie eines Tages.
Wieso denn?
Wenn eine mit über dreißig keinen Mann hat, gibt es dafür garantiert einen guten Grund. Meine Letzte war zum Beispiel eine Nymphomanin.
Anna hat nicht die geringste Ahnung, was eine Nymphomanin sein soll – sie weiß ja nicht mal genau, was ein Orgasmus ist. Aber sie lässt sich nichts anmerken. Sie fürchtet, sonst alles kaputt zu machen. Will sich weiterhin kostbar fühlen. Auch wenn sie tief in ihrem Inneren spürt, dass da etwas faul ist. Es gibt Gerüchte, angeblich hat er eine Tochter, ist verheiratet.
Ich war grade dabei, eine Funktion auf Millimeterpapier zu zeichnen, da kam sie plötzlich an und meinte, sie sei schwanger. Wir müssten heiraten, hat sie gesagt, das hat mich total überrumpelt; mir hat die Hand so gezittert, dass ich mich verzeichnet habe.
Und Anna fühlt mit ihm, so wie als er ihr davon erzählt, dass sein Vater noch lang nach dem Tod seiner Frau jeden Abend ihr Nachthemd aufs Bett gelegt hat, um sich ihr nah zu fühlen. Diese Art ewiger Liebe, die suche auch er: Händchen halten noch nach vielen Ehejahren, genau wie die Paare, die Anna manchmal auf der Straße sieht, und so gar nicht wie ihre Eltern, aber wie sollte ihr Vater auch Hand in Hand mit seiner Frau spazieren gehen? Eines Sonntags, in der Kirche, hat er sie mal am Arm berührt, erinnert sich Anna, und ihre Mutter hat nur schroff den Kopf geschüttelt, strenge Augen, strenger Mund, den Mantel fester zugezogen, sich auf die Unterlippe gebissen und bis zum Ende der Messe kein Wort mehr mit ihm geredet.
Eines Tages sieht Anna, wie Donno im Laufschritt aus der Schule eilt, 11:30 Uhr, große Pause, alle sind auf dem Hof, und er rennt Richtung Schultor. Irgendjemand sagt, er sei ins Krankenhaus gerufen worden, die Fruchtblase seiner Frau sei geplatzt. Anna trifft das wie ein Schlag in den Magen, ihr bleibt die Luft weg: Seine Frau war also wieder schwanger und Donno ein Lügner.
Es ist aus!, teilt Anna ihm in der Woche vor Ostern mit.
An der Schule wird ein Kreuzweg inszeniert, und sie stiehlt sich unauffällig davon, um ihn in einem Café in der Nähe zu treffen.
Sie hat einen Kloß im Hals, bleibt aber stark.
Ach, das sagst du jetzt, aber du kommst eh wieder. Donno glaubt ihr kein Wort. Gestern war doch noch alles in Ordnung, was soll denn dieser Unsinn?
7
Seit meiner Ankunft in Paris war einfach alles schiefgelaufen. Wenn ich an den Film denke, den ich vor meiner Abreise im Kopf gehabt hatte, tue ich mir heute noch leid. Aber was hatte ich auch erwartet? Hatte ich ernsthaft geglaubt, in Frankreich wäre ich nicht mehr dieselbe? Und dass ich, nachdem ich meinen Mann verlassen hatte, nicht in das alte Schema verfiele, außen hui, innen pfui?
Wie schon gesagt: In ein anderes Land zu ziehen bringt gar nichts, wenn sich im Inneren nichts bewegt. Man macht sich etwas vor, wenn man meint, man könnte einfach einen Schlussstrich ziehen und von vorn anfangen, wie man ein Programm neu startet – als würde das Gehirn funktionieren wie ein abgestürzter Computer, und man müsste bloß cmd+option/alt+esc drücken, damit es wieder läuft.
Aber das Gehirn ist ein heilloses Chaos, ganz ohne Bits oder Binärcode, und dazu kommt das Unbewusste, wirft alles noch mehr durcheinander, und dann noch der Körper mit seiner ganz eigenen Festplatte, und die Gewohnheit und
Charles, Mathieu, Alain, Jean-Philippe. In den ersten Jahren der 2000er war ich ständig verliebt und habe alle betrogen. Wobei.
Vor allem habe ich mich selbst betrogen, mich weggeworfen. Morgens ins Schwimmbad, hunderte Bahnen, bis meine Lippen blau anliefen, und abends viele Kilometer Joggen an der Seine, mit wild hämmerndem Herzen, dazu die absurde Angewohnheit, mir in die Wange zu beißen, bis ich das metallische Blut schmeckte; es war einfach stärker als ich, ich konnte nicht aufhören, mir wehzutun.
Wie konnte ich damals überhaupt arbeiten? Heute will mir kaum noch in den Kopf, dass ich in dieser Lebensphase nicht aus der Bahn geflogen bin, obwohl ich andauernd Vollgas gab, bis ich ins Schleudern kam, fast vor die Wand fuhr.
Anders hätte ich gar nicht gekonnt – das sagte ich mir damals wenigstens, und das sagte ich auch meiner Therapeutin, die genervt erwiderte: Jetzt aber mal halblang, ja? Und die mich, wenn ich lauter wurde, rügte: Merken Sie, wie aggressiv Sie grade werden?
Aber ich war ja gar nicht aggressiv, kein Stück. Wobei.
Ich war nicht aggressiv gegen sie, der ich mich unterlegen fühlte und der ich unbedingt gefallen wollte. Aggressiv war ich mir selbst gegenüber: Mich konnte ich nicht ausstehen.
Ich hasste meine innere Leere, meine Unsicherheit und vor allem meine Unfähigkeit, zu verhindern, dass Männer immer nur das Eine von mir wollten. Auch wenn es mit ihm, den ich ausgerechnet in dieser Zeit kennenlernte, offenbar anders war, aber wie lang konnte das mit uns schon gut gehen, wenn ich andauernd Mist baute? Und war es mit ihm wirklich anders, oder machte ich mir nur was vor?
Ich war ihm erst kurz zuvor begegnet.
Eines Abends sprach er mich an, er hatte mich erkannt, obwohl er mich noch nie live gesehen hatte, nur im Fernsehen. In der Académie française wurde ein Empfang gegeben, um den Preis zu feiern, den ein in Italien spielender Roman erhalten hatte: ein junges Paar und ein Erzähler aus Amerika, so eine Art Salinger-Klon, der die Beziehung der beiden ruiniert. Der Sender hatte mich geschickt – ich glaube, das Buch spielt in Ponza, hatte der Chefredakteur gesagt, da kommst du doch her, oder?
Komme ich nicht, aber egal. Mich juckten weder der Roman noch die Académie française, ich musste nur mal den Kopf freikriegen, und ein kleiner Spaziergang zum Quai de Conti – etwa fünf Kilometer vom Sender, Voie Georges Pompidou, Port des Champs-Élysées, Pont de la Concorde, Quai des Tuileries – kam mir da gerade recht. An einem anderen Tag wäre ich womöglich gar nicht hingegangen.
Auch er war eher zufällig da. Ich bin ja sonst allergisch gegen diese »Tout-Paris«-Partys, sagte er und erklärte, »Tout-Paris« sei eine gängige Wendung und heiße so viel wie »Schickeria«. Wäre der Autor dieses Romans nicht der Freund eines Freundes, hätte er keinen Fuß in die Académie gesetzt, auch wenn ich gern glauben möchte, es sei Schicksal gewesen. Ja, ich glaube tatsächlich an das Schicksal: Mir ist schon zu viel auf diese Art passiert, Gutes wie Fatales.
Jedenfalls war er jetzt da und sprach mich an: Wie geht’s denn C. B. so?
Bereit, ihn in Stücke zu reißen, wirbelte ich so schnell herum, dass ich mir die ganze Limonade über die Strickjacke spritzte: Was bitte wollte der denn jetzt von mir?
Aber der wollte gar nichts, wobei, zumindest wollte er mich nicht provozieren oder verspotten, bloß kennenlernen, er hatte nicht erwartet, dass die bloße Erwähnung des Namens der Regisseurin, die mich vor einiger Zeit im Fernsehen angegangen war, mich so auf die Palme bringen würde. Er zog ein Päckchen Taschentücher aus der Tasche, reichte mir eins, und ich tupfte mir die Limo von der Jacke. Normalerweise hätte er die Sendung gar nicht erst gesehen, meinte er und blickte betreten zur Seite, während ich mit dem Tuch über die Flecken rieb, tagsüber schalte er den Fernseher sonst nie ein. Reiner Zufall, fügte er hinzu, aber ich hab ein gutes Personengedächtnis und vergesse nie ein Gesicht – vor allem nicht, wenn’s mir gefällt. Ich tat, als hätte ich ihn nicht richtig verstanden, und ging zur Toilette, tut mir leid, aber sonst krieg’ ich die Limo nie raus.
Tja, Zufall. Oder Schicksal. Wie mein Umzug nach Frankreich. Letztlich hatte meine Nonna recht: Paris ist verdreckt, die Pariser sind schrecklich, und die Italiener genauso – sobald die nach Frankreich kommen, werden sie unausstehlich. Er aber war nett: Er wartete, bis ich vom Klo zurückkam, hatte mir eine neue Limo besorgt, und am Ende unterhielten wir uns den gesamten Abend.
Aber zurück zur Sache, sonst verzettele ich mich. Der Punkt ist: Als ich ihn kennenlernte, hatte ich diverse Affären mit anderen. Ich traf ihn immer öfter, im Café, zum Apéro, zum Abendessen, und eines Tages sind wir dann im Bett gelandet.
Ich rief Jean-Philippe an und erfand eine Ausrede, wieso ich ihn nicht treffen konnte.
Er ging solang ins Nebenzimmer. Ist schließlich deine Privatsache, meinte er, nachdem ich aufgelegt hatte. Aber es war auch seine ganz eigene Art Selbstschutz.
Es war schon immer besser für ihn, gewisse Dinge nicht zu wissen.
8
Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Ich weiß schon, dass ich dir gefalle, aber wie sehr? Und gefalle wirklich ich dir, oder würde es jede andere auch tun? Oder gefalle ich dir gar nicht richtig, und du hast bloß Bock auf Sex?
Ich weiß.
Begehren lässt sich nicht beziffern, wobei, wer zahlt, der beziffert, weist einen Preis zu. Soundso viel Geld bist du wert, auch wenn es heißt, Menschen hätten keinen Preis, sondern nur Würde, das wusste auch ich mal, aber dann ging dieses Wissen mir verloren, oder vielleicht war es ja rational noch da, im Kopf, aber mein Körper arbeitete auf eigene Rechnung – wenn du mich bezahlen würdest, wüsste ich, wie groß dein Begehren wirklich ist, es wäre klar, konkret, eindeutig, wie viel wärst du bereit zu zahlen?
Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Du sagst, ich sei schön, aber das sagen sie alle, immer vor dem Sex, nur: Was ist mit danach? Bin ich dann auch noch schön?
Sex und Spiel gehören zusammen, anders geht das nicht.
Man wird wieder Kind, und alles geht wieder von vorn los: Das Mädchen, das ich war, der Junge, der du warst, aber wer hatte damals die Oberhand, wenn du mit deinen Freunden gespielt hast?
9
In jenen Jahren machte die Pornografie einem das Spielen schwer. Die Hälfte aller elf- bis zwölfjährigen Jungs hatte schon mal einen Porno gesehen; es gab zwar noch Videokassetten, aber die Filme waren nicht mehr wie früher, wo man zwar alles sah, aber doch noch ein Rest Anstand blieb. Inzwischen gab es nur noch Doppel- und Dreifachpenetration, Sperma im Gesicht und Blut pinkelnde Frauen, und ihren Sexualkundeunterricht bekamen die Jugendlichen der Banlieues auf den Treppen der Plattenbauten, mithilfe raubkopierter DVDs, die unter den Ladentischen im Viertel verkauft wurden.
Und obwohl einer der Chefredakteure des Senders mich gewarnt hatte, das sei ein Minenfeld, beschloss ich, einen Beitrag über Jugendliche und Pornografie zu machen.
Es war 2002, und William, der mit zwölf seinen ersten Porno gesehen hatte, sagte, inzwischen, mit fünfzehn, würde er gar nicht mehr so viele schauen, höchstens zwei, drei pro Woche, kein Ding, ich hab schließlich ’ne Freundin, nicht wie diese Loser, die eine Möse nicht mal mit ’nem Fernglas zu sehen kriegen!
Es war 2002, und Stanislas, ein Vierzehnjähriger aus Lyon, meinte, er sehe am liebsten realistische Pornos, im Dokumentarstil, solche, in denen die Frau gar nicht unbedingt Spaß hat, wo sie beim Casting verarscht und gezwungen wird, erst mit dem Regisseur zu schlafen und dann mit den Tontechnikern. Diese Filme zeichnete er heimlich von irgendwelchen osteuropäischen Fernsehsendern auf und vertickte sie dann an seine Klassenkameraden; die Darsteller sprachen alle Russisch oder Bulgarisch, aber es gab ja sowieso nichts zu verstehen: Man schaut, masturbiert und fertig.
Es war 2002, und Malik, der gerade neunzehn geworden war, erzählte, wenn du mal ein paar dieser Streifen gesehen hast, hast du keinen Bock mehr, daheim zu sitzen und zu wichsen, also suchst du dir ein Mädchen, und wenn die sich verliebt, macht sie eh alles, was du willst, aus Schiss, du könntest sie absägen, auch wenn sie dir in Wahrheit scheißegal ist, und wenn du dann genug hast, widert dich die Alte an, die alles mit sich hat machen lassen, du willst sie gar nicht mehr sehen, und wenn sie deshalb wochenlang flennt, selber schuld, wär’ sie halt mal nicht so versaut gewesen.