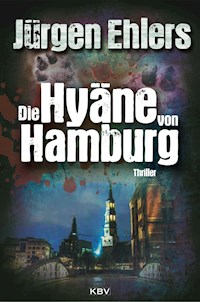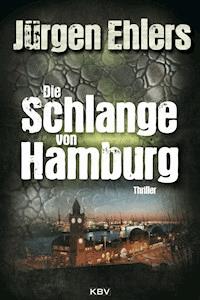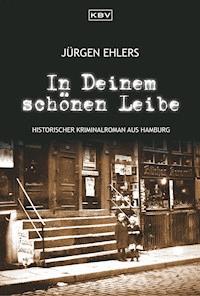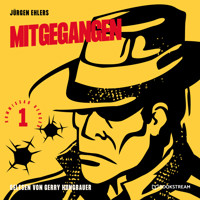Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Berger
- Sprache: Deutsch
"… dann kommt eine größere Bombe!" Oktober 1966. Ein unbekannter Erpresser fordert von der Bundesbahndirektion Hamburg nicht weniger als 50.000 DM. "WENN ZUG NICHT ENTGLAIST IST HABT IHR NOCH MAL GLÜK GEHABT", schreibt er. Ist da ein Spinner am Werk? Als eine Bombe die Schließfächer im Hamburger Hauptbahnhof zerfetzt, wird offenbar, dass der Verbrecher es ernst meint. Seine neue Forderung beträgt jetzt das Doppelte: 100.000 DM. Die Zeitungen reden panisch von einem Fantom. Der Erpresser selbst nennt sich Roy Clark, nach dem Titelheld eines Fortsetzungsromans aus der Bild-Zeitung. Mit den Ermittlungen wird Kommissar Horst Berger beauftragt. Als die Geldübergabe scheitert, steigert sich das Fantom in einen regelrechten Gewaltrausch: verbogene Bahngleise, Stahltrossen, gespannt über Schienenstränge, weitere Bomben, Verletzte … Berger sucht nach einer Möglichkeit, dem Erpresser eine Falle zu stellen, der eiskalt angedroht hat: "NÄCHST MAL WIRD SCHLIMMER."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die »Kommissar Berger«-Reihe:
Mitgegangen
Neben dem Gleis (E-Book)
Die Nacht von Barmbeck (E-Book)
In Deinem schönen Leibe
Blutrot blüht die Heide
Nur ein gewöhnlicher Mord (E-Book)
Im Haus der Lügen
Darüber hinaus vom Autor bei KBV erschienen:
Mann über Bord
Der Wolf von Hamburg
Die Hyäne von Hamburg
Die Schlange von Hamburg
Abmurksen und Gin trinken
Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren und lebt heute mit seiner Familie auf dem Land. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis, die in verschiedenen Verlagen im In- und Ausland veröffentlicht wurden, und ist Herausgeber von Krimianthologien. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«. Sein erster Kriminalroman Mitgegangen wurde in der Sparte Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.
Jürgen Ehlers
Fantom
Originalausgabe© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Umschlaggestaltung: Ralf KrampLektorat: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-95441-562-5E-Book-ISBN 978-3-95441-571-7
Inhalt
Bombe im Schließfach
Der Schatten von Indochina
Es kracht
Was man weiß, und was man nicht weiß
Gewalt
Nachwort
»Die Bombe platzt um 20 Uhr.Roy Clark …«
(Hektor von Usedom, Roy-Clark-Ballade, 1967)
Bombe im Schließfach
8. Dezember 1966 - 24. Dezember 1966
Donnerstag, 8. Dezember 1966
Endlich eine freie Telefonzelle! Alexander Dobruck zog den Zettel mit der Telefonnummer aus dem Portemonnaie, dann warf er zwanzig Pfennige ein und wählte die Nummer. Er hörte das Freizeichen. Einmal – zweimal – verdammt! Wenn nun niemand ranging?
Doch der Hörer wurde abgehoben. Endlich. Eine Frauenstimme, freundlich und nichtssagend: »Hamburger Abendblatt, was kann ich für Sie tun?«
Alexander räusperte sich. »Hier ist Roy Clark. Hauptbahnhof. In einer Viertelstunde geht die Bombe hoch.«
»Was? Was soll das …?«
Alexander legte auf. Das hatte geklappt. Er sah auf die Uhr. Noch vierzehn Minuten.
Bombenalarm! Pagels war schon weg, Roeder übernahm die Telefonwache, Berger hastete los. Eine Bombe im Hauptbahnhof!
Vom neuen Polizeipräsidium war es nur ein Katzensprung bis zur S-Bahn Berliner Tor. Horst Berger knöpfte sich im Fahrstuhl den Mantel zu, rannte aus dem Haus, zur Unterführung und dann in den Bahnhof hinein. Die S-Bahn Richtung Blankenese lief gerade ein. Berger sprang die Treppe hinunter, bahnte sich einen Weg durch die Fahrgäste, die in die Gegenrichtung eilten. Der Zug war schon abgepfiffen und die Türen schlossen sich bereits. »Zurückbleiben bitte!«, tönte die ärgerliche Stimme des Fahrdienstleiters aus dem Lautsprecher. Berger kümmerte sich nicht darum. Er riss die Türen mit Gewalt wieder auf, zwängte sich in den Wagen, und schon fuhr der Zug los. Eine ältere Dame schüttelte missbilligend den Kopf.
Knappe fünf Minuten dauerte die Fahrt vom Berliner Tor bis zum Hauptbahnhof. Knappe fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt geschehen musste. Bombenalarm – das hieß also, dass die Bombe noch nicht explodiert war. Wenn es denn überhaupt eine Bombe gab. In den meisten Fällen war es ein Fehlalarm. Irgendein Witzbold, der sich einen Scherz erlaubt hatte oder einfach mal testen wollte, wie lange es wohl dauerte, bis die Polizei kam. Oder die Feuerwehr.
Aber wenn es nun kein Scherz war?
Der Hamburger Hauptbahnhof war ein sehr massives Gebäude, schätzungsweise hundert Meter lang und fünfzig Meter breit. Er hatte den Zweiten Weltkrieg ohne allzu große Schäden überstanden. Das hieß, man würde eine sehr große Bombe brauchen, um ihn zum Einsturz zu bringen. Das würde also nicht geschehen. Aber auch ein kleinerer Sprengsatz konnte erheblichen Schaden anrichten, es könnte Verletzte geben, vielleicht sogar Tote. Horst Berger sah sich im Abteil um. Zwanzig Leute ungefähr. Eine Mutter mit einem kleinen Kind. Sollte er die Fahrgäste warnen? Wovor? Niemand konnte wissen, was passieren würde. Und ob überhaupt etwas passieren würde.
Der Zug lief in den Hauptbahnhof ein. Normaler Feierabendbetrieb. Nichts war abgesperrt. Bis jetzt war die Bombe offensichtlich noch nicht explodiert. Berger sah auf die Uhr. Der Anruf war nicht direkt bei der Polizei eingegangen, sondern beim Abendblatt. Zeitpunkt wahrscheinlich ungefähr 19:45 Uhr. Wenn die Bombe durch einen Zeitzünder gezündet werden sollte, wäre 20:00 Uhr naheliegend. Noch drei Minuten.
Horst eilte den Bahnsteig entlang in Richtung Wandelhalle. Er rannte die Treppe hinauf. Ein Schutzmann hielt ihn auf. »Sie können hier nicht durch!«
»Kriminalpolizei«, sagte Berger ärgerlich.
Der Uniformierte verstand ihn nicht oder wollte ihn nicht verstehen. »Sie können hier nicht durch!«, wiederholte er. »Gehen Sie bitte zurück und verlassen Sie den Bahnhof über den Südsteg.«
Berger hielt dem Mann seinen Dienstausweis vor die Nase und drängte sich an ihm vorbei. Immerhin war die Schutzpolizei alarmiert worden, das war gut. Die Wandelhalle war aber keineswegs verlassen. Polizei und Feuerwehr bemühten sich ohne allzu große Hast, die Menschen nach draußen zu schicken. Der große Zeiger der Bahnhofsuhr sprang auf die Zwölf. Nichts geschah.
Zwei Männer vom Kampfmittelräumdienst standen unschlüssig mitten in der Halle. Berger kannte die beiden. Sie hatten ihm einst ein Metallsuchgerät ausgeliehen, als er seinen Trauring verloren hatte. »Was machen Sie denn hier?«, fragte der eine.
Berger zuckte mit den Achseln. »Das ist ein Fall für die Kriminalpolizei, denke ich.«
»Später vielleicht, wenn es hier wirklich kracht, aber bis jetzt haben wir keine Anzeichen dafür.«
Die beiden Männer wussten jedenfalls, was der unbekannte Anrufer am Telefon gesagt hatte. »Er hat sich kurzgefasst. ›Hier ist Roy Clark‹, hat er nur gesagt. ›Hauptbahnhof. In einer Viertelstunde geht die Bombe hoch.‹«
»Die Bombe hat Verspätung«, stellte Berger fest.
In diesem Augenblick explodierte der Sprengsatz. Berger zuckte zusammen. Es war keine besonders heftige Explosion, aber dass etwas explodiert war, daran bestand kein Zweifel. Aus einem der Schließfächer drüben drang beißender, schwarzer Qualm, und es roch nach abgebranntem Feuerwerk. Berger dachte: Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Wenn das alles ist, haben wir Glück gehabt.
Der Kampfmittelräumdienst war anderer Ansicht. Der zuständige Einsatzleiter drang energisch darauf, dass die Bahnhofshalle, die sogenannte Wandelhalle, jetzt sofort geräumt wurde. Auch das Personal aus den Läden musste nach draußen. Berger ging in die Gegenrichtung, um den Ort der Explosion in Augenschein zu nehmen. Die Tür eines der Fächer war aufgesprungen. Schließfach 134. Ein Feuerwehrmann packte mit Schutzhandschuhen zu und zog eine Aktentasche nach draußen. Die Tasche selbst war kaum beschädigt, aber der Inhalt war vollständig verkohlt.
»Alle Schließfächer aufmachen«, verlangte der Mann vom Kampfmittelräumdienst. »Wir müssen sicherstellen, dass da nicht noch weitere Bomben drin sind.«
Aber es gab keine weiteren Bomben.
»Na, was sagen Sie dazu, Herr Hauptkommissar?«, fragte der Mann mit den Handschuhen.
»Es riecht nach Feuerwerk«, sagte Berger.
»Ja, Feuerwerk. Schwarzpulver ist das, was hier verbrannt ist. Damit kann man eine Menge Schaden anrichten, wenn man es richtig macht. Aber wer auch immer diese Bombe hier deponiert hat, der hat nicht gewusst, wie man es richtig macht. Das meiste Pulver ist einfach nur verbrannt und nicht explodiert.«
Eine Stunde später war die Wandelhalle schon wieder geöffnet. Nur der Bereich mit den Schließfächern blieb abgesperrt. Die Spurensicherung suchte nach Fingerabdrücken. Feierabend, dachte Horst Berger. Eigentlich war es Zeit, nach Hause zu gehen. Aber er musste zurück ins Präsidium, Bericht erstatten, einen Schlachtplan für den nächsten Tag entwerfen.
Es war fast Mitternacht, als er sich auf den Heimweg machte. Kurz erwog er, noch bei seinem Vater und seiner Halbschwester Susanne vorbeizuschauen. Er verwarf den Gedanken aber. Er wollte jetzt mit niemandem diskutieren. Er wollte schlafen.
Die kleine Wohnung im Universitätsviertel hatte Horst von seinem Sohn übernommen, als Michael nach Berlin gegangen war. Sie lag im Hinterhof eines der alten Häuser am Mittelweg, war klein, aber frisch renoviert und seit Irmi weg war für seinen Bedarf vollständig ausreichend. Der Vermieter hatte wahrscheinlich gedacht, dass dort ein Student einziehen würde, aber ein Polizist war ihm hochwillkommen. Da war jedenfalls sicher, dass die Miete pünktlich bezahlt wurde. Wenn der Vermieter gewusst hätte, wie wenig ein Polizist verdiente, hätte er vielleicht doch lieber einen Studenten genommen.
Horst öffnete den Briefkasten. Zwei Briefe. Der eine kam von der Besoldungsstelle und enthielt die Gehaltsbescheinigung, der andere kam von der Haspa und informierte ihn über den aktuellen Stand seines Girokontos. Jetzt, nach Eingang des Weihnachtsgeldes, sah es gar nicht so schlecht aus. Aber im Januar war die Kfz-Versicherung fällig. Das war der Moment, in dem er sich jedes Jahr wieder die Frage stellte, ob er eigentlich ein Auto brauchte. Er hatte diese Frage bisher immer mit Ja beantwortet, obwohl natürlich das Präsidium mit der S-Bahn problemlos zu erreichen war.
Es war kalt im Zimmer. Das Fenster stand auf Kipp. Horst schloss es und drehte die Heizung auf. Er nahm das Butterbrot aus der Aktentasche, welches er vorhin aus der Kantine mitgebracht hatte. Es schmeckte ihm nicht. Die Butter war zu dick aufgetragen, die Mettwurst zu alt. Ein Blick in den Kühlschrank. Eine letzte Flasche Astra. Mist, dachte Horst. Alles Mist.
Er hatte alles verpatzt. Irmi – er hatte die Chance versäumt, sich mit ihr zu versöhnen. Jetzt war sie aus Aumühle weggezogen, und in der Sparkasse wusste niemand, wo sie geblieben war. Zumindest sagte es ihm niemand. Das Einzige, was geblieben war, war ihr Foto. Horst hatte es mit Heftzwecken an die Wand gepinnt. Und da war sie nun, Irmi, und guckte leicht spöttisch auf ihn herab.
Freitag, 9. Dezember 1966
Lagebesprechung. Alle waren müde. Haydn gähnte. »Wir wissen inzwischen etwas genauer, wie die Bombe gebaut war«, erklärte der Mann von der Spurensicherung. »Als Sprengstoff hat der Täter eine Mischung aus Salpeter, Kaliumchlorat, Schwefel, Puderzucker, Kohlenstaub und Sägemehl benutzt …«
»Und drei Eier«, sagte Wilfried Pagels.
Der Spezialist blickte irritiert auf.
»Das Ganze klingt nach einem Kuchenrezept«, behauptete Pagels. »Nur die Eier fehlen.«
»Bitte, Herr Pagels! – Die Sprengladung war in einer Caro-Kaffeedose untergebracht …«
»Sag ich doch! Kaffee und Kuchen!«
Horst stieß Wilfried an. »Sei still!«
»Die Dose war zusammen mit Kleidungsstücken in einer Aktentasche untergebracht. Als Zeitzünder dienten ein Reisewecker und eine Taschenlampenbatterie.«
»Das klingt nicht besonders professionell«, stellte Berger fest.
»Ja und Nein. Einerseits ist Schwarzpulver aufgrund seiner geringen Brisanz nicht besonders gut geeignet, wenn man mit seiner Bombe größere Schäden anrichten will. Andererseits sind die Dinge, die ich Ihnen eben beschrieben habe, relativ leicht erhältlich und daher für private Bombenbastler wahrscheinlich attraktiv.«
»Die Brisanz …«, hakte Berger nach.
»Entschuldigung, ich vergaß, dass Sie nicht vom Fach sind. Die Brisanz, das ist das Zertrümmerungsvermögen eines Sprengstoffs. Und da gibt es erhebliche Unterschiede. Wenn Sie einen hochbrisanten Sprengstoff nehmen, also zum Beispiel Nitroglyzerin oder TNT, dann haben Sie eine Detonationsgeschwindigkeit von zehntausend Meter pro Sekunde. Wenn Sie dagegen Schwarzpulver verwenden, dann explodiert das nur mit vierhundert Meter pro Sekunde.«
»Also ist es sicherer in der Handhabung als zum Beispiel TNT?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Im Gegenteil. TNT und viele andere moderne Sprengstoffe können Sie bloß mit einem speziellen Initialzünder zur Detonation bringen. Schwarzpulver zündet viel leichter. Insofern reichte die Verwendung des Weckers und der Batterie aus, um die Ladung zu entzünden. Bei der Wirkung einer Sprengung mit Schwarzpulver kommt es allerdings auf die Verdämmung an, wenn das Pulver nicht nur abbrennen, sondern auch explodieren soll. Und daran ist unser Attentäter gescheitert. Eine Caro-Kaffeedose reicht einfach nicht aus. «
»Wie ist der Mann überhaupt an das Schwarzpulver gekommen?«, fragte Roeder.
»Das ist kein Problem. Jeder kann sich ohne große Mühe Schwarzpulver beschaffen. Es ist zum Beispiel in ganz normalen Feuerwerkskörpern enthalten. Wenn man also zu Silvester ein paar Mark mehr ausgibt und sich entsprechend viele Kanonenschläge kauft, dann kann man sich daraus eine Bombe basteln. Das ist der Weg, den ein Amateur wahrscheinlich einschlagen würde. Relativ umständlich. Aber man kann das Schwarzpulver auch in größeren Mengen ganz normal käuflich erwerben, wenn man zum Beispiel Mitglied in einem Vorderlader-Schießsportverein ist. Für Vorderlader braucht man das Pulver. Die Genehmigung für den Erwerb stellt das örtliche Landratsamt aus. In Hamburg gibt es kein Landratsamt, hier wäre das Amt für Arbeitsschutz zuständig.«
»Haydn, stellen Sie fest, wie viele solche Genehmigungen in den letzten Jahren erteilt worden sind.«
Kommissar Haydn schreckte hoch. Er hatte ganz offensichtlich geträumt.
»Und an wen«, fügte Berger sicherheitshalber hinzu.
Inzwischen war die neueste Ausgabe des Hamburger Abendblattes eingetroffen. Trudchen, die Sekretärin, brachte ein Exemplar. »Ihr habt es wieder nicht bis auf die Titelseite geschafft«, sagte sie.
»Ja, das reicht natürlich nicht«, lästerte Pagels. »Einfach nur den Hauptbahnhof in die Luft sprengen, das reicht heutzutage nicht mehr. Da muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen.«
Trudchen lachte. Nebenan klingelte das Telefon. »Ich komme, ich komme!« Sie eilte davon.
Horst Berger blätterte in der Zeitung. »Immerhin stehen wir auf Seite drei«, stellte er fest. Es war ein sehr knapper Bericht, der mit den Sätzen endete: Die Ermittlungen nach dem Täter sind noch nicht abgeschlossen. Vermutlich handelt es sich um einen Mann, der sich einen üblen Scherz erlaubt hat. Horst deutete auf den Text. »Wer hat sich denn das ausgedacht? Von uns stammt das nicht!«
»Das stammt von mir.« Kriminalrat Petersen war durch die offene Tür ins Zimmer getreten. »Unser oberstes Ziel muss es sein, jede Panik zu vermeiden. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit der Schutzpolizei und der Feuerwehr das Aufsehen gering zu halten, das dieser kleine Vorfall im Hauptbahnhof hervorgerufen hat. Der Bahnverkehr ist sicher, das soll auch dem letzten Bürger klar sein.«
Horst runzelte die Stirn. Ewald Petersen war nicht unsympathisch, aber er war ein Freund einsamer Entscheidungen.
»Herr Berger, Sie machen den Eindruck, als ob Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind.«
Berger nickte. »Ich halte dieses Vorgehen für falsch. Ich halte es für wichtig, dass wir der Bevölkerung die Wahrheit sagen. Der Sprengstoff hätte ausgereicht, um erheblichen Schaden anzurichten, und es hätte leicht Verletzte oder gar Tote geben können. Das kann das nächste Mal ganz anders ausgehen.«
»Sollen die Leute denn nicht mehr mit der Bahn fahren?«
»Doch, aber sie sollen ganz einfach wissen, woran sie sind.«
Der Kriminalrat schüttelte den Kopf. »Wir wissen ja selbst nicht, woran wir sind. Wenn Sie wirklich etwas für die Bevölkerung tun wollen, dann sorgen Sie dafür, dass es kein nächstes Mal gibt. Finden Sie den Täter, nehmen Sie ihn fest. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.« Er schlug die Tür hinter sich zu.
Im nächsten Moment betrat Trudchen das Zimmer. »Ist er weg?«
Pagels lachte.
»Es ist eben ein Anruf von der Bundesbahndirektion gekommen. Der ist bei mir gelandet, und ich hatte das Gefühl, dass es im Augenblick nicht sehr sinnvoll wäre, wenn ich das Gespräch direkt an Sie weiterleite.«
»Ja«, sagte Berger knapp.
»Hier herrscht gerade schlechte Stimmung«, erläuterte Pagels. »Wundern Sie sich also nicht, wenn unser Kollege Berger morgen das Präsidium in die Luft sprengt. Teilen Sie dann einfach der Presse mit, es habe sich vermutlich um einen Scherz gehandelt.«
»Oh. – Jedenfalls gibt es eine wichtige Neuigkeit. Die Bundesbahndirektion hat in ihren Unterlagen nachgeforscht und dabei eine Art Erpresserbrief gefunden. Die Herrschaften glauben, dass der für uns von Interesse sein könnte.«
»Erpressung«, sagte Berger. »Da haben wir das Motiv.«
Die Besprechung fand in der Bundesbahndirektion in der Museumsstraße in Hamburg-Altona statt. Horst Berger war verblüfft über die Größe der Anlage. Während Pagels das Modell einer Dampflokomotive bestaunte und Roeder versuchte, sich auf der Übersichtstafel zurechtzufinden, wandte sich Horst direkt an den Hausmeister: »Entschuldigen Sie, wo finden wir den Kleinen Sitzungssaal?«
»Ich bringe Sie eben hin, das ist am einfachsten.«
Sie waren nur zu fünft. Die beiden Vertreter der Bundesbahn stellten sich vor und begrüßten die Polizisten mit Handschlag. Rutter war als Abteilungsleiter für den Betriebsablauf zuständig, Ronsdorf für Bau, Unterhaltung und Fahrzeuge.
»Ich nehme an, Sie trinken einen Kaffee?«, fragte Rutter. Er hatte eine seidenweiche Stimme.
»Für mich bitte einen Tee«, sagte Roeder.
Rutter rief eine Sekretärin, die sich um den Tee kümmern sollte. Der Kaffee stand in zwei großen Kannen bereit.
Horst Berger sagte: »Sie hatten also doch einen Erpresserbrief bekommen. Ist das richtig?«
»Zwei sogar. Der erste kam am 15. Oktober. Aber den haben wir nicht ernst genommen. Das sah aus wie der Scherz eines kleinen Kindes. Sehen Sie selbst!«
Auf dem Umschlag stand in unbeholfener Sütterlin-Schrift:
An die
Bundesbahndirektion
Hamburg
Es war ein ganz gewöhnlicher, ungefütterter Briefumschlag billigster Sorte. Die Briefmarke zeigte das Brandenburger Tor in Grün. Zwanzig Pfennige. Der Brief war unterfrankiert; seit dem 1. April 1966 waren dreißig Pfennige zu zahlen. Er war dennoch glatt durchgelaufen. Der Brief war abgestempelt in Buxtehude 1, auf dem Stempel neben der Briefmarke stand Heimatstadt von Has’ und Swinegel. Im Gegensatz zu der Adresse war der Text im Inneren des Briefes mit sehr ungelenken, großen Druckbuchstaben geschrieben. Der Text lautete:
ROY CLARK
HAMBURG
EIN NEUER KUP. BAHNUNTERFÜHRUNG
BEI STELLE-MASCHEN
WENN ZUG NICHT ENTGLAIST IST
HABT IHR NOCH MAL GLÜK GEHABT
NÄCHST MAL WIRD SCHLIMMER
Und
ES WIRD GEBETEN
JEDER EINE
DA DIESEN BRIEF BEKOMMT
IN HÄND - ZU ÖFFNEN
UND WEITERLEITEN
MENSCHENLEBEN IN GEFAHR
»Aber es hat im Oktober keinen Anschlag gegeben?«, fragte Horst zur Sicherheit nach.
»Nein. – Und dann kam der zweite Brief.«
»Wann?«
»Am 4. Dezember. Ein Brief, in dem Geld verlangt wurde.«
»Das war vier Tage vor dem Anschlag im Hauptbahnhof«, stellte Berger fest. »Warum haben Sie uns nicht informiert?«
»Wir haben den Brief ebenfalls nicht ernst genommen.«
»Der zweite Erpresserbrief in kurzer Folge? Und den haben Sie nicht ernst genommen?«
Rutter nickte. »Und als wir gestern den Anruf bekommen haben, habe ich zunächst geglaubt, dass das auch nur ein Scherz sein könne, aber jetzt nach der Explosion …«
Horst ärgerte sich. Der Kerl war aalglatt. »Aber als dann die Bombe im Hauptbahnhof explodiert ist, da müssen Sie doch den Zusammenhang gesehen haben?«
»Ja.«
Ronsdorf räusperte sich. Der Mann hatte sich bisher noch gar nicht geäußert. Jetzt sagte er: »Sie wundern sich vielleicht über unsere langsame Reaktion. Wir sind ein staatliches Unternehmen, wir gehören zum Sondervermögen des Bundes. Unser oberstes Ziel ist die Dienstleistung. Schnelle Entscheidungen sind nicht gefragt. Und mit Kriminalität haben wir normalerweise nichts zu tun.«
Sie haben versucht, die Erpressung zu ignorieren, dachte Berger. Jetzt ließ sie sich nicht länger ignorieren. »Der Anruf bei der Zeitung belegt jedenfalls, dass der Anschlag auf diesen Roy Clark zurückgeht«, sagte er.
Freitag, 9. Dezember 1966
Alexander Bordan Dobruck, geboren am 1.5.1927 in Celle, 1,67 m groß, staatenlos, so stand es in seinem Fremdenpass. Waltraud war verblüfft gewesen, als sie zum ersten Mal das blassblaue Dokument ihres späteren Mannes gesehen hatte. »Warum hast du keinen grauen Personalausweis wie wir alle?«
»Ich bin staatenlos«, hatte Alexander geantwortet.
»Staatenlos? Was soll das heißen?« Damit konnte Waltraud nichts anfangen. Ihrer Meinung nach gehörte jeder Mensch in irgendeinen Staat. Und wer Deutsch sprach und in Deutschland lebte, der war eben ein Deutscher.
»Das reicht nicht aus«, sagte Alexander. »Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber ich bin trotzdem kein Deutscher. Mein Vater stammt aus dem heutigen Polen. Als er geboren wurde, gehörte das Dorf in Galizien, aus dem er stammte, noch zu Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel es an Polen. Meine Mutter hieß ursprünglich Maria Kydrowski. Das ist ein polnischer Name. Aber die Polen wollten uns nicht haben. Die ukrainische Minderheit sollte verschwinden. Schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges haben Hitler und Stalin Galizien unter sich aufgeteilt. Und die Deutschen wurden 1939/40 ins Reich umgesiedelt. So sind meine Eltern aus Galizien nach Deutschland gekommen. Sie sprachen Deutsch, aber sie waren gar keine Deutschen. Der Staat, in dem sie gelebt hatten, der existierte nicht mehr. So waren sie auf einmal staatenlos.«
»Das stelle ich mir furchtbar vor, wenn man nirgendwo zu Hause ist«, sagte Waltraud.
Alexander nickte. »Es war gewiss nicht leicht. Und hinzu kam, dass meine Eltern nicht besonders gut Deutsch sprachen. So konnte mein Vater nur als ungelernter Arbeiter anfangen. Er hat in Celle bei der Eisenbahn gearbeitet.«
»Bei der Reichsbahn«, vermutete Waltraud. Alexander schüttelte den Kopf. »Nicht bei der Reichsbahn. Die hatten ihn nicht haben wollen. Aber bei der Kleinbahn Celle-Wittingen, da konnte er anfangen. Und so kam es, dass meine Eltern nach Celle gezogen sind, und da bin ich dann auch geboren worden.«
»Kleinbahn?«, fragte Waltraud. So etwas kannte sie nur aus dem Lied von Bolle. Sie sang leise:
»Die Kleinbahn hat Verspätung,
und 14 Tage drauf,
da fand man unsern Bolle
als Dörrgemüse auf.«
Alexander fand das nicht witzig. »Die Kleinbahn war in Wirklichkeit eine ganz normale Eisenbahn«, sagte er. »Keine Schmalspurbahn, wie man sie vielleicht in irgendwelchen Kiesgruben findet, sondern alles Normalspur. 1,43 Meter und fünf Millimeter. Genau wie die Reichsbahn auch. Genau wie die heutige Bundesbahn. Der einzige Unterschied bestand in der Bezahlung. Mein Vater hat weniger Geld gekriegt. Er war ja nicht beim Staat angestellt, sondern bei einer privaten Eisenbahngesellschaft.«
»Aber ihr seid durchgekommen«, stellte Waltraud fest.
»Mehr schlecht als recht«, brummte Alexander. Natürlich hätten sie viel leichter mit dem Geld auskommen können, wenn sein Vater nicht angefangen hätte zu trinken. Aber diesen Punkt wollte er jetzt nicht ansprechen. Er trank ja selbst zu viel. Und seine eigenen finanziellen Verhältnisse waren ziemlich unerfreulich.
»1927 geboren.« Waltraud rechnete. »Dann bist nicht mehr im Krieg gewesen, oder?«
Doch, er war im Krieg gewesen. Anfangs hatten sie ihn nicht haben wollen, weil er ja kein Deutscher war. Aber später wurde jeder gebraucht, und da spielte seine Staatenlosigkeit keine Rolle mehr. Er sprach ja Deutsch, war gesund und damit wehrtauglich. »Als sie mich schließlich eingezogen haben, da war der Krieg schon fast vorbei. Ich bin zunächst nach Neumünster gekommen, und da haben sie mich zum Soldaten ausgebildet. Eigentlich hätten wir ja nach der Ausbildung direkt an die Front gehen sollen, aber irgendjemand an höherer Stelle hat anders entschieden, und wir wurden alle nach Dänemark geschickt, zur Flak nach Kollund.«
Waltraud wusste nicht, wo Kollund lag.
»Zwischen Flensburg und Sonderburg«, erläuterte Alexander. »Und da haben die Engländer uns dann schließlich gefangen genommen. Keiner wusste, was weiter passieren würde. Es gab die tollsten Gerüchte. Angeblich sollten wir als so eine Art Arbeitssklaven eingesetzt werden, um all das wieder aufzubauen, was die deutsche Luftwaffe in England zerstört hatte. Aber dazu hatte ich nicht die geringste Lust. Da bin ich abgehauen.«
»Zu deinen Eltern«, vermutete Waltraud.
Alexander schüttelte den Kopf. »Ich habe einen großen Bogen um Celle gemacht«, sagte er. »Ich hatte ja keine Entlassungspapiere, und falls die Engländer nach mir fahnden sollten, dann würden sie mich natürlich bei meinen Eltern zuerst suchen. Nein, ich bin direkt nach Süddeutschland, in die französische Zone, weg von den Engländern. Im Suff habe ich dann einen Fünfjahresvertrag bei der Fremdenlegion unterschrieben. So kam ich schließlich nach Indochina.«
Alexander wusste inzwischen, dass seine Frau an seinen Erlebnissen in der Fremdenlegion nicht wirklich interessiert war. Er hatte ihr nur von dem erzählt, was beim oberflächlichen Hinsehen von Bedeutung war. Vom Geld. In Indochina, als er im Norden, in Tongking eingesetzt war, hatte er achttausend Piaster im Monat bekommen. Das waren ungefähr tausendsechshundert D-Mark. Da keine Kosten für Unterkunft und Verpflegung anfielen, hätte er ein kleines Vermögen sparen können. Es gab Kameraden, die das tatsächlich machten. Einer der Unteroffiziere hatte ihm erzählt, dass er in jedem Monat dreitausend Piaster auf eine französische Bank in Paris überwies. Der Betrag, den er dort inzwischen angespart hatte, betrug mehr als zwei Millionen französische Franc. Fünfundzwanzigtausend D-Mark waren das. Davon wollte er später in Deutschland ein Geschäft eröffnen. Später. Wenn es denn ein Später gab.
»Und was hast du gemacht mit dem vielen Geld?«, fragte Waltraud jetzt.
»Ich habe keine dreitausend Piaster auf die Bank überwiesen. Ich habe überhaupt kein Geld irgendwohin überwiesen. Ich habe es ausgegeben. Für Zigaretten, für Alkohol, für leichte Mädchen. Irgendeinen Ausgleich brauchte man doch dafür, dass man dort in Indochina in der Tropenhitze Tag für Tag sein Leben riskierte.« In Wirklichkeit hatte er Glück gehabt. Die meiste Zeit war er nicht unmittelbar an der Front gewesen, und die meiste Zeit geschah gar nichts. Man stand irgendwo auf Posten und wartete, bis man abgelöst wurde. Nur einmal hatte er einen Fallschirmjägereinsatz mitgemacht. Das Dorf, über dem sie abgesprungen waren, war von den Vietminh besetzt worden …
»Vietminh?« Waltraud wusste nicht, wovon er redete.
»Kommunistische Partisanen«, erläuterte Alexander. »Freiheitskämpfer für die einen, Mörder für die anderen, je nachdem, auf welcher Seite man stand.« Dieser Einsatz hatte ihm von Anfang an nicht gefallen. Es war offensichtlich sinnlos gewesen, dieses unbedeutende Dorf zurückzuerobern, noch dazu kurz vor der Regenzeit. Aber irgendein deutscher Weltreisender, der sich mit dem Fahrrad bis nach Indochina durchgeschlagen hatte, hatte gefragt, ob er einen Einsatz der Expeditionsarmee sehen könne, und so hatte das Oberkommando diese Aktion angeordnet. Sie hofften natürlich auf einen positiven Bericht in der deutschen Presse über das Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. »Das Dorf war verlassen, aber schon als wir unter unseren Fallschirmen langsam in Richtung der Reisfelder schwebten, setzte Beschuss ein. Ich bin kein Held. Ich bin in Deckung gegangen, genau wie dieser Weltreisende. Helfgen hieß er. Heinz Helfgen. Als das Schießen aufhörte, sind wir hinter den Kameraden her, die irgendwo im angrenzenden Dschungel ein Lager von Waffen und Munition vermuteten. Die Vermutung war richtig. Wieder fielen Schüsse, und schließlich winkte einer der vorderen Männer mit den Armen und rief: ›Hierher! Hier ist es!‹ Sie hatten das geheime Lager entdeckt. Der Mann sah schaurig aus. Er hatte einen Streifschuss abbekommen, und das Blut lief ihm über das Gesicht.«
»Bist du auch verwundet worden?«, wollte Waltraud wissen.
»Ja«, sagte Alexander knapp. Da sie die Waffen und die Munition nicht mitnehmen konnten, mussten sie alles, so gut es eben ging, unbrauchbar machen. Die Männer fluchten. Die Beschriftung der Kisten zeigte, dass es Material war, das die Amerikaner geliefert hatten, und das die Vietminh den Franzosen bei irgendeinem Überfall abgenommen hatten. Und es war zu viel Material. Die Zeit lief ihnen davon. Über Nacht hier draußen zu bleiben, das war lebensgefährlich. Geradezu selbstmörderisch. Sie mussten jetzt zurück ins Dorf. Es war verabredet, dass am Nachmittag ein paar Panzer über die Route Coloniale 4 zu ihnen vordringen und sie abholen würden.
»Ein alter Mann hatte erschrocken gefragt, ob wir bleiben würden. Vielleicht war das derjenige gewesen, der uns die Lage des Waffenlagers verraten hatte. Natürlich waren wir nicht geblieben. Wir waren erleichtert gewesen, als wir bei Einbruch der Dunkelheit endlich am Ziel ankamen. Die Panzerfahrer hatten einige der Reservekanister mit Rotwein gefüllt. So wurde es noch ein sehr netter Abend.«
»Mir scheint, ihr habt viel Spaß gehabt in Indochina«, sagte Waltraud.
»Spaß?« Absolut nicht, dachte Alexander. »Am nächsten Morgen kamen wir endlich aus dem Dschungel heraus und zurück auf die Ebene. Niemand brauchte mehr zu marschieren; wir fuhren auf den Panzern mit. Wir waren in Sicherheit. Jedenfalls glaubten wir das. Plötzlich stieß mich mein Nebenmann an. Er deutete nach vorn. ›Da brennt irgendetwas!‹ Es war ein Außenposten unserer Expeditionsarmee. Die Reste davon. Der Wachturm war vollkommen abgebrannt. In den schwelenden Trümmern des kleinen Lagers fanden wir vier tote Schwarze, französische Soldaten aus dem Senegal, und die halb verkohlte Leiche eines vietnamesischen Mädchens. Dreißig Mann waren hier stationiert gewesen. Wir suchten die Umgebung nach Überlebenden ab. Wir suchten lange. Wir fanden niemanden.«
»Das reicht«, sagte Waltraud. Von solchen Dingen wollte sie nichts hören. Von solchen Dingen wollte überhaupt niemand etwas hören. Fast jeder hatte noch seine eigenen schrecklichen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, und der lag ja erst wenige Jahre zurück.
Die Fremdenlegion hatte Alexander Dobrucks Leben ruiniert.
»Als ich nach Deutschland zurückkam, da bin ich zuerst einmal zu meinen Eltern nach Celle gegangen. Aber, um es kurz zu machen, wir haben uns nicht verstanden. Sie waren inzwischen Deutsche geworden, hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, und ich, ich war gar nichts. Nicht nur hatte ich diesen lächerlichen Fremdenpass, sondern obendrein war ich in der Fremdenlegion gewesen, und das war hier in der Bundesrepublik Deutschland keine Empfehlung. In der Fremdenlegion, so hieß es, da gäbe es doch nur Verbrecher und Taugenichtse.«
Sonnabend, 11. Dezember 1966, abends
Susanne saß vor dem Radio. Selbstvergessen sang sie mit:
»… as the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale …«
Wilhelm Berger warf einen Blick auf die Skala. »AFN?«
Susanne zuckte zusammen. Sie hatte sich auf die Musik konzentriert und ihren Vater nicht kommen hören. »Ja, AFN Bremerhaven. Die deutschen Sender bringen ja keine vernünftige Musik. Und Radio Luxemburg kriegen wir hier nicht rein.«
»Ich wollte dich nicht stören. Dein Bruder hat angerufen, er kommt etwas später.«
»Ja, das habe ich mir schon gedacht. Horst kommt meistens später. Wenn er überhaupt kommt.« Susanne schob die Taube aus Porzellan zur Seite und drehte das Radio leiser.
Wilhelm lächelte. »Manchmal denke ich, es ist noch gar nicht lange her, dass du als ein kleines, wildes Mädchen ausgelassen zu irgendeiner Jazzmusik durchs Haus getanzt bist.«
»Dreißig Jahre.« Susanne lächelte auch, aber es lag etwas Wehmütiges in ihrem Ausdruck. »Negermusik hast du das damals genannt«, sagte sie. »Das fand ich lustig. Aber das Leben ist nicht mehr dasselbe wie damals. Es hat sich so vieles verändert. Die Jahre in Amerika – ich bin nicht mehr dieselbe wie damals, als ich hier bei euch in Hamburg aufgewachsen bin.«
»Jedenfalls warst du in Sicherheit.«
»In Sicherheit, ja.« Sie war kein kleines Kind mehr gewesen, und sie hatte sehr wohl begriffen, dass es richtig war, dass Wilhelm und Dagmar, ihre Mutter, sie nach Amerika geschickt hatten. Dennoch hatte sie es ihnen lange Zeit nicht verziehen.
»Es war ein Handstreich«, erinnerte sich Wilhelm. »Wir waren uns ja keineswegs sicher, ob dein Vater dich wirklich aufnehmen würde. Wir haben ihm zwei Telegramme geschickt, aber erst, nachdem du längst mit der Bremen auf dem Weg nach New York warst, ganz kurz vor deiner Ankunft. Und einen Brief mit ein paar zusätzlichen Erklärungen auch.«
Susanne nickte. Sie hatte bisher sehr wenig über ihre Zeit in Amerika erzählt, und Wilhelm hatte sie nicht gedrängt. Aber jetzt war es Zeit, dass sie ein paar Dinge klarstellte. »Sie haben mich freundlich aufgenommen«, sagte sie. »Das muss ich sagen. Aber echte Liebe war da natürlich nicht. Mein Vater hatte ja neu geheiratet, und da gehörte ich einfach nicht dazu. Und später hatten die beiden dann noch einen eigenen Sohn. George. Er ist 1947 geboren. Ein süßes Kind. Mein neuer Bruder, sechzehn Jahre jünger als ich. Es war ein seltsames Gefühl. Ich war mir sehr deutlich der Tatsache bewusst, dass ich jetzt endgültig draußen war, in der Fremde, im wahrsten Sinne des Wortes.«
»Es musste sein damals«, sagte Wilhelm. »Aber es hat uns unendlich wehgetan.«
»Mir auch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man von den eigenen Eltern weggeschickt wird. Verstoßen. So habe ich mich jedenfalls gefühlt. Und dann, dann komme ich zu jemandem, von dem ich weiß, dass es in Wirklichkeit mein Vater ist, aber das war ein Mann, den ich überhaupt gar nicht kannte, und das Einzige, was ich wirklich von ihm wusste, das war, dass er mich schon einmal verstoßen hatte, ohne mich überhaupt je gesehen zu haben. Und mir war vollkommen klar, dass er mich jetzt auch nicht haben wollte.«
Wilhelm Berger seufzte.
Susanne fuhr fort: »Jenny, die neue Frau meines Vaters, die hatte Mitleid mit mir, mit dem armen Judenmädchen aus Deutschland. Das war noch schwerer zu ertragen. Ich bin ausgezogen, sobald ich mit der Schule fertig war. Meine amerikanischen ›Eltern‹ haben mich finanziell weiter unterstützt, aber es war unübersehbar, dass sie beide froh waren, dass ich endlich weg war. Ich habe nur noch wenig Kontakt zu ihnen. Weihnachten natürlich. Wir haben Weihnachten immer zusammen gefeiert. Das war eine Qual, denn ich habe immer gedacht, dass ich jetzt eigentlich bei euch in Deutschland sein und mit euch Weihnachten feiern sollte.« Sie dachte dabei an das heile Zuhause, bevor sie Deutschland verlassen hatte.
»Du hast studiert«, sagte Wilhelm.
»Ja, das habe ich. Aber ich habe studiert ohne Ziel. Ich wollte nicht Lehrerin werden oder Anwältin, oder was man sonst so werden konnte. Er war klar, dass ich Geld verdienen musste, um unabhängig zu sein und zu bleiben. Das habe ich gemacht. Ich habe in der Universität in der Cafeteria gearbeitet. Es war eine nette Arbeit, aber reich geworden bin ich nicht dabei.«
»Und heiraten wolltest du nicht?«
Susanne lachte. »Das ist typisch, dass Eltern immer denken, man müsste heiraten. Als wäre das das Ziel im Leben. Aber das ist nicht wahr. Das Leben selbst ist das Ziel, und ob man nun heiratet oder nicht, das ist egal.«
Wilhelm Berger schwieg. Für ihn war die Ehe mit Dagmar das Größte gewesen, das Beste, was er je im Leben erreicht hatte. Aber Dagmar war tot.
»Du musst nicht denken, dass ich einsam gewesen bin da drüben. Ich hatte viele Freundinnen und Freunde. Und dann war da noch mein Bruder George. Mein Halbbruder. Wir haben immer Kontakt gehalten. Wir haben viel zusammen unternommen.«
»Was macht George jetzt?«
»Er hat auch studiert«, sagte sie. »Das heißt, er hat angefangen zu studieren. Dann ist er eingezogen worden. Amerika ist ja im Krieg. In Illinois merkt man nicht viel davon, aber die USA sind im Krieg gegen die Kommunisten in Vietnam. Inzwischen ist da schon eine halbe Million amerikanischer Soldaten im Einsatz. Fast so viele wie im Zweiten Weltkrieg in Europa. Studenten können von der Wehrpflicht zurückgestellt werden, aber George hat nicht zielstrebig genug studiert, und so wurde er schließlich eingezogen. Seit einem knappen halben Jahr ist er drüben.«
»Hätte er sich dem nicht entziehen können, indem er zum Beispiel nach Kanada gegangen wäre?«
»Darauf muss ich wohl mit einer Gegenfrage antworten, Wilhelm. Hättest du dich dem Dienst in der Wehrmacht nicht auch entziehen können, indem du das Land verlassen hättest?«
»Du hast recht. Ich habe es nicht getan, aber es wäre die richtige Entscheidung gewesen.«
»Du hast dich damals so entschieden, und George hat sich heute ganz ähnlich entschieden. Weißt du, es ist eine ziemlich harte Sache, wenn du dich dem Wehrdienst entziehst, indem du ins Ausland gehst. Du stellst dich gegen alle, gegen deine Freunde und Verwandten und Bekannten. Du stehst auf einmal ganz allein da. Es ist unendlich viel leichter, genau das zu tun, was alle anderen auch tun, auch wenn man weiß, dass es eigentlich falsch ist. Jedenfalls höre ich AFN nicht nur wegen der Popmusik. Es ist auch der Sender, der die meisten Informationen über den Krieg in Vietnam bringt.«
»Ist das nicht nur Propaganda?«, fragte Wilhelm.
»Einiges ist Propaganda«, bestätigte Susanne. »Aber bessere Informationen gibt es nicht. Eine Zeitlang habe ich zusätzlich Radio Moskau gehört. Sie senden auf Mittelwelle in deutscher Sprache. Aber was die erzählen, das hat überhaupt keinen Bezug zur Realität. Reines Wunschdenken. Ich habe aufgehört, mir das anzuhören.«
»Kriegst du Post von George?«
Susanne nickte.
»Und wie ist es mit der Zensur?«
»Es gibt keine Zensur. Er kann schreiben, was er will.«
»Tatsächlich?« Wilhelm Berger hatte im Krieg andere Erfahrungen gemacht.
»Es gibt keine Zensur«, wiederholte Susanne. »Aber George schreibt trotzdem nicht, was er denkt. Die Zensur findet in seinem eigenen Kopf statt. Er schreibt nichts, von dem er glaubt, dass ich es nicht hören möchte. Was da drüben wirklich passiert, das werde ich erst erfahren, wenn ich mit ihm sprechen kann. Er schreibt, dass er vielleicht demnächst Urlaub bekommt. Dann könnten wir uns in Saigon treffen. Oder in Bangkok. Wo auch immer.«
Montag, 12. Dezember 1966
Am nächsten Tag meldete sich die Bundesbahn. »Neue Informationen sind aufgetaucht«, sagte Rutter am Telefon. »Können Sie mal bitte kurz rüberkommen?«
»Ich komme«, antwortete Horst Berger.
Diesmal waren sie nur zu zweit, und es gab nur eine Kanne Kaffee.
»Es geht noch einmal um die Briefe«, sagte Rutter. »Es ist mir sehr peinlich, aber es sind jetzt zwei weitere, ältere Erpresserbriefe aufgetaucht, die ganz offensichtlich auch zu dieser Serie gehören. Die stammen bereits aus dem Jahre 1959. Der erste Brief ist am 15.4.1959 bei der Bundesbahn-Direktion Frankfurt/Main eingegangen …«
»Vor sieben Jahren!«
Rutter tat, als hätte er den Vorwurf nicht wahrgenommen. »Ja. Es gab damals keine Reaktion, da der Text keine konkrete Forderung enthielt. Der Brief wurde nicht ernst genommen. Wir haben erst jetzt davon erfahren.«
»Haben Sie den Brief?«, fragte Horst.
»Nein, leider nicht. Dieser Brief liegt noch in Frankfurt. Aber der nächste Brief ging dann an uns, und darin schrieb der Mann dann, er habe das Vermächtnis des Helden Roy Clark aus dem Roman in der Bild-Zeitung übernommen und fordere dreihunderttausend D-Mark.«
»Haben Sie den Text? Was hat er genau geschrieben?«
»Hier, sehen Sie selbst.« Rutter legte den Brief auf den Tisch.
ICH BIN ERBE VON ROY CLARK AUS BILD-ZEITUNG: ZAHLT 300.000 DM SONST ZUG ENTGLAIST IN VOLLE TEMPO UND BLEIBT NIX WIE SCROT UND VIELE TOTE UND KRUEPEL.
»Und dann passierte sieben Jahre lang gar nichts?«, fragte Horst.
Rutter nickte. »Bis vor zwei Monaten. Am 15. Oktober haben wir dann erneut einen Brief bekommen. Das ist der Brief, den Sie ja schon kennen.«
»Aber, um das noch einmal ganz klar festzuhalten, es hat im Oktober keinen Anschlag gegeben?«, fragte Horst zur Sicherheit noch einmal.
Rutter schüttelte den Kopf.
»Und vorher auch nicht?«
»Nein.«
»Seltsam.«
»Und dann ist heute das nächste Schreiben gekommen …«
Horst starrte den Mann an. Von einem neuen Erpresserbrief war bisher noch nicht die Rede gewesen. Glatt gekämmte Haare, glatte Stimme, dachte er. »Kann ich das Schreiben mal sehen?« Es klang so scharf, wie Horst beabsichtigt hatte.
Rutter verzog keine Miene. »Bitte.« Er schob eine Umlaufmappe über den Tisch. Darin lag der Brief.
Der Text war ebenso kurz wie klar.
JEZ VERLANG ICH 120.000 MARK. UND WENN DIESE BOMBE AUCH NIX HILFT, DANN KOMMT NOCH EINE GRÖSERE BOMBE. ROY CLARK. DAS FANTOM.
Der Brief war am Vortag in Hamburg abgeschickt worden.
»Herr Rutter, so geht das nicht«, sagte Horst. »Wir können diesen Erpresser nur fassen, wenn wir hundertprozentig zusammenarbeiten. Wenn Sie Informationen zurückhalten, dann behindern Sie die Arbeit der Polizei.«
»Das ist selbstverständlich nicht unsere Absicht. Für die Verzögerungen bei der Übermittlung der Briefe kann ich mich nur entschuldigen …«
Horst schüttelte ärgerlich den Kopf. »Das reicht mir nicht. Nach dem, was ich jetzt hier erfahren habe, habe ich den Eindruck, dass Sie uns überhaupt nicht eingeschaltet hätten, wenn das Abendblatt nicht kurz vor der Explosion mit uns Kontakt aufgenommen hätte!«
»Nein. Nein, dieser Eindruck ist völlig falsch. Warum hätten wir so etwas tun sollen?«
»Um sich mit dem Erpresser zu einigen natürlich. Ohne die Polizei. Ohne großes Aufsehen. Sie hätten bezahlt, und damit wäre Ihrer Ansicht nach alles gut gewesen …«
»Nein.« Rutter war rot geworden.
»Aber das ist eine Illusion. Damit wäre nicht alles gut gewesen. Die Erpressung wäre weitergegangen. Das ist nämlich immer so. Bis Ihnen irgendwann der Kragen geplatzt wäre …«
»Nein, nein, nein! Das ist alles falsch! – Was kann ich tun, um Sie zu überzeugen, dass es nicht so gewesen ist?«
»Indem Sie es in Zukunft besser machen!« Horst Berger sammelte die Briefe ein, trank seinen Kaffee aus und ging zurück ins Präsidium.
Der Kriminalrat ließ sich über den Stand der Ermittlungen informieren. Es gab nicht viel, was sie Ewald Petersen berichten konnten.
»Das ›Fantom‹ behauptet, das Vermächtnis des Romanhelden Roy Clark übernommen zu haben«, sagte Horst.
Petersen schüttelte den Kopf. »Roy Clark? Wer soll das sein?«
»Der kommt aus der Zeitung. Ich habe mich inzwischen schlaugemacht«, sagte Horst. »Ich habe mit einem Redakteur der Bild-Zeitung gesprochen, und der hat mir erklärt, Roy Clark sei ein Erpresser und Bombenleger aus dem amerikanischen Roman Teufel am Telephon. Der ist im Februar und März 1959 in der Bild abgedruckt worden. Die Geschichte spielt in den USA. Es geht um einen Mann, der ein Kaufhaus erpresst. Der Erpresser heißt Roy Clark. Er kommt am Ende des Romans ums Leben.«
»Haben Sie den Roman?«, fragte der Kriminalrat.
Horst schüttelte den Kopf. »Bis jetzt noch nicht. Es ist gar nicht so einfach, an diese alten Sachen heranzukommen. Die Geschichte liegt ja immerhin schon ungefähr acht Jahre zurück. Ich habe bei Bild Hamburg angerufen; diese alten Zeitungen haben sie nicht mehr. Ich habe in der Staatsbibliothek nachgefragt. Dort gibt es zwar eine Kopie, aber die ist völlig zerlesen und wird nicht mehr herausgegeben. Sie soll mikroverfilmt werden, aber im Augenblick weiß niemand, wann das passieren wird. Die Staatsbibliothek hat kein Geld.«
Ewald Petersen schüttelte den Kopf. »Wir brauchen den Text trotzdem«, sagte er.
Horst nickte. »Wir werden ihn bekommen.«
»Gut.«
»Es gibt aber noch einen zweiten Weg«, sagte Horst. »Bei der Bild-Zeitung habe ich erfahren, dass der Roman Teufel am Telephon von zwei amerikanischen Autoren stammt: John und Ward Hawkins.«
»Kenne ich nicht.«
»Das Original ist gar kein Buch, sondern eine Fortsetzungsgeschichte, die unter dem Titel The Midtown Bomber in der Saturday Evening Post erschienen ist. Und zwar in fünf Folgen im Dezember 1958. Ich denke, dass wir uns auch dieses Original besorgen sollten.«
»Das halte ich für überzogen.«
»Ich habe bereits in Amerika angerufen und gebeten, dass man uns eine Kopie zuschickt.«
Der Kriminalrat starrte Horst an. »Sie haben in Amerika angerufen? Wissen Sie überhaupt, was das kostet?«
»Ja, das weiß ich«, sagte Horst. Er hatte von seinem Amtstelefon aus angerufen, über die Auslandsvermittlung, und er hatte am Ende erfahren, dass das Telefonat etwas mehr als zweihundert D-Mark gekostet hatte.
»Na schön.« Petersen war nicht begeistert.
»Wir müssen alles tun, was wir können, um diesem Erpresser das Handwerk zu legen«, sagte Horst. »Es geht um Menschenleben. Wir wissen nicht, was als Nächstes geschieht. Fest steht, dass unser Erpresser sich für seine Tat nicht irgendeinen x-beliebigen Namen ausgesucht hat, sondern den Namen eines Bombenlegers aus der Literatur. Dieser ›Roy Clark‹ ist ganz offensichtlich sein großes Vorbild. Wenn dieser Roman einen Hinweis darauf enthält, was der Erpresser als Nächstes unternehmen könnte, dann kann das entscheidend sein.«
»Wir werden sehen«, sagte der Chef. »Was ich aber noch sagen wollte: Wir sollten im Umgang mit unseren Kunden die Höflichkeit nicht außer Acht lassen …«
»Hat die Bundesbahn sich über mich beschwert?«, fragte Berger.
»Nicht direkt. Aber der Herr Rutter hat sein Befremden ausgedrückt über den rüden Ton, den Sie angeschlagen haben.«
Horst war empört. »Die Bundesbahn hat Informationen zurückgehalten …«
»Das bestreitet Herr Rutter. Aber das ist nicht der Punkt. Wir, die Hamburger Polizei, haben einen schlechten Eindruck gemacht. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen unsere Kunden höflich behandeln, Herr Berger. Da sehe ich bei Ihnen durchaus noch Möglichkeiten der Verbesserung.«
»Roy Clark«, sagte Pagels. »Alberner Name.«
»Warum Roy Clark?«, wunderte sich Horst Berger. »Wenn ich mir schon einen Namen ausdenke, dann nehme ich doch eher ein berühmtes Vorbild. Robin Hood vielleicht. Nein, da fehlt der noble Anspruch. Zorro vielleicht?«
»Fuzzy, der Banditenschreck«, schlug Pagels vor.
Horst tippte sich an die Stirn.
»Was ist dein Gefühl bei der Geschichte, Horst?«, fragte Sigmund Roeder.
»Ich weiß nicht«, gab Horst zu. »Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nicht glauben, dass wir alle Informationen gekriegt haben, die die Bahn hat.«
Pagels zog die Augenbrauen hoch. »Wie kommst du darauf.«
»Der Brief«, sagte Horst. »Da stimmt doch etwas nicht. Hast du den Text genau gelesen? EIN NEUER KUP steht da. Wenn es einen neuen Coup gegeben hat, dann muss es doch vorher auch einen alten Coup gegeben haben. Und dieser neue Coup, das ist jedenfalls nicht die Bombe im Schließfach, sondern irgendetwas, das sich im Oktober abgespielt hat. Entweder kurz vor oder kurz nach dem Brief. BAHNUNTERFÜHRUNG BEI STELLE – MASCHEN stand da. Was ist da passiert?«
»Wissen wir, wo das ist?«, fragte Roeder.