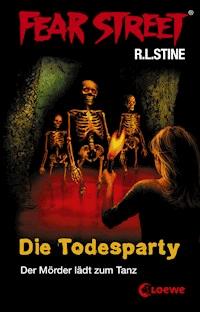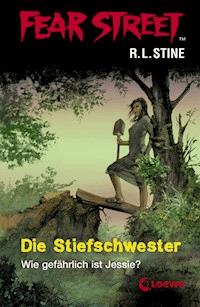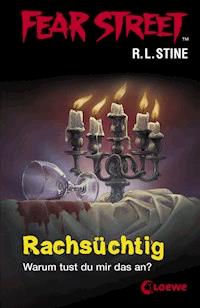Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Fear Street
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Reva hält sich für unwiderstehlich. Es macht ihr höllisch Spaß, mit den Gefühlen ihrer Mitmenschen zu spielen. Doch dann wird sie selbst zum Spielball anderer: Fremde entführen Reva und erpressen von ihrem Vater ein Lösegeld in Millionenhöhe. Und wenn er nicht rechtzeitig zahlt, muss Reva mit dem Schlimmsten rechnen ...Der Horror-Klassiker endlich auch als eBook! Mit dem Grauen in der Fear Street sorgt Bestsellerautor R. L. Stine für ordentlich Gänsehaut und bietet reichlich Grusel-Spaß für Leser ab 12 Jahren. Ab 2021 zeigt Neflix den Klassiker Fear Street als Horrorfilm-Reihe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Am liebsten hätte Paul Nichols jemanden umgebracht.
Er trommelte mit beiden Händen auf dem Lenkrad herum und wartete darauf, dass die Ampel auf Grün umsprang. Das Rotlicht leuchtete ihm entgegen und spiegelte seine Wut wider. Durch die beschlagene Windschutzscheibe schimmerten auch die vereiste Straße und die schneebedeckten Bäume rot.
Aus dem Radio ertönte die altbekannte Melodie von Stille Nacht. Verärgert schaltete Paul die Musik aus.
„In zwei Wochen ist Weihnachten“, dachte er und starrte die rote Ampel an. Aus der kaputten Heizung blies eisige Luft auf seine Füße. Warum hatte er das Gebläse eigentlich angestellt?
Paul hatte keinen Job und kein Geld.
„Fröhliche Weihnachten“, murmelte er sich selbst schlecht gelaunt zu.
Es wurde grün. Paul trat das Gaspedal durch, und der alte Plymouth schoss über die Kreuzung, obwohl die abgefahrenen Reifen auf der vereisten Straße durchdrehten.
Auf der Hauptstraße musste er langsamer fahren. Wegen der üppigen Dekoration, zu der auch ein riesiger, funkelnder Christbaum gehörte, war Waynesbridge als „Weihnachtsstadt“ bekannt.
Der glitzernde Weihnachtsschmuck verschlechterte Pauls Laune noch mehr. Er musste anhalten, um eine Familie über die Straße zu lassen. Alle lächelten, und ihre Gesichter unter den Skimützen waren von der Kälte gerötet. Die beiden Kinder zeigten aufgeregt auf das große Spielzeuggeschäft an der Ecke.
Der Vater nahm den kleinen Jungen an die Hand, als sie die Straße überquerten, und Paul musste dabei an seine eigene Familie denken. Schließlich war Weihnachten ein Familienfest.
Aber nicht für Paul. Er hatte seine Familie zuletzt vor zwei Jahren gesehen, mit sechzehn. Seit er die High School vorzeitig beendet hatte, war der Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen.
„Ho-hoffe nur, die haben ein be-beschissenes Weihnachtsfest“, murmelte er und umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Hände schmerzten.
Wenige Minuten später parkte er das Auto vor dem Hochhaus, in dem er wohnte, und stieg aus. Ihm war kalt in seiner braunen Lederjacke, und er hastete die Treppe hoch.
„Hi!“ Diane Morris schaute überrascht auf, als er zur Tür hereinkam. Sie machte jedoch keine Anstalten, sich von der grünen Couch zu erheben.
Paul verzog keine Miene. „Diane, du hier?“
Sie ließ ihre Zeitschrift fallen. „Ja. Es macht dir doch nichts aus, oder, Elvis? Meine Eltern streiten sich mal wieder. Sie sind beide total besoffen. Ich konnte einfach nicht bei ihnen bleiben.“
Paul brummte nur. Er warf seine Jacke auf einen Stuhl. Auf dem Tresen, der das Wohnzimmer von der Küche trennte, lag eine offene Packung Chips. Er stopfte sich eine Hand voll in den Mund.
„Hast du den Job gekriegt, Elvis?“, fragte Diane und setzte sich auf.
Er schüttelte den Kopf.
Dianes eben noch hoffnungsvoller Gesichtsausdruck verschwand. Verlegen starrte sie auf den Boden. „Und was ist mit dem im Supermarkt?“
„Ich fahre keine Lebensmittel aus!“, fuhr er sie an. „Ich bin doch kein Botenjunge!“
„Schon gut, Elvis“, sagte Diane schnell. Sie kam zu ihm und gab ihm einen langen, zärtlichen Kuss. Ungeduldig machte er sich los und drehte ihr den Rücken zu.
„Elvis?“ Diane tat so, als wäre sie verletzt. Sie ging nun schon drei Jahre mit ihm und war an seine Launen gewöhnt. „Lass mich dein Lächeln sehen“, verlangte sie neckisch. „Komm schon. Zeig, was du kannst.“
Diane nannte ihn Elvis, weil er sie an Elvis Presley erinnerte. Wie Elvis hatte er glattes schwarzes Haar, dunkle, romantische Augen und trug lange Koteletten. Und er hatte das gleiche herablassende Lächeln wie Elvis.
Paul konnte nie lange wütend auf sie sein. Er drehte sich um und lächelte sie gekonnt an.
Diane lachte. „Elvis, du könntest ein Star sein. Ehrlich.“
„Diane, du spinnst.“
„Ja, aber nur, weil ich mit dir rumhänge“, konterte sie und streckte ihm die Zunge raus.
Diane musterte Paul mit ihren graugrünen Augen, den einzigen Körperteilen, mit denen sie wirklich zufrieden war. Sie hatte sich immer für unattraktiv gehalten, bevor sie sich die Haare blond gefärbt hatte. Besonders schlimm waren die beiden Schneidezähne, die weit vorstanden. Sie hasste es, wenn Paul sie Hasenzahn nannte. Das tat er immer, wenn er sie ärgern wollte.
Diane war siebzehn und somit ein Jahr jünger als Paul. Sie hatte die High School mit einem recht ordentlichen Notendurchschnitt abgeschlossen. Diane hätte einen besseren Abschluss haben können, aber da ihre Eltern ständig betrunken waren und dann lautstark miteinander stritten, war es unmöglich gewesen, zu Hause zu lernen. Die meiste Zeit verbrachte Diane ohnehin in Pauls schäbiger Wohnung.
Auch sie hatte noch keinen Job gefunden.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte sie. „Waren noch irgendwelche anderen Angebote in der Zeitung?“
Paul schüttelte den Kopf. Er nahm die Chipstüte in die Hand und setzte sich zu ihr auf die Couch.
„Wir sind pleite“, fuhr Diane fort. Sie pikste ihn neckisch in die Rippen. „Und wie willst du mir jetzt den Jaguar kaufen, den du mir versprochen hast?“
Er verzog das Gesicht. „Bring mich bloß nicht zum Lachen!“
Diane nahm die Zeitschrift wieder in die Hand. „Ich habe gerade von einem Mann und einer Frau gelesen, die einen Geldtransporter ausgeraubt haben. Du weißt schon, einen von diesen kleinen Lastern, die Geld von der Bank transportieren. Sie haben ihr Auto quer auf die Straße gestellt und so getan, als hätten sie einen Platten. Und als der Geldtransporter deshalb anhielt, haben sie ihre Schusswaffen gezogen. Insgesamt haben sie sechs Millionen Dollar geraubt.“
Paul schüttelte den Kopf. „Wow. Super Sache.“
„Das könnten wir doch auch machen“, schlug Diane ernsthaft vor.
Diane träumte immer davon, dass sie beide berühmte Verbrecher sein würden. Ständig brütete sie irgendwelche verrückten Pläne aus, in denen sie Raubzüge unternahmen und wie Leinwandhelden Millionen erbeuteten.
Anfangs hatte Paul noch gedacht, dass sie Witze machte und diese Geschichten nur zum Spaß erfand. Aber nach einer Weile wurde ihm klar, dass sie es ernst meinte. Sie glaubte wirklich, auf diese Weise reich werden zu können.
„Was haben wir denn zu verlieren?“, wollte Diane wissen. Das fragte sie immer.
„Also, ich habe schon einen Job verloren“, antwortete er verbittert und spielte an einem Riss im Kunstleder der Couch herum.
Paul dachte an den Job in Dalbys Kaufhaus, den er fast zwei Jahre lang gehabt hatte. Lagerarbeiter zu sein war zwar nicht besonders aufregend gewesen, aber er hatte genug verdient, um davon zu leben. Und von Zeit zu Zeit hatte er ein paar nützliche Sachen klauen können – seine lederne Jacke, eine Uhr und einen tragbaren Fernseher.
Eigentlich kein schlechter Job.
Aber dann hatte ihn einer der Wachmänner mit einem MP3-Player in seiner Jackentasche erwischt – und das war das Ende dieses Jobs.
Man hatte Paul damals zum höchsten Boss geschleppt. Robert Dalby genoss es nämlich außerordentlich, Angestellte, die beim Klauen erwischt wurden, persönlich zusammenzustauchen, bevor er sie feuerte.
Was für ein Fiesling!
Paul war so wütend gewesen, dass er nicht einmal eine Entschuldigung hervorstottern konnte. Er hatte sich sehr beherrschen müssen, Dalby nicht an der Kehle zu packen und ihn mit seinem eigenen Seidenschlips zu erwürgen.
Seitdem war es Paul nicht gelungen, einen anderen Job zu finden. Und dabei hatte er zahlreiche Bewerbungen verschickt. Jetzt waren es schon drei Monate. Drei Monate der Wut und der Absagen.
Dianes Stimme durchdrang seine trostlosen Gedanken. Ihm wurde bewusst, dass sie mit ihm gesprochen hatte, aber er hatte nicht zugehört.
„Also?“, fragte sie ungeduldig. „Hast du?“
„Habe ich was?“, fragte Paul. Die Chipstüte war leer. Er knüllte sie zusammen und warf sie auf den Boden.
„Hast du Dalbys Haus ausgekundschaftet?“, wollte Diane wissen und sah ihn forschend an.
„Ja, hab ich.“
„Und?“
„Es dürfte kein Problem sein, da reinzukommen“, berichtete er ohne große Begeisterung.
„Echt?“ Diane packte seine Hand und drückte sie aufgeregt.
„Ich habe lediglich einen Wachhund gesehen. Sonst nichts“, sagte Paul.
Er sah sie an. „Sag mal, willst du allen Ernstes Dalbys Haus ausrauben?“
„Logisch! Das wäre doch die perfekte Rache – oder etwa nicht?“
Paul runzelte die Stirn. „Nicht, wenn wir erwischt werden.“
„Du warst doch schon einmal in Dalbys Haus, oder?“, fragte Diane. „Du hast das Zeug darin doch gesehen?“
„Ja. Das war im letzten Winter. Bei irgendeiner Party für die Angestellten“, bestätigte Paul. „Das ganze Haus ist voller Antiquitäten.“
„Diane meint das tatsächlich ernst“, stellte er wieder einmal erstaunt fest.
„Könnte ich da wirklich einbrechen?“
Paul wusste es nicht.
„Wir können das schaffen, Elvis“, sagte Diane aufgeregt und drückte seine Hand erneut. „Wir können es Dalby heimzahlen, dass er dich gefeuert hat. Wir gehen in sein Haus und schnappen uns ganz viele Antiquitäten und verkaufen sie, sodass unser Geld für ein super Weihnachtsfest reicht! Wir können einen Weihnachtsbaum haben, einen Truthahn und Geschenke!“
Vor lauter Begeisterung schlang sie die Arme um ihn und küsste ihn. „Das wird genau wie im Film, Elvis! Genau wie im Film!“
Sie hielt ihn fest, und ihr magerer Körper zitterte vor Anspannung. „Was meinst du?“
Er ließ seinen Blick durchs Zimmer schweifen, über die schäbigen Möbel und den abgewetzten Teppich.
Plötzlich sprang er auf, drehte sich um und lächelte Diane strahlend an. „Ich habe eine bessere Idee“, verkündete er.
„Hä?“, machte Diane und starrte ihn mit offenem Mund an.
„Vergiss die Antiquitäten“, befahl Paul ihr mit einem herablassenden Lächeln. „Was wissen wir denn schon über Antiquitäten? Nichts!“
„Ja, aber …“, begann Diane.
Er hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. „Was ist Dalbys wertvollster Besitz?“
Diane zuckte die Achseln. „Keine Ahnung.“
„Seine Tochter!“, verkündete Paul.
„Reva“, murmelte Diane. „Reva Dalby.“
„Genau“, bestätigte Paul. „Was kriegen wir für ein paar Antiquitäten? Vielleicht ein paar Tausender? Aber für seine Tochter wird Dalby Millionen rüberwachsen lassen.“
Diane nagte nachdenklich an ihrer Unterlippe. Sie starrte Paul an. „Du meinst …“
„Genau das meine ich!“, rief Paul. „Du willst einen Film? Es wird genauso sein wie im Film! Wir müssen es nur sehr gut planen – Schritt für Schritt, Szene für Szene. Und mit ein bisschen Glück …“ Er grinste sie an. „Mit ein bisschen Glück sind wir an Weihnachten schon Millionäre! Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist Reva Dalby zu entführen.“
2
„Können Sie mir helfen, Miss?“
Vor Reva stand ein Mann mittleren Alters mit schütterem grauem Haar. Er trug einen braunen Mantel und hatte eine abgewetzte Aktentasche dabei. An seinem gereizten Gesicht konnte Reva erkennen, dass er schon eine ganze Weile versucht haben musste, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
„Arbeiten Sie hier?“, fragte er und starrte sie mit seinen wässrigen Augen an.
„Nein. Ich finde es nur toll, hinter dem Tresen zu stehen“, antwortete Reva und verdrehte die Augen. Kalte blaue Augen, die noch eisiger blickten, als sie den schäbigen Mantel des Mannes musterten.
„Könnten Sie mir helfen, ein Parfüm auszusuchen?“, fragte er und betrachtete die teuren Glasflaschen in der Vitrine.
„Für Sie?“, fragte Reva mit einem verächtlichen Lachen.
Der Mann wurde rot. „Nein, natürlich nicht. Für meine Frau.“
„Tut mir Leid. Ich habe jetzt Pause.“ Reva wandte sich ab. Sie richtete den Blick auf einen kleinen ovalen Spiegel und begann, ihr gewelltes rotes Haar zurechtzuzupfen.
„Pause? Aber der Laden hat doch gerade erst aufgemacht!“, fuhr der Mann sie an. Sein Gesicht wurde immer röter.
Reva schaute nicht vom Spiegel auf. „Ich mache den Dienstplan nicht.“ Im Spiegel betrachtete sie sein Gesicht und weidete sich an seinem wütenden und zugleich hilflosen Ausdruck. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht loszuprusten.
Der Mann holte tief Luft. „Hören Sie, Miss, können Sie mir nicht doch helfen? Sie sind anscheinend die einzige Verkäuferin in dieser Abteilung. Und ich muss in zehn Minuten bei der Arbeit sein.“
„Tut mir Leid. Ich muss mich an den Dienstplan halten“, antwortete Reva und gähnte hinter vorgehaltener Hand.
„Also wirklich …“
Reva drehte sich um und musterte ihn noch einmal herablassend von oben bis unten. „Versuchen Sie es doch in unserem Schnäppchenmarkt im Untergeschoss“, riet sie ihm. „Die Rolltreppe ist gleich da vorn.“
Der Mann grummelte etwas Unverständliches. Wütend riss er seine Aktentasche an sich und stürmte Richtung Ausgang.
„Was ist denn mit dem los?“, fragte sich Reva lachend. „Ich wollte dem Typen doch nur helfen, etwas Geld zu sparen.“
Reva hörte abrupt auf zu lachen, als sich hinter ihr jemand geräuschvoll räusperte. Sie drehte sich um und musste feststellen, dass Arlene Smith, die leitende Verkäuferin der Kosmetikabteilung, hinter ihr stand und sie missbilligend anblickte.
„Reva, Sie waren unglaublich unhöflich zu diesem Kunden“, fuhr Ms Smith, wie sie stets genannt werden wollte, Reva an.
„Er wird es überleben“, erwiderte Reva ungerührt.
„Fragt sich nur, ob es auch das Geschäft überleben wird!“, fauchte Ms Smith.
Reva verdrehte die Augen. „Tut mir Leid, Ms Smith“, sagte sie und betonte das Ms. „Aber Sie sollten mir wirklich nicht auf die Nerven gehen, nur weil Sie heute mit dem falschen Fuß aufgestanden sind.“
Ms Smith funkelte sie wütend an. „Ich werde mit Ihrem Vater sprechen, Reva. Ihre Einstellung hat sich kein bisschen verbessert.“
„Ich wünschte, Sie würden mit ihm sprechen“, meinte Reva seufzend. „Ich wollte zur Weihnachtszeit ganz bestimmt nicht im Laden schuften. Aber mein Vater hat darauf bestanden. Er sagt, das Arbeiten wäre gut für mich.“
„Ich glaube nicht, dass es gut für irgendeinen von uns ist“, entgegnete Ms Smith mürrisch. Dann marschierte sie energischen Schrittes davon, und ihre hohen Absätze klickten bei jedem Schritt auf dem harten Boden.
„Wo hat sie bloß diese Schuhe gekauft? Beim Hufschmied?“, fragte sich Reva kichernd.
Obwohl es noch nicht einmal zehn Uhr war, strömten die Leute bereits in Scharen in das Kaufhaus.
Reva griff unter den Tresen und holte die große Flasche mit stillem Wasser hervor, die sie dort aufbewahrte. Doch schon nach dem ersten Schluck setzte sie die Flasche wieder ab, denn es kam jemand auf sie zu, den sie kannte.
Es war Kyle Storer, und er grinste selbstgefällig wie immer.
Kyle hielt sich für einen coolen Typen. Er ging Reva nun schon eine ganze Weile auf die Nerven, doch sie hatte nicht vor, mit ihm auszugehen.
Warum nicht? Weil er sich zu sehr bemühte.
Und heute versuchte er es schon wieder. Reva stöhnte innerlich, als er lässig vor ihr stehen blieb. Er trug eine helle Hose, schwarze Stiefel, ein blau-weiß kariertes Hemd im Westernstil und anstelle einer Krawatte eine Kette mit einem Silberornament.
„Ach, wie reizend“, dachte Reva abschätzig. „Spielt er jetzt etwa den Cowboy?“
„Hi, Reva, wie läuft’s?“, fragte Kyle, und sein Grinsen wurde noch breiter.
„Wie siehst du denn aus?“, wollte Reva wissen und musterte das Westernoutfit.
Kyles Grinsen geriet ins Wanken. „Hä? Meinst du meine Klamotten? Wie findest du sie?“
„Ich habe zu tun“, antwortete Reva ausweichend.
Kyle ignorierte den kühlen Empfang. „Der Laden ist jetzt schon proppenvoll“, stellte er fest. „Schätze, heute schaufelt dein lieber Dad die Kohle nur so rein. Stimmt’s?“ Er lachte, als hätte er gerade einen großartigen Witz gerissen.
„Kyle, zum Reden habe ich momentan wirklich keine Zeit“, sagte Reva eindringlich. „Ich hatte heute schon Ärger mit Ms Smith.“
„Warum kapiert er es nicht endlich?“, fragte sich Reva. „Wenn er mich nochmal fragt, ob ich mit ihm ausgehe, wird es ihm Leid tun.“
„Hast du am Samstag schon was vor?“, fragte Kyle und beugte sich über den Glastresen.
Revas Hand schoss vor und kippte die Wasserflasche um. „Oh, wie ungeschickt von mir!“, rief sie aus und beobachtete, wie das Wasser auf den oberen Teil von Kyles heller Hose spritzte.
Kyle wich zurück, und als er den großen nassen Fleck auf seiner Hose sah, wurde er knallrot im Gesicht.
„Wie peinlich!“, rief Reva gespielt mitfühlend. „Kyle, die Kunden werden denken, dass du dir in die Hose gemacht hast.“
Kyle versuchte, den Coolen zu spielen, und lächelte gezwungen. „Bis nachher“, murmelte er und hastete davon.
Reva prustete los und lachte, bis Francine kam, die unattraktive junge Frau, die mit ihr am Parfümstand arbeitete. „Tut mir Leid, dass ich so spät komme, Reva“, sagte sie. „Mein Auto ist liegen geblieben. War viel los?“
„Unheimlich viel“, behauptete Reva seufzend. „Ich bin schon vollkommen fertig. Ich muss erst mal Pause machen. Bis später, Francine.“
Francine wollte protestieren, aber Reva war schon auf dem Gang.
Als sie am Weihnachtsbaum vorbeikam, erinnerte sie sich an das Versprechen, das sie ihrer Familie und ihren Freunden vor einem Jahr gegeben hatte.
„Ich habe versprochen, ein netterer Mensch, freundlicher und mitfühlender zu anderen zu werden. Ich habe es ja versucht, aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht.“
Reva ging durch die Abteilung mit den Nylonstrümpfen, dann die drei Stufen hinunter zu ihrer Cousine Pam, die neben einer Riesenauswahl an Grußkarten stand.