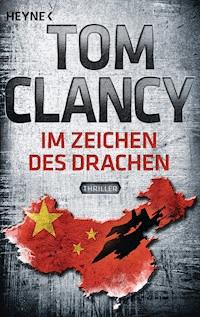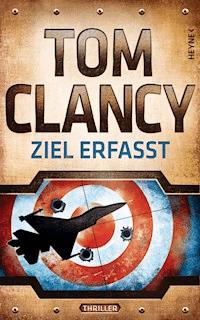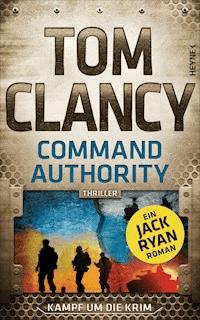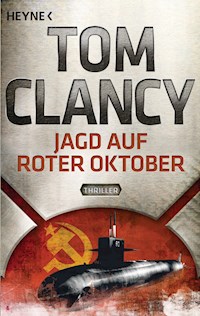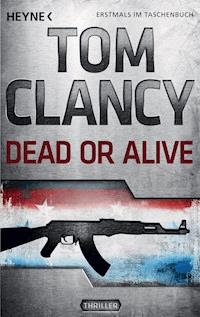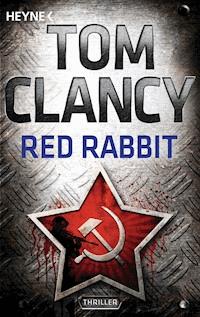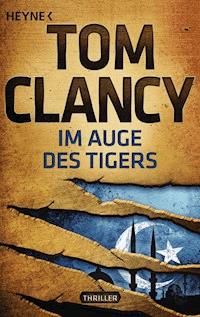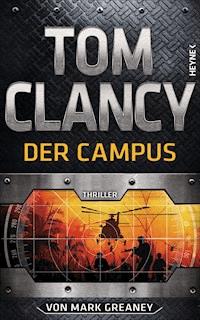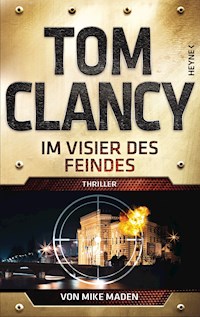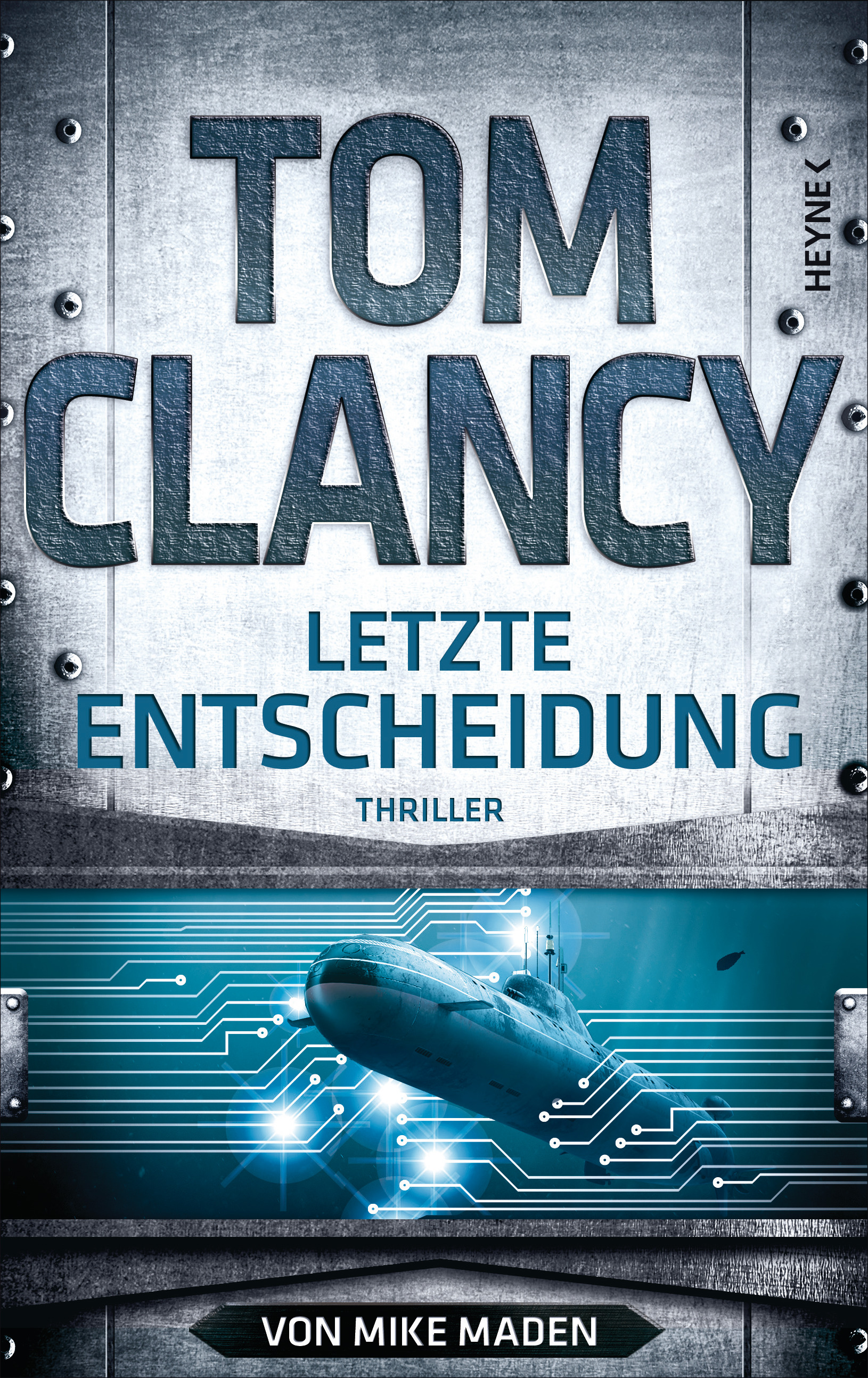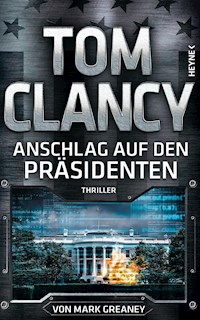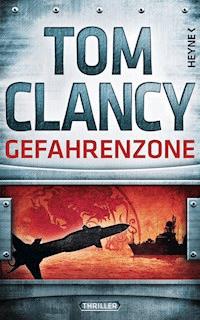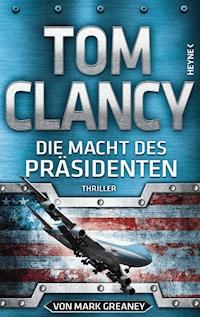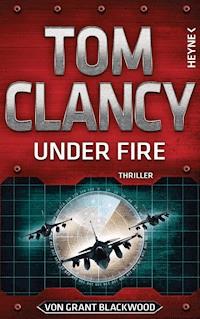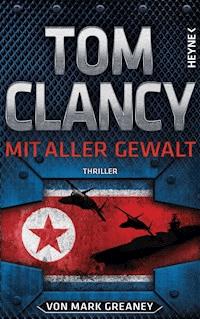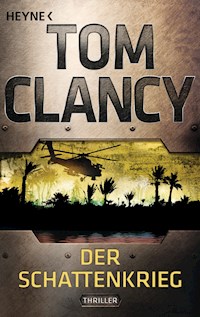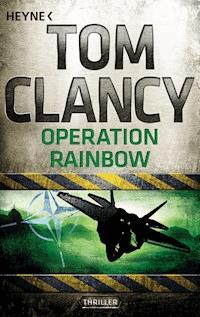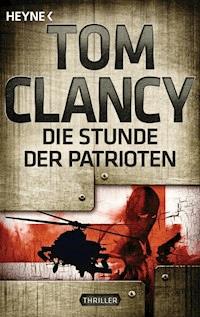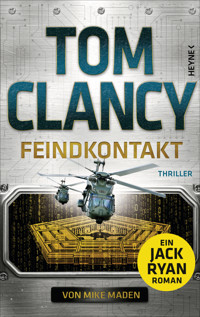
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Wenn alte Feinde mit neuen Waffen kämpfen
Ein unbekannter Hacker namens CHIBI bietet sensible Informationen der US-amerikanischen Geheimdienste international zum Verkauf an. Ein Sabotageakt nach dem anderen ist dank dieser gestohlenen Daten erfolgreich, und die Feinde der Vereinigten Staaten werden hellhörig. Auch China steigt in den illegalen Datenhandel ein, und CHIBI plant, den dauerhaften Zugriff auf die Cloud der amerikanischen Geheimdienste zu versteigern. Präsident Ryan muss die Schwachstelle finden, und zwar schnell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Ein unbekannter Hacker namens CHIBI bietet fremden Nachrichtendiensten geheime Informationen an, mit denen es gelingt, gezielt Spezialoperationen und Anschläge durchzuführen. So soll bewiesen werden, dass CHIBI unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Erkenntnisse und Informationen aller US-amerikanischen Geheimdienste hat. Interessierte Geheimdienste anderer Nationen sollen so dazu motiviert werden, sich weitere Informationen über die USA bei einer geheimen Auktion in London zu ersteigern. Gelingt dies, ist eine globale Katastrophe unabwendbar. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt. Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, desto klarer wird: Das Informationsleck liegt in den USA selbst. Die neue Datenbank namens IC-Cloud, in der die Erkenntnisse sämtlicher US-Geheimdienste gespeichert werden, scheint der Schwachpunkt zu sein. Doch wer ist der Maulwurf?
DIEAUTOREN
Tom Clancy, der Meister des Technothrillers, stand seit seinem Erstling Jagd auf Roter Oktober mit all seinen Romanen an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Er starb im Oktober 2013.
Mike Maden ist Co-Autor und Experte für internationale Friedens- und Konfliktforschung sowie für Technologie im internationalen Zeitalter, worüber er seine Doktorarbeit schrieb.
TOM CLANCY
UND
MIKE MADEN
FEINDKONTAKT
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karlheinz Dürr und Reiner Pfleiderer
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Enemy Contact
bei G.P. Putnam´s Sons, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Redaktion: Werner Wahls
Copyright © 2019 by The Estate of Thomas L. Clancy, Jr.;
Rubicon, Inc.; Jack Ryan Enterprises, Ltd.;
Jack Ryan Limited Partnership
Copyright © 2023 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung © Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock (sakura28), Shutterstock.com (Yuriy Boyko, donatas1205, VanderWolf Images, Magdalena Cvetkovic, Oleksii Lishchyshyn, ANNA_KOVA, tommyview)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31225-1V002
www.heyne.de
Hauptpersonen
REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN
John Patrick »Jack« Ryan: Präsident der Vereinigten Staaten
Scott Adler: Außenminister
Mary Patricia »Mary Pat« Foley: Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste (DNI)
Robert Burgess: Verteidigungsminister
Arnold »Arnie« Van Damm: Stabschef des Präsidenten
DER CAMPUS/HENDLEY ASSOCIATES
Gerry Hendley: Direktor von Hendley Associates und Campus
John Clark: Operationsleiter
Domingo »Ding« Chavez: Leitender Außenagent
Jack Ryan Jr.: Außenagent (Campus) und Finanzanalyst (Hendley Associates)
Gavin Biery: Leiter der Abteilung für Informationstechnologie
Bartosz »Midas« Jankowski: Außenagent
Lisanne Robertson: Logistik- und Transportleiterin
CLOUDSERVE, INC.
Elias Dahm: Gründer, Inhaber und CEO
Amanda Watson: Abteilungsleiterin Design Engineering; Projektleiterin Sicherheit der Intelligence Community (IC) Cloud
Lawrence Fung: Stellvertretender Abteilungsleiter Design Engineering; Teamleiter der Red-Team-IC-Hacker-Gruppe
Weitere Personen
Liliana Pilecki: Agentin des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agentur für Innere Sicherheit)
Deborah Dixon: US-Senatorin (Rep.); Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des US-Senats
Aaron Gage: Gründer und CEO von Gage Capital Partners; Ehemann von Deborah Dixon
Christopher Gage: CEO von Gage Group International und Gründer von Baltic General Services; Sohn von Aaron Gage und Stiefsohn von Deborah Dixon
Rick Sands: Ehemaliger Soldat des 75th Ranger Regiment (Infanterieregiment der US-Armee)
Aut inveniam viam aut faciam.Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1
Partido de Bahía Blanca, Argentinien
Er war ein Skorpion.
Nie war Unteroffizier Salvio auf diese Tatsache stolzer gewesen als in diesem Moment. Er blickte auf die Uhr.
Drei Minuten bis zum Ziel.
Wie seine Männer trug auch er eine Kampfweste und einen ballistischen ATE-Kevlar-Helm mit Nachtsichtoptik und war mit einer Glock-17-Pistole im taktischen Beinholster und einem M4A1-Karabiner bewaffnet.
Das Heulen der beiden Turbomecca-Triebwerke des EC145 Eurocopters füllte die schwach beleuchtete Kabine. Salvios Einheit, ein kleiner Trupp von Spezialeinsatzkräften der Grupo Alacrán – der Skorpion-Gruppe –, war die beste Einheit der Argentinischen Nationalgendarmerie, vielleicht sogar ganz Argentiniens.
Grupo Alacrán war die wichtigste Antiterroreinheit Argentiniens. Wie die israelische Jamam – die paramilitärische Spezialeinheit der israelischen Grenzpolizei, mit der Salvios Team im Ajalon-Tal trainiert hatte – galten seine Männer als die blutige Spitze des Speeres.
Salvio reckte drei Finger in die Höhe. Sein vertrauter Adjutant und Stellvertreter Acuña bestätigte das Zeichen mit knappem Nicken und wölfischem Grinsen. Die beiden Männer hatten im Kampf gegen bewaffnete Mafiabanden und radikale Islamisten in La Triple Frontera, der Grenzregion zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien, gemeinsam die Krallen gewetzt. Das Dreiländereck war schon seit Langem eine Bastion des grenzüberschreitenden Handels mit Drogen, Waffen und Menschen, der sowohl von internationalen Kartellen als auch von lokalen Banden kontrolliert wurde, eine Region, in der Gewalt und Kriminalität von Jahr zu Jahr schlimmer wurden. Der Bürgerkrieg im Libanon hatte außerdem Zehntausende Libanesen in diese abgelegene Gegend verschlagen, unter ihnen viele Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah.
Und mit der Hisbollah kam der Iran.
Verdammt, dachte Salvio, hatten nicht sogar Osama bin Laden und Chalid Scheich Mohammed, der Chefplaner der Anschläge vom 11. September, vor Jahren La Triple Frontera besucht?
Salvio war überzeugt, dass seine Regierung es niemals schaffen würde, die Banden auszumerzen. Sie schaffte es nicht einmal, die Flut der Gewalt einzudämmen. Aber bald nachdem bin Laden in der Gegend aufgetaucht war, war plötzlich eine Menge Geld und Technologie aus den USA hereingeflossen und hatte den Krieg gegen den Terror auch nach La Triple Frontera gebracht. Das hatte wenigstens das Wachstum dieses hässlichen Krebsgeschwürs für ein paar Jahre in Schach gehalten. Bis sich die Aufmerksamkeit der Amerikaner wieder einem anderen Weltproblem zugewandt hatte. Inzwischen befand sich die Hisbollah hier im Dreiländereck wieder auf dem Vormarsch. Nach Süden.
Dieser Nachteinsatz war der beste Beweis dafür.
Die Aufklärungseinheit der Nationalgendarmerie hatte vor zwei Tagen einen libanesischen Hisbollah-Kommandeur in der Region identifiziert, und die CIA hatte die Sichtung bestätigt. Aber dann hatte die CIA in der Nähe der Küstenstadt Bahía Blanca auch noch einen aktiven Offizier der berüchtigten iranischen Quds-Brigade entdeckt, der Eliteeinheit für Auslandseinsätze, die zur Iranischen Revolutionsgarde gehörte – und von diesem Moment an hatten Salvios Befehlshaber und die CIA Blut gerochen.
Obwohl die argentinische Regierung dagegen protestiert hatte, sollte nächste Woche in Bahía Blanca eine Zusammenkunft junger Chassiden stattfinden. Hunderte junger ultraorthodoxer Juden aus allen Teilen des Landes würden daran teilnehmen. Ein perfektes Anschlagsziel.
Und ein iranischer Kommandeur der Quds-Brigade würde den Überfall anführen.
Die Hisbollah hatte in Argentinien schon viele Menschen ermordet. Mehr als hundert Juden waren in den 1990er-Jahren bei zwei Bombenattentaten ums Leben gekommen.
Die Terrormiliz hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass sie etwas Derartiges jederzeit wieder tun könne.
Die beiden Terroristen hielten sich in einer kleinen, verlassenen Pferderanch nur sechsundzwanzig Kilometer nördlich der Stadt versteckt. »Gefangen nehmen – lebend«, lautete der einzige Befehl, den Salvio für diese Mission vom comandante mayor erhalten hatte. Das sei eine Chance, das Hisbollah-Netzwerk endlich zu zerschlagen, hatte der Kommandant hinzugefügt. Damit könne man die verdammten iranischen Hunde endlich in den Arsch treten.
Und so hatten Salvio und sein Trupp auf ihrer Basis in Ciudad Evita ihre Ausrüstung zusammengepackt, und Salvio hatte 23 seiner besten Männer für den Einsatz ausgewählt. Die drei Eurocopter flogen auf drei verschiedenen Flugvektoren, wobei sie die direkten Flugrouten vom Stützpunkt zum Ziel vermieden. Das hieß allerdings, dass die Helis bis zum Maximum ihrer Reichweite gehen mussten, aber schließlich hatte es keinen Zweck, es den Tangos zu leicht zu machen, die womöglich schultergestützte MANPADs mit sich führten. Auf jeden Fall würde Salvios Heli vor dem Rückflug aufgetankt werden müssen.
»Zwei Minuten«, tönte die Stimme des Piloten aus Salvios Headset. Prüfend blickte sich Salvio in der Kabine um. Tarabini, Gallardo, Zanetti, Crispo, Birkner, Hermann. Seine Boys waren noch jung, aber gut ausgebildet, gute Schützen und duros. Alle erwiderten seinen Blick mit zuversichtlichem Grinsen. Wie hungrige Wölfe in einem Rudel.
Sein Rudel.
»Licht aus«, befahl er dem Piloten. Die schummrig rote Kabinenbeleuchtung erlosch.
Salvio schaltete seinen Kommunikationskanal ein. »Bravo One, hier Alpha One. Lagebericht.«
Sein Scharfschützenteam – ein Scharfschütze und ein Beobachter – war bereits auf dem flachen offenen Feld, von dem die Farm umgeben war, in Stellung gegangen. »Freie Sicht auf die Farm. Keine Bewegung. Keine Lichter. Klar zum Angriff, Sir.«
»ETA neunzig Sekunden«, sagte Salvio und fügte auf Englisch hinzu: »Stay frosty!« Er klickte sich aus. Wie jeder andere Argentinier in seinem Alter war auch er mit amerikanischen Filmen aufgewachsen, aber tatsächlich war es sein »Black Hat«-Ausbilder in der Fallschirmspringerschule Fort Benning gewesen, der ihn mit diesem Befehl angebellt hatte.
Zeit, die Puppen tanzen zu lassen.
Salvio befahl den Piloten, ihre Helis in der Nähe des verwahrlosten Farmhauses in NATO-»Y«-Formation auf zwölf, vier und acht Uhr zu landen. Dabei halfen ihm Fotos, die eine Überwachungsdrohne am Vortag aufgenommen hatte. Rund um die Ranch standen nur wenige Bäume und Büsche, nur ein paar dicht beieinanderstehende Mesquitebäume versperrten teilweise den Blick auf die Fenster. Ein paar baufällige Schuppen standen verstreut um das Haupthaus, und der Zaun war an mehreren Stellen umgefallen. Die Ranch hatte eindeutig bessere Zeiten gesehen.
Die drei Eurocopter schwebten in fast perfekter Synchronisation bis auf knapp einen Meter über dem hart gestampften Boden herab, fast 100 Meter vom Haus entfernt. Salvio sprang zuerst, dicht gefolgt von seinen Männern. Kaum schlugen ihre Stiefel auf dem Boden auf, als sie auch schon lossprinteten. Während die Skorpion-Operateure auf das Haupthaus zustürmten, stiegen die Hubschrauber mit brüllendem Lärm sofort wieder hoch, um in größerer Höhe weite Überwachungsschleifen zu fliegen. Vor dem blauschwarzen Nachthimmel zeichnete sich das alte Farmhaus nur als grauer Schatten ab.
Salvio war auf vier Uhr gelandet. Flüsternd erteilte er seinem Team über das Comms seine Befehle, obwohl er sich darauf verlassen konnte, dass seine Männer auch ohne ihn wussten, was sie zu tun hatten.
»Bravo One, wir sind auf dem Boden«, meldete er dem Scharfschützenteam. »Bereit für Feuerschutz? Kommen.«
»Bereit für Feuerschutz, Sir.« Das Schützenteam lag auf sechs Uhr, die große Barrett-M95-Repetierbüchse war direkt auf die Haustür gegenüber gerichtet und bereit, jeden cabrón mit .50-BMG-Patronen zu löchern, der dem Schützen vor das Nachtsichtgerät geriet.
Salvios Team rückte zuerst geduckt in langsamem Trab vor, genau wie die beiden anderen Teams. Hier draußen auf der grasbewachsenen Ebene war kaum Deckung zu finden, weshalb die Hubschrauber Salvios Trupp relativ nahe am Ziel hatten absetzen müssen. Er hatte sich für einen Nachtangriff entschieden, in der Hoffnung, dass die Kämpfer im Haus keine Nachtsichtgeräte hatten.
Jetzt rannten die vierundzwanzig Soldaten schnell aus drei Richtungen auf das Haus zu, die Waffen entsichert, die Patronen schussbereit in der Kammer. Schwere Stiefel stapften die Stufen zu der halb morschen, um das Haus verlaufenden Veranda hinauf, gingen rechts und links neben den Fenstern und den beiden Türen in Deckung und zogen die Ringe der Blendgranaten.
Salvio war neben der Vordertür in Stellung gegangen. Arabische Musik plärrte blechern aus einem Radio irgendwo im Haus. Er flüsterte einen weiteren Befehl in sein Mikro. Scheiben splitterten, als die Schockgranaten gleichzeitig durch sechs Fenster geworfen wurden. Die Männer kniffen die Augen zu und rissen die Münder auf, als die Granaten explodierten.
Mit ihren schweren Stiefeln traten sie die Türen ein. Die Skorpions stürmten in die dunklen Räume. Das taktische Licht an Salvios Glock 17 und die herumgeschwenkten Lichter an den Karabinern seiner Männer erhellten das Wohnzimmer.
»Sicher!«, hörte Salvio einen seiner sargentos aus einem der Hinterzimmer brüllen. Kurz danach folgten weitere »Sicher!«-Rufe. Acuña erschien; die herumzuckenden Lichtstrahlen blitzten in seinen Augen, aber die Enttäuschung war ihm klar anzumerken.
»Alle Räume gesichert, Sir. Niemand hier.«
Salvio fluchte und schob die Glock ins Holster zurück. Wo zum Teufel waren diese Scheißkerle?
»Aquí!«, rief einer der Soldaten aus der Küche. Salvio und Acuña stürmten hinüber. Der Gefreite Gallardo stand in einer kleinen Nebenkammer und hielt sein Waffenlicht auf den Boden gerichtet: eine Falltür. Salvio riss die Tür hoch, zog gleichzeitig die Pistole und schaltete deren taktisches Licht ein.
»Gallardo, Hermann, mir nach«, befahl Salvio knapp und stieg in den dunklen Schacht hinunter.
Salvio und seine beiden Männer kehrten mit leeren Händen in die Küche zurück. Der Tunnel unter der Falltür war ungefähr 70 Meter lang und führte zu einem der leeren, baufälligen Schuppen draußen. Die Terroristen waren anscheinend durch den Tunnel geflohen, ohne vom Scharfschützenteam bemerkt worden zu sein.
Salvio kontaktierte die Piloten der Helikopter, die mit Nachtsichtgeräten und Wärmekameras ausgestattet waren. »Seht ihr was?«
»Nein, nicht mal ein Kaninchen.«
Verdammt!
Er hätte die Gefangennahme der beiden Terroristen unverzüglich dem comandante mayor melden sollen, doch jetzt würde der Alte ganz schön sauer sein. Salvio hatte nichts in der Hand außer seinem eigenen Schwanz. Nicht gerade das, was sie im Hauptquartier von ihm erwarteten.
Wütend bellte Salvio seine Befehle. Er würde diese Bruchbude auseinandernehmen, vielleicht fand er dabei irgendwelche Hinweise. Irgendetwas, womit er dem HQ beweisen konnte, dass der ganze Einsatz nicht völlig vergeblich gewesen war.
Sie nahmen das Haus von oben bis unten auseinander, schlitzten Matratzen auf, kippten den Inhalt von Schubladen, Schränken und Kommoden auf den Boden, rissen Dielen heraus. Als sie damit fertig waren, glich das Haus einem Trümmerfeld nach einem Tornado.
Ganz sicher war jemand hier gewesen – es lagen jede Menge Abfälle und Zigarettenkippen herum, und die verdreckte Toilette war nicht gespült worden.
Aber sie fanden nicht mal den kleinsten Hinweis, den Salvio als Trophäe hätte mit zurücknehmen können.
Während seine Männer herumstanden, Wasser aus ihren Trinkblasen tranken und Proteinriegel verschlangen, beorderte Salvio die Helikopter für die Extraktion des Teams herbei. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder in die Kaserne in Ciudad Evita zurückzukehren und Feierabend zu machen.
Zehn Minuten später landeten die drei Eurocopter, und ihre Rotoren wurden langsamer. Um den Rotorblättern aus Karbonfaser auszuweichen, liefen Salvios Männer geduckt zu den Maschinen hinüber und drängten sich hinein. Sie mussten noch Platz schaffen für den Sniper und seinen Beobachter, die am Vortag sechs Kilometer zu Fuß zurückgelegt hatten, um nicht entdeckt zu werden. Der Sniper setzte sich vor Salvios Füßen auf den Boden.
Wenigstens waren seine Männer gut drauf, tröstete sich Salvio. Sie lachten und frotzelten einander, wie es junge Männer eben machen, um nach einem Kampfeinsatz das aufgestaute Adrenalin wieder abzubauen.
Auch wenn dabei kein einziger Schuss abgefeuert worden war.
»Bereit, Leutnant?«, fragte der Pilot.
»Let’s get back to the barn«, antwortete Salvio auf Englisch, noch so ein Spruch, den sein Ausbilder in Fort Benning immer geknurrt hatte. »Rápido.« Salvios Sohn war Stürmer und sollte heute mit seinem fútbol-Team antreten. Mit ein bisschen Glück würde das Auftanken der Helis reibungslos ablaufen, dann könnte Salvio noch rechtzeitig zum Spiel wieder zu Hause sein.
Die Turbinen heulten auf, als die Eurocopter gleichzeitig abhoben, sich in den warmen, sternenfunkelnden Nachthimmel schwangen und in einer Reihe zurückflogen.
Einen Herzschlag später schrillten in allen Helis die Warngeräte los.
Raketenanflug.
Salvio packte einen Haltegriff, gleichzeitig kippte der Heli jäh nach unten, um der Rakete auszuweichen, während automatisch eine Düppelwolke hinausgeblasen wurde. Durch die Tür des Bordschützen musste Salvio mit ansehen, wie ein feuriger Strahl heranraste, in einen seiner Helis einschlug und in einer Wolke aus flammendem Metall explodierte.
Das Letzte, was Salvio hörte, war das urgewaltige Brüllen der hochexplosiven Ladung, die seinen Helikopter auseinanderriss und ihn und fast alle anderen auf der Stelle tötete. Die wenigen schreienden Überlebenden starben, als sie mit dem brennenden Wrack fünfhundert Meter tiefer auf dem Boden aufschlugen.
Innerhalb von nur dreißig Sekunden wurde Salvios gesamte Skorpion-Einheit ausgelöscht.
Konzeptbeweis Nummer eins.
2
Crisfield, Maryland
Jack hielt am Straßenrand vor dem bescheidenen einstöckigen, weiß gestrichenen Einfamilienhaus an und schaltete den Motor aus. Erinnerungen stürmten auf ihn ein. In seinem ersten Jahr im College war er zum ersten Mal hier gewesen – damals hatte Corys Mum den beiden Collegestudenten einen schmackhaften Rinderbraten vorgesetzt. »Damit ihr groß und stark werdet«, hatte sie gesagt. »Greift zu, ihr werdet es brauchen, wenn ihr heute hinausrudern wollt.« Mit dem Ruderboot, das Corys Dad selbst gebaut hatte, waren sie auf den Daugherty Creek hinausgerudert. Die Rudertour war eine der schönsten Erinnerungen, die ihn mit Cory verbanden.
Corys Familie gehörte zu dem, was man untere Mittelschicht nennt, und passte genau zu dem kleinen Haus, in dem sie wohnte – solide, zuverlässig, robust und alles andere als trendy oder elegant. Cory war ein guter Freund gewesen, und die Erinnerung an ihren gemeinsamen Roadtrip im zweiten Studienjahr, bei dem sie auch ein paar Viertausender in Colorado bestiegen hatten, brachte ihn noch heute zum Schmunzeln.
Jack fühlte sich unbehaglich, als er auf die Haustür zuging; zu viele Jahre waren vergangen, seit er und Cory sich zuletzt gesehen hatten. Geplant hatten sie es mehrmals, aber immer war etwas dazwischengekommen. Cory war erst im fünften Semester gewesen, als sein Vater starb. Er hatte seinen Traum vom Jurastudium aufgeben müssen und stattdessen den kleinen Baumarkt seines Vaters übernommen, um sich auch um seine kranke Mutter kümmern zu können. Damals hatte Jack ihn ein paar Mal besucht, aber Cory war so beschäftigt gewesen, dass sie nur bei einem Kaffee im Laden ein wenig hatten plaudern können. Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium hatte Jack zielstrebig seine Karriere weiterverfolgt, während Cory … Nein, es gab keine Missgunst, keinen Neid. Damals waren sie an einer Weggabelung angekommen und hatten unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen.
Jack hatte seinen Traumjob bei Hendley Associates und beim Campus gefunden.
Und Cory füllte Baumarktregale mit Holzschrauben und Vogelfutter.
Corys Mutter war vor ein paar Jahren gestorben, aber Jack hatte die Beerdigung verpasst – er hatte sogar erst ein gutes Jahr danach von ihrem Tod erfahren. Eigentlich hatte er Cory damals anrufen wollen, um ihm sein Beileid auszusprechen, aber weil seit ihrem Tod schon so viel Zeit verstrichen war, war es ihm einfach zu peinlich gewesen.
Peinlich, in der Tat.
Bist schon ein wahrer Freund, Arschloch.
Jack drückte auf den Klingelknopf. Kurz darauf öffnete eine Pflegerin mittleren Alters in makelloser Krankenhauskleidung die Tür. Jacks Blick fiel auf ihr Namensschild am Kragenaufschlag: Mary Francis war Krankenschwester – und Nonne. Sie lächelte.
»Sie müssen Jack sein. Cory erwartet Sie schon.«
»Danke, Schwester.«
Jack folgte ihr durch den schmalen, sauberen Flur. Die alten Dielen knarrten unter seinem muskulösen Hundert-Kilo-Körper.
»Wie geht es ihm?«, fragte Jack leise, als seien sie in einer Kirche.
»Den Umständen entsprechend«, antwortete sie in normaler Lautstärke. »Er wird nicht mehr lange leiden müssen.«
An den Flurwänden hing ein Dutzend Familienfotos in einfachen, billigen Rahmen. Ein Foto zeigte Jack und Cory neben dem Ruderboot. So viele Jahre war das her.
»Hier hinein, bitte.« Die Nonne öffnete eine der Türen und trat zurück. Eine Aufforderung, allein einzutreten.
Jack zögerte eine Sekunde. Im Moment wäre er lieber mit ungeladener Pistole in eine afghanische Tora-Bora-Höhle gestürmt, als sich dem zu stellen, was ihn vermutlich in diesem Zimmer erwartete.
»Jack. Da bist du ja.«
Cory lächelte breit und ließ das Kopfteil des Bettes hochfahren, sodass er fast aufrecht saß. Er streckte Jack die Hand entgegen. Er war stark abgemagert, strahlte aber trotz seiner blassen Gesichtsfarbe Wärme und Freundlichkeit aus.
Jack seufzte innerlich erleichtert auf. Rasch trat er neben das Bett und nahm Corys kraftlose Hand. Jack war über 1,80 Meter groß, stark und muskulös, jetzt noch mehr als damals, als sie noch Schulkameraden gewesen waren. Aber Cory war damals 1,85 Meter groß gewesen und hatte hundertzehn Kilo gewogen. Hatte mit seinem Lacrosse-Team sogar einmal die Meisterschaft in seinem Bundesstaat gewonnen. Ein richtiger Draufgänger. Kaum zu glauben, dass diese gebrechliche Erscheinung in dem Krankenbett derselbe Mann war, der den damals neunzig Kilo schweren Jack auf dem Rücken über zweieinhalb Kilometer einen Berghang in Colorado hinuntergetragen hatte, nachdem sich Jack den Knöchel verstaucht hatte. Jetzt wog Cory sicherlich weit weniger als die Hälfte seines damaligen Gewichts und war so schwach, dass er kaum noch den Arm heben konnte.
»Schön, dich wiederzusehen, Cory.«
»Tut mir leid, dass du so weit fahren musstest. Ich weiß doch, wie beschäftigt du bist.«
Cory sah, dass Jack verlegen das Gesicht verzog. »Tut mir leid, ich hab’s nicht so gemeint. Aber ich kann mir denken, dass man bei einer Firma wie Hendley Associates locker auf eine Achtzigstundenwoche kommt.«
»Stimmt. Manchmal stelle ich ein Feldbett im Büro auf, um mir das Pendeln zu ersparen.«
»Glaube ich dir aufs Wort.« Cory ließ sich wieder zurücksinken, offenbar strengte ihn das Gespräch stark an.
Jack blickte sich im Zimmer um, während Cory versuchte, eine bequemere Position zu finden und die Befestigung der IV-Kanüle auf dem Rücken seiner blutunterlaufenen, mageren Hand wieder festzudrücken. An der Wand gegenüber hing ein großes Kruzifix, daneben das Hochzeitsfoto seiner Eltern. Cory war ein Einzelkind.
Auf dem Nachttisch, neben Medizinfläschchen und Medikamenten, stand eine gerahmte Gebetstafel, eine Novene zur »Mutter der Immerwährenden Hilfe«. Auf der anderen Seite des Bettes stand ein fahrbares IV-Gestell, an dem ein Tropfenbeutel hing.
»Gefällt mir, wie du dich hier eingerichtet hast«, sagte Jack.
»Meine Innenarchitektin nennt es Medical Modern Style. So ähnlich wie in Mad Men, nur gibt’s hier Pillen statt Alk.«
»Ich sollte sie dringend mal anrufen.«
»Warte noch ein paar Wochen. Ich weiß, wo du dann das ganze Zeug hier zum Schnäppchenpreis bekommen kannst«, sagte Cory augenzwinkernd.
Jack schmunzelte. Er kannte niemanden, der so witzig sein konnte wie Cory. Oder so furchteinflößend, wenn er dann doch mal zuschlagen musste. Fäuste wie Vorschlaghämmer an einem mächtigen Baumstamm. Zwei Biker in einer Bar im Jackson Hole hatten Corys robuste Seite auf äußerst schmerzhafte Weise kennengelernt.
Jack fühlte sich plötzlich unsicher; sein Vollbart und der dichte Haarschopf waren das absolute Kontrastprogramm zu Corys kahlem Schädel. Die Chemotherapien mochten Cory das dichte blonde Lockenhaar geraubt haben, aber das Feuer in seinen braunen Augen hatten sie ihm nicht nehmen können.
Cory versuchte, den Plastikbecher mit Eiswasser vom Nachttisch zu nehmen, konnte ihn aber nicht erreichen. Jack füllte den Becher noch weiter auf und reichte ihn Cory.
»Danke.« Cory sog das kühle Wasser mit einem Strohhalm ein.
Jacks Blick schweifte noch einmal zu der gerahmten Gebetstafel: O Mutter von der Immerwährenden Hilfe, gewähre mir, dass ich immerfort deinen mächtigsten Namen anzurufen vermöge; denn dein Name ist der Schutz der Gläubigen im Leben und ihr Heil im Sterben …
»Besuchst du oft den Gottesdienst, Jack?«
»Ich? Nicht oft genug. Und du?«
»Wäre ein bisschen schwierig, das Bett in die Kirche zu bugsieren. Wozu habe ich eine eigene Nonne?«
Jack blickte noch einmal zu dem großen Kruzifix hinüber. Er erinnerte sich daran, wie die Mädchen in der Klasse auf Cory geflogen waren und wie viele Bierkrüge er hatte leeren können, ohne betrunken zu werden. »Ich sehe, dass du zum Glauben gefunden hast.«
»Der Krebs hat mich zuerst gefunden, den Glauben bekam ich umsonst dazu.«
»Gut zu hören«, sagte Jack.
Cory war der leichte Zynismus in Jacks Stimme nicht entgangen. »Ja, schon gut, ich weiß. Schnell noch gläubig werden, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber mir ist es wirklich ernst damit. Wenn einem die eigene Sterblichkeit bewusst wird, fängt man an, über die Ewigkeit nachzudenken.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Jack erwähnte nicht, dass er selbst in den letzten Jahren oft genug dem Tod ins Auge geblickt hatte. Aber der Blick in den schwarzen Abgrund einer Pistolenmündung hatte ihn nicht zu einem gläubigen Menschen gemacht.
»Mach es besser als ich, Jack. Warte nicht, bis dich so etwas aufweckt.«
»Jetzt klingst du genau wie meine Schwester.«
»Ich mochte deine Schwester. Wie geht’s ihr?«
»Sie ist Ärztin geworden, genau wie unsere Mom. Arbeitet sogar im selben Krankenhaus. Hat einen guten Burschen geheiratet.«
»Freut mich für sie. Und deine Familie – sind alle okay? Ich schaue in letzter Zeit kaum noch Nachrichten.«
»Es geht allen gut. Danke, dass du fragst.«
Cory hustete heftig. Kämpfte dicke Schleimpfropfen in seiner Kehle hinunter. Plötzlich verkrümmte er sich, schnappte heftig nach Atem, und sein Gesicht lief vor Anstrengung rot an.
Jack nahm rasch die Nierenschale vom Nachttisch und hielt sie Cory vor den Mund, während er gleichzeitig Corys knochigen Rücken stützte. Nach mehrmaligem Husten spuckte Cory endlich einen Klumpen gelblichen Schleim in die rosa Plastikschale.
Die Krankenschwester stürzte ins Zimmer.
»Cory?« Rasch trat sie ans Bett, während Jack Cory langsam wieder zurückgleiten ließ. Sie nahm Jack die Schale aus der Hand. »Könnten Sie einen Moment draußen warten, Jack?«, fragte sie, während sie Cory den Mund abwischte.
»Kein Problem.«
Cory schüttelte den Kopf und hob schwach die Hand. »Nein, warte, Jack. Es geht mir schon wieder besser.«
»Bist du sicher? Ich habe genug Zeit.«
Die Nonne hielt ihm den Becher an die Lippen, und Cory trank noch einen weiteren Schluck Wasser. Entsetzt sah Jack, wie viel Mühe es Cory kostete, bevor er sich wieder auf das Kissen zurücksinken ließ und erschöpft seufzte.
»Ich bin direkt vor der Tür«, sagte die Nonne. »Aber ruf mich bitte, bevor du mich brauchst, nicht erst hinterher, okay?«
Cory lächelte. »Versprochen.«
Sie zog die Tür leise hinter sich zu.
»Also, Jack … Erinnerst du dich noch an die Viertausender, die wir in Colorado erstiegen haben?«
»Selbstverständlich. Auf der Fahrt hierher musste ich wieder daran denken.«
»Waren gute Zeiten, Mann. Kann dir gar nicht sagen, wie oft ich daran zurückgedacht habe, während ich Zementsäcke und Dachlatten zählte. Hat mir durch manche schlimme Zeit geholfen.«
Schuldbewusst wich Jack Corys Blick aus.
»Tut mir echt leid, Cory. Ich hätte schon längst mal …«
»Oh, Mann, nein! Das wollte ich damit nicht sagen. Nur, dass es mir eine Menge bedeutet, damals diese Berge bestiegen zu haben. So hoch hinauf! Die saubere Luft. Die Stille.«
»Ja, das waren gute Zeiten damals.«
»Ich hatte viel Zeit, über mein Leben nachzudenken, während ich hier lag, verstehst du? Was ich getan habe, was ich nicht getan habe. Und um ehrlich zu sein, ich würde nicht viel ändern wollen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Einen wirklich wichtigen Fall vor dem Obersten Gerichtshof zu vertreten, wäre natürlich fantastisch gewesen, aber es hat eben nicht sein sollen.«
»Es muss schwer für dich gewesen sein.«
»War es manchmal, aber meistens war es ganz okay. Ich habe getan, was ich tun musste, und das hieß, dass ich mich um meine Familie gekümmert habe. Du hättest für deine Familie dasselbe getan. Das weiß ich mit Sicherheit.«
Jack nickte. Natürlich hätte er das. Es gab nichts, was er für seine Familie nicht tun würde.
»Und deshalb – ich bedaure nichts. Außer vielleicht einer einzigen Sache. Davon habe ich dir noch nie erzählt, aber ich habe meinem Dad zwei Dinge versprochen, als er auf dem Sterbebett lag. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Versprechen halten konnte – ich habe letztes Jahr endlich mein Jurastudium an der Georgetown University abgeschlossen.«
»Das ist absolut super! Gratuliere!«
Jack streckte ihm die Hand hin. Cory schüttelte sie, so gut er konnte.
»Danke, Mann. Und übrigens summa cum laude.«
»Habe von dir nichts anderes erwartet.« Und das stimmte: Cory hatte schon immer einen messerscharfen Verstand gehabt.
»Aber das andere Versprechen habe ich nicht gehalten. Und das bringt mich um.«
»Du siehst tatsächlich beschissen aus. Aber ich dachte, das sei der Krebs«, witzelte Jack und hoffte, Cory ein wenig zum Lachen zu bringen.
Das gelang ihm auch.
»Autsch, Mann«, sagte Cory und rieb sich den Bauch, »mach das nicht noch mal. Tut echt weh.«
»Tut mir leid.«
»Ist gelogen.«
»Ja, stimmt.«
Sie stießen die Fäuste zusammen. Wieder Freunde. Fürs Leben.
Solange es noch dauern mochte.
»Also – welches Versprechen hast du nicht gehalten?«
Und Cory erzählte es ihm.
Jack zuckte mit keiner Wimper.
»Das ist viel verlangt«, gab Cory am Ende zu. »Aber es fiel mir sonst niemand ein, den ich hätte fragen können. Und erst recht niemand sonst, der es durchziehen könnte. Aber ich hasse es, meinen Dad zu enttäuschen, verstehst du?«
»Yeah, verstehe ich gut. Aber ich denke, dass auch er es verstehen würde.«
»Würde er wahrscheinlich. Aber es geht dabei um mich. Ich will mein Versprechen halten. Und du bist meine einzige Chance.«
Jack kämpfte die Tränen zurück, die sich plötzlich in seine Augen drängten.
»Es wird mir eine Ehre sein.«
Schwester Mary Francis brachte eine Flasche zwölfjährigen Macallan-Whisky und zwei Gläser herein. Cory hatte die Flasche eigens für diesen Moment gekauft. Der kranke Mann trank ein paar Schlucke Wasser aus seinem Glas, während sich Jack durch ein paar Fingerbreit Whisky kämpfte. Sie lachten zusammen, erzählten sich Erinnerungen, wie es alte Schulkameraden tun, aber als es draußen allmählich dunkelte, fielen Cory vor Erschöpfung immer häufiger die Augen zu.
Als Cory sanft zu schnarchen begann, verließ Jack leise das Zimmer.
Schwester Mary Francis brachte ihn zur Haustür.
»Rufen Sie mich bitte an, wenn er irgendetwas braucht«, sagte Jack und gab ihr seine Visitenkarte. Sie gab ihm ihre Karte.
»Das mache ich. Gute Heimreise, Jack. Und Gott segne Sie dafür, dass Sie gekommen sind.«
Nur dreieinhalb Stunden später, als Jack an seinem Schreibtisch saß und über einer Konzernbilanz brütete, klingelte sein Telefon. Überrascht und bestürzt nahm er den Anruf entgegen.
Cory Chase war gestorben.
3
Washington, D.c. Russell Senate Office Building
Arnie van Damm, Präsident Ryans Stabschef, saß im Büro der Senatorin Deborah Dixon. Zwischen ihnen stand ein massiver, handgeschnitzter antiker Schreibtisch, aber tatsächlich trennte sie noch viel mehr voneinander.
Als Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des US-Senats und ehemalige Vorsitzende des Unterausschusses Europa und Regionale Sicherheitskooperation zählte Senatorin Dixon zweifellos zu den mächtigsten Mitgliedern des Senats und hatte vermutlich den größtmöglichen Einfluss auf die Gesetzgebung im Bereich der Außenpolitik. Verträge überlebten oder starben unter ihrer Aufsicht.
Dieses Mal jedoch war die Gesetzesvorlage nicht einfach »gestorben«, sondern war bewusst gekillt worden – gewissermaßen mit einer Kugel in den Kopf und anschließend ausgeblutet –, und zwar von Dixon persönlich, einer republikanischen Parteifreundin! Dabei hätte die Abstimmung genau nach der Linie der Partei laufen sollen – nur hatte sich Dixon nicht daran gehalten, sondern hatte mit den oppositionellen Demokraten gestimmt.
Arnie war wütend. Aber noch wichtiger war, dass auch Präsident Ryan wütend war, ebenso Außenminister Scott Adler, Verteidigungsminister Robert Burgess und der Stabschef der U.S. Army. Der Präsident hatte persönlich über Monate hinweg den bilateralen Vertrag mit Polen sorgfältig geplant und ausgehandelt, der vorsah, auf polnischem Staatsgebiet eine ständige Präsenz der U.S. Army aufzubauen und zu unterhalten. Die Basis war als vorgeschobene Verteidigungsstellung gegen die russischen Expansionsbestrebungen in der Region geplant, eine Maßnahme, zu der sich die USA im Hinblick auf die Stärkung der Abwehrkräfte der NATO veranlasst sahen, zumal aus amerikanischer Sicht das militärische Engagement der Westeuropäer noch immer ungenügend war.
Als Stabschef des Weißen Hauses gehörte es zu Arnies Aufgaben, die Räder auf dem Capitol Hill immer gut geschmiert zu halten, damit die Gesetzesvorlagen reibungslos durchliefen, und natürlich galt das auch für die Vorlage, die Dixon gerade eben gekillt hatte. Die Senatorin war immer eine gute Freundin und verlässliche Kollegin gewesen. Jedenfalls hatte das Arnie bis heute Morgen geglaubt. Während er seine Stahlrandbrille putzte, versuchte er, sich wieder zu beruhigen.
»Du bist echt süß, wenn du wütend bist, Arnie. Hat dir das schon mal jemand gesagt?« Dixon war sechsundfünfzig Jahre alt und gab sich Mühe, wie sechsunddreißig auszusehen, was ihr auch fast gelang. Pilates fünfmal die Woche, Botox dreimal jährlich, eine strenge Paleo-Diät und der beste Hairstylist im gesamten District of Columbia machten natürlich eine Menge aus, aber gute Gene waren auch recht nützlich. Sie war eine äußerst attraktive Frau, ein Hingucker, aber ihren politischen Erfolg verdankte sie letztendlich nicht ihrer fantastischen Erscheinung, sondern ihrem messerscharfen Verstand.
Na gut, zum größten Teil jedenfalls.
»Ich sehe wütend besser aus als sonst? Dann muss ich jetzt gerade der schönste Mann der Welt sein, Deborah. Ein verdammter Adonis! Ich dachte, wir hätten einen Deal?« Arnies kahler Schädel war vor Wut rosa angelaufen.
»Nun, dann hast du dich eben getäuscht. Wir haben lange genug darüber diskutiert, und ich habe gründlich über alles nachgedacht, was du gesagt hast. Der Unterausschuss hat die Angelegenheit von allen Seiten betrachtet, auch die Pro- und Kontra-Aussagen der Experten. Aber wie du weißt, Arnie, muss ich meinen Job machen. Ich bin gewählte Senatorin, nicht irgendein Apparatschik unserer Grand Old Party. Als solche soll ich ›beraten und abstimmen‹ und nicht gehorsam mit dem Schwanz wedeln, wenn Ryan oder seine Leute pfeifen.«
»Nette Rede, Deborah. Die hast du doch nicht selbst geschrieben, oder?«
»Erspar mir den Scheiß, Arnie. Also: Was willst du?«
»Zuerst einmal eine öffentliche Entschuldigung. Du hast den Präsidenten in peinlichster Weise vorgeführt – schon im kommenden Monat ist ein Gipfel mit dem polnischen Präsidenten in Warschau geplant, bei dem die beiden Präsidenten den ersten Spatenstich des Projekts machen wollen.«
»Erstens: Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meinen verfassungsgemäßen Pflichten als Senatorin nachkomme, auf die ich einen Amtseid geleistet habe. Und zweitens: Schieb mir nicht die Schuld zu, nur weil du schon voreilig die goldene Schaufel für die Grundsteinlegung von Fort Ryan bestellt hast, die nun eben nicht stattfinden wird.«
»Verdammt, Deborah, das ist nicht fair, und das weißt du auch. Niemand fordert dich auf, deine Pflichten zu vernachlässigen. Aber wenn du Bedenken hast, hättest du damit zu uns kommen sollen, wir hätten bestimmt eine Lösung gefunden. Aber du hast dich nicht gerührt. Was zum Teufel ist passiert?«
»Nichts ist ›passiert‹, Arnie – außer, dass ich eben meiner Sorgfaltspflicht nachgekommen bin.«
»Und was hast du mit deiner ›Sorgfaltspflicht‹ entdeckt, das wir nicht längst bis zum Überdruss ausdiskutiert hatten?«
»Ach, komm schon, Arnie. Reden wir doch wie Erwachsene miteinander. Die ganze Sache ist doch nur eine Hurra-Veranstaltung, ein gigantisches Mediengedöns. Der Vertrag schickt den Russen genau die falschen Signale zur falschen Zeit. Es ist höchste Zeit für eine Deeskalation, ganz besonders jetzt, wo gerade ein neuer Präsident an die Macht gekommen ist. Gebt ihm die Chance, sich einzuarbeiten. Wenn wir eine vorgelagerte Militärbasis direkt an der Grenze seiner Einflusssphäre aufbauen, wird er sich doch gezwungen sehen, entsprechend zu reagieren! Wenn er nichts tut, werden die Hardliner im Kreml seinen Kopf fordern – bildlich gesprochen oder vielleicht sogar tatsächlich.«
»Si vis pacem, para bellum«, antwortete Arnie und beugte sich näher. »Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor.«
»Si vis pacem, para pacem«, gab sie scharf zurück. »Wir sollten es zur Abwechslung mal mit Diplomatie versuchen statt mit Provokationen.«
»Wir sind hier nicht die Aggressoren. Wir sind weder in Litauen noch in der Ukraine einmarschiert.« Damit meinte Arnie die jüngsten russischen Einfälle in diese Länder, die von diesen vor allem mit amerikanischen Waffen zurückgeschlagen oder zumindest aufgehalten werden konnten. »Aber das weißt du doch. Ich frage dich noch einmal: Was soll das alles?«
»Ich denke, ich habe mich absolut klar ausgedrückt. Dass Ryan den Vertrag bilateral mit Polen aushandelte, verärgert unsere wichtigsten NATO-Verbündeten, vor allem Deutschland und Frankreich, und provoziert nur noch einen weiteren Krieg mit den Russen. Wir rücken immer näher an ihre Grenzen heran, obwohl wir genau das Gegenteil versprochen hatten.«
»Die Russen suchen ständig nach Ausreden …«
»Nein, Arnie. Betrachte das doch einmal aus ihrem Blickwinkel. Die Russen ließen die deutsche Wiedervereinigung zu, aber erst, nachdem die NATO zugesichert hatte, nicht weiter nach Osten zu expandieren. Und was passierte dann? Deutschland wurde wiedervereint – was übrigens der schlimmste strategische Albtraum der Russen war, zumindest in Europa –, und die NATO erweiterte sich trotzdem nach Osten.«
»Das stimmt nicht. Oder hast du die NATO-Russland-Grundakte von 1997 nicht gelesen? Außerdem passierte das alles lange vor Ryans Präsidentschaft.«
»Aber er steht dazu. Oder hat er etwa unsere NATO-Verpflichtungen in Osteuropa verringert? Kroatien? Albanien? Dann auch noch Montenegro! Um Himmels willen, Arnie, glaubst du wirklich, wir brauchen Montenegro für die strategische Tiefenverteidigung in Europa? Spar dir die Antwort, wir beide kennen sie doch längst. Und die Russen kennen sie auch. Du bist doch eines von Präsident Ryans Wunderkindern. Dann sag mir doch, was du tun würdest, wenn du Russe wärst und die Situation genau umgekehrt wäre?«
»Ich würde jedenfalls nicht meine Nachbarn überfallen.«
»Wirklich nicht? Wenn Kuba plötzlich Atomraketen aufstellen würde? Oder wenn die Russen ihre Bear-Bomber auf Luftstützpunkten in Kanada stationieren würden? Würdest du dann dem Präsidenten raten, geduldig abzuwarten? Weil man das nicht als Bedrohung ansehen könne?«
»Aber wir sind nicht die Russen!«
»Russen!« Dixon schüttelte den Kopf und winkte mitleidig ab. »Was habt ihr Neokonservativen nur mit Russland? Das ist doch heute nichts weiter als eine riesige Tankstelle für Öl und Gas und mit Atomwaffen, die sie nie einsetzen werden. Bestenfalls eine drittklassige Macht.«
»Sag mal, Deborah, welche Farbe hat der Himmel in deiner Welt? In meiner ist er blau, und in meiner Welt ist Russland eine aggressive und extrem gefährliche Atommacht, die immer weiter expandieren wird, wenn niemand sie aufhält. Die Deutschen werden das ganz bestimmt nicht wagen. Aber die Polen – oder zumindest werden sie uns helfen, die Russen aufzuhalten.«
»Unser derzeitiger Verteidigungshaushalt ist zehnmal größer als der Russlands und auch noch deutlich größer als die gesamten Verteidigungsausgaben der nächsten acht Länder, einschließlich Russland und China. Und, verdammt, unser Verteidigungsbudget ist dreimal größer als der gesamte Rest der NATO-Länder zusammengerechnet. Glaubst du im Ernst, ein weiterer amerikanischer Stützpunkt in Polen macht da noch einen Unterschied?«
Arnie seufzte. »Wir waren doch früher einer Meinung? Jetzt verstehe ich dich nicht mehr. Sag mir ganz offen und ehrlich, was du eigentlich willst?«
»Was ich will?« Dixon stand auf. »Ich sag dir, was ich will. Einen Bourbon on the rocks. Willst du auch einen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie zu ihrer Büro-Minibar hinüber.
Während Dixon Eiswürfel in ihr Glas fallen ließ, strich sich Arnie nachdenklich über den kahlen Schädel. Was für ein Spiel trieb diese Frau?
Geistesabwesend glitt sein Blick über die Wände. Er kannte die Fotos – Dixon mit Königen und Präsidenten, mit dem Papst und mit einer Reihe bekannter Wirtschaftsbosse. Auf einem Foto hielt sie einem zweifach Amputierten im Walter-Reed-Militärkrankenhaus tröstend die Hand. Ein anderes Foto zeigte sie im Cockpit eines F-35-Kampfflugzeugs, und auf einem weiteren Foto klebten ihre Augen am Periskop eines Jagd-U-Boots der Los Angeles-Klasse.
Außerdem gab es auch Fotos von Hilfsprojekten, die vom Dixon-Gage Charitable Trust in Afrika und überall auf der Welt finanziert wurden.
Die Fotowand sagte alles. Deborah Dixon war eine sehr erfolgreiche Abgeordnete, eine teilnahmsvolle Politikerin, eine außenpolitische Expertin und, nach ihrem maßgeschneiderten Fendi-Anzug und den Manolo-Blahnik-Pumps zu urteilen, eine Frau mit teurem Geschmack, die einen schwerreichen Mann geheiratet hatte.
Aber sie war zweifellos auch sehr ehrgeizig.
Dixon setzte sich wieder hinter ihren Schreibtisch und nippte an ihrem Bourbon. »Wo waren wir stehen geblieben?«
»Ich will, dass dir eins klar wird: Mit dieser Sache kommst du nicht durch. Präsident Ryan ist entschlossen, den Vertrag verabschieden zu lassen. Er hat sich um deine Zustimmung bemüht, aber du hast ihn in die ausgestreckte Hand gebissen. Das war ein schwerer Fehler, vor allem für eine Person, die ihre Augen auf den höchsten Preis richtet.«
Dixon schnaubte verächtlich. »Verdammt, Arnie, ich habe mal jemanden vom Reinigungspersonal im Weißen Haus überrascht, als er sich an den Schreibtisch des Präsidenten setzte. Zeig mir jemanden in dieser Stadt, der nicht die ›Augen auf den höchsten Preis richtet‹. Die Frage ist nur, was würde irgendeiner dieser Menschen tun, wenn er den Preis tatsächlich erringen würde?«
»Die Nation gegen alle Feinde verteidigen, innere und äußere. Jedenfalls hoffe ich das.«
»Ah, wenigstens dabei sind wir einer Meinung. Aber der Teufel steckt immer im Detail.«
»Schau mal, Deborah. Du willst für das Amt des Präsidenten kandidieren? In Ordnung. Aber mit Ryans Unterstützung würde es dir entschieden leichter fallen als ohne.«
»Und das könntest du heute schon zusichern?«
Arnie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht, wie du genau weißt. Der Präsident wird die Person unterstützen, die er für am besten geeignet hält.«
»Dann ist die Entscheidung doch wohl klar, oder nicht?«
»Es wäre ein Fehler, gegen die Agenda des amtierenden Präsidenten für die Präsidentschaft zu kandidieren, vor allem, wenn man derselben Partei angehört.«
»Du weißt, dass ich keine typische Parteifunktionärin bin und auch nie war. Ich bin unabhängig.«
»Gut – dann kandidiere eben als Unabhängige!«
»Mit null Chancen? Nein danke. Ich brauche natürlich die Nominierung durch die Republikanische Partei, wenn ich gewinnen will.«
»Dann achte darauf, wie du dich verhältst, warte deine Chance ab und folge der Agenda des Präsidenten!«
Dixons blasiertes Lächeln verschwand. Ihr Gesicht lief rot an vor Wut.
»Soll das ein Ratschlag sein? Klingt eher wie eine Warnung!«
»Nur ein guter Rat. Aber überlege dir gut, welche Konsequenzen es hat, wenn du ihn nicht befolgst.« Arnie stand auf. »Ich muss zu einer Besprechung, Senatorin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.« Er drehte sich um und ging, ohne auf ihre Antwort zu warten.
Dixon lehnte sich zurück und drehte das Whiskyglas zwischen den Fingern. Innerlich kochte sie vor Wut. Präsident Ryan war sauer. Na schön, das hatte sie erwartet. Das gehörte zu dem Preis, den sie zu zahlen bereit war. Aber sie hatte auch gar keine andere Wahl. Soweit es den Vertrag mit Polen betraf, hatte man ihr glasklare Anweisungen gegeben.
Allerdings hatte sie nicht die Absicht, auf ihre Chance zu warten.
Nachdenklich nippte sie ein wenig Whisky. Der Gedanke, dass Ryan hinter ihr her sein könnte, schickte ihr einen kalten Schauder über den Rücken.
Aber die Alternative war noch viel schlimmer.
4
Teheran, Iran Ministerium für Nachrichtenwesen (Vaja)
Zufrieden?
Mehdi Mohammadi, der iranische Minister für das Nachrichtenwesen, dessen Ministerium auch die iranischen Geheimdienste unterstellt waren, saß nun schon seit mehr als einer Minute unbeweglich vor dem Computermonitor und starrte diese Frage an. Obwohl sie nur aus einem einzigen Wort bestand, war sie höchst interessant und barg ungeahnte Möglichkeiten.
Und Gefahren.
Dass unten am Bildschirmrand eine Countdown-Uhr gnadenlos die Sekunden heruntertickte, war alles andere als hilfreich, um eine solche Entscheidung zu treffen. Noch zweiundvierzig Sekunden.
»Herr Minister?« Der bärtige junge Techniker lächelte hoffnungsvoll. Er mochte seinen Job. Aber noch lieber mochte er es, weiteratmen zu dürfen. Beides geriet in Gefahr, wenn er Mohammadi verärgerte.
»Ich überlege noch.« Mohammadi strich sich mit der guten Hand über den Bart.
Tatsächlich jedoch war er hochzufrieden. Die Intel von CHIBI war genauso gut wie versprochen. Vielleicht zu gut.
Einerseits hatten die Informationen es den Al-Quds-Brigaden ermöglicht, eine Falle zu stellen und die argentinischen Kreuzzügler auszulöschen, wodurch die Tür in Argentinien für weitere Operationen der Hisbollah weit aufgestoßen wurde – vielleicht sogar für den ganzen Subkontinent. Das würde die Amerikaner und Israelis noch weiter von ihrem Krieg gegen den Allerhöchsten Herrn ablenken, den sie ohnehin nicht gewinnen konnten.
»Dreißig Sekunden, Herr Minister.«
»Ich bin nur auf einem Auge blind und kann die Uhr noch ganz gut selbst lesen!«
Das Ministerium für Nachrichtenwesen der Islamischen Republik Iran – Wezārat-e Et․t․elā῾āt-e Gˇomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān, (abgekürzt VAJA) – war früher im Englischen besser als VEVAK bekannt gewesen. Es war die größte, mächtigste und finanziell am besten ausgestattete Behörde des Iran, und Mohammadi war unmittelbar dem Obersten Führer Ajatollah Yasseri unterstellt. Selbst der mächtige Expertenrat durfte sich nicht in seine Arbeit einmischen. Im Nahen Osten stand sein Geheimdienst nur dem israelischen Mossad nach; weltweit war er den Geheimdiensten der Großmächte fast ebenbürtig. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse – in seiner Branche Intelligence genannt – waren heutzutage der Schlüssel zu buchstäblich allem. Mohammadis »Unbekannte Soldaten des Imam Zaman« führten überall auf der Welt geheime Aufklärungsoperationen durch. Aber geheimdienstliche Informationen von solcher Qualität hatten sie noch nie beschaffen können.
Diese Art von Informationen wird alles verändern.
Intelligence von wahrhaft unschätzbarem Wert.
Aber wie war CHIBI an diese Erkenntnisse gekommen? Mohammadi hatte eine einzige, anonyme E-Mail erhalten; selbst seine besten Techniker hatten den Absender nicht herausfinden können. Die Mail enthielt ein sehr schlichtes Angebot. »Eine kostenlose Probe« war ihm darin versprochen worden.
Mohammadi hatte das zuerst für eine Falle gehalten, für irgendeinen komplizierten Schwindel, durch den ihm die Amerikaner oder die Israelis Informationen über die Operationen der Quds-Einheiten und der Hisbollah in Lateinamerika entlocken wollten.
Aber nicht einmal die Amerikaner würden zwei Dutzend argentinische Spezialkräfte für nichts weiter als ein Täuschungsmanöver opfern.
Es war einfach alles zu gut, um wahr zu sein. Aber bekanntlich wusste Allah, wie er den Verstand der Ungläubigen verwirren konnte. Und wie jeder Geheimdienstprofi wusste, waren die größten Spionageerfolge im Kalten Krieg nicht durch die traditionellen Spionagemethoden erzielt worden, sondern einfach dadurch, dass irgendwelche Leute durch die Tür der Gegenseite spazierten und freiwillig ablieferten, was immer sie wussten – Leute, die das entweder aus ideologischer Überzeugung taten oder weil sie sich von ihrem Ego oder ihrer Gier verführen ließen.
War das auch hier der Fall? Oder war es wirklich nur eine aufwendig und verdammt clevere Falle, um die Revolution zu vernichten? Und wenn es so war – wer steckte dann dahinter?
Die Operationen gegen den sogenannten »Persischen Frühling« hatten in einem totalen Fiasko geendet. Dank sei Allah, dass ich von Anfang an dagegen gewesen war, dachte Mohammadi. Aber bei diesem Streit hatte sich damals dieser Narr Ghorbani durchgesetzt. Sein Tod war sicherlich Allahs gerechte Strafe gewesen, aber die Russen hatten sich bei dieser fehlgeschlagenen Operation schwer die Finger verbrannt. Vielleicht suchten sie jetzt nach einer Art Vergeltung für Reza Kazems Versagen?
Würde Mohammadi diese Gelegenheit nicht nutzen, verlöre er womöglich das mächtigste Schwert, das ihm Allah jemals in die Hand geben würde, um die Kreuzfahrerfeinde Allahs zu besiegen. Allah würde es ihm womöglich niemals verzeihen, wenn er dieses großzügige Angebot ausschlug.
Und sicherlich würde ihm auch der Ajatollah nicht verzeihen, es abgelehnt zu haben. Mohammadis gesundes Auge, das nicht von den brutalen Folterknechten der SAVAK – des berüchtigten Geheimdienstes des Schahs – geblendet worden war, zuckte kurz zu dem Techniker, der direkt neben ihm saß. War dem jungen Mann klar, dass sein Leben in den nächsten paar Sekunden auf der Kippe stand?
Aber es gab noch eine weitere Möglichkeit. Könnte dies nicht das Schwert des Teufels sein, das auf das Herz der Islamischen Republik zielte? Würde er, Mohammadi, am Ende nicht selbst das Schwert aus dem Feuer ziehen und in das Herz der Revolution stoßen, wenn er sich dazu verleiten ließe, auf Informationen zu vertrauen, die von dem Ungläubigen am anderen Ende dieser Computerverbindung geliefert wurden?
Kein Lohn ohne Risiko. So würden es die Amerikaner sehen, oder nicht?
Mohammadi berührte den Stumpf aus verschmolzenen Knochen und verbranntem Gewebe, der von seiner linken Hand übrig geblieben war. Noch so ein Geschenk der CIA und des vom Mossad ausgebildeten SAVAK-Abschaums, die gemeinsam versucht hatten, die iranische Revolution im Keim zu ersticken. Sein Hass auf die Amerikaner und Juden kannte keine Grenzen. Aber Allah hatte sein Leiden genutzt, um ihn so hart wie den Stumpf an seinem Arm zu machen. Aus den heiligen Schriften hatte er viel gelernt, aber nichts war so wichtig wie die Wahrheit, dass es im Paradies keine Feiglinge gab.
Er blickte wieder auf die Uhr. Noch vier Sekunden.
»Schreib: ›Ja, zufrieden‹«, befahl Mohammadi knapp.
Der Techniker seufzte innerlich und tippte die Antwort schnell ein.
Der Austausch erfolgte in Englisch, der Sprache, die CHIBI benutzte. Als junger islamischer Gelehrter war Mohammadi nach Kanada geflohen, um dem mörderischen Zugriff des Schahs zu entkommen. Während seiner Jahre in Kanada hatte er Französisch und Englisch gelernt – bis ihn schließlich die SAVAK-Agenten aufgespürt und nach Teheran zurückverschleppt hatten. Dort hatten sie ihn dann einem intensiven »Verhör« unterzogen.
Auch das war ein Beweis für die allwissende Führung Allahs in seinem Leben.
»Und jetzt frage: ›Wie viel?‹«
Der Techniker gab die Frage ein.
Die Antwort erschien sofort auf dem Monitor.
Sie kennen die Bedingungen.
»Nennen Sie Ihren Preis«, ließ Mohammadi antworten.
Sie kennen die Bedingungen.
»Lassen Sie mich wenigstens wissen, gegen wen ich biete.« Mohammadi befürchtete, bei der Auktion von einem anderen Bieter überboten zu werden, der diese Informationswaffe am Ende gegen die Islamische Republik einsetzen könnte. Andererseits wollte er auch nicht zu viel bezahlen müssen. Die iranische Wirtschaft lag derzeit am Boden. Um die Auktion in London zu gewinnen, würde Mohammadi den Ajatollah um sündhafte hohe Beträge bitten müssen. Aber was wäre, wenn die anderen Mitbieter weit weniger mächtig waren als sein eigenes Ministerium und folglich viel weniger bieten würden?
Sie kennen die Bedingungen.
CHIBI war ganz offensichtlich sehr vorsichtig. Weder Grammatik noch Wortwahl oder argumentative Logik gaben Mohammadi auch nur den geringsten Hinweis auf CHIBIs Identität.
»Feinde der Revolution?«
Sie kennen die Bedingungen.
Natürlich kannte er sie. Absolute Anonymität der Bieter war zugesichert worden. Aber die anderen Bieter mussten sicherlich andere große Geheimdienste sein, die gegen die Amerikaner kämpften. Wer sonst würde das haben wollen, was CHIBI zu verkaufen hatte?
Ja oder nein?
»Ja. Ich werde zum von Ihnen genannten Termin einen Vertreter nach London entsenden.«
Nähere Anweisungen erhalten Sie in Kürze.
CHIBI verschwand vom Display. Irgendeiner der unzähligen digitalen Dschinns, die in der Wildnis des Dark Web herumgeisterten.
Ein kalter Blick aus Mohammadis geblendetem Auge sorgte dafür, dass der Techniker aus dem klimatisierten Raum floh. Der Chef des iranischen Geheimdienstes blieb allein in dem unterirdischen Bunker zurück, umgeben von einem Dutzend großer, leise summender Monitore, und rieb sich nachdenklich den Armstumpf.
CHIBI war ein Genie. Schon ein einziges, geheimes Gebot in einer anonymen Auktion würde dem Anbieter maximalen Profit garantieren. Und wenn CHIBI anderen Interessenten »kostenlose Proben« von derselben Qualität wie für die Sache in Lateinamerika angeboten hatte, war bei der Auktion ein scharfer Wettbewerb zu erwarten – und entsprechend hohe Gebote.
Er musste dringend mit dem Obersten Führer sprechen. Mohammadi stand auf und strich die Falten seiner Klerikerrobe glatt.
Keine Frage, die iranische Volkswirtschaft befand sich auf Talfahrt. Er würde deshalb seine gesamten Überredungskünste brauchen, um beim Obersten Führer die riesige Summe lockerzumachen, die er benötigte, um in London Erfolg versprechend mitbieten zu können.
»Unschätzbar« war eben nicht billig zu haben.
Inschallah.
5
Fort Meade, Maryland Nsa-Hauptquartier
Tote Ratten. Manchmal auch Tauben. Aber tote, ausgetrocknete Ratten waren besser. Wir gossen scharfe Soßen darüber, um die herumstreunenden Katzen abzuschrecken, und stopften dann die Filmrollen oder Transpositionschiffren hinein. Das waren unsere toten Briefkästen. So oder so ähnlich machten wir es damals in Moskau.«
Mary Pat Foley, die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, kurz DNI, lehnte sich in ihrem Sessel an dem langen Mahagoni-Konferenztisch zurück, von diesen Erinnerungen fast überwältigt. Ihr Ehemann Ed Foley war der jüngste Leiter der Außenstelle Moskau gewesen, den die CIA jemals in die sowjetische Hauptstadt geschickt hatte. Mary und Ed hatten dort zusammengearbeitet. Hatten ihre Kinder mit nach Moskau genommen und dort großgezogen. Das war gegen Ende der 1980er-Jahre gewesen. Im Kalten Krieg.
So lange war das nun schon her.
Mary Pat ließ den Blick rundum gleiten. Die meisten hatten ein höflich-reserviertes Lächeln aufgesetzt. Zweifellos aus Nachsicht, der Chefin gegenüber.
Sie waren alle so jung, diese Gesichter. Die meisten so um die vierzig, ein paar sogar noch jünger. Mit ihr am Tisch saßen die Leiter oder Leiterinnen der Sicherheitsabteilungen sämtlicher sechzehn Dienste, die sich an der Intelligence Community (IC) Cloud beteiligten, oder ihre Stellvertreter. Rechts neben ihr saß auch ein Vertreter ihrer eigenen Behörde, des Office of the Director of National Intelligence, kurz ODNI. Die Jalousien an den Glaswänden des Konferenzraums waren herabgefahren worden, sodass die vielen NSA-Analysten, die im Großraumbüro an ihren Workstations saßen, keinen Einblick hatten. Vollständige Sicherheit ringsum.
Einst war sie bei derartigen Besprechungen die Jüngste gewesen. Mittlerweile war sie meistens die Älteste.
Wann hat sich das geändert?, fragte sie sich.
Tage, Wochen, Monate flogen immer schneller dahin.
Das jüngste Gesicht saß ihr direkt gegenüber, am anderen Ende des langen Tisches. Amanda Watson war nicht nur die jüngste der Teilnehmenden, sondern auch die attraktivste Frau im Raum. Naturblond und mit durchtrainierter Figur sah die dreiunddreißigjährige Computerspezialistin wie eine Moderatorin von Fox News aus; tatsächlich war sie jedoch die leitende Entwicklungsingenieurin von CloudServe und die wichtigste Architektin der IC-Cloud. Außerdem war Watson für die Sicherheit der IC-Cloud zuständig und leitete persönlich das »Red Team«, eine Gruppe begnadeter Hacker, die unablässig versuchten, die IC-Cloud zu hacken, um potenzielle Hardware- oder Software-Schwachpunkte aufzudecken, die die Sicherheit der Cloud gefährden könnten. Wer wäre besser dafür qualifiziert als die Frau, die das erste »unhackbare« Cloud-Netzwerk der Welt entwickelt hatte?
»Ratten? Klingt ziemlich eklig«, sagte Watson mit einem perfekt konstruierten Lächeln. »Aber vermutlich hat es funktioniert?«
»Ganz wunderbar.«
Foley scannte noch einmal die Gesichter. Sie suchte nach einer Möglichkeit, ihr Argument verständlich zu machen. Sie war sich ziemlich sicher, dass der Durchschnitts-IQ hier am Tisch sehr viel höher war als ihr eigener, und Watsons IQ war vermutlich überirdisch. Wie komme ausgerechnet ich auf die Idee, diese Intelligenzbestien noch belehren zu wollen?
Die Entscheidung, sämtliche Erkenntnisse aller Nachrichtendienste in einer einzigen »Cloud« zusammenzuführen, war von Leuten getroffen worden, die viel smarter als sie selbst waren und die sowohl ihr als auch Präsident Ryan versichert hatten, dass das die Zukunft der Datenverarbeitung in der Welt der Nachrichtendienste sei – ein System zur gemeinschaftlichen Nutzung aller Informationen bei größtmöglicher Sicherheit. Tatsächlich bestand diese »Cloud« nur aus langen Reihen von Servern in einer Hochsicherheitseinrichtung. Hier gab es keine Firewalls und Revierkämpfe mehr, die eine Bundesagentur daran hindern konnten, sich Zugriff auf alle entscheidenden Erkenntnisse zu verschaffen, die einer der anderen Dienste gesammelt hatte. Keine verpassten Gelegenheiten mehr. Keine katastrophalen Fehlschläge mehr. Alles, was die Behörden der Intelligence Community taten, würde nun auf die neue IC-Cloud hochgeladen – nicht nur ELINT (die elektronische, nicht kommunikativ genutzte Aufklärung), sondern auch SIGINT (die durch Erfassung und Analyse der elektronischen Signale und Kommunikationen gewonnenen Erkenntnisse) und sogar die Informationsgewinnung durch menschliche Quellen (HUMINT), wozu auch Spionage zählte. Jede und jeder mit der erforderlichen Sicherheitsfreigabe würde darauf zugreifen können. Fortan würden alle immer auf demselben Kenntnisstand sein. Für den Informationsaustausch zwischen allen Agenturen, Behörden und Organisationen der Nachrichtendienstgemeinde würde die gemeinsam genutzte und gepflegte IC-Cloud um ein Vielfaches effizienter sein, enorme Kosten einsparen und außerdem die Sicherheit der Computernetzwerke verbessern, weil sich die Zahl und Komplexität der Hardware und der Zugriffsknotenpunkte verringern würden.
Auf dem Papier war das definitiv eine brillante Idee.
Und alles würde sicherer sein als jemals zuvor. Behaupteten sie jedenfalls. Einer von Mary Pats Assistenten hatte ihr das mit einem einfachen Beispiel erklärt: Statt einer Anzahl von kleinen, im ganzen Land verstreuten Bankfilialen, von denen jede einzelne jederzeit von Bankräubern überfallen werden könnte, hätte man dann nur noch eine einzige Einrichtung, sozusagen ein gigantisches, hochgesichertes elektronisches Fort Knox, in dem die »Goldbarren« – die gesammelten Erkenntnisse aller Nachrichtendienste – sicher verwahrt würden.
Und niemand konnte jemals in Fort Knox einbrechen.
Oder?
»Ratten waren besser, weil niemand Ratten mag, nicht einmal die Kommunisten, und erst recht nicht tote Ratten, die überall um die Mülltonnen herum lagen.«
Watsons makellos gezupfte Augenbrauen zogen sich leicht zu einer unausgesprochenen Frage zusammen. Was wollen Sie damit sagen?
»Sie alle sind Digital Natives«, fuhr Foley fort. »Sie sind mit diesem digitalen Kram aufgewachsen, das ist für Sie wie eine zweite Muttersprache. Sie können sich untereinander problemlos über ›Hadoop Cluster‹ und ›BitLockers‹ oder ›SaaS‹ unterhalten. Dagegen besteht meine Generation aus Digital Dinos.«
»Dinos, Ma’am?«, fragte der junge Analyst von einer der FBI-Abteilungen für Datensicherheit.
»Dinosaurier. Es ist mir einfach zu mühsam, allen immer zu erklären, dass ich ein digitaler Dinosaurier bin, weil ich erst spät begonnen habe, mich mit digitaler Datenverarbeitung zu befassen. Ich weiß natürlich, dass das die Zukunft ist – oder besser gesagt, es ist sogar schon die Gegenwart –, aber ich bin und bleibe analog. Funktioniert für mich besser.«
»Ich versichere Ihnen, Madame Director, dass die IC-Cloud um ein Vielfaches besser funktionieren wird als jedes analoge System«, beteuerte Watson. Das war nicht übertrieben. Bei der heutigen Quartalsbesprechung hatten sie zwei Stunden damit zugebracht, die schon jetzt erstaunlichen Erfolge des Systems noch einmal genau zu analysieren. Perfekte Operationsfähigkeit, null Sicherheitslücken.
Foley tippte auf ihr Tablet. »Ich weiß, dass es funktioniert. Ihre Daten beweisen es.«
»Trotzdem machen Sie sich Sorgen«, stellte Watson fest. Unter den Anwesenden war sie die Einzige, die aus dem Privatsektor kam. Die Zukunft ihrer Firma CloudServe hing davon ab, dass sie ihre Klienten – die bundesstaatlichen Behörden – zufriedenstellte.
»Eine Berufskrankheit«, erwiderte Foley mit müdem Lächeln. In letzter Zeit schlief sie nicht mehr gut, auch das hatte mit ihrem Beruf zu tun. Was beunruhigte sie? War es ihre eigene Unsicherheit, die ihr Sorgen bereitete? Dass sie womöglich mit all diesem Technobabbel nicht mehr Schritt halten konnte? Oder spürte sie einfach nur ihr Alter?
Es wäre nicht schwer, jemanden wie Watson einfach als jung und hübsch abzutun. Frauen in Foleys Alter machten das häufig, allerdings aus den falschen Gründen. Bei Frauen galten Jugend und Schönheit immer noch als karrierefördernde Attribute. Aber in Watsons Fall wäre das ein Fehler. Foley hatte sich den Lebenslauf der Frau genau angesehen.
Watson war ohne jeden Zweifel brillant.
Was Watson für die Ryan-Administration besonders interessant gemacht hatte, war ihr bedingungsloser Patriotismus, eine in den privilegierten Vorstandsetagen großer Konzerne in der Bay Area von San Francisco beklagenswert seltene Einstellung. Amanda Watsons Bruder, Kyle »Rex« Watson, hatte als Scharfschütze in der Delta-Spezialeinheit gedient und war zusammen mit seinem Beobachter »Mutt« vor ein paar Jahren bei einem Auslandseinsatz ums Leben gekommen. Seit seinem Tod hatte sich Watson unermüdlich für verwundete Veteranen und ihre Familien eingesetzt und für ihre wohltätige Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
Niemand hier am Konferenztisch zweifelte an Watsons Kompetenz, an ihrer Intelligenz oder an ihrem Patriotismus, und Foley zuallerletzt. Aber es war nicht Watson, die Foley Kummer bereitete.
Vor ein paar Jahren war die wichtigste Einheit der Cyber-Kriegsführung der Chinesen, das sogenannte Ghost Ship, auf dem chinesischen Festland bei einer wahrhaft heroischen Bombenoperation durch Kampfpiloten des U.S. Marine Corps vernichtet worden. Aber seither hatten die Chinesen die Zahl ihrer Kader und ihre Fähigkeit zur elektronischen Kriegsführung und Cyberspionage noch weiter ausgebaut, wozu auch die berüchtigte Einheit 61398 der Volksbefreiungsarmee gehörte, die gängige Bezeichnung für die Cyberkriegs-Einheit, die sich mutmaßlich mit Spionage und Sabotage von Computersystemen beschäftigte. Das konnte längst niemanden mehr sonderlich überraschen, denn Festland-China brachte Jahr für Jahr mehr als vier Millionen Absolventen der sogenannten STEM-Disziplinen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hervor. Außerdem waren viele Tausende STEM-Studenten und -Absolventen in den Vereinigten Staaten chinesische Staatsbürger. Tatsächlich waren nicht wenige von ihnen beim Ausspionieren der amerikanischen Unternehmen und Forschungsinstitute, in denen sie beschäftigt waren, ertappt worden.
Schätzungen zufolge verloren amerikanische Unternehmen durch Cyberspionageprogramme Urheberrechte im Wert von ungefähr dreihundert Milliarden Dollar – Programme, durch die auch Konstruktionspläne für hochentwickelte amerikanische Waffensysteme gestohlen werden konnten, darunter sogar für den Lockheed Martin F-35 »Lightning II«, ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation.
»Die chinesische Armee hat in letzter Zeit durch Spezialeinheiten ihre APT-Fähigkeiten sehr stark ausgebaut«, sagte Foley. Mit dem Akronym ATP (Advanced Persistent Threat) meinte Foley die fortgeschrittene andauernde Bedrohung durch effektive Angriffe auf kritische IT-Infrastrukturen und geschützte Daten von Behörden und Unternehmen aller Branchen. »Ganz besonders haben sie in KI-gestützte Hackerangriffe investiert, deren Häufigkeit und Reichweite exponentiell zugenommen haben. Sagen Sie, Mrs. Watson, macht Ihnen das keine Sorgen?«
»Doch, natürlich macht mir das Sorgen. China ist ohne jeden Zweifel die größte Bedrohung unserer Cybersicherheit, mit der wir es zu tun haben. Aber die Russen liegen nicht weit zurück, und das gilt auch für die Nordkoreaner, die Iraner … die Liste ist schier endlos. Aber die IC-Cloud ist ein standardisiertes, automatisiertes Cloud-Computersystem, das durch Air-Gapping besonders geschützt ist und seine Nichtanfälligkeit für derartige Angriffe bewiesen hat, wie Ihnen bereits bekannt sein dürfte, Madame Director.«
»Gut, aber was mir nachts den Schlaf raubt, Amanda«, setzte Foley noch einmal an, »ist die Tatsache, dass die gesamten Informationen und Erkenntnisse, die unsere Nachrichtendienste gewonnen haben, in einer einzigenIC-Cloud gespeichert und analysiert werden. Aber unsere IC-Community ist auch international äußerst eng verknüpft, besonders mit dem Five-Eyes-Programm, außerdem mit dem Club de Berne und mit INTCEN, dem Intelligence Analysis Centre der Europäischen Union. Kurz gesagt, der gesamte westliche nachrichtendienstliche Apparat würde gefährdet, sollte die IC-Cloud jemals kompromittiert werden. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass es für unsere Gegner eine riesige Verlockung darstellen würde, wenn wir alle unsere Eier in einen einzigen Korb legen würden. Die Zahlen sprechen nämlich nicht für uns. Die Intelligence Community wehrt gegenwärtig Jahr für Jahr Zigmillionen Angriffe ab – und dafür möchte ich allen hier am Tisch danken –, aber wenn auch nur ein Angriff auf die IC-Cloud erfolgreich wäre, nur ein einziger, würden wir den katastrophalsten Zusammenbruch der Nachrichtendienste in der Menschheitsgeschichte erleben.«
Watson nickte geduldig. »Verzeihen Sie, aber ich glaube, dass die Zahlen sehr wohl für uns sprechen. Ich meine, wenn Millionen von Angriffen jährlich fehlschlagen, ist das doch der Beweis, dass die IC-Cloud ihren Job perfekt ausführt, und es gibt jeden Grund für die Annahme, dass sie das auch in Zukunft tun wird.«