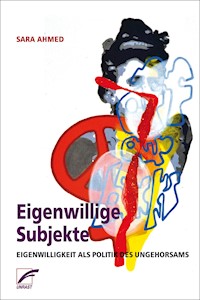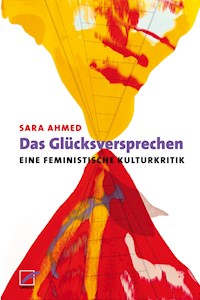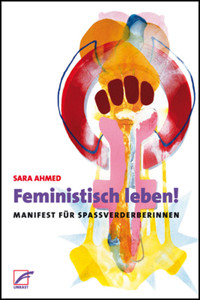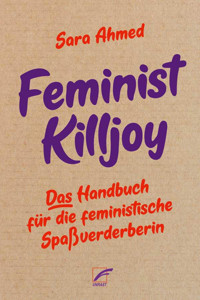
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bekannt für ihre messerscharfen Analysen und provokativen Thesen wählt die britische Autorin, Wissenschaftlerin und Aktivistin Sara Ahmed in diesem "Handbuch für die feministische Spaßverderber:in" eine eher persönliche, essayistische Herangehensweise, um ihre intellektuell anspruchsvollen Theorien im Alltag leb- und anknüpfbar zu machen. Praxisnah, frech und auch wütend geschrieben enthält ihr hochaktuelles Buch zahlreiche kluge Ideen zur Umsetzung eines intersektionalen Feminismus auf verschiedensten Ebenen, erhellende Beispiele für ihre praktische Anwendung, Leitsätze und Überlebenstipps, Lektüreempfehlungen und Anleitungen für Lesegruppen. Sara Ahmed, die hier auf eigene Erfahrungen zurückgreift und auf die anderer, vor allem queerer BIPoC-Vordenkerinnen, ist ein unterhaltsames, praxisnahes Buch der Selbstermächtigung gelungen, das jenen, die nicht wissen, wie mit dem Feminismus zu beginnen ist, ebenso dienlich sein kann wie jenen, die schon mittendrin stecken, die weiterlernen und die Geschichtsschreibung des feministischen Widerstands als Quelle der Stärke und der Inspiration nutzen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sara Ahmed ist eine britische Autorin, Wissenschaftlerin und feministische Aktivistin of Color. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Postcolonial Studies, feministische und queere Theorie. Über 20 Jahre arbeitete sie im Wissenschaftsbetrieb, u.a. am Goldsmiths College der University of London, bis sie 2016 aus Protest gegen den Umgang mit sexueller Belästigung an ihrer Universität kündigte. Heute arbeitet sie als freie Wissenschaftlerin und Autorin und betreibt seit Jahren ihren lesenswerten provokativen Blog ›feministkilljoys‹.
Sara Ahmed
Feminist Killjoy
Das Handbuch für die feministische Spaßverderber:in
Aus dem Englischen übersetzt von Nora Langenfurth
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Sara Ahmed: Feminist Killjoy
1. Auflage, Oktober 2024
eBook UNRAST Verlag, Dezember 2024
ISBN 978-3-95405-211-0
© UNRAST Verlag, Münster 2024
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titel der Originalausgabe:
The Feminist Killjoy Handbook, Penguin Random House, UK
Copyright © 2023 Sara Ahmed
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Felix Hetscher, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
1 Einführung der feministischen Spaßverderber:in
2 Überleben als feministische Spaßverderber:in
3 Die feministische Spaßverderber:in als Kulturkritiker:in
4 Die feministische Spaßverderber:in als Philosoph:in
5 Die feministische Spaßverderber:in als Poet:in
6 Die feministische Spaßverderber:in als Aktivist:in
Spaßverderber:innen-Wahrheiten, -Maximen, -Bekenntnisse und -Gleichnisse
Leseliste für die feministische Spaßverderber:in
Feministische Spaßverderber:innen-Lesegruppe: Diskussionsfragen
Danksagungen
Anmerkungen
Für Nila, Gulzar und bell
Und für alle feministischen Spaßverderber:innen da draußen,die immer noch ihr Ding machen
1Einführung der feministischen Spaßverderber:in
Ich beginne mit einer Geschichte, meiner Geschichte, der Geschichte, wie ich zu einer feministischen Spaßverderber:in wurde.
Wir sitzen am Esstisch. Alle sitzen immer auf den gleichen Stühlen, als ob wir uns damit mehr als nur unsere Plätze sichern wollten. Wir führen freundliche Gespräche. Mein Vater fragt erst nach der Schule, dann nach diesem und jenem. Und plötzlich sagt er etwas Beleidigendes, häufig etwas Sexistisches und schaut mich dabei herausfordernd an. Ich würde versuchen, nicht zu reagieren, still sitzen zu bleiben und mich einfach in Luft aufzulösen. Aber manchmal kann ich nicht anders. Ich könnte leise gesprochen haben. Ich könnte mich aufgeregt haben und frustriert erkannt haben, dass ich von jemandem aufgeregt wurde, der mich absichtlich aufgeregt hat. Ganz egal, was und wie ich es sage, wenn es einen Streit gibt, wenn die Diskussion hitzig wird, der Grund hierfür liegt immer bei mir. Am Ende lautet der Vorwurf jedes Mal: »Sara hat uns schon wieder das Abendessen verdorben.«
Wenn du dem Glück/lichsein der Anderen in die Quere kommst, wirst du zur feministischen Spaßverderber:in, oder wenn du ihnen generell in die Quere kommst und damit das Essen und zusätzlich die Atmosphäre ruinierst. Du wirst zur feministischen Spaßverderber:in, wenn du nicht bereit bist, mit allem klarzukommen, dich mit allem zu arrangieren, still sitzen zu bleiben und es einfach hinzunehmen. Du wirst zur feministischen Spaßverderber:in, wenn du reagierst, Autoritäten widersprichst und Worte wie ›Sexismus‹ benutzt, weil es sexistisch ist, was du zu hören bekommst. Es gibt so vieles, von dem dir zu verstehen gegeben wird, es sei zu vermeiden, nicht anzusprechen oder nicht zu tun, um eine Situation nicht zu ruinieren. Denn sonst ist es schließlich wieder ein ruiniertes Abendessen. Und es gibt so viele ruinierte Abendessen!
Also wurde ich zur feministischen Spaßverderber:in. Ich schreibe dieses Handbuch als feministische Spaßverderber:in. Bist du auch eine? Woher kannst du das wissen? Stelle dir erst einmal folgende Fragen: Weigerst du dich, über Witze zu lachen, die du beleidigend findest? Wurdest du schon einmal als spaltend bezeichnet, weil du auf eine gesellschaftliche Spaltung hingewiesen hast? Wurde dir schon einmal gesagt »Lächle mal, Liebes, es könnte doch noch schlimmer sein« oder »Mach dich mal locker, Schatz, es wird schon nicht passieren«? Musst du nur den Mund öffnen, damit andere ihre Augen verdrehen? Wird die Atmosphäre angespannt, wenn du irgendwo auftauchst oder wenn du etwas ansprichst? Wenn du eine oder alle diese Fragen mit Ja beantwortet hast, könnte es sein, dass auch du eine feministische Spaßverderber:in bist. Dann habe ich genau für dich dieses Handbuch geschrieben.
Die Geschichte der feministischen Spaßverderber:in beginnt aber nicht an dem Tisch, an dem wir uns einmischen oder zu Wort melden. Die Geschichte beginnt lange, bevor wir dort angekommen sind. Die feministische Spaßverderber:in beginnt ihr politisches Leben als Stereotyp einer Feminist:in, als eine Vorverurteilung bzw. als die Vorstellung, Feminismus sei die Ursache und der Grund für alles Leid. Indem wir uns selbst als feministische Spaßverderber:in bezeichnen, verwandeln wir die Verurteilung in ein Projekt; denn wenn Feminismus Unglück/lichsein verursacht, dann ist das vielleicht genau das, was wir verursachen müssen.
Oft liefern genau die Begriffe, mit denen der Feminismus abgetan wird, die besten Beweise dafür, wie sehr wir den Feminismus benötigen. Indem wir uns selbst als feministische Spaßverderber:innen bezeichnen, widmen wir uns nicht nur der Aufgabe, anderen den Spaß zu verderben, sondern wir entdecken auch eine feministische Geschichtsschreibung. Die feministische Spaßverderber:in gehört zur Geschischtsschreibung. Die feministische Spaßverderber:in hat eine Geschichte. Geschichtsschreibung kann Türen öffnen. Sie kann dabei helfen, zu erkennen, dass schon andere vor uns genau dort waren, wo wir jetzt stehen. In diesem Handbuch reisen wir mit den feministischen Spaßverderber:innen dorthin, wo sie bereits gewesen sind. Auf diesen Reisen wird die feministische Spaßverderber:in zu unserer Begleiter:in. Wir brauchen ihre Begleitung.
Die feministische Spaßverderber:in ist schon seit einiger Zeit meine Begleiter:in, eine Lebensgefährt:in ebenso wie eine Schreibgefährt:in. Auch wenn ich schon einmal über die feministische Spaßverderber:in geschrieben habe, wollte ich ihr ein eigenes Buch schenken. Warum ist ihr Buch ein Handbuch? Der Begriff ›Handbuch‹ bezog sich ursprünglich auf ein kleines handliches Buch, das Informationen und Fakten zu einem bestimmten Thema, Anleitungen für eine Kunstform oder einen Beruf, Anweisungen für die Bedienung von Maschinen oder Informationen für Tourist:innen bereitstellt. Das Handbuch für die feministische Spaßverderber:in enthält allerdings keine Anleitungen, Informationen oder Hinweise, wie du zu einer feministischen Spaßverderber:in werden kannst. Stattdessen zeigt es, wie das Leben dir als feministische Spaßverderber:in eine Reihe von Anleitungen, Informationen und Hinweisen gibt, wie du in dieser Welt zurechtkommen kannst.
Eine feministische Spaßverderber:in zu sein, kann zwar manchmal chaotisch und verwirrend sein, es kann uns jedoch auch Momente von Klarheit und großer Einsicht bringen. Daher füge ich noch einige Spaßverderber:innen-Wahrheiten, -Maximen, -Gleichnisse und -Bekenntnisse hinzu, die zwischen den Spaßverderber:innen-Erfahrungen immer mal wieder auftauchen und die ich am Ende des Buchs aufgelistet habe. Einige dieser Wahrheiten, Maximen, Gleichnisse und Bekenntnisse sind als ganz normale Sätze in früheren Büchern von mir zu finden. Ich spitze sie hier noch einmal zu, indem ich sie unterschiedlich wiederverwende, sie bestärke und noch etwas klarer formuliere.
Dieses Handbuch ist also als Ressource für feministische Spaßverderber:innen gedacht, als eine helfende Hand. Vielleicht hast du dich deinen Eltern gegenüber geoutet, nur um mit ihrer Trauer über dein angeblich aufgegebenes Glück/lichsein konfrontiert zu werden. Die feministische Spaßverderber:in kann dabei helfen. Vielleicht hast du versucht, dich über sexuelle Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz zu beschweren und bist dann selbst ins Verhör geraten. Die feministische Spaßverderber:in kann dabei helfen. Vielleicht hast du wohlüberlegte und nuancierte Kritik an Rassismus und Transfeindlichkeit formuliert, und dies wurde als ›Wokeismus‹ oder als ›Cancel Culture‹ diskreditiert. Die feministische Spaßverderber:in kann dabei helfen.
Vielleicht bist du aber auch wütend darüber, dass die MeToo-Bewegung in den Medien oft so dargestellt wird, als sei sie viel zu weit gegangen, bevor sie überhaupt etwas erreicht hat. Die feministische Spaßverderber:in kann dabei helfen. Ich hoffe, dass dieses Handbuch eine helfende Hand für die von uns sein kann, die auf unterschiedliche Art und Weise gegen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten kämpfen. Wir brauchen helfende Hände und wir brauchen Handbücher, weil die Kosten dieses Kampfes sehr hoch sind.
Ich beginne dieses Einführungskapitel mit einer Diskussion darüber, was wir aus der Geschichte des Wortes ›Spaßverderber:in‹ (killjoy) lernen können, bevor ich mich der Idee zuwende, wie die Figur der feministischen Spaßverderber:in dazu benutzt wird, den Feminismus als von Leid motiviert abzutun. Abschließend formuliere ich Ideen dazu, wie und warum wir die feministische Spaßverderber:in für uns selbst zurückfordern, indem wir unsere eigenen Geschichten erzählen, wie wir zu einer solchen wurden.
Es ist an der Zeit, euch unsere Reisebegleiter:in vorzustellen. Sie braucht vielleicht keine Vorstellung. Vielleicht kennst du sie bereits. Vielleicht bist du schon eine. Selbst diejenigen von uns, die sich selbst als feministische Spaßverderber:innen bezeichnen, können durchaus noch mehr über sie lernen. Um mehr über feministische Spaßverderber:innen zu erfahren, muss man nicht bei ihnen anfangen. Nicht alle Spaßverderber:innen sind Feminist:innen. Das Wort ›Spaßverderber:in‹ gibt es in der Tat schon länger als das Wort ›Feminist:in‹. Um dir einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Spaßverderber:innen entstanden sind, führe ich direkte Zitate aus historischen und zeitgenössischen Quellen an. Das Oxford English Dictionary nennt als ersten dokumentierten Gebrauch des Begriffs ›Spaßverderber:in‹ eine Bemerkung in der Allgemeinen Geschichte der Musik von Charles Burney aus dem Jahr 1776: »Die Götter wurden damals nicht, so M. Rousseau, als Spaßverderber:innen betrachtet und von geselligen Zusammenkünften ausgeschlossen.«[1]
Dieser recht merkwürdige Verweis deutet darauf hin, dass wenn Menschen oder Götter als ›Spaßverderber:innen‹ betrachtet werden, sie von Treffen ausgeschlossen werden, um diese gesellig zu halten. Der zweite Hinweis, der unter ›Spaßverderber:in‹ aufgeführt ist, bezieht sich auf George Eliots Roman Romola, der 1863 erstmals veröffentlicht wurde. Eine der Figuren, Savonarola, wird als »Freudentödter (killjoy) von Florenz«[2] bezeichnet und von »zügellosen jungen Männern« verabscheut. Die Spaßverderber:in wird von einer Stadt, einem Fest, einer Versammlung ferngehalten, denn sie hält diejenigen zurück, die zügellos ihre Freiheit ausleben. Ein Bild entsteht oft durch eine Schilderung von etwas, das gar nicht da ist. Historisch gesehen half die Spaßverderber:in durch kleine Hinweise, ein Bild von Geselligkeit zu schaffen, indem sie diejenigen verkörperte, die ihr ein Ende bereiten würden. Die Spaßverderber:in verdirbt den Spaß anderer, nicht ihren eigenen Spaß. Vielleicht weil sie keinen eigenen Spaß hat, den sie verderben kann. Synonyme für Spaßverderber:innen sind Partymuffel, Miesepeter, Miserabilist:in, Spielverderber:in, Spaßbremse.
Zu Beginn und in der Mitte des 20. Jahrhunderts finden sich weitere Hinweise auf die Spaßverderber:in. Alice Lowther, die meist als Ehefrau eines britischen Diplomaten beschrieben wird, aber selbst Schriftstellerin war, veröffentlichte 1929 eine Kurzgeschichte namens »The Kill Joys« über drei Schwestern, von denen zwei der dritten den Spaß verderben. Als die Jüngste, Adela, nach dem Tod ihres Vaters heiratet, kommen ihre älteren Schwestern, Jane und Susan, um für ihre neue Familie zu arbeiten, was eine Verbesserung ihres Status bedeutet; »von Hoffnung erfüllt und dankbar« arbeiteten sie »mit Eifer«.[3] Doch später, als ihre Bitte, für ihre Arbeit bezahlt zu werden, abgelehnt wird, arbeiten sie »unter dem Gefühl der Ungerechtigkeit«. Die Schwestern wurden »eine Belästigung für die Familie, der sie dienten«, und waren nicht mehr »nützlich«, selbst ihre Hingabe war eine Quelle der Verärgerung. »Kann nicht irgendetwas getan werden«, klagt eines von Adelas Kindern, »diese alten Spaßverderber machen mir Angst«.[4] Diese tragische Geschichte, die mit dem Selbstmord der Schwestern endet, in Übereinstimmung mit dem Wunsch der Familie, dass sie sich entfernen, ist zwar unbekannt, aber vertraut durch die Wiederverwendung alter Tropen von traurigen Jungfern und hässlichen Stiefschwestern. Obwohl die Geschichte nicht aus der Perspektive der Spaßverderber:innen erzählt wird (eine Spaßverderber:in ist normalerweise jemand aus der Sicht eines anderen), sympathisiert sie mit ihnen, indem sie die Grausamkeit schildert, die auf das Urteil als solcher folgt, und den Eindruck erweckt, dass die Spaßverderber:innen möglicherweise zu Recht »unter dem Gefühl der Ungerechtigkeit« arbeiten.
Der Psychoanalytiker Edmund Bergler veröffentlichte zwei Essays, »Psychology of the Killjoy« und »The Type: ›Mr Stuffed Shirt‹« (1949 bzw. 1960)[5], die ein weit weniger sympathisches Bild von Spaßverderber:innen zeichnen. Für Bergler ist die Spaßverderber:in sowohl eine Krankheit als auch ein Persönlichkeitstypus. Für Bergler wird die Spaßverderber:in »allgemein als eine Person angesehen, die sich darüber freut, anderen den Spaß zu verderben«. Mit anderen Worten, »ihre Rache ist die Spaßverderber:innen-Haltung«. In dieser Darstellung ist die Spaßverderber:in in Selbstverleugnung; sie erkennt sich selbst nicht als Spaßverderber:in, wird aber von anderen so beurteilt. Bergler verweist auf die »Frau eines Spaßverderbers«, die die Fähigkeit ihres Mannes beschrieb, »Menschen zu erstarren, indem er bei einer fröhlichen Zusammenkunft eisiges Schweigen bewahrt oder jeden vorgeschlagenen Vergnügungsplan mit abfälligen und bissigen Bemerkungen kommentiert.«[6] Die Spaßverderber:in wird als eine Person dargestellt, die sich der Wärme der menschlichen Geselligkeit entzieht, die mächtig und strafend ist und ihr eigenes Unglück/lichsein erfunden hat, nur um die eigene Grausamkeit zu rechtfertigen. Dabei wendet sie allerhand Methoden an, um Unglück zu verbreiten, angefangen bei »versteinertem Schweigen« bis hin zu »bissigen Bemerkungen«. Wer möchte schon so ein Mensch sein? Der Sinn dieses Bildes der Spaßverderber:in könnte allein darin bestehen, eine Person heraufzubeschwören, die niemand sein möchte.
Schon mit diesem kurzen Abriss der Geschichte des Begriffs ›Spaßverderber:in‹ wird deutlich, dass er erfunden wurde, um ein Bild von denjenigen zu zeichnen, die ›nicht wir‹ sind und die die Macht haben, uns zu nehmen, was wir für uns behalten möchten. Auch wenn die Spaßverderber:in zunächst dazu diente, einen Persönlichkeitstypus zu beschreiben, wird diese Zuschreibung heute eher genutzt, um eine Art Politik zu bezeichnen. Vielleicht könnte man diese Art dann gemein nennen. So hören wir beispielsweise von politisch korrekten Spaßverderber:innen, deren Anliegen, das zu korrigieren, was andere sagen oder machen, so dargestellt wird, als würden sie ihre eigene Agenda durchsetzen wollen, um anderen den Spaß zu verderben. So schreibt ein Kolumnist »politisch korrekte Spaßverderber:innen haben den Feiertagsspaß vom Menü gestrichen, indem sie Böller verbieten wollen«.[7] Ein anderer resümiert: »Politisch korrekte Spaßverderber:innen haben beleidigende Fahnen verbannt.«[8] Wir hören auch von gesundheits- und sicherheitsfanatischen Spaßverderber:innen, deren Sorge um die öffentliche Sicherheit, selbst wenn sie gut gemeint ist, angeblich einen paternalistischen und symptomatischen Willen zeige, um vormals freudvolle Freiheiten zu verbieten. Ein Autor gibt seinem Buch über das Problem des Paternalismus den prägnanten Titel Spaßverderber:in.[9] Uns wurde gesagt, dass ›gesundheits- und sicherheitsbewusste Spaßverderber:innen‹ Müttern das Teemachen, Modell-Dampfboote, Genesungskarten, Trampoline, Eiswagen, Punch-and -Judy-Shows, Blumenampeln und Käserollrennen verboten haben. Falls du von diesen Dingen noch nie gehört hast, sie gehören alle zu »Großbritanniens ältesten, traditionellsten Veranstaltungen«.[10] So lautet die Schlagzeile: »Käserollen nach 200 Jahren radikal gestrichen, dank gesundheits- und sicherheitsfanatischen Spaßverderber:innen.« Aufgrund von Spaßverderber:innen, so heißt es, dürfen wir unsere Traditionen nicht bewahren und nicht mehr das tun, was wir zuvor entspannt und unumstritten genossen haben.
So viele Freuden wurden umgeschrieben, indem wir uns selbst von den anderen distanzierten, die entweder gemein oder bedrohlich waren oder verweichlicht und albern. Sie waren diejenigen, die uns nicht nur daran hinderten, Spaß zu haben, sondern auch einfach daran, wir selbst zu sein. Auf Spaßverderber:innen aufmerksam zu machen, wurde zum Sport.
Immer wieder taucht die Spaßverderber:in in Titelzeilen auf. Aber hinter den Sensationsschlagzeilen stecken meistens deutlich kompliziertere Geschichten. Nehmen wir das Beispiel des Käserollens. Diese Geschichte wird als Absage einer jahrhundertealten Tradition dargestellt. Wenn wir etwas genauer nachschauen, finden wir sofort heraus, dass die Veranstaltung aber von den Organisator:innen gestrichen wurde, weil die Besucherzahl des Vorjahres dreimal höher war als erwartet und sie einen weiteren logistischen Albtraum vermeiden wollten. Das Objekt wird verändert (das Absagen einer Veranstaltung wird zur Absage einer Tradition), um die Story aufzublasen, damit es etwas wird, was es nicht ist.
Das Problem mit diesen Geschichten ist nicht einfach nur, dass sie falsch sind. Viele sind ideologisch motiviert. Ein Journalist schreibt, das Absagen von Weihnachtsfeiern wäre beinahe so traditionell »wie der Kranz an deiner Haustür«.[11] Das heißt, die Geschichten über das Absagen von Weihnachtsfeiern zu erzählen, sind selbst zu einer Weihnachtstradition geworden. Typischerweise verwenden solche Geschichten als Beweis relativ unbedeutende Entscheidungen öffentlicher Gremien über Sprache. So wurde z. B. 1998 ziemlich viel Wirbel um die Verwendung des Wortes ›Winterval‹ durch den Stadtrat von Birmingham gemacht.[12] Die Daily Mail gab eine Korrektur einer Ausgabe einer ihrer vielen Geschichten über Winterval heraus: »Wir freuen uns, klarzustellen, dass Winterval Weihnachten weder umbenannt, noch ersetzt hat.«[13] Du kannst natürlich hocherfreut die Geschichte korrigieren, aber sie dennoch weiterhin erzählen. Viele geben nicht nur politisch korrekten Stadträten die Schuld, sondern auch denen, von denen angenommen wird, dass sie in ihrem Auftrag handeln – den Beleidigten. Eine Schlagzeile vom 2. November 2005 macht ganz deutlich, wem man unterstellt, dass sie sich beleidigt fühlen: »WEIHNACHTEN GESTRICHEN: ES BELEIDIGT MUSLIME«[14] Ich kehre zurück, um zu untersuchen, was diese Figur des leicht beleidigten Muslims letztendlich bewirkt. Keine der Geschichten enthält Zitate von britischen Muslimen darüber, dass sie sich beleidigt fühlen. Wenn manche Menschen Spaßverderber:innen sein können, ohne etwas zu sagen oder zu tun, ist es vielleicht ihre bloße Existenz, die als das Ende der Tradition empfunden wird.
Seit der Corona-Pandemie gibt es einige neue ›Weihnachts-Spaßverderber:innen‹, alle diejenigen, die für Beschränkungen sozialer Zusammenkünfte während der Feiertage argumentierten oder diese bestärkten. Ein Pfarrer meinte: »Die Leute sind genervt und müde von diesem Mikromanagement ihres Lebens. Sie wollen frei und froh sein und sie wollen an Weihnachten frei und froh sein, ohne diese ›Weihnachts-Spaßverderber:innen‹.« Ja: Freiheit und Fröhlichkeit können als Gleichgültigkeit gegenüber den potenziell schädlichen Auswirkungen von Handlungen auf andere behauptet werden. Einige dieser Geschichten über Weihnachts-Spaßverderber:innen während der Pandemie schaffen es immer noch, die Minderheiten zu beschuldigen: »Beamt:innen haben das Wort ›Weihnachten‹ abgeblockt, da es möglicherweise Angehörigen von Minderheitsreligionen beleidigen könnte.«[15] Dabei ist das Wort ›abgeblockt‹ zu beachten. Die Geschichte benutzt auch das Wort ›verbannen‹. Die Erklärung dafür, das Wort ›Weihnachten‹ in einer E-Mail nicht zu benutzen, sprach gar nicht von Beleidigung, sondern vielmehr ging es darum, »inklusiver zu handeln«. Jeder Wechsel des Wortgebrauchs in der Kommunikation, einfach damit mehrere oder andere Communitys adressiert werden, wird in eine Geschichte des Verbots verwandelt.
Wenn der Begriff ›Spaßverderber:in‹ verwendet wird, um einen Politikstil zu beschreiben, bringt er immer noch ein Bild einer Person und einer Pathologie mit sich, vielleicht die Art von Person, die sich daran beteiligt, was heute als ›Cancel Culture‹ bezeichnet wird. Obwohl ›Cancel Culture‹ ein relativ neuer Begriff ist, erzählt er eine alte Geschichte. Hier eine weitere Geschichte aus den Nachrichten: »›Weg mit den Schrumpfköpfen!‹ Ein führendes Museum hält die Ausstellung von menschlichen Exponaten aus Südamerika für rassistisch. Spaßverderber:innen am Oxford Museum haben entschieden, dass die beliebten Ausstellungsstücke menschlicher Schrumpfköpfe nicht mehr gezeigt werden dürfen. Die woken Hüter:innen der britischen Kultur haben entschieden, dass die Ausstellung ›rassistisches und stereotypes Denken‹ unterstütze.«[16] Das Stehlen von Freude wird oft als das Stehlen von Geschichte dargestellt. Nicht nur die Freude wollen uns die Spaßverderber:innen stehlen. Es sind die Spaßverderber:innen, die uns der Geschichte berauben würden, indem sie Worte wie ›rassistisch‹ verwenden, um diese Geschichte zu beschreiben. Die Spaßverderber:innen stehlen die Vergangenheit, unsere Geschichte, unser Erbe, manchmal indem sie Objekte aus der Gegenwart entfernen, die wir sonst betrachten, konsumieren und genießen könnten.
Die Spaßverderber:innen und die ›woken Hüter:innen der Kultur‹ sind eng miteinander verwandt, sie sind diejenigen, die uns etwas vorenthalten, das eigentlich uns gehört. Feminismus wird oft auch als Entbehrung angesehen. Auch wenn es das Wort ›Spaßverderber:in‹ schon länger gibt als das Wort ›Feminist:in‹, wirft die Einreihung der Feminist:in in die Geschichte der Spaßverderber:in ein neues Licht auf die lange Geschichte des Feminismus. Ein Artikel aus dem Jahr 1972 in der New York Times beschreibt eine Gruppe von Cheerleadern, indem er betont, dass sie keine feministischen Spaßverderber:innen seien: »Im Madison Square Garden gestern dauerte es nicht lange, um zu erkennen, dass die enthusiastische Welt des Cheerleadings keinen Platz in ihrem Team für Gloria Steinem, Germaine Greer und andere Spaßverderber:innen der Frauenbewegung hat.«[17] Der moralisierende Gegensatz, der zwischen den jubelnden Cheerleadern und den spaßverderbenden Feminist:innen aufgebaut wird, hat einen großen Teil der Arbeit getan. Der Artikel beginnt mit einem Zitat, das anscheinend direkt von den Cheerleadern selbst kommt: »›Sexistische Ausbeutung?‹, fragt Mary Scarborough von der Western Kentucky University und wirbelt ihren Vinyl-Pompon: ›Worüber reden die überhaupt?‹ ›Unsere BHs verbrennen?‹, fragt Rooney Frailey von der University of Notre Dame: ›Oh mein Gott, nein, niemals. Du würdest gar nicht durch die Spiele kommen.‹« Unterstellt wird hierbei, dass Feminist:innen Cheerleading als »sexistische Ausbeutung« ablehnen und dass selbst den Frauen, die diese Erfahrungen machen, die feministische Sprache fremd ist. Der Ausdruck feministische Spaßverderber:in wird benutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass Feminist:innen gegen so vieles sind, gegen alles, und sogar dafür, dagegen zu sein.
Feministische Spaßverderber:innen tauchen in ähnlicher Art in einem weiteren Artikel auf, der behauptet »Eine Gruppe militanter Feminist:innen will allen Männern verbieten, Frauen hinterherzupfeifen und sie ›Schatz‹ zu rufen. Dieser Gruppe knochiger Spaßverderber:innen zufolge sei dies eine Form sexueller Belästigung, vergleichbar mit Grapschen und Exhibitionismus.«[18]
Spaßverderber:innen werden nicht nur als ein Kollektiv angesehen, in dem alle ähnlich aussehen (eine knochige Bande auf jeden Fall), sondern auch als eines, was gleichgültig gegenüber jeglichem Maßstab ist. Feministische Spaßverderber:innen machen aus Kleinigkeiten große Dinge und behandeln kleine Dinge – z. B. einen harmlosen Spaß, wie etwa ›Schatz‹ zu sagen, was doch ein Kompliment ist, ›Schatz‹ , so ein zärtlicher Begriff – als ob es sich dabei um bedeutende Dinge handele.
Während der MeToo-Bewegung sahen viele Anschuldigungen genau so aus: Feminist:innen wurden zu einem Haufen knochiger Spaßverderber:innen erklärt, die Macht über andere ausüben würden. Etwas sexuelle Belästigung zu nennen, machen sie nur, um zu nerven, Spaß zu verderben und etwas zu zerstören, das eigentlich ganz nett ist; also z. B. zu verbieten, nette Worte wie ›Schatz‹ zu einer Frau zu sagen.
Die Figur der feministischen Spaßverderber:in zeigt uns, wie die Verharmlosung von Schaden und die Machtinflation oft zusammenwirken. Bereits die Identifizierung von etwas als schädlich wird als Versuch behandelt, Macht über jemanden auszuüben oder zu behalten, als ob Feminist:innen Kleinigkeiten größer machen, um sich selbst größer zu machen. So werden die von Feminist:innen eingeführten Begriffe und Konzepte, um zu erklären, wie Macht funktioniert, wie sexuelle Belästigung, ebenfalls zu Spaßverderbern, Trägern von schlechten Gefühlen, Auflagen, die von Außenseiter:innen gemacht werden.
Es muss hinzugefügt werden, dass dieser Artikel teilweise vom Versprechen des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron handelte, einen Vertrag des Europarats anlässlich des 8. März zu unterzeichnen, der eine Klausel beinhaltete, die »ungewolltes verbales, nonverbales oder physisches Verhalten sexueller Natur mit dem Ziel oder dem Ergebnis der Verletzung der Würde einer Person, insbesondere, wenn sie eine einschüchternde, feindselige, abwertende, erniedrigende oder anstößige Umgebung schafft« verbietet. Diese Klausel ist eine Standarddefinition sexueller Belästigung und wurde bereits im Vereinigten Königreich als Teil des Gleichstellungsrechts verabschiedet. Es wurde jedoch so getan, als sei sie neu und fremd sowie von Europa aufgezwungen: »Es ist kein Wunder, dass die Bürokraten in Brüssel und die Diktatoren in Berlin schon vor langer Zeit ihren Sinn für Humor verloren haben.« Nach dem Brexit konnte man schnell beobachten, wie Europa selbst als die Figur der Spaßverderber:in ausgemacht wird, die moralische Einschränkungen und Humorlosigkeit auferlegt. Wenn Gleichstellung wie Humorlosigkeit behandelt wird, dann ist Ungleichheit, so wird uns erzählt, humorvoll. Es ist nicht verwunderlich, dass der Brexit uns als ein Glücksversprechen verkauft wird. Argumente für den Austritt nahmen die Form einer vielversprechenden Version eines nostalgischen Nationalismus an, um einen Begriff der Anthropologin Sarah Franklin zu benutzen. Es gehe darum, »die Kontrolle zurückzuholen«, als ob in die Vergangenheit zurückzugehen, »die Kontrolle zurückholen« hieße, als ob wir die Nation damit zurückerobern würden.[19] Wenn Nostalgie das Fantasieren über Vergangenheit bedeutet, kann wenigstens diese Fantasie bewahrt werden, egal ob die Versprechen realisiert wurden oder nicht. Ein Politiker spottete, dass »die Fische jetzt besser und glücklicher herumschwimmen, seit sie britisch sind«[20]. Wo auch immer du die Figur der Spaßverderber:in findest, wirst du die Fantasie des Glück/lichseins finden. Eine Spaßverderber:in zu sein, heißt nicht nur, das Glück/lichsein zu bedrohen, sondern auch die Fantasie des Glück/lichseins als Idee, wo (und bei wem) Glück gefunden werden kann.
Der Feminismus hat neue Worte geschaffen, die darauf hinweisen, dass es Probleme damit gibt, wie Dinge gehandhabt wurden. Lass dich nicht täuschen: Wir wollen, dass sich einige der alten Dinge ändern. Wenn du ein:e Feminist:in wirst, dann erfährst du, wie sehr sich einige Feminist:innen für die alten Dinge einsetzen. Eine Veränderung der Sprache oder des Handelns zu fordern, kann ausreichen, um als Spaßverderber:in bezeichnet zu werden. Das zeigt, dass Spaßverderber:innen vermehrt in Zeiten auftauchen, in denen vermehrt starke soziale Transformationsprozesse stattfinden. Wenn du darauf bestehen musst, mit den richtigen Pronomen für dich selbst oder deine:n Partner:in angesprochen zu werden – und diejenigen, die auf die richtigen Pronomen bestehen müssen, sind oft diejenigen, die mit den falschen Pronomen angesprochen werden – kannst du als Spaßverderber:in beurteilt werden, als jemand, der sich anderen aufdrängt und sie daran hindert, frei zu tun, was sie schon immer getan haben. Die Spaßverderber:in taucht auf, um eine Grenze zu markieren. Wenn etwas als aufgezwungen beschrieben wird, heißt das, es kommt nicht von uns. Wenn etwas einmal zur Gewohnheit geworden ist, eine Norm, eine Routine, dann wird es nicht als aufgezwungen angesehen. Beispielsweise haben Feminist:innen eingeführt, dass wir immer Ms sagen und Mrs[21] vermeiden, um infrage zu stellen, dass der Status einer Frau davon abhängt, ob sie verheiratet ist oder nicht. In einem Zeitungsartikel von 2012 schreibt Jasmine M. Gardner dazu: »Jede Person weiß, dass wenn du dich selbst ›Ms‹ nennst, dass du dann auf etwas hinweisen willst.«[22]
So viele dieser Worte, die wir einführen, haben eine Spaßverderber:innen-Geschichte; wenn wir sie verwenden, werden wir als jemand wahrgenommen, der einen wunden Punkt anspricht, obwohl einige dieser Worte im Laufe der Zeit weniger scharf, mehr zur Gewohnheit werden. Ich werde zu dieser Frage der Gewohnheit zurückkehren, wenn ich die feministische Spaßverderber:in als Philosoph:in betrachte.
Wenn auch nicht alle Spaßverderber:innen Feminist:innen sind, so sind doch alle Feminist:innen Spaßverderber:innen. Ich meine damit: Als Feminist:in identifiziert zu werden oder dich selbst als Feminist:in zu identifizieren, heißt, als Spaßverderber:in betrachtet zu werden, ob du dich nun selbst mit diesem Begriff bezeichnest oder nicht. Das heißt nicht, dass alle Feminist:innen tatsächlich von Natur aus oder selbstgewählt Spaßverderber:innen sind. Mit dem Namen dieser Figur wird der Eindruck erweckt, Feminist:in zu sein bedeute, sich selbst oder Anderen allen Spaß zu rauben.
Ein Artikel über die postfeministische Generation, der 1982 in der New York Times erschien, zitiert eine:n Studierende:n: »Schau dich um und du siehst glückliche Frauen und dann siehst du diese bitteren, bitteren Frauen. Diese unglücklichen Frauen sind alle Feminist:innen.«[23] Hinter dieser Wahrnehmung, »diese unglücklichen Frauen sind alle Feminist:innen« stehen zwei widersprüchliche Behauptungen: erstens, dass Unglück/lichsein Frauen dazu verleitet, Feminist:innen zu werden, weil sie nicht bekommen, was sie wollen, einen Ehemann oder ein Baby vielleicht; zweitens, dass Feminismus Frauen unglücklich macht. Die Autorin Fay Weldon argumentiert, dass »der Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter schlecht für das Aussehen ist. Er macht niemanden glücklich, es sei denn, man findet eine Belohnung im Kampf für eine Gerechtigkeit, die evolutionär nicht entstanden ist.«[24] Die Implikation lautet, Kämpfen für Geschlechtergerechtigkeit mache unglücklich, weil es ein Kampf gegen die Natur sei. Zur Feminist:in zu werden, mindere unsere Weiblichkeit, unsere Attraktivität.
Die Extreme des Begriffs ›kill‹ in ›feminist killjoy‹ sagen uns etwas. Wir erfahren etwas über die Natur feministischer Forderungen dadurch, dass sie als tödlich und deprimierend beurteilt werden. Du hast vielleicht bemerkt, wie die Zuschreibung ›feministische Spaßverderber:in‹ benutzt wird, um sich auf eine Person, eine Bewegung zu beziehen, ein Wort oder ein Konzept, das durch diese Bewegung eingeführt wurde. Der Begriff ›feministische Spaßverderber:in‹ ist klebrig, er haftet wie ein Klettverschluss, befestigt an einem ›mir‹ oder einem ›uns‹, als Erklärung all dessen, was wir tun. Daher bleibt die Zuschreibung meistens an dir haften, wenn du einmal als feministische Spaßverderber:in adressiert worden bist.
Ein Stereotyp ist eine wiederholte Äußerung, eine Charakterisierung, die dadurch, dass sie vereinfachend und etwas flach ist, in einem grundsätzlichen Sinne falsch ist. Ich sage grundsätzlich, denn was etwas zu einem Stereotyp macht, sagt etwas darüber aus, was es nicht erfasst. Wir können schon verstehen, warum einige Reaktionen auf diese Stereotype des unglücklichen Feminismus oder der feministischen Spaßverderber:in dazu dienen sollen, diesen Stereotypen entgegenzutreten oder zu widersprechen, indem sie betonen, das sei gar kein Feminismus oder sie sei gar keine Feminist:in. Es könnte verlockend sein, zu versuchen, glücklich und positiv zu erscheinen, um dem Mythos des feministischen Elends entgegenzuwirken, um den Feminismus weniger beängstigend und ansprechender zu machen. Es könnte verlockend sein, den Feminismus vor der feministischen Spaßverderber:in zu retten und Bilderbücher mit strahlend glücklichen Feminist:innen zu erstellen. Solche Bilderbücher gibt es.
Ich verfolge eine andere Strategie. Mein Ziel ist es nicht, uns vor der feministischen Spaßverderber:in zu retten, sondern ihr eine Stimme zu geben. Wenn wir versuchen, keine feministischen Spaßverderber:innen zu sein, und uns von ihnen distanzieren, dann verpassen wir, was die feministische Spaßverderber:in uns zu erzählen hat. Was sie über uns selbst, die Art der Arbeit, die wir tun und warum wir sie tun, zu berichten hat. Diese Figur einzufordern, bedeutet, die Wahrheit in ihr zu erkennen. Feminist:innen werden als Bedrohung (des Glück/lichseins) angesehen, weil sie das bedrohen, was einige (für ihr Glück/lichsein) für nötig halten; einen Glauben, eine Praxis, eine Art zu leben, ein soziales Arrangement. Die Kulturkritikerin Lauren Berlant beschreibt das sehr ausdrucksstark: »Es gibt nichts Befremdlicheres, als wenn jemand deine Freude mit einer Theorie wegdiskutiert.«[25] Die feministische Spaßverderber:in hilft uns dabei, zu erklären, warum der Feminismus als bedrohlich wahrgenommen wird und Menschen von ihren Freuden entfremdet.
Ich schreibe dieses Handbuch für diejenigen, die bereit sind, feministische Spaßverderber:innen zu sein, was nicht dasselbe ist wie unglücklich zu sein, ob gewollt oder nicht. Die feministische Spaßverderber:in einzufordern, heißt, den negativen Beurteilungen nicht zuzustimmen, die dahinterstecken (dass diese oder jene Person eine unglückliche oder bedrohliche Person sei). Wenn du den Begriff der feministischen Spaßverderber:in für dich beanspruchst, kommst du ins Gespräch mit anderen Menschen, die, wie du, ein Potenzial in diesem Begriff sehen, darin wie seine Negativität umgelenkt werden kann. Es gibt eine lange Tradition der Rückeroberung von Begriffen, die gegen uns gerichtet wurden, Beleidigungen ebenso wie Stereotype – Begriffe wie queer, zum Beispiel –, um etwas darüber zu sagen, wer wir sind und wogegen wir sind. Ich erkunde die Queerness des Projekts, Spaß zu verderben, in meinem Kapitel über die feministische Spaßverderber:in als Aktivist:in.
Ich habe Geschichten über feministische Spaßverderber:innen gesammelt. Dieses Handbuch ist diese Sammlung. Neben meinen eigenen Erfahrungen als feministische Spaßverderber:in teile ich hier auch Geschichten, die andere mit mir geteilt haben. Wenn ich mit feministischen Studierenden und Wissenschaftler:innen darüber sprach, wie es für sie ist, Beschwerden einzureichen, bemerkte ich, wie oft die feministische Spaßverderber:in auftaucht. Das ist nicht überraschend: Eine Spaßverderber:in zu sein, wird oft mit einer Beschwerdeführer:in gleichgesetzt, als ob, etwas Negatives auszusprechen, bedeutet, selbst negativ zu sein. Dieses Handbuch beinhaltet auch einige Geschichten über Beschwerden.[26] Ich teile zudem Beispiele von feministischen Spaßverderber:innen, die in feministischen Texten hervorgehoben werden, insbesondere in Texten von Schwarzen Feminist:innen und Feminist:innen of Color, als auch in weiteren Kulturbereichen, wie Literatur und Film. Feministische Spaßverderber:innen-Geschichten zu teilen, heißt, sich von der eigenen lebendigen Erfahrung hin zur repräsentativen Darstellung und wieder zurück zu bewegen. Wir können feministische Spaßverderber:innen-Charaktere in einer Geschichte erkennen, basierend auf unseren eigenen Erfahrungen, sie zugewiesen zu bekommen, und nachdem wir sie erkannt haben, kehren wir mit einem frischen Blick zu unseren Erfahrungen zurück.
Lasst mich zurückkommen zu meiner Geschichte, wie ich zu einer feministischen Spaßverderber:in wurde. Dieses Szenario, um den Tisch herum zu sitzen, war vertraut. Alles kann vertraut werden, wenn es häufiger passiert. Warum machte mein Vater immer wieder die gleichen Bemerkungen, obwohl er doch wusste, wie ich reagieren würde? Vielleicht wurde mir dadurch eine Lektion in patriarchaler Autorität erteilt, dass er sagen konnte, was auch immer er wollte, und ich sollte lernen, das zu akzeptieren. Vielleicht hat er diese Punkte immer wieder gemacht, weil er wollte, dass ich mich so verhalte, wie er mich beurteilte: als problematisches Kind, als eigenwilliges Kind, unreif, impulsiv, ungehorsam. Der Feminismus wird oft als persönliches Versagen abgetan, nicht nur als eine Neigung, sondern als Fehler, als ob eine Person etwas ablehnt, weil sie widerspenstig ist; als ob sie etwas ablehnt, weil sie oppositionell ist. Ihre Reaktion auf das Gesagte kann verwendet werden, um ein Urteil zu rechtfertigen, das bereits gefällt wurde: War ja klar, dass sie das sagen würde. Sie wird das sagen, heißt, ich habe das schon gesagt.
SPAßVERDERBER:INNEN-WAHRHEIT: AUF EIN PROBLEM HINZUWEISEN, BEDEUTET, ZUM PROBLEM ZU WERDEN
Diese Spaßverderber:innen-Wahrheit halte ich für eine Grundwahrheit, eine Wahrheit, von der ausgehend so vieles folgt. Wenn du ein Problem aufdeckst, stellst du ein Problem dar; wenn du ein Problem darstellst, wirst du zum Problem gemacht. Der Umgang mit einem Problem wird zum Umgang mit einer Person. Mit anderen Worten, eine Möglichkeit, mit einem Problem umzugehen, besteht darin, Menschen davon abzuhalten, darüber zu sprechen, oder die Menschen, die darüber sprechen, verschwinden zu lassen. Wenn Menschen aufhören, über ein Problem zu sprechen, oder diejenigen, die darüber sprechen, verschwinden, dann kann angenommen werden, dass das Problem verschwunden ist. Das klingt wie eine Anleitung. Uns wird gesagt, wir sollten aufhören, über ein Problem zu sprechen oder gehen. Wir machen nicht immer das, was uns gesagt wird. Je mehr wir aber über das Problem sprechen, desto häufiger begegnen wir dem Problem. Die feministische Spaßverderber:in ist mehr als nur eine Zuschreibung. Es geht darum, dass wir bereit sind, ihr immer wieder zu begegnen. Wenn es Menschen unglücklich macht, dieses existierende Arrangement zu hinterfragen, sind wir bereit, Menschen unglücklich zu machen. Wir entscheiden uns für ein Bekenntnis, das ich für das Hauptbekenntnis der Spaßverderber:in halte.
SPAßVERDERBER:INNEN-BEKENNTNIS: ICH BIN BEREIT, UNGLÜCK/LICHSEIN ZU VERURSACHEN
Die feministische Spaßverderber:in wird nicht nur als Aufgabe verstanden in dem Sinne, wie uns Bedeutung oder Wert zugewiesen wird, sondern auch als Auftrag im eigentlichen Sinne. Wenn der Spaßverderber:innen-Auftrag bedeutet, Unglück/lichsein zu erzeugen, dann können wir nun auch sagen, was er nicht bedeutet. Was die Figur der feministischen Spaßverderber:in so offensichtlich ausmacht, ist die Zuschreibung, sie beabsichtige, was sie verursacht. Als ob es ihr darum ginge, dem Glück/lichsein anderer Menschen in die Quere zu kommen oder sich einfach so in den Weg zu stellen. Wir beabsichtigen nicht, Unglück/lichsein zu verursachen, wir sind nur bereit dazu, Unglück/lichsein zu verursachen. Diese Unterscheidung kann von der Zuschreibung verschleiert werden. Wir sprechen also nicht über Sexismus und Rassismus, um Menschen unglücklich zu machen, wir sind nur bereit dazu, über Sexismus und Rassismus zu sprechen, selbst wenn es Menschen unglücklich macht.
Wir lernen sehr viel, wenn wir die feministische Spaßverderber:in als unseren Auftrag annehmen. Wenn du sagst, dass du ein:e Feminist:in bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du ähnliche Kommentare dazu zu hören bekommst, wie die, die dich dazu gebracht haben, Feminist:in zu werden. Hier sind einige erinnerungswürdige Kommentare, die mit mir geteilt oder die an mich gerichtet wurden, von meiner Familie, von Freund:innen und anderen Menschen an Abendbrottischen: »Frauen können nicht gleich sein, da Babys Muttermilch benötigen«, »Enoch Powell hatte recht«, »Es ist egoistisch, wenn homosexuelle Menschen Kinder bekommen«, »Das passiert, wenn du einen Muslim heiratest«, »Sara, ich wusste gar nicht, dass du orientalisch bist«, »Scheidung diskriminiert Männer«. Du wirst noch etwas über die Kontexte zu jedem dieser Kommentare in diesem Handbuch lesen. Einige dieser Kommentare wurden direkt an mich gerichtet, andere könnten auch Zeitungsschlagzeilen sein. Wenn es Zeitungsschlagzeilen wären, wäre es einfacher zu wissen, ob und wie man darauf reagieren soll. Manchmal mischen wir uns in eine Debatte ein, weil, lasst es uns zugeben, wir es schon zu oft gehört haben. Aus diesem Grund haben wir unsere Argumentationsweisen und unsere Fähigkeiten schon sehr gut trainiert. Manchmal mischen wir uns aber auch nicht ein, weil schon unsere Einmischung die Sache als wichtig erscheinen lassen würde, als Grund, um dann darüber zu diskutieren. Auch wenn es schon unglaublich schwierig ist, auf Sexismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit oder Rassismus in einem öffentlichen Rahmen zu reagieren, ist es noch viel schwieriger, darauf in privaten, vertrauten Räumen zu antworten. Eine feministische Spaßverderber:in zu werden, bedeutet auch, zu lernen, damit umzugehen, wenn Freund:innen und Familienangehörige solche Kommentare abgeben. Es gibt keine richtigen Wege, damit umzugehen, nur unterschiedliche Ansätze.
Etwas zu handhaben, bedeutet, daraus zu lernen. Das heißt, wir können neben Abendbrottischen auch an andere Tische denken, an denen Menschen sich treffen. Wir können sie als politische Orte verstehen, als Orte, an denen wir unsere feministische Arbeit tun. In ihrem Buch Just us nimmt die Poetin und Kritikerin Claudia Rankine ihre Leser:innen auf eine Reise an verschiedene Orte mit: den Flughafen, das Theater, die Dinnerparty und den Fotoautomaten. Was diese Orte verbindet, sind die unangenehmen Gespräche, die sie dort mit weißen Menschen über das Weißsein führt. Rankine betont, ein Gespräch über das Weißsein zu führen, bedeute nicht, etwas Neues in einen Raum zu bringen, was nicht bereits dort wäre. Aber es kann sich so anfühlen, weil man nicht auf gewisse Dinge hinweisen soll, und wenn man es doch tut, wird das Gespräch turbulent wie ein Sturm, »der die gegenseitigen Ängste und Ärgernisse unsichtbar durch den Raum fegt«.[27]
Unbehagen kann ebenso eine Verbindung herstellen. An dieser Stelle wenden wir uns Ama Ata Aidoos Roman Our Sister Killjoy zu. Sissie, unsere Spaßverderber:innen-Schwester, ist die Erzählerin des Romans. Ihre Geschichte liest sich wie ein Reisetagebuch. Sie reist von Afrika nach Europa, von Ghana nach Deutschland und England. Ihre Spaßverderber:in-Geschichte beginnt schon, bevor sie überhaupt in Deutschland ankommt. Im Flugzeug lädt eine weiße Stewardess sie dazu ein, sich zu ihren »Freund:innen« zu setzen, zwei ihr unbekannten Schwarzen Menschen. Gerade als sie antworten möchte, dass sie die beiden gar nicht kennt, zögert sie: »Wenn ich es abgelehnt hätte, bei ihnen zu sitzen, hätte dies eine unangenehme Situation geschaffen, oder nicht? Wenn man bedenkt, dass die Flugbegleiterin neben ihrer offensichtlich guten Erziehung auch darin geschult wurde, für das Wohl aller Passagiere zu sorgen.«[28]
Sissies Zögern spricht eine deutliche Sprache. Nicht in den hinteren Teil des Flugzeugs zu gehen oder zu sagen, dass sie die anderen Schwarzen Personen nicht kennt, hieße, den Platz zurückzuweisen, der für sie vorgesehen war. Wenn eine Stewardess darin ausgebildet wird, »das Wohl Aller« zu erkennen, würde das Nichtbefolgen ihrer Anweisungen das Unwohlsein Aller verursachen.
Dieses Mal spielt Sissie mit. Aber sie kann erkennen, was falsch daran ist. Und weil sie es tut, können wir das auch erkennen. Im Verlauf des Romans wird Sissie mehr und mehr sie selbst, eine feministische Spaßverderber:in, in allem, was sie sagt und tut. Für die Wiederverwendung der Figur der Spaßverderber:innen-Schwester, stehe ich zutiefst in Ama Ata Aidoos Schuld und ich werde in diesem Handbuch immer wieder zu Sissies Katalog ihrer Spaßverderber:innen-Begegnungen zurückkehren. Aidoos Our Sister Killjoy ist der erste Text, der der Spaßverderber:in eine eigene Stimme gibt. Aidoo (und auch Sissie) zeigt uns, dass eine Spaßverderber:innen-Schwester oder eine feministische Spaßverderber:in zu sein, bedeutet, uns bewusst darüber zu sein, was wir durch sie erschaffen: »unangenehme Situationen«. Sehr oft bedeutet eine »unangenehme Situation« zu schaffen, selbst als unangenehm angesehen zu werden. Wenn wir den feministischen Spaßverderber:innen-Auftrag annehmen und diese Urteile zu einem Projekt machen, dann ist es wichtig, dass dieses Projekt geteilt wird.
Wenn wir also zur feministischen Spaßverderber:in geworden sind, stellen wir uns immer mehr auf andere feministische Spaßverderber:innen ein und bemerken, wann und wo sie auftauchen. Ich denke an eine Szene in Rachel Cusks Roman Arlington Park. Ein Abendessen, ein Tisch, drumherum Freund:innen, die sich dort treffen. Eine der Figuren des Buchs, Matthew, spricht. Er »redet und redet. Über Politik, Steuern und Leute, die ihm in die Quere gekommen sind«[29]. Er »redet und redet« über Frauen, die in den Mutterschutz gehen. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die er feuern wird, wenn sie nicht direkt, nachdem sie ihr Baby bekommen hat, zurück zur Arbeit kommt. Eine Frau, Juliet, bleibt zunächst ruhig. Aber irgendwann hält sie es nicht mehr aus, ihn durch ihr Schweigen glauben zu lassen, dass sie ihm zustimmt. Sie sagt: »Das ist illegal.« Sie sagt: »Sie könnte dich verklagen.« Illegal: Dieses Wort durchschneidet die Atmosphäre wie ein Messer, weil sein von ihm vorausgesetztes Recht, einfach zu tun, was er tun will, von einer Person hinterfragt wird. Es ist Juliet, die dann als übertrieben wahrgenommen wird. Matthew antwortet: »Du musst vorsichtig sein.« Und dann »sah sie, wie nah sie seinem Hass kam, er war wie ein Nerv, von dem sie einen Millimeter entfernt war, kurz davor, ihn zu treffen«. »Du musst aufpassen. In deinem Alter kann man schnell schrill klingen.« Das geschieht, weil sie den Mund aufgemacht hat. Den Mund aufzumachen, heißt bereits, nicht aufzupassen, ob sie seinem Hass näherkommt. Der Hass war schon vorher da, aber eben im Hintergrund, wie ein offener Nerv. Eine feministische Spaßverderber:in zu sein, heißt, damit zu leben, immer kurz davor zu sein, jemandem auf die Nerven zu gehen.
Bemerkenswert ist auch, dass er auf ihr Alter Bezug nimmt. Vielleicht ist die feministische Spaßverderber:in ein Auftrag des Alterns. Du wirst dann zu einer Hexe und einer alten Spaßverderber:in.
Die radikale Feministin Mary Daly definiert eine Hexe als »eine hartnäckige Person, besonders eine Frau, die sich Umwerbungen verweigert«[30]. Du wirst zur Hexe, indem du nicht nachgibst, sei es einem sexuellen Annäherungsversuch oder einem anderen Versuch; denn Sexismus kann ein Annäherungsversuch sein, wie Frauen gesagt wird, sich anderen gegenüber verfügbar zu machen. Wenn du nicht nachgibst, nicht lächelst, nicht ruhig bist, dann wirst du als energisch wahrgenommen. Ich denke an das Wort ›schrill‹. Schrill zu klingen, wird als laut wahrgenommen, als grell und quietschend. Andere Menschen können das Gleiche wieder und wieder sagen, sie können es auch laut sagen, aber sie werden nicht als schrill wahrgenommen. Du wirst zum Problem, wenn du es wagst, zu sagen, dass das, was sie sagen, problematisch ist. Ach, was für ein Frust, wenn du als frustrierend empfunden wirst! Ach, welch eine Schwierigkeit, wenn von dir angenommen wird, schwierig zu sein. Das ist schon ausreichend, um dich für schwierig zu erklären.
Es kann sogar bedeuten, dass du klingst wie das, was sie wahrnehmen: Du sprichst lauter und schneller, weil du weißt, dass du sonst nicht durchkommst. Es endet damit, dass du wütend klingst, weil davon ausgegangen wird, dass du wütend bist. Wir können sogar das werden, was man uns vorwirft zu sein. Ich sprach mit einer lesbischen Wissenschaftlerin darüber, was es bedeutet, als Person in dieser Dynamik gefangen zu sein: »Denn dann beginnt die Hexenjagd, du wirst zur Zielscheibe gemacht, du wirst zur lästigen, aufmüpfigen Frau. Du wirst zur Frau, die nicht hineinpasst. Du wirst zu alldem, dessen die Mobber:innen dich beschuldigen, weil niemand dir zuhört. Und du merkst, wie du selbst einen gereizten Tonfall bekommst (mit der Hand auf den Tisch schlägst). Ach komm! Du kannst sie sagen hören: ›Ha, siehst du!‹« Eine Diversitätsbeauftragte sagte etwas sehr Ähnliches zu mir: Sie muss den Mund in Meetings nur aufmachen, und schon sieht sie rollende Augen um sich herum. Augen, die zu sagen scheinen: »Oh, hier ist sie wieder!« Beide lachten wir, weil wir merkten, dass wir diese Szenen kannten. Du musst nicht einmal etwas sagen, und trotzdem beginnt das Augenrollen.
Wenn ich diese Gleichung teile, lachen die Leute oft. Manchmal lachen wir mit. Wir müssen alle einzeln mitlachen können, damit wir lachen können. In diesem Lachen kann auch ein Seufzen sein. Von rollenden Augen verfolgt zu werden, bedeutet mit Augen verfolgt zu werden. Je mehr wir lachen, desto mehr werden wir gesehen. Wir lachen unter dem Gewicht dieser Prüfung. Wenn wir lachen, lachen wir es nicht einfach weg. Wir wissen, dass es so viel gibt, über das wir hinweglachen sollen; denk daran, Ungleichheit wird routinemäßig als humorvoll dargestellt. So viele Geschichten der feministischen Spaßverderber:in beginnen mit der Erfahrung, etwas nicht lustig zu finden.
SPAßVERDERBER:INNEN-MAXIME: WENN ETWAS NICHT LUSTIG IST, LACHE NICHT!
Ich sprach mit einer Dozentin, deren Fachbereichsleiterin immer wieder antisemitische und homofeindliche Kommentare von sich gab: »Ich denke, sie hält sich für witzig«, sagte sie zu mir. »Es ist sehr offensichtlich, dass ich einen jüdischen Namen trage, dass meine Familie jüdisch ist. Ich bin nicht religiös, aber es ist eben mein Hintergrund. Ich bin jüdisch und die Fachbereichsleiterin gab eine Menge Kommentare ab und machte antisemitische Witze. Sie sagte, jüdische Menschen seien geizig und ähnliche Sachen. Ich bin auch offen lesbisch, und wieder dachte sie erneut, das wäre etwas, womit sie mich aufziehen könnte. Also sagte sie dauernd Sachen über andere Menschen, wie z. B. ›Glaubst du, er ist schwul? Glaubst du, sie ist lesbisch?‹ Es gab ziemlich viele dieser Situationen.«
»Ich denke, sie dachte« bedeutet, sie hat eine Idee davon, warum diese Person so etwas sagt. Häufig scheint verbaler Missbrauch lustig gemeint zu sein. Was uns eine Vorstellung von der Nützlichkeit dieser Absichten gibt. Zu glauben, man sei lustig, kann dazu ermutigen, Sachen zu sagen, die anderen gegenüber erniedrigend und abfällig sind. Diese Form der verbalen Belästigung »ging über Jahre«.
Wenn du immer wieder das gleiche Problem hast, kann es sehr schwierig sein, nicht zu denken, du seist das Problem. Sie beschreibt es so: »Mir wurde gesagt, ich hätte einen Groll, dass ich einen Groll habe, weil ich jüdisch bin, dass ich einen Groll habe, weil ich Ausländerin bin und in diesem Land lebe und wegen des Brexits verärgert bin, oder weil ich lesbisch bin und nur nach Problemen suche. Und dann fängst du an zu denken, suche ich nach diesen Problemen? Ich projiziere es einfach auf mich selbst, bin ich es, ist es meine Schuld? Ich liege nachts wach und frage mich, bin ich tatsächlich das Problem?« Wenn man dir sagt, du hättest einen Komplex und seist besonders empfindlich, dann kann es sein, dass deine Traurigkeit als Groll angesehen wird. Als ob du eine Beschwerde einreichen würdest, weil du verbittert bist. Die bloße Tatsache, dass du anders bist (weil ich lesbisch bin, weil ich jüdisch bin und so weiter), wird dazu benutzt, zu erklären (und damit abzutun), was du gesagt hast.
Eine feministische Spaßverderber:in zu werden, heißt, zuzuhören, wie wir abgewiesen werden. Indem sie es hört, hört die Dozentin auch, wie sie an sich selbst zweifelt: »Vielleicht bin ich nur zu empfindlich. Siehst du, ich beginne schon, mich selbst zu beschuldigen, bin überempfindlich, verstehe keinen Spaß, bla, bla, bla, die Sachen, die du dir selbst erzählst, wenn du versuchst, damit klarzukommen.« Sie kann sehen, was sie tut, während sie es tut, während sie die Schuld auf sich nimmt. Am Ende kann es passieren, dass du dich selbst davor warnst, eine feministische Spaßverderber:in zu werden, du dir selbst vornimmst, nicht aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Über etwas hinwegzukommen, ist eine Aufforderung, die du an dich selbst stellst. Sie benutzt zweimal das Wort ›überempfindlich‹. Feministische Spaßverderber:in werden oft als überempfindlich angesehen.
Sogar selbst identifizierte feministische Spaßverderber:innen können es manchmal »auf sich selbst projizieren«, indem sie diese externen Stimmen in ihren eigenen Köpfen hören; die sagen, dass wir zu sensibel sind und Probleme größer machen, als sie sind. Diese externen Stimmen sind laut, wir hören sie überall. So wie die ›Gen Z‹ eine Generation sei, die nur verhätschelt wurde, keinerlei Widerspruch und keine Witze aushält, weil sie die Realität nicht aushält. Ein typisches Beispiel ist diese Art der Rhetorik. »Niemand kann Gefühle widerlegen, und so ist die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, all die Dinge abzuschaffen, die Stress auslösen, keine Argumentation, keine Diskussion, einfach die Stummschaltung drücken und so tun, als ob das Unangenehme verschwinden zu lassen, das Gleiche sei wie eine wirkliche Veränderung.«[31] Für einige Kommentator:innen sind Triggerwarnungen der Beweis für eine überempfindliche Generation, die sofort dichtmacht, wenn irgendetwas anstrengend wird. Tatsächlich sind Triggerwarnungen vielmehr eine Technik, die es einigen Menschen ermöglicht, in einem Raum zu bleiben, wenn wir schwierige Gespräche über schreckliche Angelegenheiten führen. Bei Triggerwarnungen geht es darum, mehr Informationen anzubieten, nicht weniger. Es geht nicht darum, Diskussionen zu beenden, sondern diejenigen mit Traumaerfahrungen zu unterstützen, daran teilnehmen zu können.
Die Idee, dass die jüngere Generation ein Problem geworden ist, weil sie zu sensibel ist, steht im Zusammenhang mit einem breiteren öffentlichen Diskurs, der Empfindlichkeit als eine Form moralischer Schwäche darstellt, die dann unsere Redefreiheit einschränkt. Wir sind zurück bei den »woken Instanzen«, die uns unserer Rechte berauben, zu sagen und zu tun, was wir wollen. Einige Menschen bestehen auf ihrem Recht, Raum zu beanspruchen, indem sie immer offensiver gegen andere vorgehen. Rassismus und Transfeindlichkeit funktionieren beide nach diesem Muster. Wenn rassifizierte und religiöse Minderheiten, insbesondere Muslime und trans Personen so hingestellt werden, als seien sie einfach zu leicht zu verärgern, dann führt dies zu einer Häufung rassistischer und transfeindlicher Aussagen. Es gibt eine »Anstiftung zum Diskurs«[32] in der Geschichte der Unterdrückung: Viele Menschen wiederholen immer wieder rassistische und transfeindliche Äußerungen, während sie gleichzeitig darauf beharren, es sei ihnen ja nicht erlaubt, diese zu tätigen. Ein Comedian forderte am Ende eines Stücks, das jede Menge transfeindlicher Inhalte hatte, Folgendes ein: »Ich denke, darum geht es ja bei Comedy wirklich, gemeinsam durch Dinge hindurchzugehen und mit tabuisierten Themen umzugehen. Ich möchte das Publikum an einen Ort bringen, wo sie vorher noch nicht waren, wenn auch nur für einen kurzen Moment.«[33] Die sogenannten »tabuisierten Themen« sind tatsächlich ziemlich ausgetretene Pfade, die wir eher gewöhnt sind zu beschreiten, statt welche, die wir nicht kennen. Es ist vielmehr eine Bestätigung und keine Herausforderung der Transfeindlichkeit der Mainstreamkultur. Aber wenn du das aussprichst, dem Problem einen Namen gibst, wird sich die Person mit großer Wahrscheinlichkeit als ›gecancelt‹ oder eingeschränkt hinstellen, was ganz schnell zu einer Cancel-Tour wird. Und so endet es damit, dass einige Menschen endlos darüber sprechen dürfen, dass sie nicht sprechen dürfen und ihnen weiterhin Plattformen gegeben werden, auf denen sie behaupten dürfen, sie hätten keine Plattform. Als feministische Spaßverderber:in positioniert zu sein, lehrt uns, zu sehen, dass Macht oft durch eine Umkehrung funktioniert: Die, die stärker im öffentlichen Bereich repräsentiert sind, tendieren dazu, sich selbst als stärker zensiert darzustellen. Wann auch immer Menschen eine Plattform bekommen, um zu sagen, sie hätten keine Plattform, oder wenn Menschen ewig lange darüber reden, dass sie zum Schweigen gebracht würden, gibt es nicht nur einen performativen Widerspruch, sondern du kannst dadurch auch aufzeigen, wie Macht funktioniert.[34]
Manchmal reicht es schon, wenn du sagst, dass du etwas besorgniserregend findest, um als Spaßverderber:in hingestellt zu werden, die versucht, jemanden oder etwas zum Schweigen zu bringen. Einmal kam eine Studierende, die im Bachelorstudium Englische Literatur und Women’s Studies studierte, weinend zu mir. Sie sagte, ein Dozent habe einen Film gezeigt, der eine grafische Darstellung einer Vergewaltigung beinhaltete. Als sie ihm danach mitgeteilt hatte, wie verstörend sie den Film und die Diskussion fand, sagte er zu ihr, sie sei nur verstört, weil sie den Film falsch verstanden habe, indem sie die Vergewaltigung »zu wortwörtlich nimmt«. Er sagte, die »Vergewaltigung war nur eine Metapher«. Ihre Verletzung wird abgetan als Kleinlichkeit. Seine Ästhetisierung der Vergewaltigung erlaubte es ihm, den Film zu zeigen und dies auch weiterhin zu tun. Das Beharren auf dem Recht, bestimmte Materialien zu benutzen, kann zu einer schonungslosen Gleichgültigkeit führen, wie diese Materialien auf andere wirken können.