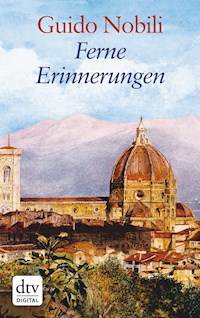
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bezaubernd und außergewöhnlich Bezaubernd und außergewöhnlich Micio, wie der kleine Guido im Familienkreis genannt wird, wächst in einer Welt von Erwachsenen auf, die Wert auf gute Manieren und gesellschaftliche Abgrenzung legen. Doch der Neunjährige ahnt, daß das Leben draußen mehr zu bieten hat. Ihn beschäftigen die seltsamen Besucher im Haus genauso wie Gott, den er sich als »reinsten Geist« in einer Flasche im Regal vorstellt, die Schule, ohne die er glücklich wäre, die Liebe ... »Wir erleben die bunte, prallgefüllte Alltagswelt: das Zusammenleben dreier Generationen in einer Stadtvilla, die Welt der Dienstboten, Kirche, Schule und Theater, alles gefiltert durch den wachen, kritischen Geist des Knaben, den der alte Herr, der da von sich schreibt, mit bewundernswerter Einfühlsamkeit vor uns agieren und argumentieren läßt.« Günther Gerlach
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Guido Nobili
Ferne Erinnerungen
Aus dem Italienischen und mit einem Nachwort von Günther Gerlach
Deutscher Taschenbuch Verlag
Deutsche Erstausgabe 2007© der deutschsprachigen Ausgabe:Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40432-7 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-25279-9Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
1
2
3
4
5
6
Nachwort
1
Wenn Sie einmal zufällig mitten über die Piazza della Indipendenza gehen und den Blick nach Norden wenden, sehen Sie ein stattliches Haus, das mit den Schultern der Statue Bettino Ricasolis eine Linie bildet. Das war mein Elternhaus. Dort im ersten Stock bin ich geboren, im letzten Zimmer auf der für den Betrachter rechten Seite. Vielleicht wird eines Tages an dieser Fensterbrüstung, unter dem grauen Gitterladen, eine Ehrentafel für mich angebracht. Ich habe sie schon vorbereitet, um die Nachwelt für alle Fälle auf die rechte Fährte zu setzen. Die Inschrift lautet: »Hier wurde ein hochberühmter Unbekannter geboren, der die Menschheit so einzuschätzen wußte, wie sie es verdiente.«
Am 7.Dezember 1850 erschien ich auf der Welt, und seit jenem Tag ist viel Wasser unter den Brücken des Arno hindurchgeflossen, und viele Dinge haben sich seither verändert. Meine Angehörigen der älteren Generation, die mit mir in diesem Haus lebten, sind alle tot. Den schönen, weiten Platz hat man kleinbürgerlich verengt, indem man schattige Linden anpflanzte. Dann hat man dort zwei Statuen aufgestellt, die eine für Ricasoli, die andere für Peruzzi, um der Nachwelt zu beweisen, wie wenig sich auch große Männer der Lächerlichkeit entziehen können, sogar nach ihrem Tod.
Dieser Bettino, der arme Mensch, mußte also in Gehrock und weißer Krawatte, den Klappzylinder in der ausgestreckten Hand, auf diesen Sockel klettern, als Synthese all der grausamen Scherze, die man mit dem Andenken eines Ehrenmannes treiben kann. Wenn einmal niemand mehr wissen wird, was ein Chapeau claque ist, was werden dann in fernen Zeiten die Archäologen für phantastische Theorien aufstellen, um zu erklären, was jener runde Gegenstand gewesen sein mag, den die Statue in der Hand hält.
Nein, kein Hut, werden sie sagen, denn platt wie er ist, kann man ihn nicht aufsetzen. Wer wird auch den verborgenen Klappmechanismus vermuten können?...
Der eine wird behaupten, es handle sich um die symbolische Krone der Toskana, die Bettino Ricasoli, Baron von Trappola, der Markgräfin Mathilde darreicht. Die alte Geschichte wurde immer so gelehrt. Aber, wird ein anderer entgegnen, es fehlen die Edelsteine, die Halbkugeln, also ist es nicht Bettino Ricasoli. Es muß bestimmt ein keltischer Priester sein, der in dieser Schale dem Jupiter das Eingeweideopfer darbringt. Aber hier schweifen wir schon deutlich ab, wird mancher Leser bemerken.
Mein System mag falsch sein, aber wenn ich erzähle, möchte ich erzählen dürfen, wie es mir gefällt. Wenn meine Erzählweise den Leser nicht zufriedenstellt, wenn sie der perfekten Erzähltechnik nicht recht zu entsprechen scheint, dann möge er ruhig aufhören zu lesen, ich nehme es ihm nicht übel. Aber ich will abschweifen, ich will umständlich sein, ja auch langatmig. Ich möchte schreiben, wie es mir gefällt.
Wenn wir uns in diesem Punkt einig sind, können wir fortfahren. Ich stelle Ihnen jetzt alle meine Lieben vor, die das unerbittliche Schicksal mir früher oder später hinwegnahm. Es mag aussehen, als listete ich die Mitglieder einer Schauspieltruppe auf. Das ist wohl nicht die eleganteste Art, aber doch die kürzeste.
Mein Großvater Lino, achtzig Jahre alt, frisch und aufrecht trotz seines Alters, von ruhiger und guter Wesensart, lenkt das Haus nach den soliden Grundsätzen eines alten Edelmanns. Luigia, eine vierundachtzigjährige Schwester seiner Frau, geht täglich im Morgengrauen in die Kirche San Marco und bleibt dort bis elf. Ferdinando, mein Vater, sicher gutmütig, aber nach außen hin streng, hat die fixe Idee, an mir die rigorosen Regeln einer auf die Vernunft gegründeten körperlichen und moralischen Erziehung der Nachkommenschaft zu erproben. Elena, meine Mutter, eine sehr schöne Frau, gesund, kräftig, mit hoher Intelligenz und großem Herzen, nur sechzehn Jahre älter als ich.
Dann Onkel Guglielmo und seine Frau Maddalena; Onkel Cesare und Onkel Niccolò, der jüngste unter den Brüdern; mein Bruder Aldo, fünf Jahre jünger als ich; mein Cousin Carlo, ein Jahr jünger als Aldo, und sein Bruder, noch im Säuglingsalter.
Diener, Mägde, Ammen, ein Koch und ein Kutscher, die eine Welt für sich bilden im Untergeschoß des Hauses und in den Gebäuden hinten im Garten, wo die Remisen sind, mit Zugang von der Via delle Officine.
Zeit der Handlung, wie es auf den Theaterzetteln zu heißen pflegt, ist Anfang des Jahres 1859.
Das Leben in unserem Haus lief, trotz des Herumschwirrens des Dienstpersonals, zumindest in meinen Augen ab wie ein Uhrwerk. Am Morgen gab es für alle ein gemeinsames Frühstück; die Kutsche brachte mich, meinen Bruder und einen Cousin zur Schule; und abends trafen sich alle wieder zur Hauptmahlzeit.
Diese Abendessen bleiben mir unvergeßlich. Meine Onkel waren jung und lustig, und in ihrer Gesellschaft vergaß auch mein Vater die aufgesetzte finstere Miene, die er sich auferlegt hatte, um mich im Zaum zu halten, und alle zusammen führten eine so angenehme Unterhaltung, daß man meinen konnte, es habe auf der Welt nie eine heiterere Tafelrunde gegeben.
Wenn Gäste zum Essen kamen, verschwanden wir Knaben in ein anderes Zimmer, wo mein Bruder Aldo, mein Cousin Carlo und ich allein und gleichsam ohne Zaumzeug waren, so daß ein Essen mit Gästen bedeutete, daß wir am nächsten Morgen ein Abführmittel nehmen mußten, was wiederum einen Tag schulfrei zur Folge hatte.
Aber zu Anfang des Jahres 1859 schlich etwas im Haus umher, das auch mir trotz meiner Unerfahrenheit verdächtig vorkam. Es schien da etwas zu geben, von dem mein Großvater nichts wissen sollte. Mit der größten Vorsicht kamen viele Personen ins Haus, meist durch den Eingang an der Via delle Officine. Wenn wir gerade bei Tisch saßen, flüsterte der Diener Leopoldo dem Onkel Niccolò etwas ins Ohr, woraufhin dieser seine Mahlzeit unterbrach, sich erhob und in einen kleinen Salon am anderen Ende des Hauses eilte.
Wenn der Großvater dann fragte, wer der Störenfried sei, nannten ihm die Onkel irgendeinen Namen, und sobald sie konnten, stahlen auch sie sich einer nach dem anderen davon.
Ich wollte neugierig herausfinden, was vor sich ging, aber vergebens. Denn wenn ich in einer solchen Situation versuchte, das Eßzimmer zu verlassen, nagelte ein finster drohender Blick meines Vaters mich auf meinem Stuhl fest und ließ mich nicht los, ehe die Onkel zurückkamen. Einer von ihnen unterrichtete dann so, daß der Großvater es nicht merken sollte, mit wenigen Worten und fast ohne den Mund zu bewegen meinen Vater über eine Sache, die ich nicht verstand.
Eines Abends, als ich doch einmal der Überwachung hatte entfliehen können, sah ich, wie zwei dieser geheimnisvollen Besucher das Haus verließen. Einer ging in Richtung der Pferdeställe; er war beleibt, sah aus wie ein Verwalter vom Lande und trug einen großen Schlapphut. Der andere ging durch den Haupteingang, wo seine Kutsche auf ihn wartete. Er war schwarz gekleidet, Zylinder, vornehme Haltung, aber mit einem harten, verächtlichen Zug um den Mund, der eingerahmt war von einem zweigeteilten, langen und dünnen und mit Pomade eingeriebenen Schnurrbart und einem spitzen Kinnbart.
Was in aller Welt wollten diese Leute, die mir verdächtig waren? Was hatten diese seltsamen Gestalten in unserem Haus herumzuschnüffeln? Denn schließlich, dachte ich, sind wir doch eine anständige Familie. Aber dieses Sich-Davonstehlen, diese Ausflüchte, diese Zusammenkünfte flößten mir so wenig Vertrauen ein, daß ich, mit einem Schwall hilfloser und konfuser Sätze, meine Mutter unter vier Augen fragte, wer diese vielen verschiedenen Leute seien, die ich bei all dem behutsamen Kommen und Gehen bemerkt hatte.
»Sie entwickeln«, antwortete meine Mutter mit einem leisen Seufzen, »einen Apparat zum Fliegen. Sie wollen sehen, ob sie sich selbst den Hals dabei brechen, und am Ende werden wir auch dran sein.«
Ich war ein gutgläubiger Junge, und die Antwort überzeugte mich. Sie schienen da an einer schönen Erfindung zu arbeiten, und ich war sicher, sie würde ihnen gelingen, so groß war mein Vertrauen in das Wissen und den Verstand der Meinen. Andererseits leuchtete mir der Gedanke, so weit durch die Luft zu fliegen, nicht recht ein. Er machte mir eher Angst, besonders nach einem Experiment, das ich aufgrund reiflicher Überlegung dazu angestellt hatte. Wenn man fliegen will, hatte ich mir gesagt, braucht man unter sich einen Abgrund. Schaut man in eine Pfütze, in der sich der Himmel spiegelt, wird man gleichsam in einen Abgrund hinabgezogen. Überspringt man sie, muß man sich genauso fühlen, als säße man in einem Flugapparat, oder gar noch schlimmer, denn schließlich sieht man da unten in der Pfütze die Unendlichkeit. Bei der nächsten Gelegenheit versuchte ich also, über eine Pfütze zu springen. Aber während ich früher keinen Gedanken darüber verloren hätte, fühlte ich mich nun, nach dem gründlichen Studium des Abgrunds, nicht mehr dazu in der Lage, und das bereitete mir Kummer. Denn wenn ich mich weigern würde zu fliegen, wäre ich dem Tadel und den Neckereien der Onkel ausgesetzt, die tapfere Leute waren. So tapfer, daß Onkel Niccolò am Krieg von 1848 teilgenommen hatte, und Onkel Cesare wäre auch dabeigewesen, wenn er sich nicht beim Aufbruch der toskanischen Freiwilligen in Aulla das Bein gebrochen hätte.
In der kleinen Welt der häuslichen Dienerschaft glühten heiße Leidenschaften; ihre Liebschaften, ihr Haß und ihre Eifersüchteleien blieben auch oben in den herrschaftlichen Räumen nicht ohne Folgen. Der Kutscher war eifersüchtig auf den Koch, wegen eines der Kammermädchen. Um ihn bei seiner Herrschaft in Verruf zu bringen, schnippelte er eines Tages heimlich ein Fensterleder in die Kaldaunen mit Butter und Käse. Sosehr wir auch kauten, diesen Brocken konnten wir nun wirklich nicht hinunterbekommen!
Kurz darauf wurden in Butter gebratene und mit feinsten Glassplittern panierte Schnitzel serviert. Und schließlich war ich es, der eines Tages in seiner Dinkelsuppe ein undefinierbares Etwas fand, das ich triumphierend überall herumzeigte. Es war ein Backenzahn, den sich mein Großvater am Tag zuvor hatte ziehen lassen!
Angesichts einer solchen Ungeheuerlichkeit ordnete mein Großvater an, der Kutscher Basilio sei zu entlassen. Aber wenn sie sich auch nicht direkt widersetzten, so suchten meine Onkel doch nach Ausflüchten. Basilio stammte aus Trient; eine hochgestellte Persönlichkeit hatte ihn, den politischen Flüchtling, empfohlen. Er sollte über derart geheime Informationen verfügen, daß man ihn nicht so kurzerhand loswerden konnte. Nachdem man einen Kompromiß mit meinem Großvater gefunden hatte, übernahm es Onkel Guglielmo, dem Kutscher, statt ihn fortzujagen, eine gehörige Standpauke zu halten. Und so stieg er am Abend hinab in die Gesindestube, wo die gesamte Dienerschaft beim Essen saß.
Obwohl die Türen geschlossen waren, konnte ich, wenn ich an der Dienstbotentreppe lauschte, die sonore Stimme meines Onkels hören, der gegen alle ein Donnerwetter losließ. Als er wieder heraufkam, sagte er, mein Großvater könne beruhigt sein; er stehe dafür gerade, daß solche Vorfälle sich niemals wiederholten.
»Richtig«, sagte mein Großvater wenig überzeugt, »Überraschungen mit meinen Zähnen werden wir nicht mehr erleben; das war der letzte. Und auf mein künstliches Gebiß will ich schon selbst aufpassen.«
Aber warum wird Basilio nicht entlassen? Vielleicht weiß er etwas von dem Geheimnis des Flugapparats, dachte ich bei mir. Schließlich läßt er ja all diese verdächtigen Leute ins Haus.
In einer Unterredung mit Tante Luigia, unserer Expertin für Fragen der Religion, lenkte ich das Gespräch vorsichtig und geschickt auf diesen Fall und konnte so herausfinden, daß der Flugapparat gegen die Religion und ebenso gegen die Grundsätze einer guten Regierung verstieß. Gegen die Religion verstieß er, da der Mensch von Gott so konstruiert wurde, daß er laufen soll, nicht fliegen. Den göttlichen Willen derart zu mißachten, indem man zu fliegen versuchte, war eine Sünde, ein Fall für die Inquisition und verdiente den Scheiterhaufen. Und was den Staat betraf, so betrachtete dieser das Fliegen als Straftat, denn so könnten die Verbrecher einfach durch die Luft abschwirren und sich der verdienten Strafe entziehen. Und auch die Schmuggler könnten den Zoll in den Ruin treiben. Das war mehr als genug, um mich zu überzeugen, und ich hielt es für ein Gebot der Vorsicht, gegenüber niemandem etwas über dieses Geheimnis durchsickern zu lassen, da es sonst viele Menschen kompromittieren könnte, die mir lieb waren. Während ich nun voller Zuversicht darauf wartete, daß dieser geniale Flugapparat zum Vorschein kommen würde, schleppte eines Abends Onkel Cesare mit Hilfe eines Dieners eine lange Stange aus Kastanienholz aus dem Garten hoch in den Salon im ersten Stock, wobei sie die Haupttreppe benutzten, um nicht meinem Großvater zu begegnen. Die Stange war so lang, daß sie vorsichtig manövrieren mußten, um nicht an den Vasen und den Leuchtern anzuecken. Sie rückten die Möbel beiseite und legten die Stange mitten in das Balkonzimmer.
Heute abend fliegen sie! dachte ich bei mir. Man sieht schon erste Anzeichen. Sie sind sicher in den ersten Stock heraufgekommen, um besser Schwung zu bekommen. Und sie fliegen nachts, damit sie nicht von den Wachen entdeckt werden. Ich selbst möchte nicht fliegen, nur zuschauen würde ich schon gern. Aber werden sie mich hierbleiben lassen?
»Was macht Micio hier?« fragte mein Onkel in halbstrengem Ton und wandte sich zu mir um.
Dazu muß man wissen, daß die Onkel mir wegen meiner himmelblauen Augen den Kosenamen »Micio bianco« gegeben hatten, und diesen familiären Beinamen behielt ich eine ganze Weile.
»Was machst du hier? Verschwinde, lauf runter, sonst ergeht strengster Befehl, sofort zu Bett zu gehen.«
Betrübt ging ich die Dienstbotentreppe hinunter und zurück ins Eßzimmer im Erdgeschoß. Nacheinander verließen alle den Raum, auch meine Mutter, und ich blieb allein mit meinem Großvater und seiner Schwägerin, der Tante Luigia. Die beiden Alten spielten ein wenig Domino und unterhielten sich. Dann zogen sie sich jeder in sein Zimmer zurück, und ich schlief ein, mit ausgestreckten Armen und dem Kopf auf dem Tisch.
Das Zimmermädchen, die gute Teresa, an die ich eine liebevolle Erinnerung bewahre, rüttelte mich und hieß mich aufstehen. Schlaftrunken wollte ich schnurstracks ins Bett gehen, aber sie erinnerte mich an meine Pflichten und das Familienprotokoll: »Was soll das? Sie trotten ins Bett wie ein Esel, ohne allen gute Nacht zu sagen?«
Eine bessere Gelegenheit hätte sich mir nicht bieten können, um mit gutem Grund in den Salon, wo alle versammelt waren, zurückzukehren und einen verstohlenen Blick auf den Apparat zu werfen. Ich ging hinauf in den ersten Stock und drückte vorsichtig auf die Türklinke des Salons. Aber der Riegel war vorgeschoben, und auf mein leises Geräusch antwortete von drinnen sofort der vielfache Ruf: »Wer ist da?« Meine Mutter kam heraus, nicht ohne sorgfältig die Tür hinter sich zu schließen. Aber ich hatte blitzschnell einen Blick durch den Türspalt geworfen, und was ich sah, ließ mir vor Entsetzen das Blut in den Adern gefrieren und flößte mir Furcht und Schauder ein.
Damit man besser einschätzen kann, was ich in jenem Moment empfand, muß ich den Knaben von acht Jahren, der ich damals war, etwas genauer vorstellen.
Körperlich war ich ein bißchen mager, aber gutgewachsen und flink wie ein Eichhörnchen. Und um die Wahrheit zu sagen, die Furcht, mit der mein Vater mich fest im Zaum hielt, war unbedingt nötig, weil meine übermütigen Streiche sonst ausgeufert wären. Mein Respekt vor meinem Vater war grenzenlos. Wenn ich wieder einmal etwas ausgefressen hatte, mußte ich – und tat es auch – von meinem Onkel Guglielmo, der Reiter war, die Reitgerte holen und sie meinem Vater übergeben. Dieser peitschte mich aus und gab mir die Gerte zurück mit dem Auftrag, sie dem Onkel wiederzubringen und mich bei ihm zu bedanken. Wenn ich die Gerte auf den nackten Waden spürte, sprang ich umher und rollte mich auf dem Boden, aber nur ganz selten entfuhr mir ein Stöhnen, denn mein Vater hatte mich gewarnt: Schreie waren ein Zeichen von Feigheit, etwas Vulgäres.
Heutzutage pflegt man die Jugend nicht mehr durch Schläge zu erziehen, aber ich weiß nicht, ob die Abschaffung dieser Sitte sich auf den Charakter der Menschen vorteilhaft auswirkt. Eine harte Züchtigung verleiht dem Gesetz Bedeutung. Das Gesetz der Familie verlangt Ordnung. Damals zog der Bruch dieser Ordnung die Peitsche nach sich. Nun, wo die Peitsche abgeschafft ist, bleibt das Gesetz ohne Folgen, und man lernt schon von klein auf, daß es auf





























