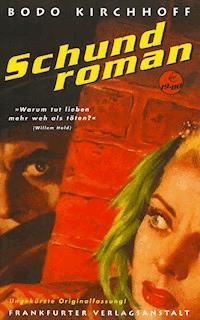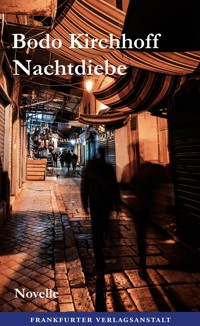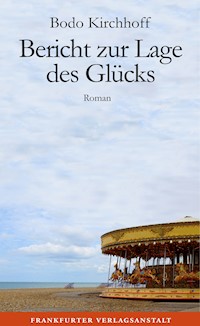Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: FVA Digital: Erzählungen Bodo Kirchhoffs
- Sprache: Deutsch
»Ferne Frauen«, umfasst elf Kurzgeschichten, in denen jeweils ein männlicher Ich-Erzähler auf eine für ihn unerreichbare Frau blickt – entfernt im räumlichen oder geistigen Sinne, gleich ob sie die eigene Ehefrau, eine engagierte Hure oder ein Traumbild ist. Der Autor schildert in filigranen Miniaturen Begegnungen, die nie stattfanden, die Versuchsanordnungen gleichen, die sich auflösen oder gar tödlich enden. In den Versuchen, Nähe herzustellen, offenbart sich dem Erzähler die Distanz zum eigenen Ich. Erstmals 1987 veröffentlicht fand die Erzählsammlung bei Kritik und Publikum viel Beachtung, 2005 hat der Autor unter Wahrung des Originaltons die Texte neu bearbeitet. Bodo Kirchhoff ist nicht nur als Verfasser groß angelegter Romane bekannt, auch in der Kurzform brilliert der renommierte Stilist seit mehreren Jahrzehnten. Von der kompromisslosen und polarisierenden Radikalität des Frühwerks, das mit sezierendem Blick gesellschaftlichen Randfiguren nachspürt, wird der Leser zunehmend in einen umfassenderen Handlungsrahmen geführt, hinein in einzigartige Augenblicke einer Ehe, Momentaufnahmen einer Familie. Lakonisch, präzise und geprägt von einer subtilen Hintergründigkeit schreibt der Autor immer auch über die Schwierigkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden. Bodo Kirchhoffs Erzählungen sind eine literarische Kostbarkeit, anhand derer die Entwicklung des Autors vom »bad boy« der Literatur zu einem der profiliertesten Schriftsteller der Gegenwartsliteratur lesend nachvollzogen werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Ferne Frauen«, umfasst elf Kurzgeschichten, in denen jeweils ein männlicher Ich-Erzähler auf eine für ihn unerreichbare Frau blickt – entfernt im räumlichen oder geistigen Sinne, gleich ob sie die eigene Ehefrau, eine engagierte Hure oder ein Traumbild ist. Der Autor schildert in filigranen Miniaturen Begegnungen, die nie stattfanden, die Versuchsanordnungen gleichen, die sich auflösen oder gar tödlich enden. In den Versuchen, Nähe herzustellen, offenbart sich dem Erzähler die Distanz zum eigenen Ich.
Erstmals 1987 veröffentlicht fand die Erzählsammlung bei Kritik und Publikum viel Beachtung, 2005 hat der Autor unter Wahrung des Originaltons die Texte neu bearbeitet.
Bodo Kirchhoff ist nicht nur als Verfasser groß angelegter Romane bekannt, auch in der Kurzform brilliert der renommierte Stilist seit mehreren Jahrzehnten.
Von der kompromisslosen und polarisierenden Radikalität des Frühwerks, das mit sezierendem Blick gesellschaftlichen Randfiguren nachspürt, wird der Leser zunehmend in einen umfassenderen Handlungsrahmen geführt, hinein in einzigartige Augenblicke einer Ehe, Momentaufnahmen einer Familie. Lakonisch, präzise und geprägt von einer subtilen Hintergründigkeit schreibt der Autor immer auch über die Schwierigkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden.
Bodo Kirchhoffs Erzählungen sind eine literarische Kostbarkeit, anhand derer die Entwicklung des Autors vom »bad boy« der Literatur zu einem der profiliertesten Schriftsteller der Gegenwartsliteratur lesend nachvollzogen werden kann.
»In seinem bisher besten Buch beweist der Erzähler Bodo Kirchhoff jetzt sein Talent und seine Originalität.« (Die ZEIT zu »Ferne Frauen«)
»Kirchhoff ist ein Meister erotischen Erzählens, was heutzutage nicht oft vorkommt.« (Deutschlandradio Kultur)
»Ein breites Spektrum, das in diesem Erzählwerk von Bodo Kirchhoff zu entdecken ist und ein Hochgenuss für die Leser.« (Hessischer Rundfunk)
»Jede einzelne Erzählung ist lesenswert. In ihrer Gesamtheit sind sie ein literarisches Autorenportrait der Sonderklasse.« (Kölnische Rundschau)
Inhalt
Olmayra Sanchez und ich
Die Frau hinter der Tür
Der Badeanzug
Toter Mann
Vierzig werden
Desire
Tschakwau
Das Grübchen
Im Operncafé
Etwas schärfer, wenn’s geht!
Frühes Ende
Olmayra Sanchez und ich
Ich spüre außer mir nichts, das war schon immer so und hat auch manchmal gestört. Wenn es um den Menschen an sich ging, konnte ich eben schlecht mitreden; ich dachte dabei gleich an mich und zog falsche Schlüsse. Und so wurde es mein Ziel, mich wenigstens ein einziges Mal in einen anderen hineinzuversetzen. Durch einen Vulkanausbruch in Kolumbien, der eine Schlammlawine ausgelöst hat, ergab sich schließlich die Gelegenheit. Das Fernsehen machte mich mit Olmayra Sanchez bekannt. Man sah, wie sie aus einem Wasserloch schaute und unter den Blicken der Welt über Tage hin starb. Als alles vorbei war, schloß ich mich ein und machte mir meine Gedanken.
Ich saß am Küchentisch und blickte lange auf ein Zeitungsfoto, eine gelungene Aufnahme. Da war Olmayra Sanchez in einem Reifenschlauch, auf den sie, scheinbar bequem, beide Unterarme gelegt hatte. Das braune Wasser stand ihr bis zum Hals, sie lächelte schwach. Es war fast ein Urlaubsmotiv, dachte man sich die zerschmetterten Balken und all das Schlammige ringsherum weg. Olmayra war erst dreizehn, so konnte man lesen, doch schon mit Zügen einer jungen Frau, das fiel mir auf. Ihre Füße und Beine, vielleicht auch Teile des Rumpfes – ich konnte es ja nur vermuten –, mußten unterhalb des Wasserspiegels eingeklemmt sein; nach ihrem Tod hat man darüber nichts weiter erfahren, sie war dann in jeder Hinsicht gestorben (so ist es eben bei uns, in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, und es könnte noch ärger werden, man weiß es nicht).
Ich legte das Foto beiseite; es gab noch andere Fotos, die Zeitschriften waren voll davon. Ein Bild, das kurz vor ihrem Ende gemacht worden war, zeigte sie mit aufgeweichten weißlichen Fingern und den erloschenen Augen einer Greisin. Was war dem vorausgegangen? Ich versuchte, mich in die letzten Tage und Nächte der Sanchez, soweit es ging, hineinzudenken.
Begonnen hatte ja alles, wie schon erwähnt, mit dem Ausbruch eines Vulkans in Kolumbien, dessen Name kurze Zeit später bei uns Gegenstand eines Fernsehquiz wurde (solche lustigen Fragesendungen, werden zunehmen, fürchte ich); und es war auch das Fernsehen, welches den Verlauf des Ganzen festgehalten, wenn nicht gar gestaltet hatte. Die Blicke der Welt, sagte ich mir, haben es diesem Mädchen wahrscheinlich etwas leichter gemacht zu sterben, ja, sie haben Olmayra Sanchez zeitweilig in einen Siegestaumel angesichts des nahenden Todes gestürzt und sie sogar Humor beweisen lassen. Da gab es zum Beispiel einen Filmbericht, in dem sie winkte und zu den Kameras sprach und sich und der ganzen Welt, auch mir in meiner doch reizlosen Wohnung, Mut machte: Voller Zuversicht war sie, daß man sie aus diesem Loch herausholen und sie damit gleichsam über den Vulkan und also die Natur triumphieren würde, und wenn man ihr die Daumen drückte, drückte man sich damit selbst die Daumen; anfangs waren ihre Worte noch untertitelt, dann fand sich eine Synchronstimme, die man für ihre Stimme hielt, so, als beherrschte Olmayra mit einem Mal unsere Sprache.
Kurz vor ihrer ersten Rede in deutsch hatte man noch mit einem Flaschenzug an ihr gezogen und sie fast in Stücke gerissen; alles was fehlte, war eine tüchtige Pumpe. Das wußten die Leute in Europa, Amerika und Australien, und alle Welt wußte auch, daß diese Pumpe nicht mehr rechtzeitig eintreffen konnte; nur Olmayra wußte es nicht. Schon vom Tode ins Auge gefaßt und aller Rechte auf ihre Tragödie beraubt, wandte sie sich tapfer an die Öffentlichkeit; es waren auch dieser jähe Weltruhm und ihre besondere Art von Verblendung, die mein Interesse erregten. Ich selbst werde ja sterben, ohne die geringste Spur zu hinterlassen; ich werde nie naiv oder verblendet gewesen sein, aber auch nie berühmt. Wenn ich wenigstens ihr Retter geworden wäre! So aber habe ich nur ihr Sterben verfolgt, wie Millionen andere, und höchstens mich selbst gerettet, mit meinen Gedanken.
Sie mußte sich irgendwann in diesem Wasserloch wiedergefunden haben, nachdem die Schlammassen zur Ruhe gekommen waren, dachte ich. Und überhaupt stellte ich es mir ruhig um sie vor, ruhig und finster, die Luft noch von Asche erfüllt. Es herrschte weder Tag noch Nacht, als ihre Schmerzen begannen. Die Beine ließen sich nicht mehr bewegen. Jeder Versuch tat so weh, nahm ich an, daß ihr die Augen hervortraten. Sie glaubte, in einem Maul voller Zähne zu stecken. Teile von Hauswänden hatten ihr vielleicht die Schenkel gebrochen und beide Füße umschlossen, ein Armierungseisen war in die Kniekehle gedrungen. Anfangs reichte ihr das Wasser nur knapp bis zur Brust, ein Balken bot Halt. Ihre Zähne schlugen aneinander, begreiflicherweise; sie hatte Angst, und sie fror. Ab und zu gab es einzelne Rufe, wie fernes Hundegebell, man kennt das aus Filmen.
Der Schmerz beschleunigte ihren Atem, starr schaute sie ins Dunkle. Was war geschehen? Wo waren ihr Bett, ihre Kammer, ihr Dorf? Was war das für ein Maul, in dem sie steckte? Olmayra rief nach ihrer Mutter – wer würde das nicht tun –, erst leise, dann laut, dann wieder leise. Die Asche in der Luft schien alles zu schlucken, vor allem das Licht. Kleine schwarze Flocken legten sich auf ihre Arme. Sie hatte nur ein Leibchen an, ihr Nachthemd. Das Wasser stieg. Sie konnte es nicht sehen, aber sie fühlte es; der Tod kroch förmlich an ihr empor.
Als es heller wurde, waren schon fast ihre Schultern umspült, und die Angst zu ertrinken, ließ sie vorübergehend alle Schmerzen vergessen, davon kann man ausgehen. Es regnete jetzt graue Tropfen, die etwas Öliges hatten. Das Licht nahm zu, war aber ein strahlenloses stumpfes Licht; es gab keine Sonne. Olmayra sah den Rand des Wasserlochs und, keinen Steinwurf entfernt, den Kopf einer Kuh. Er ragte aus dem schimmernden Schlamm, die Augen waren aufgerissen. Die Kuh war am Leben, doch sie brüllte nicht. Dafür schrie eine Frau, die durch den Regen taumelte. Es war eine Nachbarin, und ihr heiseres Schreien schien gar kein Ende zu nehmen, bis es ein immer stärker werdendes Brummen und Brausen so übertönte, daß es einer Pantomime gleichkam. Olmayra faltete bei diesem Brausen die Hände. Jetzt kommt Gott persönlich, schoß es ihr vielleicht durch den Kopf. Dann sah sie, wie die Nachbarin hinschlug und einfach im Schlamm liegenblieb, während sich das Wasser in dem Wasserloch zu kräuseln begann und aus dem Brausen tobender Lärm wurde. Ein Hubschrauber landete neben dem Loch. Er war nicht dunkelgrün, wie die Armeehubschrauber, sondern weiß mit roten Streifen. Das Maul der Kuh ging auf; Aschewirbel jagten über den Boden. Und für einen Augenblick schien sogar die Sonne.
Dem Hubschrauber entstiegen vier Männer, einer von ihnen trug eine Filmkamera; durch ein langes Kabel war er mit einem der anderen, der einen Kasten um die Schultern hängen hatte, verbunden. Der dritte hielt mit beiden Händen eine Stange, an deren Spitze etwas angebracht war, das einer Frucht ähnelte. Sie geben mir zu essen, dachte Olmayra – eine Kamera hatte sie schon öfter gesehen, einen Mikrofongalgen noch nie. Der vierte Mann hatte die Hände frei. Er trug eine Weste mit vielen Taschen und hatte silbrige Löckchen und einen Schnurrbart, mit Fingerzeigen gab er Befehle. Der Lärm hörte auf. Die vier Männer schauten zu ihr herüber, und Olmayra Sanchez begriff, daß nicht Gott oder das Militär, sondern das Fernsehen gekommen war, und dadurch erst recht alles gut würde. Denn Gott hätte womöglich geprüft, ob sie reinen Herzens genug wäre, um gerettet zu werden, und die Soldaten hätten auf Befehle gewartet oder einen Umschlag voll Dollars. Aber das Fernsehen wollte sie interviewen, und dazu mußte sie leben.
Der Mann, der die Hände frei hatte, kam näher. An der hingefallenen Frau vorbei stapfte er durch den schon steif werdenden Schlamm. Wie ist dein Name? rief er.
Olmayra Sanchez.
Und was ist mit dir? Kannst du nicht raus?
Sie erklärte ihm, daß ihre Beine eingeklemmt seien, und er sagte: Sprich nicht so hastig. Und dann sah sie auch schon, wie die lange Stange mit der Frucht an der Spitze zu ihr geschwenkt wurde. Sprich dort hinein und nicht zu laut, rief der Mann, der die Hände frei hatte, und sie nickte, und ihre Schmerzen waren für einen Augenblick weg. Sie wiederholte ihren Namen, der mit der Kamera begann jetzt zu filmen. Er kniete am Rande des Lochs, und Olmayra fürchtete, er könnte hineinfallen und böse werden auf sie. Sie versuchte, klar und deutlich zu reden, obwohl ihr Mund ganz trocken war trotz des Wassers um sie herum. Sie hatte großen Durst, aber nach etwas wie Durst war nicht gefragt worden. Schau zu mir, rief der Kameramann, und sie drehte sich ein Stück und riß den Mund auf: Es war, als sägte man ihr die Schienbeine entzwei. Olmayra biß sich tief in die Hand, der sicherste Weg, um nicht zu schreien – später sah man ein Foto von diesem Biß. Was ist das für eine Stelle hier? fragte der Mann mit den silbernen Löckchen, war hier euer Haus gestanden?
Olmayra Sanchez nahm die Hand aus dem Mund. Ich weiß es nicht, sagte sie. Was ist geschehen? Wo sind die Häuser, wo ist das Dorf? Sie wollte die Stange ergreifen, aber der, der sie hielt, schwenkte sie hoch. Euer Vulkan ist ausgebrochen, rief er ihr zu. Und dadurch kam der Schlamm und hat alles begraben!
Sie nickte jetzt nur, sie fühlte sich mitschuldig am Verschwinden des Ortes. Wie ihre Eltern und die Nachbarn, wie jeder hatte sie sich für klüger gehalten als der Vulkan, und also war jeder Vorwurf berechtigt. Immer zu mir schauen, rief der, der sie filmte, und Olmayra zeigte ein Lächeln. Sie beneidete die vier Männer; sie beneidete jeden, der nicht sie war, sogar die Frau im Schlamm, obwohl sie dalag wie tot. Wer nicht ihre Schmerzen hatte, dem gehörte die Welt – so mag sie gedacht haben.
Warum holt mich hier keiner raus? fragte sie, als das Wasser immer noch stieg. Hab noch Geduld, rief eine Stimme, und Olmayra versprach, Geduld zu haben, und neigte den Mund zum Wasser; wenn sie leben wollte, dann mußte sie trinken, das würden die Männer sicher verstehen, also sie nahm einen Schluck von dem Wasser, das nach Petroleum schmeckte, und spuckte es wieder würgend aus, und der mit den freien Händen wollte wissen, wie lange sie da schon drin sei, in diesem Loch.
Die Stange wurde gesenkt, und diesmal griff sie nicht mehr danach. Ich weiß es nicht, sagte sie, es war dunkel, ich erinnere mich nicht.
Aber du mußt dich doch erinnern …
Wir haben einen Film gesehen im Fernsehen. Dann sind wir ins Bett. Und dann ist das Haus umgefallen.
Wie hieß dieser Film?
Olmayra versuchte sich zu erinnern. Es war ein Film mit Musik und schönen Frauen.
Wurde geschossen? fragte der Mann.
Ich weiß es nicht.
Gut. Sag mir einfach, was du weißt.
Und sie nannte die Namen ihrer Geschwister und die ihrer Eltern und deren Eltern und auch den Namen der Straße, die der Schlamm zugedeckt hatte, und sagte noch einmal, daß sie vor dem Zubettgehen alle ferngesehen hätten, einen Film mit Musik, und daß ihr kalt sei und irgend etwas durch ihr Bein hindurchgehe.
Bald kommt die Sonne, rief ihr der Mann zu. Und wenn die Sonne kommt, wird dir warm. Und bald kommt auch Hilfe! Er sah auf die Uhr und besprach etwas mit den übrigen Männern, und der mit der Kamera filmte zuerst den Kuhkopf und schwenkte danach zu Olmayra, die jetzt ihr Kinn hob, um kein Wasser zu schlucken.
Wir kommen zurück, hörte sie den mit der Stange rufen und sah auch schon, wie die Männer in den Hubschrauber stiegen, und sich der große Propeller zu drehen begann und alles aufwirbelte mit seinem Wind, so daß es Wellen gab in dem Loch und ein Schwappen in ihr Gesicht und dazu einen Lärm wie der von den einkrachenden Häusern während der Nacht, einen Lärm, der dann aber leiser wurde und leiser, ja sich gänzlich verlor, bis es nichts mehr gab außer dem feinen Rieseln der Asche und von Zeit zu Zeit einem Schnauben der Kuh und mal aus dieser, mal aus jener Richtung Laute, als spreche der Schlamm, und eine Zeit anbrach, in der jede Minute noch etwas schlimmer als die vorangegangene war.
Olmayra Sanchez betete, das Fernsehen möge wiederkommen, und das Fernsehen kam wieder, und mit dem Fernsehen kamen viele Leute. Man warf ihr einen alten Reifenschlauch in das Loch, gut aufgepumpt, damit sie nicht absaufe, und gab ihr zu essen und zu trinken, damit sie bei Kräften bleibe, und sprach ihr gut zu, damit sie den Verstand nicht verliere, und als es heißer wurde gegen Mittag und die Sonne brannte, bekam sie ein feuchtes Tuch auf den Kopf, das war rot, weil das Fernsehen in dem grauen Einerlei eine Farbe brauchte.
Danke, rief Olmayra den Leuten zu. Ich werde es schaffen, mit eurer Hilfe und der der Jungfrau Maria!
Und bei Anbruch der Dunkelheit flog der Hubschrauber mit den Männern vom Fernsehen wieder davon, und die Leute zerstreuten sich. Es regnete, und jeder Windhauch trug einen fettig süßen Geruch durch die Luft. Die nun folgende lichtlose Nacht, dachte ich, muß Olmayra Sanchez endlos erschienen sein. Der Spieß in ihr wurde zum Tier, das sich langsam zum Hirn fraß, und sie umklammerte den Reifenschlauch und streichelte ihn und starrte ins Dunkle und hoffte, die Kuh würde noch einmal muhen, aber alles war still, bis auf das Toben in Kopf.
Als es tagte, waren Olmayras Hände weißlich geworden und die Augen fast schwarz. Leute krochen heran, und man gab ihr zu trinken, das Fernsehen kehrte zurück, der mit den Löckchen winkte ihr zu; ein Kran wurde errichtet. Man legte ihr Seile um, und alle sprachen durcheinander, und die Seile wurden straff, und sie brüllte, als man ihr die Beine auszureißen begann. Die Leute wichen zurück, man ließ die Seile fallen. Bald kommt eine Pumpe, rief ihr der mit der Kamera zu und wartete, bis das Verzerrte aus ihrem Gesicht war, bevor er sie filmte – sie und das Loch und den Kran und das Firmenschild auf dem Kran. So verstrich dieser Tag, und die Pumpe kam nicht, aber dafür die Nacht, und mit einem Mal waren die Leute wieder alle verschwunden, und das Tier in ihrem Fleisch fraß weiter, und das Wasser stieg, und es stank von der Kuh, die längst tot war. Olmayra glaubte, Musik zu hören, die Musik aus dem Film, den sie sich angeschaut hatten, ehe der Schlamm gekommen war, aber es war ihr eigenes Wimmern. Bis zum Tagesgrauen hielt dieses Wimmern, bis noch mehr Leute zu dem Wasserloch strömten und nun drei Kameras aufgebaut wurden, statt einer Pumpe, und man ihr zurief: Olmayra, du bist jetzt berühmt, die ganze Welt kennt dich – sag ein paar Worte zur Welt …
Und sie grüßte die Welt und verkündete, bald würde die Pumpe da sein, und alle könnten zusehen, mit welchem Triumph sie aus diesem Loch herauskäme, und die Fernsehleute waren zufrieden. Man baute den Kran wieder ab, und der Nachmittag kam und der Abend und gleich auch die Nacht, und sie war abermals allein. Und irgendwann in dieser Nacht, war zu lesen, soll sie gebrüllt haben, nur ein einziges Mal – zu dem Zeitpunkt, dachte ich, als sie das sichere Gefühl hatte, es sei keiner mehr in der Nähe, wenn sie der Welt, statt dankbar zu sein, ihr Gebrüll entgegenbrachte. Aber irgendwer hatte es gehört und weitererzählt, und ich fragte mich noch, was danach war, in den Stunden, ehe es hell wurde und man sie tot in dem Reifenschlauch fand; doch es blieb bei der Frage, während ich all die Fotos zerriß.
Die Frau hinter der Tür
Ich hatte mir vorgenommen, nie darüber zu sprechen, aber was nehmen wir uns nicht alles vor, wenn plötzlich der Boden unter uns wegbricht. Es begann mit einem der üblichen Anrufe nach meiner Sendung, irgendeine Frau, die mir aus ihrem menschenleeren Leben erzählte, jedoch Glück hatte, daß ich im Begriff war, etwas zur Einsamkeit vorzubereiten, ihr also zuhörte mit Moderatorengeduld, ja sogar Fragen stellte und einen Ton anschlug, der mir später, als ich das Band abhörte, geradezu warm vorkam, und endete damit, daß ich zum Töten oder etwas Ähnlichem ausholte.
Zwei Tage nach diesem Anruf klopfte es abends an der Tür meiner Wohnung, mehrmals und sanft. Ich hatte mir gerade Wein eingeschenkt und trank noch einen Schluck, um die Gelassenheit, die ich gern an den Tag lege, zu bewahren, dann stand ich vom Sofa auf; von meinen Bekannten besaß niemand einen Schlüssel zum Eingang, und zu den Nachbarn im Haus bestand kein Kontakt – wer also konnte das sein? Nach kurzer Pause klopfte es erneut. Ich sah durch den Spion, was einen ja von vornherein beunruhigt, und da stand jemand im Dunkeln vor meiner Tür, nur etwas Licht, das von den Lämpchen an den Fahrstühlen kam, im Haar.
Wer ist da? rief ich. Das wissen Sie doch, erwiderte eine Frauenstimme, und ich löschte die Lampen in der Diele, als könnte ich mich damit selbst auslöschen. Was wollen Sie von mir? Ein Kratzen drang durch das Holz, wie von Fingernägeln. Machen Sie auf, ich weiß doch, wie allein Sie sind! Es klang wie ein Befehl, und ich fragte, wer sie ins Haus gelassen habe. Ist das wichtig? drang es durch die Tür; wichtig ist, daß ich jetzt bei Ihnen bin. Oder stört Sie das etwa? Ich nickte vor mich hin und schwieg; auf Zehenspitzen lief ich in den Wohnraum. Nur nicht laut werden, sagte ich mir. Mein Blick ging aus dem Fenster, über die Stadt. Da klingelte es, und ich verfluchte mich leise; die Frau, die mich im Sender angerufen hatte, ließ nicht locker.
Ein paar Momente lang blieb alles ruhig, ruhig bis auf meinen Atem. Dann hörte ich sie reden – es klang, als stünde sie schon in der Diele. Sie sei so lebendig, sagte sie, eine der lebendigsten Frauen überhaupt; ja viele wünschten ihr den Tod, so sprühe sie vor Leben!
Ich wandte den Kopf um – Von mir aus können Sie so lebendig sein, wie Sie wollen, nur gehen Sie jetzt wieder, das ist die falsche Adresse!
Es klingelte erneut, und sie rief mich beim Namen, sagte, ich sei am Ende – am Ende sind Sie, mein Lieber!
Und darauf kehrte ich langsam zur Diele zurück, jedes meiner alten Möbel berührend – ich sammele Einzelstücke, Solides in Kirsche und Ahorn. Dann das dritte Klingeln, zweimal kurz, wie ein verabredetes Zeichen, und meine Menschenkenntnis sagte mir, daß diese Frau auch äußerlich abstoßend wäre; doch etwas, das anders war als mein Ich, ließ mich das Gegenteil glauben. Ich streifte den Garderobenständer, es gab ein helles Geräusch: Wo Stock und Schirme hingehörten, waren meine Golfschläger abgestellt.
Wieder da? fragte sie durch die Tür.
Ich wollte schon ja rufen, aber da fragte sie, warum ich so anders als am Telefon sei, so ungeduldig …