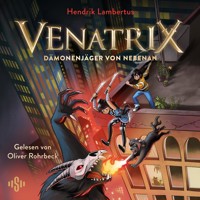9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Harz um 1470. Der Kupfer- und Silberbergbau, einst die Lebensader der Region, ist durch Pest, Kriege, Wassereinbrüche und Grubenunglücke fast zum Erliegen gekommen. Die Geschwister Cordt und Anna Fredemann tun alles, um die hoch verschuldete Grube ihres Vaters am Laufen zu halten. Als Cordt in einem alten Stollen einen vergessenen Klosterschatz entdeckt, beschließen sie, den Fund heimlich über die gefährlichen Stege des Oberharzes auszuführen, um mit dem Geld die Schulden zu tilgen. Doch Räuber lauern ihnen auf, und sie müssen ohne den Fund in den Wald flüchten. Ihre Zukunft scheint verloren, bis sie in einer alten Bergbau-Siedlung dem fremdländischen Alchemisten und Mineralogen Bartolomeo begegnen – der sie in das Geheimnis des Seigerverfahrens einweiht. Mit dieser neuen Einschmelz-Methode, mit der sich Silber aus Kupfererz gewinnen lässt, gibt es Hoffnung für die Grube. Nur ruft der Erfolg Neider auf den Plan. Und Bergbau ist ein gefährliches Geschäft. Über der Erde manchmal ebenso sehr wie unter Tage …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hendrik Lambertus
Feuer und Erz
Historischer Roman
Über dieses Buch
Zwei gegensätzliche Geschwister, ein gemeinsames Erbe. Und eine Entdeckung, die alles verändert.
Der Harz 1472. Der Kupfer- und Silberbergbau ist durch Pest, Kriege und Grubenunglücke fast zum Erliegen gekommen. Die Geschwister Cordt und Anna Fredemann tun alles, um die Grube ihres Vaters am Laufen zu halten.
Als Cordt in einem verlassenen Stollen einen Klosterschatz entdeckt, gibt es plötzlich Hoffnung. Gemeinsam beschließen sie, den Fund heimlich über die gefährlichen Stege des Oberharzes zu schaffen, um mit dem Geld die Schulden zu tilgen. Doch Räuber lauern ihnen auf und stehlen den Schatz. Die Zukunft ihrer Familie scheint verloren.
Bis sie in einer alten Bergbau-Siedlung dem fremdländischen Alchemisten und Mineralogen Bartolomeo begegnen – der sie in das Geheimnis des Seigerverfahrens einweiht. Diese Methode, mit der sich Silber aus Kupfererz gewinnen lässt, eröffnet endlich neue Wege für die Grube.
Nur ruft der Erfolg Neider auf den Plan. Denn Bergbau ist ein gefährliches Geschäft. Über der Erde manchmal ebenso sehr wie unter Tage …
Vita
Hendrik Lambertus wurde 1979 geboren und ist promovierter Skandinavist und Mediävist. Seit 2011 betreibt er als freiberuflicher Schreibcoach die Schreibwerkstatt «Satzweberei» und veröffentlichte Bücher in unterschiedlichen Genres. Nach «Das Erbe der Altendiecks» und «Der Zorn der Flut» erscheint mit «Feuer und Erz» sein dritter historischer Roman, in dem er sich einem hochinteressanten Thema widmet: dem Erzabbau im Mittelalter. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bremen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Sabine Biskup
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Hartwig Büttner/Edition LichtWerk; Shutterstock; Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER/picture alliance; Agricola De re metallica 1556–161.png © commons.wikimedia.org
ISBN 978-3-644-01749-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Den Bergleuten gewidmet. Glück auf!
Teil 1
1472
Erstes Kapitel
Cordt Fredemann stieg hinab in die Dunkelheit. Sprosse für Sprosse arbeitete er sich voran, während es um ihn herum immer wärmer wurde – bis ihn die Hitze schließlich umhüllte wie eine schwere wollene Decke. Ein brandiger Geruch drang ihm in die Nase, kratzte in seinen Nebenhöhlen und kroch tief in seine Lungen.
Die Hitze ließ ihn an die Erzählungen des Herrn Pfarrers von St. Johannis denken: über verlorene Seelen, die ins Höllenfeuer tief im Inneren der Erde stürzten. Doch Cordt konnte darüber nur schmunzeln. Denn die Tiefe des Berges barg keine Schrecken für ihn. Und er war auch nicht verloren, wenn er zu Wochenbeginn in die Hitze des Rammelsbergs einfuhr.
Für ihn war das vielmehr wie eine Heimkehr. In der schwarzen Tiefe unter seinen Füßen wartete jene Grube auf ihn, die seine Familie seit Generationen bewirtschaftete. Das Katzenloch. Seine Grube.
In einem Kreis aus flackerndem Licht bewegte Cordt sich durch die Dunkelheit, das kostbare Geschenk seines Geleuchts. Er hatte die Grubenlaterne an einer Öse an seinem Gürtel befestigt, denn er brauchte beide Arme auf der Fahrt, wie man jene Leitern nannte, die in die Grube hinabführten.
Wenn Cordt die linke Hand aufsetzte, fühlte er das Holz unter seinen Handflächen – fest und glatt gerieben von den zahlreichen Händen, die die Sprosse über die Jahre immer wieder umfasst hatten. Wenn hingegen die rechte Hand dran war, hallte ein metallisches Klacken durch den Schacht – denn Cordt besaß gar keine rechte Hand. Stattdessen ragte ein gekrümmter Haken aus Eisen aus dem ledernen Stulpen, der seinen Armstumpf bedeckte. Die Biegung des Hakens war so geformt, dass sie exakt in die Sprossen griff und ihm sicheren Halt bot. Sofern man in der Enge und Dunkelheit der Grube, viele Klafter tief unter der Flanke des Berges, überhaupt von Sicherheit sprechen konnte …
Cordt war stolz auf diese Konstruktion, die er selbst angefertigt hatte. Nun ja, zumindest stammten die Skizzen von ihm, die dann der alte Schmiedemeister Arnold, ein Freund von Vater, umgesetzt hatte. Cordt war ihm dabei zur Hand gegangen, so gut es eben mit seiner Linken möglich war. Zur Hand gehen … Es gab so viele Formulierungen, die ehrliche Arbeit mit dem Werk der Hände gleichsetzten!
Ärgerlich wischte Cordt den Gedanken beiseite. Im Berg war kein Raum für Grübeleien, hier musste jeder Schritt mit Bedacht gesetzt werden.
Und doch schweifte er heute immer wieder ab. Das lag gewiss daran, dass der Kaufmann Albrecht Botken diese Woche zu Vater ins Haus kommen würde, mit seinen verfluchten Schuldbriefen. Wenn die Erz-Ausbeute in der letzten Zeit nur nicht so mager gewesen wäre! Die Gedanken an Hölle und Verdammnis waren da doch gar nicht so abwegig.
Trotzig biss Cordt die Zähne zusammen. Genug mit dem finsteren Herumbrüten. Er war jemand, der etwas tat. Dinge verändern wollte. Und darum kämpfte er sich auch heute in die Grube hinunter, rastete geduldig seinen Haken in eine Sprosse nach der anderen ein. Es war mühsam, auf diese Art in die Grube einzufahren, und es dauerte gewiss mehr als doppelt so lange wie bei einem Mann mit zwei Händen. Auch seine Arme, Beine und Gelenke wurden so doppelt belastet, aber daran ließ sich nichts ändern.
Endlich erreichte Cordt einen Absatz, der mit hölzernen Stützen umkleidet war. Bislang hatte der Schacht senkrecht in den Berg hineingeführt – er verlief seiger, wie die Bergleute es nannten. Nun ging er tonnlägig weiter: im steilen Winkel schräg in den Berg hinein. Im Rammelsberg bei Goslar lagen die Erzschätze in ebendiesem Winkel unter dem Hang, und der Schacht folgte ihrem Verlauf.
Cordt setzte seinen Weg über Steigbäume fort – Baumstämme, in die man tiefe Kerben als Stufen geschlagen hatte – auf das flackernde Dämmerlicht zu, das vor ihm in der Tiefe glomm. Schließlich erreichte er ein kuppelartiges Gewölbe, das man mit großer Mühe ins Gestein getrieben hatte. Es war deutlich geräumiger, als es für die beengten Schächte und Strecken sonst üblich war.
Das lag daran, dass es als Hornstatt diente. Hier war eine große Haspel in den Fels eingelassen: eine hölzerne Seilwinde, die mit Muskelkraft über zwei Kurbeln an den Seiten betrieben wurde. Sie war dazu da, die hölzernen Förderkörbe voller Erzbruchstücke aus der Tiefe heraufzuziehen. Oben, an der Mündung des Katzenloch-Schachts, gab es eine weitere Haspel, die die Körbe dann bis ans Tageslicht hinaufbrachte. Die Grube war so tief in den Berg getrieben, dass ein einzelnes Hanfseil nicht mehr genügte, um bis an ihren Grund zu reichen. Daher diente diese Hornstatt als Umladeplatz für die Förderkörbe, eine umständliche und schweißtreibende Arbeit.
Vater erzählte manchmal davon, wie in den alten Tagen der Urgroßväter das Erz so dicht unter der Oberfläche gelegen hatte, dass man es direkt aus dem Hang schlagen konnte, ohne einen Schacht oder Stollen betreten zu müssen. Doch diese Zeiten waren lange vorbei, die oberen Erzschichten seit Generationen abgetragen. Wer jetzt noch Schätze aus dem Rammelsberg holen wollte, musste dafür immer weiter in die Tiefe vordringen. Bei dem Gedanken straffte Cordt sich entschlossen. Sie lebten fürwahr in mühsamen Tagen – doch das war kein Grund, die Arbeit nicht trotzdem aufzunehmen!
Beiläufig schaute er sich in der Hornstatt um. Die Hauer Jobst und Hinrik hatten heute Dienst an der Haspel. Gemeinsam hievten sie gerade kantige Erzbrocken aus dem Korb der unteren Seilwinde und luden sie in die obere um. Kienspan-Fackeln aus harzigem Holz, das mit nur wenig Rauch brannte, spendeten ihnen dabei schummriges Licht.
«Morgen», brummte Cordt ihnen zu.
Jobst schaute kurz auf und erwiderte den Gruß. Er war noch sehr jung und trotzdem schon lang wie eine Fichte, mit ochsenbreiten Schultern. Nicht gerade ein Vorteil in den engen Strecken des Berges, doch ideal für die schwere Arbeit an der Haspel. Er hatte ein offenes, freundliches Gesicht, und Cordt mochte ihn.
Hinrik hingegen ließ sich einige Herzschläge Zeit, ehe er ebenfalls ein «Morgen» murmelte. Sein Gesicht war vom Alter zerfurcht, die Hände rau und schwielig, doch noch immer voller Kraft. Es gehörte hier unten zu seinen Aufgaben, ein Auge auf Jobst zu haben, der noch wenig Erfahrung besaß und die Gefahren der Grube nicht annähernd gut genug kannte.
«Na, beehrt uns mal wieder der Sohn des Grubenmeisters?», knurrte er, ohne Cordt direkt anzuschauen. «Bisschen nach dem Rechten sehen, was?»
Unwillig verspannte sich Cordt. Der Sohn des Grubenmeisters … Hinrik hatte ihn nicht ohne Grund so genannt. Denn für ihn war Cordt nicht mehr als das: Er war kein Hauer, diese Arbeit blieb ihm mit nur einer Hand verwehrt. Er war auch kein Steiger, der die Aufsicht über die Arbeiten führte, denn dafür war er noch viel zu jung. Und schon gar nicht war er ein Schichtmeister, der für den Rat von Goslar die Verwaltung der Gruben betreute. In Hinriks Augen hatte er damit keine erwähnenswerte Funktion – sondern einfach nur das Glück, der Erstgeborene des alten Claus Fredemann zu sein. Für die Arbeit als vollwertiger Bergmann fehlte ihm eine Hand.
Und genau das ließ Hinrik ihn spüren. Für ihn hatte Cordt hier unten nichts verloren, in der dämmrigen Welt der Bergknappen, die ihr hartes Tagewerk mit ihren zwei Händen verrichteten.
«Ja, ich sehe nach dem Rechten», erwiderte er so beiläufig wie möglich. Doch er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme herausfordernd klang. Es war ihm noch nie leichtgefallen, seinen Zorn zu kontrollieren. «Wollen doch mal schauen, was die letzte Feuersetzung so gebracht hat.»
Hinrik knurrte etwas Unverständliches. Jobst hingegen schaute noch einmal auf. «Wie geht es eigentlich Eurem Vater, Meister Cordt?»
«Er wird wohl noch ein paar Tage im Bett brauchen», entgegnete Cordt vorsichtig, denn diese Schätzung war mehr als optimistisch. Vater hatte zwar inzwischen kein Fieber mehr, doch die Krankheit hatte ihn sichtlich ausgezehrt – daran konnten auch Mutters Gemüsesuppe und ihre beständigen Gebete nichts ändern. Es würde viel Zeit vergehen, bis er die Grube wieder selbst beaufsichtigen konnte. Doch die Bergknappen sollten sich nicht auch noch von Sorgen um ihren Grubenmeister ablenken lassen …
«Gebe Gott, dass Meister Claus rechtzeitig einen guten Nachfolger findet», brummte Hinrik am Förderkorb. «Sonst geht es mit unserem Katzenloch endgültig bergab.»
Das war gleich doppelt taktlos: nicht nur in Bezug auf Vaters Gesundheit, sondern auch auf Cordt – immerhin würde er der nächste Meister der Grube sein! Auch wenn das dem alten Hauer Hinrik offenbar nicht gefiel.
«Kümmere du dich mal um deine Arbeit!», erwiderte Cordt hitzig. «Und ich versehe meine Pflichten in der Grube.»
Er lächelte Jobst knapp zu, um ihm zu zeigen, dass sein Ärger nicht ihm galt. Dann wandte er sich ab und folgte der Schräge des Schachtes weiter in die Tiefe. Er wusste wohl, dass seine Reaktion weder besonders wortgewandt noch souverän gewesen war. Anna hätte ihn deswegen gewiss gescholten.
«Du trägst dein Herz zu sehr auf der Zunge, Cordt», hatte sie einmal zu ihm gesagt. «Du musst es nicht gleich jedem ins Gesicht sagen, wenn dir etwas nicht passt. Man kommt viel weiter, wenn man die Dinge in Ruhe beobachtet und dann besonnen und überlegt vorgeht …»
Er versuchte für gewöhnlich, diesen Rat zu beherzigen. Doch leicht fiel es ihm nicht – erst recht nicht, wenn man beständig seine Position hier unten in der Grube hinterfragte.
Entschlossen ging er weiter, und mit jedem Schritt wurde der brandige Geruch intensiver, als wäre er in einer Waldhütte, deren Rauchloch verstopft war. Neue Geräusche stiegen aus der Tiefe zu ihm empor: das widerhallende Klopfen von Schlägel und Bergeisen, unterlegt von hohl verzerrten Männerstimmen und gelegentlichem Rumpeln und Poltern. Das geschäftige Innenleben des Berges. Die Geräusche kamen nicht nur aus ihrem Katzenloch, sondern auch aus den anderen achtzehn Gruben des Rammelsbergs. Sie waren durch Strecken und Querschläge miteinander verbunden, obwohl sie verschiedene Eigentümer hatten. Das war notwendig für jene Arbeiten, die die Bergleute einer Grube allein nicht bewältigen konnten: Eindringendes Grubenwasser musste abgeleitet und kostbare Atemluft durch die Kunst der Bewetterung zugeführt werden. Gelegentlich waren an den Wänden der Gänge eingeritzte Markscheide-Zeichen zu sehen, die anzeigten, wo das Gebiet der einen Grube aufhörte und die andere begann.
Vater erzählte oft davon, dass es in älteren Tagen noch viel mehr und auch kleinere Gruben gegeben hatte. Doch das war früher gewesen, als der Bergbau geblüht hatte und die tiefsten Grubenbaue noch nicht mitsamt ihren Schätzen abgesoffen waren …
Endlich hatte Cordt den unteren Absatz des Schachtes erreicht. Vor ihm lag nun eine Strecke, die ebenerdig verlief. Er hielt kurz inne und löste sein Geleucht vom Tragriemen, um es vorsichtig in seinen eisernen Handhaken einzuhängen. Ein rascher Griff mit seiner Linken sorgte dafür, dass der Haken sich um die Öse der Lampe schloss. Darauf war Cordt besonders stolz: Sein Handersatz ließ sich verstellen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
Zufrieden betrachtete er die Lampe, die nun sicher am Haken hing. Es war ein guter Frosch, eine flache Öl-Laterne aus Ton, die ihren Namen daher hatte, dass ihre rundlichen Formen eben an einen hockenden Frosch erinnerten. Sie war gefüllt mit Unschlitt-Fett, das aus den Eingeweiden des Schlachtviehs gewonnen wurde, und ihr Docht brannte hell und gleichmäßig.
Für gewöhnlich wurden solche Frösche an der Grifftülle in der Hand getragen. Cordts Frosch war eine Spezialanfertigung mit einem eisernen Bügel für seinen Haken.
Er trug das Grubenlicht vor sich her, während er der engen Strecke durch den Berg folgte. Dann wichen die Wände vor Cordt auseinander, und er betrat die Weite der Grube: einen Hohlraum im Berg, den man direkt in das Erzvorkommen hineingetrieben hatte, um es Bröckchen für Bröckchen ans Tageslicht zu fördern. Diese Weite war das eigentliche Herz des Katzenlochs, der Ort, an dem gerade gearbeitet wurde. Wie der Thronsaal eines sagenhaften Zwergenkönigs erstreckte sich die Weite vor Cordt im Halbdunkeln, zuweilen von steinernen Säulen getragen, die man als Stützen stehen gelassen hatte.
Weiter hinten, am Ende der Weite, arbeiteten die Hauer im flackernden Licht der Kienfackeln: ein gutes halbes Dutzend Männer in derben Arbeitskitteln. Um die Hüfte hatten sie einen Gurt mit dem Bergleder geschlungen, einer Art Schürze, die hinten getragen wurde, um das Gesäß vor Nässe und Kälte zu bewahren – weshalb die Bergknappen sie meist passend als Arschleder bezeichneten. Die Köpfe wurden von Gugeln mit langen Kapuzenzipfeln geschützt. Lediglich Georg, der als Steiger die Aufsicht führte, trug statt der Gugel-Kapuze einen Hut mit Krempe.
Als Sohn des Grubenmeisters besaß auch Cordt das Vorrecht, seinen Stand durch einen üppigeren Hut herauszustellen. Doch er verzichtete nur zu gerne darauf und trug lieber eine Leder-Gugel über seinen schwarzen Haaren, so wie die einfachen Hauer es taten, denen er sich nun raschen Schrittes näherte.
Sie waren gerade dabei, die Erzbrocken zu zertrümmern, die als Geröllhaufen auf dem Boden der Weite verstreut lagen. Mit der Linken setzten sie ihr Bergeisen an, eine Art Meißel, aufgesteckt auf einen hölzernen Schaft. Mit der Rechten schwangen sie den Schlägel, einen kurzen Hammer, der immer wieder auf das stumpfe Ende des Eisens niedersauste, um dem Erz weitere Bröckchen abzuringen. Mit Schaufel und Kratze wurden die handlicheren Bruchstücke dann in einen Holztrog verfrachtet und zum Förderschacht geschleppt.
Bei der Arbeit sangen die Hauer, dass es dumpf durch den Berg hallte. Es war kein feierlicher Choral, wie Cordt es aus der Kirche kannte, und auch keines jener fremden Lieder, die reisende Gaukler manchmal nach Goslar mitbrachten. Sie sangen einen Bergreihen, eine muntere Melodie ohne Vorgaben, die sie sich gegenseitig zuwarfen und nach Lust und Laute weiterspannen, wie es sich eben gerade bei ihrer Arbeit ergab. Cordt mochte das, hatte es schon früher geliebt, als seine Stimme noch zu hoch zum Einreihen gewesen war. Die freie Musik der Bergleute erschien ihm lebendiger als jene, die mit Tinte auf Pergament festgeschrieben war.
Lächelnd trat er näher an die Arbeitenden heran. Mit der Linken löste er einen Lederriemen, den er über dem Rücken trug, und legte ihn auf dem Boden ab. Daran waren vier weitere Metallköpfe für die Bergeisen befestigt. Die Spitze des Werkzeugs nutzte sich schnell ab, und ein Hauer musste im Laufe der Schicht mehrmals ein neues Eisen auf den Schaft aufstecken. Cordt nahm darum immer einige frisch geschärfte Eisen aus der Bergschmiede mit, wenn er ins Katzenloch einfuhr.
Prüfend schaute er sich um – und hielt inne. Etwas war heute anders als sonst. Etwas, das er eigentlich erkennen sollte. Aber er konnte den Finger nicht darauflegen, was es war.
Der Steiger Georg hatte ihn inzwischen bemerkt. Er wandte sich zu Cordt um und begrüßte ihn mit einer knappen Verbeugung. Ein grauer, strähniger Bart umrahmte sein Gesicht, wie die Flechten, die von alten Bäumen des Harzgebirges herabhingen. Er wirkte durch und durch knorrig, der Rücken von Jahrzehnten der Arbeit gekrümmt, als wäre er selbst ein menschlicher Auswuchs des Felsbodens unter seinen Füßen.
«Nun? Wie ist die Ausbeute, Steiger?», fragte Cordt und versuchte, trotz seiner Irritation aufgeräumt zu klingen.
Der alte Georg musterte ihn aus seinen kleinen, graublauen Augen und machte eine vage Handbewegung. «Der Mensch nimmt, was der Berg zu geben bereit ist.»
Cordt unterdrückte ein Seufzen. Das konnte alles und gar nichts heißen! Nie war er sich sicher, woran er bei Georg war. Betrachtete ihn der stoische Steiger mit Widerwillen, so wie der alte Hinrik? Oder war Cordt ihm schlichtweg egal?
Er beschloss, sich ein eigenes Bild zu machen, und ließ seinen Blick über die Erzbrocken am Boden wandern. Sie stammten aus einer Einbuchtung in der Decke der Weite, die es noch nicht gegeben hatte, als Cordt in der vergangenen Woche hier unten gewesen war.
Die Erze unter dem Rammelsberg waren hart und eng miteinander verwachsen. Von alters her griffen die Menschen darum auf die schwer zu bändigende Macht des Feuers zurück, um ihnen zu Leibe zu rücken: Die Hauer hatten im Laufe der Woche harziges, gut brennbares Holz aus den umliegenden Wäldern in die Grube gebracht und auf einem eisernen Rost so hoch aufgestapelt, dass es bis zum First der Weite reichte. Am Samstag hatten sie den riesigen Haufen dann in Brand gesetzt. Während die Bergknappen am Sonntag in die Kirche strömten und ihren familiären Verrichtungen nachgingen, brannte das Feuer in der Tiefe des Berges, von unten belüftet durch den Eisenrost. Seine Hitze wirkte auf das Gestein ein und dehnte es aus, ließ Risse darin entstehen und sprengte es schließlich auf.
Am Montag brauchten sie nur zurückzukehren, um mit Schlägel und Eisen zu ernten, was das Feuer im Berg freigelegt hatte. Die drückende Hitze und der Rauchgeruch der Feuersetzung hingen noch immer in der Weite.
Cordt wischte sich den Schweiß von den Augenbrauen – und erstarrte. Nun wusste er, was heute anders war!
«Die Säule!», rief er unwillkürlich aus. «Ihr habt das Feuer an eine der Säulen gesetzt!»
Laut hallte seine Stimme in der Grube wider. Die Hauer blickten von ihrer Arbeit auf, die Melodie ihres Bergreihens geriet ins Stocken. Manche schauten fragend, andere missbilligend. Doch das war Cordt jetzt egal. Was hier auf dem Boden lag, waren nicht nur Erz-Bruchstücke aus Wänden und Decke. Es waren die Trümmer eines jener Pfeiler aus Gestein, die man einst bewusst hatte stehen lassen, um den First der Weite zu stützen!
Der alte Steiger Georg musterte Cordt ungerührt. «Ja», antwortete er ruhig. «Und die Ausbeute ist gut. Diese Säule barg einen Schatz in ihrem Kern, und wir haben ihn ihr entrissen.»
«Diese Säule hat vor allem die Decke getragen!», erwiderte Cordt.
Georg schaute beiläufig nach oben, als würde er prüfen, ob Regen aufzieht. «Bislang ist uns der Rammelsberg nicht auf den Kopf gefallen», meinte er trocken.
Lachend nahmen die Hauer ihre Arbeit wieder auf. Cordt trat unterdessen näher an Georg heran. «Die Schwestern der Säule haben ihre Arbeit mit übernommen», sagte er halblaut. «Aber trotzdem fehlt ihre Kraft über kurz oder lang. Damit habt ihr diese Weite zu einem gefährlicheren Ort gemacht, das weißt du.»
Der Steiger Georg erwiderte unbewegt seinen Blick. «Ich weiß das, und Ihr wisst das, junger Meister», sagte er. «Aber wir beide wissen auch, wie viel Erz Euer Vater Woche für Woche aus dem Katzenloch verlangt. Und irgendwo muss ich das hernehmen. Die Tiefe unter unseren Füßen ist ersoffen und verloren. Also braucht es andere Quellen.»
Unwillig runzelte Cordt die Stirn. Georg war ein erfahrener Steiger, dessen Urteil er vertraute. Deswegen schmerzten ihn die Worte umso mehr. Der Steiger ließ es so klingen, als sei Vater irgendein rücksichtsloser, geldgieriger Kaufmann aus der Stadt!
«Das Erz sichert uns allen das Überleben. Weniger Ausbeute würde dafür nicht genügen», presste er hervor und dachte dabei an Annas Rat: Nicht immer gleich den Zorn herausschreien …
«Ich weiß das, und Ihr wisst das», wiederholte Georg. «Und darum musste die Säule weg.»
Der Steiger wandte sich ab, um sich wieder um die Hauer zu kümmern – und runzelte plötzlich die Stirn.
«He, Til!», rief er mit besorgter Stimme über den Lärm der Schlägel hinweg. «Was machst du denn da?»
Til war der Zweitjüngste in der Schar der Bergknappen, gleich nach Jobst – ein drahtiger Kerl mit rotblondem Haar, das vorwitzig aus seiner Gugel hervorlugte. Gerade war er dabei, mit einer langen Stange in einem Riss in der Decke der Weite herumzustochern.
«Ich kümmere mich um den Spottvogel hier!», rief Til eifrig zurück. «Der will nicht so, wie ich das will …»
Spottvögel nannten die Bergleute Gesteinsbrocken, die sich beim Feuersetzen zwar gelockert hatten, sich aber nicht richtig aus dem Fels lösen ließen. Nun erkannte auch Cordt, dass der Riss in der Decke einen solchen Brocken umschloss, der halb herunterhing und halb feststeckte. Til warf sich mit seinem ganzen Gewicht auf die Stange, um den Felsen frei zu hebeln.
«Lass das mal lieber …», setzte der Steiger Georg an. Das Wort «bleiben» sollte er nicht mehr aussprechen.
Denn Til hatte Erfolg. Der Spottvogel löste sich tatsächlich aus der Decke – und mit ihm eine Lawine aus weiteren Brocken, die er bislang wie ein steinerner Korken zurückgehalten hatte.
Til schrie auf, seine Stange zersplitterte mit einem Knall. Dann war von ihm nichts mehr zu sehen. Ein ohrenbetäubendes Krachen und Rumpeln erfüllte die Grube, darunter hektische Rufe der Bergknappen. Der Gesteinsstaub raubte Cordt die Sicht, er stolperte zurück, während um ihn herum schattenhafte Gestalten durcheinandertaumelten und fortgeworfene Kienspanfackeln verglühten. Jemand rempelte ihn an.
Für einen Moment befürchtete er schon, dass die ganze verdammte Weite um sie herum einstürzte – das Ende des Katzenlochs!
Doch das geschah nicht. Das Gepolter verebbte, und einige Herzschläge später stand Cordt noch immer lebendig auf seinen Füßen. Kein Gestein krachte auf ihn herab, um ihn in der Tiefe des Berges zu begraben. Es knirschte und knackte zwar noch ringsum, aber das Schlimmste war vorbei.
Die staubige Luft drang in seine Lungen und ließ ihn husten. Wenigstens brannte die Flamme seines Frosches noch. Ein gutes Geleucht! Ohne nachzudenken, setzte er sich in Bewegung – dorthin, wo er den jungen Hauer Til zuletzt gesehen hatte –, doch er kam nicht weit. Schon nach wenigen Schritten versperrten ihm Schutt und Gestein den Weg, massiv aufgetürmt wie das teuflische Mauerwerk eines Berggeistes. Die gesamte hintere Ecke der Weite war in sich zusammengestürzt – genau der Bereich, den vor einer Woche noch die Säule gestützt hatte. Von Til dagegen war nicht einmal mehr eine Spitze seines rotblonden Haares zu sehen. Dafür entdeckte Cordt den Steiger Georg. Er lag vor der Einsturzstelle auf dem Rücken, ein Bein unter einem Felsbrocken eingeklemmt. Vermutlich hatte er versucht, Til noch zur Seite zu stoßen, als er das Unglück kommen sah. Der alte Steiger stöhnte vor Schmerzen.
«He!», rief Cordt in die Dunkelheit der Weite. «Ihr Hauer! Sofort alle herkommen!»
Seine Knie zitterten, sein Herz schlug so heftig wie der schwere Hammer in Meister Arnolds Werkstatt. Zugleich fühlte sich alles in ihm seltsam ruhig an. Irgendwo in der Tiefe gab es zwar Angst, Verzweiflung und Wut, wie Adern im Gestein der Bergflanke, doch da war auch eine seltsame Gewissheit. Cordt wusste, was zu tun war – und dass er nun die Verantwortung trug. Er war der Sohn des Grubenmeisters, das Katzenloch war seine Grube. Die Bergknappen waren seine Männer. Es lag an ihm, für sie zu sorgen und sie anzuleiten.
Schritte näherten sich von allen Seiten. Das waren nicht nur die Hauer des Katzenlochs. Auch in den benachbarten Gruben musste man das Unglück bemerkt haben, und die Hauer kamen von dort durch die verzweigten Quergänge herbei.
«Eilt euch!», rief Cordt. Als wenn sie das nicht auch so getan hätten … «Wir haben hier einen Verletzten zu transportieren!» Er schwieg kurz beklommen. «Und einen Toten zu bergen», ergänzte er dann. Der Herrgott meinte es in diesen Tagen wahrhaftig nicht gut mit dem Katzenloch – und mit dem ganzen Rammelsberg.
Zweites Kapitel
Das Bargedorp, wie die Leute das Bergdorf in der Mundart des Harzes nannten, drückte sich an die Hänge des Rammelsbergs. Nach Süden hin schlossen sich weitere Gipfel des Harzwaldes an, dicht bestanden mit ernsten, dunklen Tannen – das Reich murmelnder Waldgeister. In früheren Zeiten mochte auch der Rammelsberg so ausgesehen haben, doch die Menschen hatten ihn auf der Suche nach Erz schon vor Jahrhunderten gerodet und den Geistern der Wildnis entrissen. Nun wuchsen hier nur noch solche Pflanzen, die den Bergleuten an Zähigkeit und Überlebenswillen in nichts nachstanden: dornige Disteln und Ginster, Brombeergesträuch und seltsame Flechten, die den erzhaltigen Boden zu lieben schienen.
So kam es, dass Anna Fredemann einen freien Blick nach Norden hatte, während sie dem schlammigen Karrenpfad von den Gruben talwärts folgte. Die Luft war klar und kühl, und wenn man sie tief einatmete, schmeckte man schon das Versprechen des Frühlings darin. In das Tal unter ihr war träge und selbstzufrieden die freie Reichsstadt Goslar eingebettet, umgeben von festem Mauerwerk und überragt von den Türmen ihrer Kirchen. Anna mochte den Anblick. Die Stadt sah für sie aus wie eine gewaltige Kaiserkrone aus Stein, die irgendein urzeitlicher Hüne an den Nordhängen des Harzes abgelegt und vergessen hatte, mit den Türmen als Zacken und den dicht gedrängten Dächern als Samthaube in der Mitte.
Ihre Heimat, das Bargedorp, machte da einen weitaus weniger prächtigen Eindruck. Doch Anna wusste, dass der Schein trog. Denn das Bergdorf war älter als Goslar. Hier hatten die Menschen zuerst gesiedelt, als sie vor vielen Hundert Jahren auf die Schätze des Rammelsbergs gestoßen waren. Die Stadt mit ihrer ganzen Üppigkeit war erst danach gewachsen, genährt vom Fleiß der Bergleute, wie Annas Vater gerne betonte. Auch dass die alten Kaiser schließlich sogar eine ihrer Pfalzen nach Goslar verlegt und die Stadt mit allerlei Rechten beschenkt hatten, verdankte sie nur dem Reichtum an Silber, Kupfer und Blei – und somit der Arbeit mit Schlägel und Bergeisen in den Gruben, den krumm geschufteten Buckeln der Menschen vom Bargedorp.
Bei der Vorstellung musste Anna lächeln. Sie konnte regelrecht hören, wie Vater das bei dem einen oder anderen Krug Gose-Bier in aller Umständlichkeit ausführte. Mal mit einem gutmütig-ironischen Unterton den Städtern im Tal gegenüber und mal mit Ernst und Grimm. Je nachdem, in welchem Maße er gerade über den Rat von Goslar und seine Berggesetze verärgert war.
Doch ihr Lächeln erstarrte, als sie an seinen derzeitigen Zustand dachte, der sich einfach nicht bessern wollte. Ein krampfhafter, bellender Husten hatte wie ein Aufhock-Geist Besitz von ihm ergriffen und ließ ihn nicht mehr los. Mochte der Herrgott geben, dass dem alten Grubenmeister Claus Fredemann noch viele Tage unter dem hellen Sonnenlicht bleiben würden. Unwillkürlich beschleunigte Anna ihre Schritte, als käme es auf jeden einzelnen, kostbaren Augenblick an.
Sie trug eine Kiepe auf dem Rücken, ein gewohnter Anblick auf den Pfaden des Rammelsbergs. Viele Frauen waren hier mit solch einem Tragekorb unterwegs, zumeist hoch beladen mit Brennholz, das sie in den umliegenden Wäldern gesammelt hatten. Oftmals folgte ihnen dabei eine Schar von Kindern, die ihre eigene Last aus Tannenzapfen und Reisig in Körben auf dem Kopf trugen, im Sommer manchmal auch süße Waldfrüchte, die sie unten in der Stadt verkauften.
Die älteren Kiepenfrauen wirkten dabei so, als seien sie fest mit ihrer Last verwachsen – ein hölzerner Buckel, der zu einem Teil von ihnen geworden war, während sie sich in jenem schwankenden Rhythmus voranbewegten, den ihre Muskeln sich im Laufe der Jahre unter der Kiepe angewöhnt hatten, gestützt auf einen knotigen Stecken.
Anna hingegen war jung und von kräftiger Statur, ihr Rücken ungebeugt. Zudem enthielt ihre Kiepe kein Brennholz, sondern leichtere Schätze: einen Laib warmes Brot, einen Tontopf mit Getreidegrütze und einen Krug Bier, alles sorgfältig mit einer Decke geschützt. Sie kam gerade von den Kammern, den hölzernen Hütten und Verschlägen, die sich oberirdisch über den Gruben am Rammelsberg dahinzogen. Hier wurde das Erz sortiert und gewaschen. Schuppen dienten zur Aufbewahrung des Gezähes, wie die Werkzeuge der Bergknappen genannt wurden, in Bergschmieden wurden sie nachgeschärft und repariert. Doch in den Kammern wurden auch Bier und Speisen an die Handwerker, Bergleute und helfenden Knechte ausgegeben.
Zusammen mit Grete und Barbara, zwei Töchtern von Hauern in ihrem Alter, hatte sie den größten Teil des Tages damit zugebracht, die hungrigen und vor allem durstigen Arbeiter zu versorgen. Sie hatte sich auf ihre rauen Scherze eingelassen und deutliche Grenzen gesetzt, wenn irgendein junger Kerl gar zu dreist wurde. Das hatte sie schon immer gut gekonnt: sich Respekt verschaffen. Es war gar nicht so schwierig; man musste nur für jeden Menschen die passenden Worte finden, die ihn wie ein geschickt angesetzter Hebel zu bewegen vermochten. Das half selbst bei den knorrigsten Erzbrocken, mochten sie auch menschliche Gestalt haben.
Am Ende ihrer Schicht hatte sie für Vater einige gute Sachen aus der Bier-Kammer zusammengepackt und sich auf den Weg gemacht. Mutter hatte gerade schon genug damit zu tun, ihn zu pflegen, und sollte sich nicht auch noch um die Küche kümmern. Doch wenn Anna ehrlich zu sich war, dann war das nicht der einzige Grund.
Dem Katzenloch, der Grube ihrer Familie, ging es nicht gut. Und das galt auch für ihre Silbertruhe, für ihre Küche und letzten Endes für ihre Mägen. Sie konnten es sich schlichtweg nicht zu oft leisten, Fleisch, Kraut und andere gute Sachen aus der Stadt zu kaufen. Also war sie dankbar, wenn sie etwas von der Verpflegung mit nach Hause nehmen konnte, die eigentlich für die Hauer und Knechte am Berg gedacht war.
Sie folgte jenem Weg, den man die Grünestraße nannte, vorbei an einigen kleinen Bauernhöfen. Dann passierte sie auch schon den Durchgang in der Knicke, der hohen und dicht verwachsenen Dornenhecke, die die äußere Befestigung des Bergdorfs bildete. Es hatte keine eigene Stadtmauer wie das stolze Goslar, war aber in das Landwehr-System aus Gräben, Erdwällen und Heckenwerk eingebunden, das die weitere Umgebung der Stadt beschirmte.
Hinter der Knicke lagen einige Straßenzüge mit niedrigen Häusern aus Lehmfachwerk, die sich gedrungen aneinanderschmiegten – die Buden der einfachen Bergknappen. Dieser Teil des Bergdorfs war selbst in den alten Tagen des blühenden Bergbaus nicht gerade mit Reichtum gesegnet gewesen, und heute sah es umso schlimmer aus. Viele der Buden waren schlecht instandgehalten, mit herausbrechendem Lehmverputz, andere standen gar leer oder dienten als Ziegenställe. Die Leute waren abgewandert, nachdem die Schätze des Berges ersoffen waren. Manche hatte es sogar bis ins Erzgebirge gezogen, wo der Silberbergbau blühte.
Anna beeilte sich, diesen Teil des Dorfes hinter sich zu lassen. Sie hielt auf die doppelte Turmspitze von St. Johannis zu, die alle Dächer überragte. Die Kirche war mit ihrer Apsis nach Osten ausgerichtet, in die Richtung des Heiligen Landes, und sie brauchte sich nicht hinter den Stadtkirchen von Goslar zu verstecken. Nicht viele Dörfer konnten sich solch einer großen Kirche rühmen, weder in den Tälern des Harzes noch auf dem flachen Land, das sich nordwärts in Richtung der Herzogsstadt Wolfenbüttel erstreckte. St. Johannis kündete sowohl vom Reichtum der alten Gruben als auch von der Gottesfurcht der Bergleute, die ihr Leben Tag für Tag den höheren Mächten anvertrauten, wenn sie in die Tiefe des Berges fuhren.
Eine wuchtige Mauer aus Feldsteinen umgab das Gelände der Kirche, bewehrt mit zwei gedrungenen Wachtürmen. Das Ganze glich einer winzigen Burg, eine schützende Zuflucht für die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes. Ringsum drängten sich einige größere Wohnhäuser, die ebenfalls aus Stein errichtet waren: die Kemenaten der Bergherrenfamilien, denen die Rammelsberg-Gruben gehörten.
So war das jedenfalls früher gewesen … Inzwischen waren die Fredemanns die einzige Familie, die immer noch in ihrer Grube arbeitete und ihr Stammhaus im Bergdorf hatte. Die anderen Gruben gehörten anteilig reichen Kaufleuten aus Goslar, die Lohnarbeiter für sich schuften ließen und in großen Häusern in der Stadt lebten. Oder sie befanden sich im Besitz von Gewerken von außerhalb wie dem Bischof von Hildesheim oder dem Rat der fernen Salzstadt Lüneburg, die im Laufe der wechselvollen Geschichte des Rammelsbergs Anteile daran erworben hatten.
In Gedanken versunken, bog Anna um die Ecke der Fredemann’schen Kemenate – und erstarrte. Zwei kräftige, wohlgenährte Pferde waren vor dem Haus angebunden. Die gehörten gewiss nicht ihrer Familie! Und wohlhabende Besucher bedeuteten selten etwas Gutes …
Misstrauisch näherte sie sich dem Haus über den Hof. Jutte, die alte Magd, war gerade dabei, die Hühner zu versorgen. Anna warf ihr einen fragenden Blick zu.
«Botken ist da», raunte Jutte mit einem bedeutungsvollen Blick. «Er hat seinen Sohn mitgebracht. Hat einen neuen Hut mit breiter Krempe, sieht sündhaft teuer aus.»
Anna nickte grimmig. Das Einzige, was noch unerfreulicher war als der Besuch eines Botkens, war eine Gelegenheit, bei der zwei Träger dieses Namens auftauchten.
«Hat meine Mutter sie nicht weggeschickt?», erwiderte sie mit einem flauen Gefühl im Bauch. «Vater geht es doch nicht gut.»
«Er sitzt trotzdem mit den Botkens zusammen», berichtete Jutte. «Wenn der sich dabei mal nicht den Tod holt! Und ein Huhn soll ich auch schlachten, die bleiben wohl länger. Wissen nicht, wohin mit ihrem Silber, aber fressen uns die Haare vom Kopf … So sind sie, die Kaufleute! Ich sage ja immer …»
Anna eilte weiter. Jutte redete gerne und viel, und für gewöhnlich war ihr Gerede eine wertvolle Informationsquelle. Doch gerade hatte Anna nicht den Nerv, ihr zuzuhören. Sie ging ins Haus und stellte die Kiepe an der Treppe zum Vorratskeller ab. Aus der Wohnstube war eine Stimme zu hören, dominant und verbindlich. Das war nicht Vater, der da sprach.
Anna strich entschlossen ihr Schürzenkleid glatt und betrat die Stube. Kühl war es in dem steinumschlossenen Raum. Die Kemenate besaß eigentlich eine Heizung, die vom Hof aus befeuert wurde, doch jetzt, im Frühjahr, blieb sie aus. Die Familie hielt sich ohnehin zumeist rund um den Herd in der Küche auf, und Brennholz war wertvoll.
Entsprechend hatte Vater sich eine Wolldecke über die Beine geworfen. Der Grubenmeister Claus Fredemann saß im hochlehnigen Stuhl des Hausherrn am Tisch. Er war ein kleiner, stämmiger Mann, dem man auch im hohen Alter noch ansah, dass seine Arme einst große Kraft besessen hatten. Doch nun hing seine Haut schlaff von den Knochen, als wäre sie zu groß für seinen greisen Körper, und seine Wangen wirkten hohl und eingefallen. Anna erschrak bei dem Anblick. Im Sitzen wurde noch deutlicher, wie kraftlos er war! Mit beiden Händen umklammerte er die Armlehnen, den Mund entschlossen zu einem Strich zusammengepresst, während ein einzelner Schweißtropfen auf seiner Stirn glänzte. Er schien seine ganze Willenskraft darauf zu verwenden, sich aufrecht zu halten – und wirkte doch wie eine zusammengesackte Stoffpuppe, die ein Kind auf den Thron des Kaisers gesetzt hatte.
Ihm gegenüber saß der Kaufmann Albrecht Botken – breitschultrig und stattlich, mit einem lockigen Vollbart, der ihm weit auf die Brust fiel. Er trug einen langen, blau gefärbten Tappert-Mantel mit geschlitzten Ärmeln, der den Eindruck von Massigkeit noch unterstrich, denn er bestand aus geradezu unverschämt viel Stoff – ein überdeutliches Zeichen von Botkens Reichtum.
Sixtus Botken, sein Sohn, war dagegen ziemlich dürr und fast schon das Gegenteil des Vaters. Die blonden Locken, die unter seinem Hut hervorquollen, erinnerten zumindest vage an dessen Bart. Auch er trug einen voluminösen Tappert, doch während Albrecht Botken das Kleidungsstück raumeinnehmend ausfüllte, schien Sixtus in den wogenden Stoffbahnen zu verschwinden. Er hielt sich kerzengerade, offenbar angestrengt darum bemüht, ebenso streng und würdevoll auszusehen. Ansonsten gab es für ihn nichts zu tun, denn sein Vater übernahm das Reden.
«… und so müsst Ihr doch einsehen, mein guter Meister Fredemann, dass mein Angebot zu unser aller Vorteil ist!», führte dieser gerade aus, und seine Prankenhände gestikulierten lebhaft.
Vater kniff die grauen Lippen noch fester zusammen. Seine Antwort war weitaus weniger wortreich: «Nein.»
Dann erschütterte ein krächzendes Husten seinen Körper. Sixtus seufzte entnervt, offenbar langweilte ihn der Disput. Er griff nach der Tonkanne, die zwischen den Männern auf dem Tisch stand, um sich Bier nachzuschenken. Mutter musste sie dort abgestellt und sich dann in die Küche zurückgezogen haben. Anna runzelte die Stirn. Es war nicht recht, dass Vater diese Sache allein durchstehen musste!
Entschlossen trat sie an den Tisch und beugte sich zur Kanne, als wollte sie sich vergewissern, dass noch genug zu trinken für alle da war. Vater nickte ihr schwach zu, während er mit seinem Husten kämpfte. Albrecht Botken ignorierte sie. Sixtus hingegen schaute auf und fixierte sie mit seinen kleinen, wasserblauen Augen.
«Ihr könnt doch zu solch einem Angebot nicht einfach nur Nein sagen», empörte sich der alte Botken in einem jovialen Tonfall, der etwas aufgesetzt klang. «Ist Euch bewusst, wie sehr ich Euch dabei entgegenkomme? Schaut: Der Rat der Stadt Goslar legt gerade alles daran, den Rammelsberg-Bergbau möglichst komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Wo immer er kann, setzt er verdiente Bürger als Gewerken ein, die ihren Grubenanteil zum Wohle der Stadt verwalten. Ihr seid der Letzte, der seine Grube noch mit eigenen Händen auf eigene Rechnung bewirtschaftet. Das wird sich nicht mehr lange tragen. Die Zeiten ändern sich! Wenn Ihr jetzt verkauft, kann ich Euch günstige Konditionen …»
Anna räusperte sich. «Eines frage ich mich: Wenn der Rat die Gruben-Lehen an besonders verdiente Bürger vergeben hat – warum habt Ihr keines erhalten, Meister Botken?»
Sie sagte das im Tonfall freundlichen Interesses. Doch sie wusste genau, dass sie damit einen wunden Punkt traf. Anna hatte gewisse Quellen in der Stadt, mit denen sie darüber gesprochen hatte. Als der Rat im vergangenen Jahr die Gruben-Anteile neu an Goslarer Bürger vergeben hatte, war Botken daran äußerst interessiert gewesen – doch er war von seinen zahlungskräftigen Konkurrenten aus der Kaufmanns- und Krämergilde ausgestochen worden. Das erklärte wohl auch sein Interesse am Katzenloch … Der Rat hatte den Rammelsberg wie einen riesigen Kuchen angeschnitten und aufgeteilt, und Botken verlangte sein Stück.
Albrecht Botken starrte sie verblüfft an, als würde es ihn wundern, dass sie überhaupt sprechen konnte. Er vergaß sogar, sich über ihre Spitze zu ärgern! Sein Sohn Sixtus verzog merkwürdig die Mundwinkel. Offenbar wusste er nicht so recht, ob er grinsen oder sich beleidigt fühlen sollte.
«Es ist gut, Anna», brummte Vater mit einem warnenden Blick zu ihr. Sie nickte gehorsam und trat einen Schritt beiseite, jedoch ohne die Männer am Tisch aus den Augen zu lassen.
Sie hatte schon als kleines Mädchen gelernt, dass das die beste Taktik war: folgsam nicken – und dann doch machen, was man wollte. So kam eine Frau zu ihrem Recht.
«Der Rat hat uns als Lehenshalter des Katzenlochs bestätigt», sagte Vater fest, doch wieder mischte sich ein Husten in seine Stimme. «Die Grube ernährt die Fredemanns und ihre Bergknappen seit langer Zeit und wird sie weiter ernähren.»
«Ihr wisst selbst, wie es um den Bergbau und Eure Grube steht», knurrte Albrecht Botken halb verächtlich und halb gönnerhaft.
«Seit der Meister von Gotha seine Heinzenkunst konstruiert hat, geht es wieder aufwärts», erwiderte Vater.
Daran konnte Anna sich noch erinnern: Als Kinder hatten Cordt und sie staunend verfolgt, wie der geschickte Mechanikus mit seinen Kunstknechten im Auftrag des Rates das große hölzerne Wasserrad gebaut hatte. Es trieb eine Endlos-Kette von offenen Lederbällen an. Sie fuhren in die Tiefe, tauchten dort ins Grubenwasser ein und schöpften es hinauf in den Abfluss-Stollen, ein Ball nach dem anderen ohne Rast oder Unterbrechungen – fleißiger und gewissenhafter, als hundert menschliche Wasserknechte es gekonnt hätten. Die Heinzenkunst hatte einen Teil der tieferen Grubenbaue nach langen Jahrzehnten wieder zugänglich gemacht und das Interesse am Bergbau neu belebt.
Albrecht Botken knurrte unwillig.
«Die Bereiche in der größten Tiefe sind immer noch ersoffen», stellte er fest. «Und die Grube nährt Euch nur kümmerlich. Sie mir zu überschreiben, ist das Klügste, was Ihr tun könnt, Fredemann.»
Anna trat wieder an den Tisch heran und griff nach der halb leeren Bierkanne, als wäre es dringend nötig, sie nachzufüllen.
«Und noch eines frage ich mich», sagte sie beiläufig. «Wenn der Bergbau so kümmerlich vor sich hin darbt, wie Ihr behauptet, Meister Botken, und auch menschliche Kunstfertigkeit keine Besserung bringen wird: Was wollt Ihr dann überhaupt mit dem Katzenloch anfangen? Eure Worte und Euer Interesse passen nicht zusammen.»
Sie zog die Kanne vom Tisch, so wie sie gleichsam den Boden unter Botkens Argumenten wegzog. Dieser schnaubte erbost, und Sixtus funkelte sie nun wütend an. Offenbar hatte er sich für das Beleidigt-Sein entschieden.
«Meine Tochter hat eine freche Zunge, aber sie hat auch recht», sagte Vater leise, der seinen Husten inzwischen bezwungen hatte. «Ihr wollt die Grube nicht aus Gutherzigkeit kaufen, Meister Botken. Meine Antwort bleibt, wie sie ist: nein.»
Anna nickte dazu, während sie sich langsam mit der Kanne entfernte. Es war, weiß Gott, gerade schwierig genug mit dem Katzenloch – aber Aufgeben kam nicht infrage!
Ein dumpfer Knall ließ sie zusammenzucken. Albrecht Botken hatte seine mächtige Pranke auf den Tisch geschlagen, dass die Bierkrüge hochsprangen. Alle joviale Freundlichkeit war aus seinem Gesicht verschwunden, stattdessen zeigten sich nun rote Flecken, wo der Bart seine Wangen nicht bedeckte.
«Fredemann, ich bin nicht in Euer Haus gekommen, um mich verspotten zu lassen!», bellte er. «Ich habe es im Guten versucht, aber ich kann auch anders. Ihr habt Schulden, Fredemann, das weiß ich wohl. Die Grube wächst Euch allmählich über den Kopf. Ich kenne einige Eurer Schuldner recht gut, und sie wären gewiss bereit, die Schuldbriefe an mich zu verkaufen. Dann habe ich Euch in der Hand und kann Euch vor die Tür jagen, mitsamt Eurer missratenen Tochter und dem Rest Eurer Familie. Also nehmt besser mein Angebot an, bevor es zu spät ist!»
Mit jedem Wort hatte er sich etwas mehr erhoben und ragte nun wie ein bedrohlicher Riese über Vater auf. Dieser erwiderte trotzig seinen Blick und stemmte sich ebenfalls aus seinem Stuhl hoch – um kraftlos wieder zurückzusinken. Ein mattes Stöhnen entwich seinem Mund.
«Fredemann!», polterte Albrecht Botken. «Ich erwarte Eure Antwort!»
Das war zu viel! Anna wirbelte herum, knallte die Kanne wieder auf den Tisch und schob sich zwischen Vater und den Kaufmann.
«Seht Ihr nicht, dass es ihm nicht gut geht?», rief sie aufgebracht. «Er hätte dieses Gespräch gar nicht führen dürfen, in seinem Zustand. Wollt Ihr ihn ins Grab bringen? Was seid Ihr für ein Christenmensch?»
Botken ballte die Fäuste. Offenbar war er keine Widerworte gewohnt. Vater murmelte etwas, aber er war so schwach, dass man es kaum verstand.
«Mein Vater braucht jetzt Ruhe», erklärte Anna und starrte Botken in die grünblauen Augen. «Bitte geht nun. Geht!»
Der Kaufmann erwiderte finster ihren Blick. Eine Ader pochte an seiner Schläfe. Für einen Moment war sie sich sicher, dass er sie schlagen würde. Doch dann berührte Sixtus seinen Vater leicht an der Schulter.
«Komm», sagte er leise. «Wir sind hier nicht erwünscht.»
Albrecht riss sich abrupt von ihm los und fuhr herum. Sixtus zuckte zusammen, zog unwillkürlich den Kopf ein. Sein Vater funkelte ihn an – und polterte wortlos aus dem Raum. Sixtus folgte ihm mit hängenden Schultern. An der Tür blieb er kurz stehen und warf einen Blick zurück. Eindringlich fixierte er Anna, als wäre sie ein Insekt, das er am liebsten zerpflückt hätte, um es genau zu untersuchen. Dieser bohrende Blick war ja noch schlimmer als Albrechts Gepolter …
«Ihr wisst, dass die Grube nicht genug abwirft», sagte Sixtus leise.
«Raus», zischte Anna eisig. Sie warf einen raschen Blick zur Küchentür, die einen Spaltbreit offen stand. Natürlich hatte Mutter alles von dort aus verfolgt und würde sich nun um Vater kümmern. Gut. Denn sie selbst musste sicherstellen, dass die Botkens wirklich verschwanden und so bald nicht wiederkamen!
Sie folgte den beiden Männern auf den Hof, wo Jutte ihnen hinterherstarrte. Während Albrecht und Sixtus ihre Pferde losbanden, stand Anna mit verschränkten Armen an der Hausecke, ein unmissverständliches Zeichen, dass sie hier nicht länger willkommen waren.
Als Albrecht Botken schon im Sattel saß, näherten sich plötzlich rasche Fußschritte aus der Richtung der Gruben. Anna schaute auf und sah, dass der kleine Kunz die Straße entlanggerannt kam. Er war keine vierzehn Jahre alt und gehörte zu den Bergjungen, die über Tage bei der Erzwäsche arbeiteten und noch nicht in die Grube fuhren. Sein schmutziges Gesicht war rot vor Anstrengung, er musste den ganzen Weg den Berg herabgerannt sein.
«Frau Anna», keuchte er, als er sie sah. Anna runzelte die Stirn. So wurde sie nicht oft angesprochen, aber Kunz kannte sie nicht sehr gut und sah in ihr vor allem die höhergestellte Tochter eines Bergherren. «Frau Anna, ich muss sofort zum Grubenmeister!»
«Dem geht es nicht gut», erwiderte Anna, während sich ein kalter Klumpen wie ein Erzbrocken in ihrem Bauch zusammenballte. «Was ist denn los?»
«Es gab eine Tretung», erklärte Kunz atemlos. «Eine Tretung im Katzenloch!»
Tretung … Das war ein schreckliches Wort, das jeder fürchtete. So nannte man es, wenn ein Teil der Grubendecke einbrach – und alles begrub, was sich darunter befand. Anna erstarrte.
«Cordt?», fragte sie beklommen.
«Euer Bruder ist nicht verletzt», erwiderte Kunz, und grenzenlose Erleichterung breitete sich in Anna aus. «Aber der Steiger Georg! Und der Hauer Til Druden ist tot.»
Die Erleichterung – welch ein selbstsüchtiges Gefühl! – schlug in Entsetzen um. Der Berg hatte ein weiteres Opfer gefordert. Til. Er war noch so jung gewesen, immer mit einem frechen Grinsen auf den Lippen. Der Bruder von Barbara. Anna hatte gerade erst an ihrer Seite in der Bier-Kammer gearbeitet. Unwillkürlich verkrampfte sie ihre Hände ineinander, als könnte sie sich an sich selbst festhalten.
«Da seht Ihr es», sagte eine näselnde Stimme. Abrupt schaute Anna auf. Die Botkens waren immer noch da und hatten alles mitbekommen. Vom Sattel aus schaute Sixtus auf sie herab. «Ihr könnt die Sicherheit Eurer Leute mit Euren Mitteln nicht länger gewährleisten», erklärte er, als würde er mit einem kleinen Kind reden. «Wenn sie durch Euren Trotz zu Schaden kommen, seid Ihr dafür verantwortlich.»
«Ach, reitet doch zur Hölle», zischte Anna, und Sixtus trieb grußlos sein Pferd an. In ihr Entsetzen mischte sich kalte Wut. Wut über diesen Kerl, der es wagte, das schreckliche Ereignis für seine Zwecke einzuspannen! Doch wenn sie ehrlich war, war es auch Wut darüber, dass er nicht ganz unrecht hatte. Wie lange konnten sie das Katzenloch noch betreiben, ehe alles in sich zusammenbrach?
Drittes Kapitel
Als Barbara Druden vom Tod ihres Bruders Til in den Tiefen der Katzenloch-Grube erfuhr, sagte sie nichts. Auch als sie aus der Bergmanns-Bude ihrer Familie rannte, vorbei an den Ziegen auf den Straßen des Bargedorps und über die kahlen Hänge des Rammelsbergs, entschlüpfte ihr kein einziges Wort.
Schließlich erreichte sie jenen Stollen oberhalb des Dorfes, aus dem ein Rinnsal aus der Flanke des Berges trat und durch Röhren ins Tal geführt wurde – die Wasserzisterne der Siedlung. Sie stolperte hinein und ließ sich auf den kalten, feuchten Felsenboden fallen, als könnte sie sich im Schatten des Berges vor der schrecklichen Wahrheit verstecken.
Und hier – endlich! – löste sich ein Laut aus ihrer Kehle. Barbara Druden begann zu singen. Es war ein Lied ohne Worte, eine Aufreihung von klagenden Lauten, geformt zu einer Melodie, die aus ihrem Inneren entsprang wie das Wasser aus dem Schatten des Berges. Verzerrt hallte es im Bergedorfer Stollen wider, als würden die Geister der Tiefe mit ihr singen.
Barbara wusste natürlich, dass Gesang keine angemessene Reaktion auf eine Todesnachricht war, gar auf den Tod des eigenen Bruders! Aber so war das eben bei ihr, so war es schon immer gewesen. Was sich in ihr an Gefühlen aufstaute, brach früher oder später als Lied hervor – sei es die schlichte Freude über einen schönen Sommertag oder das Undenkbare, unbegreiflich Schreckliche, das man nicht in Worte fassen konnte.
Sie sang weiter und immer weiter, während ihr Tränen über die Wangen liefen und ihre Stimme brach. Sie sang von Til, ihrem frechen, wunderbaren Bruder, und davon, dass er unmöglich fort sein konnte. Sang von ihrer kleinen Schwester Els, die Tils rötliche Haare hatte, und von ihrem Bruder Volkmar, der noch viel zu jung für die Arbeit in der Grube war, von ihrer altersschwachen Mutter, ihrem toten Vater, ihrer halb verfallenen Bude und der Not, die nun über alle kommen würde, die sie liebte.
So sang Barbara Druden im Schatten des Stollens und kam erst wieder hervor, als ihre Kehle so trocken war, dass keine Laute mehr herauskommen wollten. Der Abend hatte sich inzwischen über diesen Tag gesenkt, der ganz gewöhnlich begonnen und so schrecklich geendet hatte. Til war in die Grube eingefahren und nicht wiedergekehrt, würde niemals wiederkehren.
Erschöpft machte Barbara sich auf den Weg nach Hause. Sie wusste, dass sie dort gebraucht wurde, nun dringender denn je. Schließlich war sie die Älteste und hatte Mutter und die Geschwister mit dem Unaussprechlichen allein gelassen. Das beschämte sie, doch zugleich wusste sie, dass sie keine andere Wahl gehabt hatte. Dieses Lied, Tils Lied, hätte sie zerrissen, wenn sie es nicht herausgelassen hätte.
Sein Lied begleitete sie auch während der nächsten Tage, in denen die Welt in grotesker Normalität weiterlief und doch nichts mehr so war wie vorher. Die Bude ihrer Familie umfasste nur einen Raum, in dem sich ihr ganzes Leben abspielte. Sie kannte es nicht anders, und trotzdem fühlte sich alles plötzlich furchtbar eng an, obwohl doch Til fehlte und sein Schlaflager nun leer und unbenutzt dalag.
Sein Lied kreiste die ganze Zeit in ihrem Kopf herum, als sie sich um alles kümmerte, was getan werden musste. Manchmal fand es auch seinen Weg als leises Summen über ihre Lippen. Selbst unterwegs zur St.-Johannis-Kirche begleitete es sie, am Tag von Tils letztem Weg, seiner Beerdigung.
Zahlreiche Kerzen beleuchteten das Schiff der Kirche mit ernster Feierlichkeit. Die Bergknappen des Katzenlochs waren geschlossen in ihrer dunklen Tracht erschienen, auch der Steiger Georg, der sich beim Gehen auf einen Krückstock stützte und den Blick gesenkt hielt. Zusammen mit ihren Familien nahmen sie die vorderen Bänke ein, während sich die Leute der anderen Gruben weiter hinten hielten. Tils Leichnam ruhte auf einer hölzernen Bahre vor dem Hochaltar mit dem Kreuz des Herrn. Man hatte ihn in weiße, saubere Tücher gehüllt, die seine schweren Verletzungen gnädig verbargen. Das war seine Ausstattung für die Fahrt in die Ewigkeit – ein Sarg aus Holz oder gar Stein war etwas für reiche Leute.
Der alte Pater Berchtold hielt die Totenmesse für Til. Mit routinierter Eindringlichkeit bat er um die Vergebung seiner Sünden. Das gehörte oft zu seinen Pflichten, denn es kam immer wieder vor, dass Bergleute in der Grube unverhofft und ohne den reinigenden Segen der Sterbesakramente ums Leben kamen.
Barbara ließ die Messe mit steinernem Gesicht und einem klammen Gefühl im Bauch über sich ergehen. Das alles hatte nichts mit dem Til zu tun, den sie gekannt und geliebt hatte. Dem Til, dessen Lied nun in ihrem Hinterkopf herumspukte.
Immer wieder wanderte ihr Blick zu dem Nebenaltar im Seitenschiff der Kirche. Dort stand die heilige Barbara, ihre Namenspatronin, als hölzerne Figur, mit einem kleinen Turm in den Händen, den Kopf huldvoll geneigt. Sie war die Nothelferin gegen die plötzliche Todesgefahr und somit auch die Patronin der Bergleute. Til hatte sie nicht gerettet.
Auch beim Dies Irae konnten die dunklen, lateinischen Klänge die Melodie in Barbaras Hinterkopf nicht übertönen. Sie schaute zu den Männern der St.-Johannis-Bruderschaft, die ganz vorne im Chorgestühl Platz genommen hatten. Es waren alterfahrene Steiger, Hüttenbetreiber und andere angesehene Mitglieder der Rammelsberg-Gemeinschaft, die sich zusammengeschlossen hatten, um Not leidenden Bergleuten und ihren Familien zu helfen.
Barbara hatte bereits mit den Männern von St. Johannis gesprochen. Ja, sie würden ihrer Familie helfen. Doch was sie ihr geben konnten, war zu wenig – auch die Truhen der Bruderschaft waren leer. Til hatte zudem Woche für Woche einen Teil seines Hauer-Lohns als Büchsenpfennig in die Knappschaftskasse eingezahlt, die gemeinsame Rücklage für Bedürftige. Doch auch das reichte nicht.
Das hatte Barbara schon ausgerechnet, wieder und immer wieder. Ohne Tils Lohn wurde es eng für Els und Volkmar, und es dauerte noch Jahre, bis ihr kleiner Bruder vielleicht dereinst selbst ein Bergknappe werden konnte. Auch das war Teil des Liedes, das sie nicht mehr loslassen wollte.
Es begleitete sie nach draußen, auf den St.-Johannis-Kirchhof, wo Tils Körper einer Grube übergeben wurde, nachdem man ihn zuvor aus einer anderen Grube befreit hatte. Dann war es endlich vorbei, und die Trauergemeinde zerstreute sich. Die meisten strebten hinüber zu einer der alten Bergherren-Kemenaten, wo die St.-Johannis-Brüder einen kleinen Leichenschmaus zu Tils Ehren ausrichteten. Mutter war schon dort, um zur Hand zu gehen, während Barbara noch am Grab zurückblieb. Sie hörte ein Kichern und wandte sich um. Die Kinder aus dem Bargedorp waren erleichtert aus der Kirche geströmt und spielten nun auf der Wiese vor der Kirchhof-Mauer Fangen. Auch Volkmar und Els waren darunter. Gerade brachte sich Barbaras kleine Schwester kreischend hinter einem Busch in Sicherheit. Das wirkte seltsam unpassend an diesem Tag. Doch nach der letzten Zeit voller Trübsal tat den Kindern gewiss ein wenig Normalität gut. Und schließlich trug jeder sein ganz eigenes Lied in der Brust …
«Es tut mir so leid.»
Plötzlich stand ihre Freundin Anna Fredemann, die Tochter des Grubenmeisters, vor ihr und drückte sie an sich. Barbara erwiderte die Geste matt. Dann löste sich Anna von ihr, um sie prüfend anzuschauen.
Die Bergherrentochter war etwa in ihrem Alter, stämmig gebaut und mit hellbraunem Haar, das sie heute unter einem dunklen Tuch gebündelt hatte. Ihr rundes Gesicht war weich, doch ihr kräftiger Kiefer kündete von einer sturen Entschlossenheit, die man leicht übersah, wenn man Anna nicht gut kannte.
«Wir werden euch nicht im Stich lassen», sagte sie leise. «Schließlich gehört die Druden-Familie zum Katzenloch, seit unsere Vorväter die ersten Stollen in den Berg getrieben haben.»
Barbara zwang sich zu einem Lächeln. «Danke. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen.» Sie mochte Annas unverwüstlichen Optimismus, aber sie wusste auch, dass es um die Truhen der Fredemanns nicht eben gut bestellt war.
Anna schaute sich unterdessen um und winkte schließlich energisch. «Cordt! Kommst du?»
Ihr Bruder näherte sich quer über den Kirchhof. Er war kantiger gebaut als seine Schwester, und sein dunkles Haar war fast schwarz, ebenso wie sein Bart. Barbara hatte nie viel mit ihm gesprochen, denn Cordt Fredemann hielt sich gerne abseits und wirkte oft ernst und gedankenversunken. Von Volkmar wusste sie, dass die Dorfkinder ihn mit einer Mischung aus Faszination und Furcht betrachteten. Sie erzählten sich Geschichten über die unglaublichen Dinge, die er mit dem Eisenhaken anstellen konnte, der seine rechte Hand ersetzte. Doch Barbara wusste natürlich, dass das Unfug war. Sie fand Cordts stille, fast melancholische Art irgendwie … interessant. Manchmal fragte sie sich, welche Lieder wohl in dieser Stille wohnen mochten.
«Hier.» Cordt hatte einen kleinen Lederbeutel hervorgezogen, den er Barbara nun etwas unbeholfen überreichte. Überrascht nahm sie ihn entgegen. Sie fühlte das Gewicht von Silberpfennigen zwischen ihren Fingern. «Mein Vater kann heute leider nicht hier sein», sagte Cordt. «Aber es ist auch in seinem Sinne, dass ihr das bekommt. Eine kleine Hilfe, für die erste Übergangszeit. Tut mir leid, dass es nicht mehr ist.» Er stockte kurz. «Und tut mir leid, dass das Katzenloch nicht besser zu Til gewesen ist. Er war ein tüchtiger Hauer.»
Cordt verzog das Gesicht. Fast sah es aus, als fühlte er sich schuldig für die Grausamkeit des Berges.
«Danke», murmelte Barbara überwältigt. Damit hatte sie tatsächlich nicht gerechnet. Sie wusste natürlich, dass dieses Silber nicht reichen würde, um Jahre der Not zu überbrücken. Aber es war mehr als nichts. Und vor allem berührte sie, dass die Bergherrenkinder an ihre Familie gedacht hatten, obgleich auch bei ihnen das Geld nicht gerade in Strömen floss … Anna nahm sie noch einmal in den Arm, während sich in das Lied in Barbaras Hinterkopf zaghaft neue Töne mischten.
Dann blieb ihr keine Zeit mehr für ihre Gedanken, denn sie musste Mutter dabei helfen, den Leichenschmaus der Johannis-Bruderschaft auszurichten. So schleppte sie Bierkannen, trug Brotkörbe und ließ zahllose Beileidsbekundungen über sich ergehen. Als sich schließlich am späten Nachmittag die Leute verstreuten, fühlte sie sich einfach nur erschöpft. Mutter war schon mit Els und Volkmar vorgegangen, während Barbara noch sorgfältig einige Brotreste einpackte. Dann machte sie sich auf den Weg, um rasch nach Hause zu kommen – auch wenn sich ihre Bude ohne Til kaum mehr wie ein Zuhause anfühlte.
Sie wollte gerade in die Grünestraße einbiegen, die ins Viertel der einfachen Bergleute hinaufführte, als sie plötzlich eine Stimme hörte: «He, da!»
Erstaunt schaute sie sich um. Am Tor der Kirchhofmauer lehnte ein junger, ziemlich schlaksiger Mann. Er trug einen breitkrempigen Hut mit Feder, unter dem blonde Locken hervorschauten, und auch sein üppiger Mantel sah teuer aus. Der Kerl kam gewiss nicht aus dem Bargedorp! Offenbar hatte sich irgendein Kaufmann aus der Stadt hier raus verirrt.
«Meint Ihr mich?», fragte Barbara misstrauisch, die sonst niemanden auf der Straße sah.
Der Fremde löste sich von der Mauer, ging einige Schritte auf sie zu und verbeugte sich leicht.
«Du bist doch die Schwester des Hauers, der im Katzenloch verunglückt ist?», fragte er halblaut.
Sie nickte matt. «Barbara Druden. Und Ihr seid …?»
«… sehr interessiert am Rammelsberg-Bergbau», beendete der Fremde ihren Satz. «Und es tut mir leid, dass das geschehen musste. Mein Beileid.»
Barbara murmelte einen Dank, die Schultern unbehaglich hochgezogen. Was wollte der Kerl von ihr?
Statt einer Erklärung fasste er sie verbindlich am Arm und führte sie einige Schritte in den Schatten der Kirchhofmauer.
«Die Tretung im Katzenloch hat sich schnell herumgesprochen, auch auf den Märkten von Goslar reden die Leute darüber», berichtete er. «Gewiss hast du schon die Gerüchte gehört …»
«Gerüchte?», erwiderte Barbara Unheil ahnend.
«Man sagt, in der Grube wurde aus Gier nach Erzen zu unvorsichtig gegraben. Raubbau im Berg, ein altes Problem. Und wenn dann eine tragende Säule fehlt, weil sie voller Erz steckte, kann geschehen, was eben geschehen ist.»
Barbara spürte, wie ihr das Herz eng wurde. Ja, sie hatte davon gehört, die Leute redeten schließlich mehr als genug. Aber sie vertraute darauf, dass der alte Steiger Georg wusste, was er tat. Und natürlich auch der Grubenmeister Claus und sein Sohn Cordt, der ihr gerade erst die Silberpfennige zugesteckt hatte.
«Lasst die Leute doch reden», knurrte sie. «So, und nun muss ich gehen, ich habe noch zu tun.»
Unwillig wandte sie sich ab, doch der Lockenkopf mit dem üppigen Hut trat ihr erneut in den Weg.
«Dann vertraust du also der Bergherrenfamilie vom Katzenloch?», fragte er fast schon lauernd und musterte sie aus kleinen, wässrig blauen Augen.
«Gewiss», gab sie kurz angebunden zurück und versuchte vergeblich, sich an ihm vorbeizudrücken.
«Ich habe dich vorhin mit den Kindern des Grubenmeisters sprechen sehen», bohrte der Fremde nach.
«Ja. Die Fredemann’sche Anna ist meine Freundin.»
«Ihr seid vertraut miteinander? Das ist gut. Die Fredemanns sind gewiss redliche Leute. Aber manchmal wird auch der Beste von der Not dazu getrieben, Dinge zu tun, die nicht ganz in Ordnung sind.»
«Ich muss gehen!»
Barbara schob sich energischer vorwärts, und diesmal trat der Kerl einen Schritt beiseite. Als sie sich fast an ihm vorbeigezwängt hatte, schnellte sein Arm vor und drückte ihr etwas Kaltes, Glattes in die Hand.
Überrascht hielt sie inne und betrachtete das Objekt. Das war ein golden glänzender Gulden, geprägt mit dem Bild des heiligen Johannes! Viel mehr Geld, als Cordt ihr zugesteckt hatte.
«Was … soll das?», keuchte sie.
«Nur eine kleine Anerkennung für dein Entgegenkommen», sagte der Fremde wegwerfend. «Ich interessiere mich, wie gesagt, für den Bergbau am Rammelsberg. Und ich würde mich freuen, wenn ich gelegentlich mit dir über das Geschehen in den Gruben sprechen könnte. Du arbeitest in der Bier-Kammer, bekommst vieles mit … Vielleicht magst du ja für mich die Augen offen halten und mir Bericht erstatten. Denk mal darüber nach. Wo der Gulden herkommt, gibt es noch mehr.»
Unwillkürlich schloss Barbara ihre Faust um die kühle, blanke Münze, als könnte man sie ihr jederzeit wieder entreißen. Damit bekam sie ihre Familie für eine ganze Weile satt!
«Und im Gegenzug soll ich nur … mit Euch über die Gruben reden?»
Er nickte. «Mit mir – und mit niemandem sonst. Diese Abmachung wird unser Geheimnis bleiben. Ich bezahle dich fürs Schweigen ebenso wie fürs Reden. Und nun gehab dich wohl, Barbara Druden. Wir sprechen uns bald wieder.»
Er tippte sich an den breitkrempigen Hut und spazierte davon, ließ Barbara verwirrt zurück.