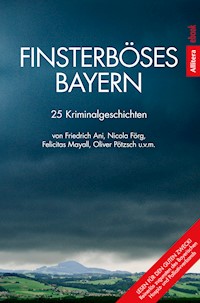
Finsterböses Bayern E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
25 renommierte Krimi-Autoren, in Bayern geboren oder dort lebend, haben sich den dunklen Seiten ihrer Heimat gewidmet und zeigen in hochspannenden, skurrilen, amüsanten und bewegenden Kurzkrimis: Das Verbrechen lauert immer und überall, im Freistaat und darüber hinaus. Mit Kriminalgeschichten von: Friedrich Ani, Volker Backert, Jan Beinßen, Angela Eßer, Nicola Förg, Werner Gerl, Katharina Gerwens, Michael Gerwien, Lisa Graf-Riemann, Harry Kämmerer, Thomas Kastura, Lotte Kinskofer, Roland Krause, Iris Leister, Christian Limmer, Harry Luck, Felicitas Mayall, Stefanie Mohr, Oliver Pötzsch, Billie Rubin, Frank Schmitter, Michael Soyka, Ingeborg Struckmeyer, Georg Unterholzner, Dieter Weißbach
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FINSTERBÖSES BAYERN
25 Kriminalgeschichten
Herausgegeben von
Angela Eßer und Heidi Keller
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter www.allitera.de
Das Buch entstand mit freundlicher Unterstützung der Bayerische Stiftung Hospiz
April 2014 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2014 Buch&media GmbH, München Umschlaggestaltung: Alexander Strathern, München Titelbild: photocase.com Printed in Germany ISBN 978-3-86906-499-4
Inhalt
ERICH RÖSCH
Literarische Auftragsmorde – Morden für den guten Zweck?
FRIEDRICH ANI
Im Paradies
VOLKER BACKERT
Letzte Worte
JAN BEINßEN
Tödliches Grün
ANGELA EßER
Nessun dorma
NICOLA FÖRG
Jessas!
WERNER GERL
Beichtgeheimnis
KATHARINA GERWENS
Alte Schätzchen
MICHAEL GERWIEN
Sonst noch etwas?
LISA GRAF-RIEMANN
Ein Sommer in Swan Hill
HARRY KÄMMERER
Licht aus
THOMAS KASTURA
Fear
LOTTE KINSKOFER
Perfektes Timing
ROLAND KRAUSE
Du sollst nicht begehren
IRIS LEISTER
Drei, zwei, eins – deins
CHRISTIAN LIMMER
Killer AG
HARRY LUCK
Kreuther Gschnetzeltes
FELICITAS MAYALL
Winterkrimi
STEFANIE MOHR
O Tannenbaum
OLIVER PÖTZSCH
Der Fall Ludwig
BILLIE RUBIN
Tür an Tür mit Malice
FRANK SCHMITTER
Der Mitternachtsläufer
MICHAEL SOYKA
Tamara muss sterben
INGEBORG STRUCKMEYER
Bittersüßes Ende
GEORG UNTERHOLZNER
Der verschwundene Flößer
DIETER WEIßBACH
Taxi zum See
DIE AUTOREN
URSPRUNG UND ENTWICKLUNG DER HOSPIZIDEE UND PALLIATIVVERSORGUNG
HOSPIZ- UND PALLIATIVVERSORGUNG
BILDUNG UND FORSCHUNG
LANDESWEITE ORGANISATIONEN
BAYERISCHE STIFTUNG HOSPIZ
Erich Rösch
Literarische Auftragsmorde – Morden für den guten Zweck?
Haben wir mit der vorliegenden Anthologie etwa eine neue Literaturgattung geschaffen? Das war einer meiner ersten Gedanken, als ich das fertige Manuskript zu diesem Buch endlich in Händen halten durfte. Oder gibt es den literarischen Auftragsmord schon?
Wie auch immer, noch nie sind in Bayern so viele Menschen auf einmal »für den guten Zweck gestorben« wie in diesem Buch, eine Premiere ist es allemal und gelungen obendrein!
Von der Idee bis zur Umsetzung war es ein langer Weg. Nicht, weil die Autorensuche so mühsam war, nein, es gelang recht schnell, hochkarätige Autoren aus Bayern von unserer Idee zu überzeugen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!
Nicht, weil es schwierig war, einen Verlag für dieses Buch zu finden, nein, die erste Anfrage beim ersten Verlag war schon erfolgreich. Dem Allitera Verlag, insbesondere Verleger Alexander Strathern und vor allem Heidi Keller, die »unser Kind« von der ersten Minute an begleitet hat, sei Dank!
Nicht, weil es schwierig war, eine Herausgeberin für diese Anthologie zu finden, nein, einmal von der Idee begeistert, war es für Frau Keller nicht schwer, Angela Eßer anzustecken. Ihnen beiden sei gedankt!
Nicht, weil es schwierig war, den Druck dieses Buches mitzufinanzieren, nein, die Bayerische Stiftung Hospiz kennt uns und unsere Anliegen und unterstützt uns jedes Mal aufs Neue bei unseren Projekten – und seien sie noch so ungewöhnlich. Dem Stiftungsrat der Bayerischen Stiftung Hospiz unter Vorsitz von Dr. Thomas Binsack sei gedankt!
Viele Mosaiksteine haben sich also wunderbar zusammengefügt, sodass am Ende entstehen konnte, was der Leser nun in Händen hält: die wohl erste Sammlung regionaler Krimis – dazu drei Geschichten, die in den USA, in England und Italien spielen – zugunsten der Hospizbewegung überhaupt!
Was war dann der lange Weg, werden Sie nun fragen.
Die Idee zu diesem Buch entstand spontan auf einer langen Autofahrt. Als Verantwortlicher auf Landes- und Bundesebene verbringe ich mehr Zeit auf Bayerns und Deutschlands Straßen beziehungsweise in Hotels, als mir manchmal lieb ist. Aber ich habe einen Weg gefunden, mir das sozusagen »schönzulesen«.
Auf dem Weg nach Berlin einem Hörbuch einer bayerischen Krimiautorin (Sie finden sie auch in diesem Buch vertreten), gelesen von einer bayerischen Schauspielerin, zu lauschen, lindert das Heimweh und hilft dem Bayern, Sprachbarrieren zu genießen.
Im Hotel fern der Heimat vor dem Einschlafen noch schnell einen Mord lösen beziehungsweise lösen lassen, der eigentlich gar keiner ist (auch so etwas ist hier vertreten) – und es kann auf einmal Spaß machen, für Themen bundesweit unterwegs zu sein, die für die meisten Menschen immer noch ein Tabu darstellen: Sterben, Tod und Trauer.
Ein Krimi macht dieses Thema nicht kleiner und ein Mord ist und bleibt auch in Zukunft nicht die Lösung für die Fragen, mit denen sich die Hospizbewegung konfrontiert sieht. Aber ein richtig guter Krimi – und in diesem Buch finden Sie 25 davon – ist manchmal eben die Belohnung für so manches, was einem in meinem »Beruf« begegnet und anstrengt.
Der lange Weg? Nun – die Idee auszusprechen, erforderte schon Mut: Darf man das zusammenbringen? Die tägliche Sorge für schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige und die Spannung eines Krimis, in dem auch jemand stirbt, sozusagen zur Unterhaltung?
Ist das ein möglicher Weg, auf die Anliegen der Hospizbewegung aufmerksam zu machen? Das individuelle Sterben eines geliebten Menschen und das Sterben einer Romanfigur »just for fun«, nur, »weil in beiden Fällen am Ende einer tot ist«?
Unlösbar? Nein, nicht wirklich. Wir Hospizler sind geübt, Unaussprechliches anzusprechen und scheinbar Unmögliches zumindest in Erwägung zu ziehen. Und so war es ein Gespräch mit Monika Dobler, der Inhaberin der Münchner Krimibuchhandlung Glatteis, das mich bestärkt hat, den Faden weiterzuspinnen. Ihr sei an dieser Stelle herzlich gedankt! Ich durfte ihr zwischen all ihren Büchern von meiner Idee erzählen, sie hatte einfach Zeit für mich, ein bisschen Ermutigung, gab mir die Zusage, jederzeit wieder vorbeikommen zu dürfen, und einen Zettel mit einer Adresse und einer Telefonnummer. So hat alles begonnen. Da war jemand, der Zeit hatte, und auf einmal war es einfacher. Genau das, was gerade das ehrenamtliche Engagement in der Hospizbewegung so wertvoll macht, hat auch hier geholfen: Zeit haben, Mut machen, dranbleiben – aber nicht die »Arbeit« abnehmen. Seinen Tod stirbt jeder selbst, und dieses Buchprojekt hätte weit weniger Energie freigesetzt, wenn es als Vorschlag von außen gekommen wäre.
Es gab im weiteren Nachdenken über diese Idee noch eine Erweiterung:
Die bayerische Hospizbewegung ist in den mehr als 25 Jahren ihrer Entwicklungsgeschichte mittlerweile in jeder Region, jeder Stadt, jedem Dorf des Freistaats angekommen, und »die Hospizler«, die sich ehrenamtlich engagieren oder in der Hospizbewegung in Bayern eine berufliche Zukunft gefunden haben, sind so vielfältig wie die Regionen, aus denen sie kommen.
So sind auch die hier vorzufindenden Krimis – geprägt von ihrer Region, geprägt von Bayern. Autoren aller bayerischen Regionen anzusprechen und um einen schriftlichen Beitrag zu bitten, lag also nahe. Die Bereitschaft des ein oder anderen, sein Werk auch persönlich – vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hospizverein – vorzutragen, das hat die kühnsten Erwartungen während einer langen Autofahrt übertroffen!
Bayern ist groß und noch lange nicht jede Region mit einem Beitrag in diesem Werk vertreten. Und schon entsteht die Hoffnung auf eine Fortsetzung, die es aber nur geben kann, wenn Menschen wie Sie dieses Buch kaufen – weil Sie gute Krimis zu schätzen wissen und dieses Angenehme darüber hinaus mit dem Nützlichen eines finanziellen Beitrags zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei der Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen und deren Angehöriger verbinden.
Allen Unterstützern dieses Projekts unser herzlicher Dank und Ihnen viel Freude beim Lesen!
Dr. Erich Rösch ist Geschäftsführer des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes.
Friedrich Ani
Im Paradies
Sah schon hart aus, wie er so dalag, blutbesudelt über und über, beinah hätt ich mich übergeben, was ziemlich seltsam ausgesehen hätte, ziemlich seltsam. Ich hockte bloß da und ließ die Männer von der Polizei und vom Unfalldienst ihre Arbeit machen. Eine junge Frau in einem netten Kleid, sommerlich, ziemlich sommerlich, redete mit mir, wollte mich anscheinend beruhigen. Ich war ruhig, sehr ruhig. Nicht so ruhig wie Ludwig natürlich, der war jetzt ruhig für die Ewigkeit, aber man könnte sagen, ich war gefasst. Auch wenn das eine eigenartige Bezeichnung für einen wie mich ist.
Mein Name ist übrigens Ralph.
Ich kannte Ludwig seit dreieinhalb Jahren, als er an jenem sonnigen Spätfrühjahrstag jäh zu Tode kam.
Oder sagen wir: zu Tode kommen musste.
Wovon die Polizisten natürlich nicht die geringste Ahnung hatten, als sie ihn da unten, am Fuß des Abhangs, aus seinem gottverdammten roten Chrysler Cabrio schälten. Sie dachten, es war ein Unfall. Ludwig war hundertachtzig auf der Landstraße gefahren, ich hatte im Wagen gesessen, hinten, er brüllte gegen den Fahrtwind an, der Angeber. Unaufhörlich schrie er ihren Namen, mir taten schon die Ohren weh: SARAH! SARAH!
Immer wieder hatte sie davon gesprochen, ihn umzubringen. Am Ende hatte sie ihn nur noch gehasst, sie hasste ihn wie ein Geschwür. Als wäre er ein bösartiges Karzinom auf ihrer Haut, und mit Karzinomen kenn ich mich aus, ich hatte mal eins, das wurde wegoperiert.
So lernten wir uns kennen, Ludwig und ich, im Treppenhaus. Er kam rein, ich kam grad aus der Praxistür, er rutschte auf einem Hochglanzprospekt aus und fiel mir direkt vor die Füße. Lachen hätt ich können, wenn mir nach Lachen zumute gewesen wär. Auch wenn das reichlich eigenartig ausgesehen hätte bei einem wie mir, reichlich eigenartig. Unsereiner lacht nicht.
Er setzte sich auf die Treppe, rieb sich Arme und Knie und fing an zu reden. Über die Computerfirma, in der er arbeitete, über die Probleme mit den neuen Mikrochips, über einen Kerl, den er für einen Versager hielt und der trotzdem immer die besser bezahlten Aufträge bekam, lauter solchen Mist, der mich nicht im Geringsten interessierte. Endlich hörte er auf und lachte los. Lachte, als hätte er einen sensationellen Witz gehört. Ich schwör’s, ich hab keinen erzählt. Er lachte also bloß so, vielleicht hatte er einen Schock oder war dabei auszurasten. Computerleute rasten gern aus. Er lachte und lachte, und ich hatte Schmerzen am Rücken von der Operation und wollt raus an die frische Luft. Ich machte mich davon, und er kam hinter mir her.
Angeblich wollte er in dem Haus eine Freundin besuchen. »Das ist ein Zeichen, dass ich hingefallen bin«, sagte er auf der Straße. Fabelhaftes Wetter, saftige Wiesen, Frauen in kurzen Röcken, schon sommerlich, massiv sommerlich, obwohl es erst April war.
»Die Frau ist von Anfang an ein Reinfall gewesen«, sagte er, »sie ist scharf auf mein Auto und sucht einen Job, so ist die. Ich hab das erst nicht gemerkt, aber jetzt ist alles ganz klar. Von mir kriegt die nichts. Das Blöde ist, ich steh auf sie, wenn ich mit ihr im Bett bin, rast ich aus.«
Ich wusste, dass Computerleute leicht ausrasten.
Wir standen auf dem Bürgersteig, und er redete weiter und ich hörte ihm zu. Das war unsere unausgesprochene Abmachung vom ersten Moment an: Er redet, ich hör zu, manchmal nick ich oder schüttel den Kopf, ansonsten ließ ich ihn labern. Er brauchte das. Und mir war’s egal, ich bin ein guter Zuhörer. Und ich hör eine Menge.
Zum Beispiel hörte ich, was er zu Sarah sagte, als sie zum ersten Mal bei ihm übernachtete.
In der Zwischenzeit wohnte ich bei ihm. Er hatte eine Fünf-Zimmer- Wohnung am Pariser Platz und jeder von uns hatte eine Menge Platz für sich allein. Ich bin gern allein. Im Gegensatz zu Ludwig. Wenn er länger als eine halbe Stunde allein in der Wohnung war, RASTETE er aus. Rief hundert Freunde an, oder Leute, die er dafür hielt, und quatschte ihnen die Ohren ab. Meistens versuchte er es bei Frauen. Manche von ihnen fielen auf ihn rein und verabredeten sich mit ihm. Wie Sarah.
Sie war vierunddreißig und Chiropraktikerin. Wegen seiner Rückenwehwehchen hatte er sich von ihr behandeln lassen und jedes Mal, wenn er aus ihrer Praxis nach Hause kam, sperrte er sich im Bad ein. Aber ich hab verdammt gute Ohren, verdammt gute Ohren. Meiner Meinung nach kamen seine Kreuzverzerrungen daher, weil er dauernd an sich rumrubbelte. Ich weiß das, ich wohnte im Zimmer nebenan, durch die Wände war einiges zu hören. Zum Beispiel der Satz, den er zu Sarah sagte, als sie zum ersten Mal bei ihm übernachtete.
»Wenn du mir nicht gehorchst, passiert was!«
Ich wusste sofort, eines Tages würde etwas passieren. Allerdings was anderes, als er erwartete, was ganz anderes.
Sarah ließ sich tatsächlich auf ihn ein. Ging mich nichts an. Sarah und ich verstanden uns gut, sie warf mir manchmal Blicke zu, die mich nervös machten. Ich wusste nicht, was sie mir damit sagen wollte. Im Nachhinein denk ich, sie wollte mich als Verbündeten haben, sie knüpfte ein Band für den entscheidenden Augenblick, ich sollte auf ihrer Seite sein, wenn es so weit war.
Ludwig verabredete sich mit ihr fürs Wochenende, dann sagte er kurzfristig ab, weil er einen Termin hatte. Alles gelogen. Ich kannte die Wahrheit. Er legte die Freundin seines verhassten Kollegen flach, weil er ihn demütigen wollte. Lächerlich. Wenn Sarah nachts, nachdem er es massiv mit ihr getrieben hatte, lieber nach Hause fahren als bei ihm übernachten wollte, verpasste er ihr eine Ohrfeige. Einmal fesselte er sie ans Bett und behauptete am nächsten Morgen, das sei genau die Methode, die bei ihr zünden würde.
Seine Art, mit ihr umzuspringen, wurde allmählich sadistisch. Anscheinend befriedigte er damit eine Art Masochismus bei ihr, jedenfalls ließ sie sich seine Gemeinheiten und Betrügereien gefallen. Gleichzeitig hasste sie ihn. Sehr merkwürdig. Eine Zeit lang ging ich ihr aus dem Weg, weil ich ihr Verhalten nicht kapierte.
Mir sind Frauen rätselhaft wie Sterne, aber ohne sie wär’s noch finsterer im Leben. Wenn Sarah Ludwig hasste, sich aber trotzdem alles von ihm gefallen ließ, was war da zu tun? Ich saß nebenan und hörte zu, wie er sie traktierte und wie sie schrie und wie sie sich stritten und wie Sarah dann mit nackten, patschenden Füßen durch den langen Flur lief und in der Küche Wodka aus der Flasche trank. Hätt ich mich einmischen sollen? Ich war mir sicher, Sarah würde von sich aus handeln, eines Tages. Eines Tages würde sie ihn bezahlen lassen für sein Schweineverhalten.
Der Tag war ein Sonntag. Spätes Frühjahr, Sonne und Vogelgezwitscher ohne Ende. Wenn ich mal eines dieser Biester zu fassen krieg,zermalm ich es, gottverdammtes Gezwitscher, ich hasse Vögel. Diese Viecher haben keinen Schimmer, wie es ist, hier unten zu leben, Geißeln der Schwerkraft, gottverdammt, ich kann gar nicht sagen, wie oft am Tag ich die Schwerkraft hasse.
Sonntag. Sehr früher Morgen.
Ich war wach und langweilte mich NICHT. Lag so da und lauschte zwangsweise dem Scheißgepiepe. Plötzlich ein leises Stöhnen nebenan, ich spitzte die Ohren. Was passierte? Ich schlich zur Tür, Ludwigs Tür war geschlossen, aber ich hörte seine Stimme. Dann ging die Tür auf und ich versteckte mich. Sarah sagte: »Ich hol das Öl, damit ich dich besser massieren kann.« Und sie tappte über den Flur. Ich roch ihren Duft, diesen rauen Duft, der aus allen Poren ihres Körpers strömte, ich weiß das, sie hatte mich mal umarmt. Dann kam sie zurück und tat etwas Merkwürdiges: Sie ließ die Tür angelehnt. War das ein Zeichen für mich? Ich konnte Ludwigs Beine erkennen, mehr nicht, er lag auf dem Bauch.
Diesmal aber hatte Sarah nicht nur das Öl geholt. Sondern auch ein Küchenmesser, das war lang und scharf, dermaßen lang und scharf, sie versteckte es hinter dem Rücken. Ludwig beachtete sie nicht. Er glaubte, sie wär nett wie immer. Sie schmierte ihn ein, sagte ein paar schmierige Sachen zu ihm und er grunzte und dann holte sie aus, das Messer in der Hand.
Da musste ich niesen. Das passiert mir nie, ich schwör’s, gottverdammt. Ich nies höchstens ein Mal im Jahr, im November, vielleicht im Dezember, aber im Mai hab ich mein ganzes Leben lang noch nicht geniest. Ludwig fuhr herum, sah das Messer und schlug zu. Ich keuchte noch, und mein Herz klopfte dramatisch und mein halbes Gesicht war verklebt vom Rotz, den musste ich erst abwischen. Da fiel Ludwig über Sarah her und ließ seine Fäuste auf sie draufhageln. Sie hatte keine Kraft, sich zu wehren oder zu schreien. Er drosch wie ein Verrückter auf sie ein, er rastete total aus.
Und bevor ich was tun konnte, stürzte Ludwig aus dem Zimmer, zog sich an, riss die Autoschlüssel vom Haken, verpasste mir einen Fußtritt und jagte mich aus der Wohnung. »Du kommst mit, Ralph!«, brüllte er, und als ich ihn wütend anbellte, verpasste er mir noch einen Tritt. Ich rannte vor ihm her die Treppe runter und sprang in dieses gottverdammte rote Chrysler Cabrio.
»Diese Nutte!«, schrie er, gab Gas und ließ den Motor aufheulen.
Dann raste er los, und ich hockte hinten im schneidenden Fahrtwind, und meine Wut schäumte weiß aus meinem Maul.
Mit zweihundertzwanzig zischten wir über die Autobahn. Anstatt mich um Sarah zu kümmern, lag ich flach auf dem Rücksitz und dachte, der Scheißwagen hebt gleich ab. Ludwig brüllte immer noch. In der Nähe des Starnberger Sees bog er ab und nahm die Landstraße. Ich richtete mich auf.
»… und wenn ich zurück bin, häng ich sie mit dem Kopf voraus aus dem Fenster, und wenn sie was Verkehrtes sagt, lass ich sie los, das garantier ich dir. So was macht keine Nutte mit mir. Du hast mir das Leben gerettet, Ralph, ist dir das klar? Ohne dich wär ich jetzt eine Leiche, stell dir das vor, die hätt mich abgestochen, die Nutte! Ist schon irre, dass ich dich behalten hab, ich hätt dich auch wieder im Tierheim abliefern können, niemand wollt dich sonst haben, hähä, bloß ich, ich hab geschnallt, was du wert bist. Ralph, alter Freund. Jetzt machen wir uns einen schönen Tag nach all dem Horror und dann kümmern wir uns um die Nutte. Capito?«
Capito, dachte ich und sprang nach vorn. So schnell konnte er nicht blinzeln. Ich schnappte nach seinem rechten Arm, riss ihn vom Lenkrad weg, und Ludwig fuchtelte rum. Das verdammte rote Cabrio schleuderte über die Straße, hundertachtzig Stundenkilometer immer noch, fantastische Geschwindigkeit, lauer Wind, lustiges Gezwitscher in den Zweigen. Die Kiste flog auf den Abhang zu. Es wurde Zeit für mich, den Fuchur zu geben und schwerelos durch die Lüfte zu schweben.
Und wie es das Schicksal wollte, begegneten sich noch einmal unsere Blicke. Was is’n das jetzt?, sagte Ludwigs Blick und meiner: Deine Leasing-Karre ist jetzt Schrott.
Und während ich im Graben landete, mich überschlug und wohlbehalten auf die Beine kam, donnerte Ludwig gegen zwei oder drei Bäume und wurde am Ende, knapp überm weichen feuchten Frühjahrsgras, vom linken Hinterreifen seines roten Cabrios noch ordentlich rasiert.
Über und über voller Blut lag er da unten, und ich hockte mich hin und rührte mich nicht von der Stelle. Bis diese junge Frau zu mir kam, in ihrem sommerlichen Kleid, und sich neben mich kniete. Sie hatte einen hübschen Busen, aber sie roch nicht halb so rau wie Sarah, nicht mal ein Viertel so rau, nicht mal ein Achtel. Sie tätschelte mir den Kopf und hielt meinen Gesichtsausdruck allen Ernstes für traurig.
Seit ich bei Sarah wohne, bin ich viel ausgeglichener. Wir gehen oft spazieren, sie redet wenig, und wenn sie was sagt, dann immer schöne Sachen. Im Krankenhaus hab ich sie jeden Tag besucht, im Park, nicht im Zimmer, das ist verboten, weil ich angeblich bakteriell gefährlicher bin als die Verwandten der Patienten, so ein Scheiß. Am Anfang weinte sie oft, später lächelte sie manchmal, und wenn ich für sie im Kreis tanze, lacht sie sogar und sagt Ralphi Valentino zu mir.
Die Akte bei der Polizei ist geschlossen. Es war ein Unfall, tragisch. Ich hab viel Mitleid gekriegt, eine neue Erfahrung für einen räudigen Mischling wie mich.
Es gibt Nächte, da darf ich bei Sarah im Bett liegen. Das ist das Paradies. Ich saug ihren rauen Duft ein, und wenn sie fest schläft, streich ich ihr mit der Zunge über den Rücken. Sie stöhnt dann leise.
Volker Backert
Letzte Worte
Left is right – and right is wrong!« Leise sang Gerald vor sich hin, als er die Neonreklame im Schaufenster der Kunstgalerie im Münchner Luitpoldblock einschaltete. Unwillig flackernd erst brach sich G & A – The Art Gallery gleißend helle Bahn, hinaus in die feuchtkühle Dämmerung der Brienner Straße.
Left is right – and right is wrong. Erstaunlich, dachte Gerald, als er das Logo G & A betrachtete; erstaunlich, welch tiefe Lebensweisheit doch in dem trivialen Jazzrefrain aus alten Studententagen steckte. G & A – Gerald und Anette – »Left is right – and right is wrong!« A, Anette, war falsch, war der größte Fehler seines Lebens. Höchste Zeit für einen klaren, sauberen Schnitt. Nur noch eine halbe Stunde …
»Hast du Dr. Mertens angerufen? Nimmt er jetzt den Giacometti oder nicht?« Anette stand in der Tür. Kühl, perfekt, unnahbar – und immer direkt auf den Punkt: Sie wusste genau, dass er heute alle angerufen hatte; alle außer Dr. Mertens. Die pure Provokation! Während er kurz den Kopf schüttelte, stieg urplötzlich wieder die Wut in ihm auf, die alte, eisige Wut auf diese verkrachte Kunststudentin, die er Silvester 1979 im domicile an der Leopoldstraße aufgegabelt und nicht mehr losbekommen hatte. Er, der arrivierte Kunstprofessor, mit dem ewigen Traum von der eigenen Galerie. Und sie, die Möchtegernmalerin, schon damals getrieben – permanent getrieben! – vom Hunger nach Anerkennung, Erfolg und Geld. Seinem Geld!
Verärgert riss er seinen Blick los, mit dem er Anette die ganze Zeit unbewusst gemustert hatte: auch mit sechsundvierzig noch nahezu perfekte, frauliche Formen … gepflegte Eleganz … dunkle Augen, dunkles Haar … Fast alterslos attraktiv; wie das Blattgoldporträt von Gustav Klimt, wie Adele Bloch-Bauer I, dachte Gerald, als er den Rémy Martin XO Excellence auf seinem Schreibtisch entkorkte und sich langsam nachgoss. Und kein Mensch ahnt, dass wir seit Jahren getrennte Schlafzimmer haben … Erst hatte er sie noch insgeheim verdächtigt, einen anderen zu haben. Doch selbst Wilfert, sein eigens engagierter Privatdetektiv, hatte nach vier Wochen kapituliert: »Vergiss es, Gerald. Es gibt keinen anderen Mann. Sie ist nur für die Galerie unterwegs.«
Zu viel unterwegs. Viel zu viel Bewegungsfreiheit hatte er ihr gelassen. Während er selbst kreativ im Büro saß, nach neuen Themen und Künstlern fahndete, sich um Flair und Ambiente der einflussreichsten Galerie Süddeutschlands kümmerte, fuhr Anette im ganzen Land herum, schloss – überteuerte! – Verträge und Versicherungen ab, übernachtete in – exklusiven! – Hotels und hielt natürlich ihre – erstklassige! – Garderobe auf dem neuesten Stand.
Kein Sex, kein kaufmännisches Denken, kein künstlerischer Instinkt – dem Zeitgeist hinterherhechelnd statt neue Trends vorauszuahnen … Geralds verächtlicher Blick verlor sich an der Wand in Jackson Pollocks Action Painting Nr. 32. 1950, Acryl auf Leinwand, 269 mal 457 Zentimeter, wirre schwarze Linien, wüste Farbspritzer … jede äußere Ordnung scheinbar im Chaos versinkend … und dennoch durchdrungen von konzentrierter Kraft und Willensstärke, klaren künstlerischen Kurs haltend … bis zum Schluss! Er blickte auf die Uhr. Noch zehn Minuten bis zum großen Finale bei G & A … Wohlige Wärme breitete sich in Gerald aus. Was für ein Cognac …
»Left is right – and right is wrong!« Erwartungsfroh summend fuhr Gerald auf dem Bürostuhl Karussell. Durch die offene Tür blickte er ins Vorzimmer, wo sich Anette jetzt mit ihrer einzigen Mitarbeiterin besprach. Joyce. Joyce. Welch unsäglicher Las-Vegas-Name für eine waschechte Augsburgerin. Neunundzwanzig, kompetent und charmant; seit zwei Jahren Anettes rechte Hand. Ein absoluter Glücksfall, nicht nur für die Galerie. Versonnen strich er über seinen silbergrauen Schnauzer.
Joyce – sienarotes, schulterlanges Haar, mandelförmige Augen, grazile Eleganz. Ein Akt von Modigliani. Jeanne Hébuterne vielleicht; der schlanke, lange, weiße Hals … Jetzt schien sie Anette fast ins Ohr zu flüstern, ins linke Ohr … Left is right – and right is wrong. Gerald rieb sich die Hände. Eine erfreulich enge Zusammenarbeit der beiden, geradezu freundschaftlich. Viele vertrauliche Details hatte er so in den letzten Wochen durch Joyce erfahren. Details über teure Fehler Anettes bei Vertragsverhandlungen. Details über exorbitante Schneiderrechnungen. Und nicht zuletzt Details und Originalzitate, die vor allem eines zeigten: Anettes abgrundtiefe Verachtung für ihn.
Es reichte einfach. Endgültig. Nicht nur die Ehe war gescheitert, die Galerie selbst stand auf der Kippe. Eine teure Scheidung würde sie vollends in den Abgrund reißen.
Jetzt oder nie. Mit einem Ruck stand er auf, straffte sich kurz und energisch. Joyce schwebte herein; langsam, mit fast lasziver Eleganz. Fasziniert starrte Gerald auf ihren Mund, auf die dunkelroten Lippen, die ihn letzte Nacht noch an den Rand des Wahnsinns getrieben hatten. Die Lippen, die ihm auch die Augen geöffnet hatten – hinsichtlich Anette. Die Lippen, die heute früh telefonisch zwei Tickets geordert hatten. München–Nizza. Vier Wochen Côte d’Azur. Abflug in vierzehn Tagen, wenn alle unangenehmen Formalitäten erledigt waren. Joyce hatte sich als umsichtige, geradezu kongeniale Planerin erwiesen, nachdem sie von der alten Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit erfahren hatte: Fünfhunderttausend Euro im Todesfall.
»Sind Sie so weit, kann ich den Champagner holen?«, hauchte Joyce.
»Ja, natürlich. Schenken Sie ein, Joyce, wie immer.«
Wie immer. Das Ritual, der Wochenabschluss in der Kunstgalerie G & A im Luitpoldblock, ein Glas Champagner im Büro. Anette kam herein, legte wortlos etwas auf den Schreibtisch und blickte ziellos, fast unruhig, aus dem Fenster, hinaus in die ungemütliche Herbstnacht. Abschied, dachte Gerald. Abschied für immer. Gelassen wandte er sich Joyce zu, die auf einem kleinen Silbertablett drei gefüllte Gläser hereinbalancierte. In der Mitte ihr eigenes; französisches Bleikristall, spätes 19. Jahrhundert. Links und rechts davon die beiden anderen, identischen aus der 1959er-O’Hara-Kollektion. Ruhig nahm Gerald die beiden vom Tablett. Zügig, ohne zu zittern, reichte er, wie zuvor tausendmal mit Joyce einstudiert – Left is right – and right is wrong –, das Glas aus seiner Rechten an Anette weiter.
»Santé!« Ein sanftes Klirren, kühler Samt, der am Gaumen entlangperlte und langsam, neues Leben verheißend die Kehle hinabrollte … Nur der schwache Nachgeschmack trübte etwas den Genuss … schade, der Rémy zuvor …
Anette, immer noch ganz normal, aufrecht stehend; ihr Blick vielleicht etwas unstet … Joyce, fast amüsiert von Anette zu Gerald blickend … Gerald wurde unruhig. Leichtes Sodbrennen kündigte sich an. Und das Büro war wieder völlig überheizt heute. Schnell noch einen tiefen, kühlen Schluck. In Geralds Magen schien ein Feuerball zu explodieren … was für ein unmenschlicher Schmerz … ein Geschwür vielleicht … ein Durchbruch … nein, noch schlimmer: Hatte er die Gläser verwechselt!? Sein Magen stand in Flammen, aufstöhnend brach er zusammen, die Arme fest auf den Leib gepresst. Ein Arzt … Joyce musste sofort einen Arzt rufen! Mühsam suchte er nach Hilfe, drehte verzweifelt den Kopf … und sah Joyce und Anette eng umschlungen, in fiebrig-nervöser Erwartung auf ihn herabstarren …!
Grausamer Schmerz tiefster Erkenntnis schoss glühend heiß durch Geralds Gedärme, während seine zuckenden, schaumverschmierten Lippen ein letztes Mal jenen unsagbar grauenvollen Trugschluss seines Lebens brabbelten: »Left – is – right – and – right – is – wrong …!«
Jan Beinßen
Tödliches Grün
Dreißig Millionen deutsche Gartenbesitzer haben einen Rasen, im Durchschnitt zweihundertfünfzig Quadratmeter groß. Jahr für Jahr verteilen sie fünfzehntausend Tonnen Saatgut – in der vagen Hoffnung, es möge sie dem Traum jenes feinen Zierrasens ein wenig näher bringen, der für Golfplätze typisch ist. Aber freilich gelingt es nur den allerwenigsten.
Ohne unbescheiden klingen zu wollen, möchte ich feststellen: Mir ist es gelungen! Ich habe es fertig gebracht, die perfekte Grünfläche anzulegen. Ich verfüge über das notwendige Selbstvertrauen, um behaupten zu können, dass mein Gras das gesündeste, homogenste und makelloseste in ganz Nürnberg ist und über die feinsten Blätter und zugleich dichteste Narbe verfügt. Ach, was sage ich? Nicht nur in Nürnberg, sondern in ganz Deutschland, wahrscheinlich sogar europaweit.
Nun, ehrlicherweise muss ich mich in einem Punkt korrigieren: Es ist nicht direkt mein Rasen, von dem ich spreche. Zumindest nicht im juristischen Sinn. Eigentümer ist mein Chef, der mich letzten Sommer als neuen Gärtner eingestellt hat. Ein passionierter Golfer, der die satte Farbe des Putting Green auch im Garten seiner Villa genießen wollte.
Diesen Wunsch habe ich ihm erfüllt. Das hat mich viel Mühe, Zeit und Schweiß gekostet, denn was mein Vorgänger mir hinterlassen hatte, kann man nur als rasentechnisches Desaster bezeichnen. Ich musste bei null anfangen und habe mich ganz und gar meiner neuen Aufgabe verschrieben. Mit Erfolg, wie man in diesem Sommer sieht.
Ich mähe ein- bis zweimal täglich auf zwei Zentimeter Länge, dünge fünf- bis zehnmal pro Saison. Schon früh am Morgen ziehe ich meine Bahnen und durchkämme mit Jagdblick die Halme, stets auf der Suche nach dem Unvorstellbaren, dessen Entdeckung immer auch mit dem Gefühl der Scham verbunden wäre: Gänseblümchen und Löwenzahn haben auf meinem Rasen nichts zu suchen!
Dass ich so erfolgreich bin, kommt nicht von ungefähr: Ich kenne mich aus mit der Materie und habe mich gebildet. Von mir erfahren Sie alles, was es über Wiesen zu wissen gibt: Ein Rasen ist im Prinzip nichts anderes als eine künstlich angelegte, nur aus Süßgräsern bestehende und durch regelmäßigen Schnitt kurz gehaltene Pflanzendecke. Durch Verdunstung des Bodenwassers spendet der Rasen im Sommer Kühle, seine Wurzeln bewahren den Boden vor Erosion. Gleichzeitig hat ein hochwertiger Rasen etwas – wie soll ich sagen? – Magisches.
Das beruhigende Grün des erweiterten Seelenraums Rasen kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade bei der intensiven Rasenpflege Nachbarschaftskonflikte unausweichlich sind. Ragen die Äste eines Nadelbaumes auch nur wenige Zentimeter über den Zaun, beeinträchtigt er durch Schattenwurf das Wachstum. »Als Mechanismus der Toleranzschwellenherabsetzung birgt der gepflegte Rasen jede Menge Aggressionspotenziale«, hat mein Anwalt daher sehr treffend schon am ersten Verhandlungstag gesagt.
Aber der Reihe nach. Ich wollte zunächst noch etwas über die Geschichte des Rasens erzählen: Als Ursprungsland des kurz geschorenen Zierrasens gilt England. Seit Elisabeth I. im 16. Jahrhundert ihren Adel zu repräsentativer Gartenkunst ermutigte, entstanden dort weitläufige Lustgärten. Bei uns in Deutschland setzte sich städtischer Rasen vom 19. Jahrhundert an durch, um Freizeitorte für unruhige Proletarier zu schaffen. Die Mittelschicht eroberte den Rasen mit den Wirtschaftswunderjahren, in denen die blühende Gartenkultur auch der Dokumentation des eigenen Erfolgs diente.
Bei einem Kunstprodukt wie dem Rasen geht es um die Schaffung von Homogenität. Noch so ein Wort, das ich erst durch meinen Anwalt kennengelernt habe. Anders ausgedrückt könnte man wohl sagen, dass ich ein ordnungsliebender Mensch sein soll. Was durchaus zutrifft. »Jede Form von Beeinträchtigungen wird von meinem Mandanten als Gefahr für die innere Ordnung des Seelenhaushalts angesehen«, erklärte mein Verteidiger dem Richter.
Stimmt. Die Sache mit den überstehenden Nachbarsbäumen hat mir schlaflose Nächte bereitet. Und tatsächlich sind meine schlimmsten Albträume wahr geworden, als in der beschatteten Zone kleine bräunliche Flecken auftauchten. Ich schlug sofort in meinem Diagnose- und Therapiehandbuch für Rasenkrankheiten nach und überlegte, ob es sich möglicherweise um Anfangszeichen für Brown Patch handeln könnte. Furchtbar! Ich meine: Da kannst du dich doch aufhängen, wenn die Gräser so aussehen. Ich habe es in meiner Not mit kleinen Stickstoffgaben versucht, damit die erkrankten Stellen schneller herauswachsen. Aber das brachte nicht viel. Die einzige Lösung bestand darin, die Nachbarsbäume zu fällen.
Das habe ich getan. Der Nachbar regte sich sehr darüber auf. Er beschimpfte mich und wurde beleidigend. Wenn er sich nur über mich ausgelassen hätte, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber dann begann er damit, meinen Rasen schlechtzureden. Er nannte ihn einen überzüchteten Teppich und ihm fielen noch weitere schlimmere Dinge ein, die ich hier nicht wiedergeben möchte.
Jedenfalls habe ich ihm mit derselben Axt den Schädel zertrümmert, mit der ich zuvor seine Fichten gefällt hatte. Dafür werde ich wohl trotz meines guten Anwalts ins Gefängnis müssen. Es ist ein quälender Gedanke nicht zu wissen, wer sich für den Rest des Sommers um meinen Rasen kümmert.
Angela Eßer
Nessun dorma
Siebenundfünfzig Rentner draußen auf dem Gang und ein toter Busfahrer in der Gerichtsmedizin. Alle mindestens über siebzig, außer dem Busfahrer, der lag knapp drunter. Siebenundfünfzig deutsche Touristen aus Augsburg. Eine komplette Reisegruppe vor seinem Büro. Und bis jetzt vierunddreißigmal dieselbe Geschichte. Commissario Alessandro di Zampone stöhnte. Er konnte sich ausrechnen, wie oft er noch »Aber ich kann doch nichts dafür, Herr Commissario!« hören würde, angereichert mit Krankheitsgeschichten, Schwächeanfällen, Trinkpausen, Familienanekdoten und natürlich Mafia-Gerüchten. Einmal auf Deutsch und dann in der italienischen Übersetzung.
Aber es half alles nichts. Schließlich hatten sie hier einen Toten. Einen toten Busfahrer, der noch vor gar nicht so langer Zeit quicklebendig auf der Via Emilia gefahren war und heute Mittag tot am Tisch lag. Mit dem Kopf im Pastateller, das Gesicht voller Tomatensoße.
Also dann, er atmete tief ein, Nummer fünfunddreißig. »Liebe Signora … äh … Munster …«
»Münsterländer. Signorina, per favore. Signorina Münsterländer.«
»Bene, Signorina Munsterlander. Scusi – entschuldigen Sie, dass Sie haben so lange warten müssen.«
»Das ist schon in Ordnung, Herr Commissario. Wie sagt man: Sie tun auch nur Ihre Pflicht.«
»Si, Signorina.«
Die kleine betagte Dame war ihm sympathisch. Sie wirkte zwar ein bisschen antiquiert, aber sie hatte ruhige klare Augen. Sie würde hoffentlich nicht ausschweifend werden oder gar einen Ohnmachtsanfall bekommen.
»Also, Sie waren mit dieser Reisegruppe schon ein paarmal in Italien. Lombardei, Venedig, Toskana, Latio, und dieses Jahr wollten Sie nun unsere schöne Emilia Romagna entdecken.«
»Si, Commissario. Von Bologna nach Rimini, aber nicht auf der Schnellstraße, sondern einmal wirklich die alte Via Emilia entlang, der Küche Italiens.«
Sie mochte den Mann. Er wirkte zwar ein bisschen überarbeitet und ungeduldig, aber er würde sie verstehen. Und das, obwohl er Willi nicht gekannt hatte. Er hatte Willi ja erst gesehen, als er schon tot war. Commissario Zampone würde sicher nachfühlen können, wie es ihr ging.
Zampone, Zampone … ein schöner Name. Das war doch das italienische Wort für …
»Liebe Signorina, Sie sind also mit der Reisegruppe im Albergho Cagliostro untergebracht. Erzählen Sie mir doch einfach, was passiert ist.«
»Herr Commissario, so einfach ist das nicht!«
»Comme, Signorina?«
Nein, bitte nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Geschichte mit der Katze. Vielmehr dem Kater, der »Pavarotti« hieß und der Nachbarin von diesem Herrn Schmitt gehörte. Und wenn in diesem Albergho nicht ein Pavarotti-Double von Kater herumgestreunt wäre …
»Wissen Sie, in der Albergho ist die Maria so ein bisschen Mädchen für alles. Sie macht uns das Frühstück, kocht dort, kümmert sich um die Blumen und hat immer ein freundliches Wort für uns. Und bei all den Touristen, die sie jeden Tag sieht und die sicher nicht immer pflegeleicht sind, hat sie trotzdem gute Laune. Jeden Morgen steht sie im Frühstücksraum, macht uns wunderbaren Cappuccino und summt dabei Nessun dorma. Und wenn Maria nicht dieses Nessun dorma gesungen hätte …«
Wieso jetzt Nessun dorma, dachte Zampone, nicht der Kater?
»Nessun dorma?«
»Ja, Sie kennen dieses Lied doch sicherlich.«
»Si, Signorina, ich kenne das Lied.«
»Herr Schmitt … also, Sie kennen doch Herrn Schmitt jetzt … der hat dann manchmal mit eingestimmt, wenn auch völlig falsch. Aber Maria hat gelacht und mit ›bene, bene‹ gelobt. Ja und dann lief dieser Kater durch das Albergho, aber das werden Ihnen die anderen ja sicherlich schon alles erzählt haben.«
»Si, Signorina.«
Er holte tief Luft. Also doch der Kater. Warum musste er sich eigentlich immer und immer wieder diese dämliche Geschichte anhören?
»Herr Schmitt hat dann ›Pavarotti!‹ gerufen und … stellen Sie sich vor, der Kater ist tatsächlich gekommen, obwohl der doch sicher ganz anders heißt. ›Pavarotti?‹, hat Maria erstaunt gefragt und Herr Schmitt hat von dem Kater seiner Nachbarin erzählt. Maria fand das sehr lustig und hat dann angefangen, von Pavarotti zu erzählen, also dem echten, Sie wissen schon, diesem großen Sänger. Schließlich stammt er ja aus dieser Gegend, aus Modena.«
»Si, Signorina.«
Oh, sie sprach Modena ja sogar richtig aus. Die meisten Deutschen zogen das »e« wie einen Kaugummi auseinander, dabei war es doch so einfach.
»Maria schwärmte von seiner wunderbaren und einmaligen Stimme und erzählte, dass Pavarotti auch ein großartiger Hobbykoch gewesen sei. Und sie hätte sogar das Originalrezept seiner Piccantina.«
»Das Originalrezept von Pavarotti?
»Ja. Sie hat es natürlich nicht von Pavarotti direkt, aber sie hat eine Schwägerin, deren Tante es ihm wohl«, sie räusperte sich, »abgeschwatzt hat. Aber es ist das Originalrezept. Und da hat Herr Schmitt sie überredet … Sie müssen wissen, Herr Schmitt ist ein Mann mit sehr viel Charme«, erklärte sie und errötete dabei. »Also, er hat eine Blume aus der Vase vom Tisch genommen und Maria gebeten, es für uns zu kochen. Maria hat strahlende Augen bekommen und gesagt, dass es ihr eine Freude wäre. Sie wurde allerdings gleichzeitig ein wenig verlegen und erklärte, sie hätte leider keinen original Aceto, denn der wäre doch so teuer, ob sie auch etwas anderes kochen könne. Aber da hat sie Herr Schmitt unterbrochen, sie in den Arm genommen und gesagt, das wäre überhaupt kein Problem, er hätte welchen auf seinem Zimmer …«
»Aceto Traditionale di Modena?« Alessandro di Zampone hob die Augenbrauen.
»Ja, den original Essig und nicht das, was wir von zu Hause aus dem Supermarkt kennen. Herr Schmitt war ganz stolz und freute sich sehr, uns allen dieses kleine Vermögen zu spendieren. Wissen Sie, so viel vom Leben haben wir auch nicht mehr und …«
»Und diese Maria hat wirklich das Originalrezept von Pavarottis Piccatina?«
»Natürlich, Herr Commissario. Maria lügt nicht, das hätte ich gemerkt!«
»Und sie wollte wirklich das Rezept mit Aceto Traditionale machen?«
»Aber sicher, Herr Schmitt hat ihr die Flasche gegeben.«
Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Unglaublich, Pavarottis Piccatina und er hatte nicht einmal mehr ein paar Kekse in seiner Schublade. Er wollte endlich nach Hause, auch wenn es da keine Piccatina gab. Er holte tief Luft. »Signorina, wie ging es dann weiter?«
»Ja, wie ging es dann weiter? Lassen Sie mich kurz nachdenken. Es war ja so eine Aufregung, weil Herr Schmitt den Aceto holen ging und Willi, also der Busfahrer, ich meine, der Tote …«
»Si?«
»Willi hat sich so fürchterlich aufgeregt, er wollte doch mit uns den Ausflug wieder zu so einer Fattoria machen. Da sollte eine Weinprobe stattfinden, so wie das Willi jedes Jahr für uns arrangiert. Und dort sollte es auch Aceto geben, aber jetzt hatte Herr Schmitt doch schon welchen gekauft. Ja, und dann sollte diese Fahrt nun ausfallen, wegen der Piccantina. Herr Schmitt hat versucht, ihn zu beruhigen, und ihm versprochen, wir würden den Ausflug einfach später machen. Und das, obwohl ich von Herrn Schmitt weiß, dass er bei der Weinprobe keinen Wein mehr kaufen wollte. Er hat nämlich zu mir gesagt, zu Hause würde der Wein nie so gut schmecken wie hier in Italien.«
Langsam wurde Alessandro di Zampone ungeduldig. Weinprobe, Piccantina, Pavarotti hin oder her. Der Busfahrer war tot und das ganz bestimmt nicht, weil er sich ein bisschen aufgeregt hatte.
»Signorina, was ist dann passiert?« Er trommelte mit den Fingern auf den Tisch.
»Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass Maria den Tisch gedeckt hat. Ja, und Parmesan, den frisch geriebenen, den hat sie auch auf den Tisch gestellt. Willi war … also, er war eigentlich putzmunter!«
»Signorina Munsterlander, der Busfahrer war nicht putzmunter, sondern lag irgendwann tot am Tisch!« Alessandro di Zampone schaute die kleine alte Dame forschend an. Jetzt war Schluss, er hatte keine Lust, noch stundenlang immer dieselbe Geschichte zu hören.
»Vielleicht hatte er ja einen Herzinfarkt, Herr Commissario, das kann passieren in dem Alter. Und außerdem hat Willi immer so viel getrunken, obwohl er doch noch den Bus fahren musste. Es war alles ganz schrecklich, aber ich kann doch nichts dafür, Herr Commissario!«
Da war es also schon wieder. Jetzt also zum fünfunddreißigsten Mal:»Aber ich kann doch nichts dafür, Herr Commissario!« Der Busfahrer war aufgedunsen, völlig grün im Gesicht und die Augen waren schreckgeweitet gewesen, aber keiner konnte etwas dafür. Di Zampone fasste sich an den Bauch. Und jetzt fing auch noch sein Magen an zu knurren.
»Signorina, Sie saßen doch alle mit am Tisch und wollen nichts gemerkt haben? Impossibile – unmöglich, das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Sie müssen mir glauben, Herr Commissario. Willi war ganz normal. Immer noch aufgebracht, aber er hat sich wahrscheinlich auch auf die Piccatina gefreut …«
»Piccatina, Piccatina, Piccatina«, di Zampone spuckte die Worte förmlich aus. »Signorina Munsterlander, so kommen wir nicht weiter. Ihrem Busfahrer ging es morgens wunderbar, er regt sich ein bisschen auf …«, drohend stellte er sich vor sie, »Signorina, hier ist ein unschuldiger Busfahrer gewaltsam zu Tode gekommen und niemand kann sich an irgendwas erinnern. Es muss aber irgendwas passiert sein und … maledetto! Wissen Sie was, ich glaube, dass eine Nacht hier in der questura bei Ihnen allen wieder ein bisschen die Erinnerung auffrischen würde, was halten Sie davon?«
»Aber Herr Commissario, Sie wollen uns alte Leute doch nicht etwa … und außerdem, so unschuldig war Willi nun wiederum auch nicht!«
»Come prego?«
»Mir haben zu Hause all diese gekauften Weine nie so gut geschmeckt wie in Italien. Herrn Schmitt übrigens auch nicht, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Und mein Grappa, den ich letztes Jahr auf so einer Fattoria gekauft habe … so ein schöner bernsteinfarbender … also der war ganz merkwürdig. Und dann habe ich, ganz zufällig, Herr Commissario, das müssen Sie mir glauben, also, da habe ich gehört, wie Willi zu jemandem am Telefon gesagt hat, wie wunderbar es doch wäre, dass so alte Omis, stellen Sie sich vor, er hat wirklich ›alte Omis‹ gesagt, also, dass alte Omis auf den Urlaubsfahrten ihre Rente nicht mehr in Rheumamatratzen und Heizdecken investieren würden, sondern in deutschen Schnaps mit …« Sie stockte.
»Ascoltano, Signorina …«
»Stellen Sie sich vor, er hat einfach billigen deutschen Schnaps mit einem schönen italienischen Etikett beklebt und …«, sie räusperte sich, »ich möchte gar nicht wissen, wie er es geschafft hat, dass der Schnaps so gelblich wurde.«
Der Commissario verschränkte seine Arme. Soso, gelblicher deutscher Schnaps. Sicher, hier wurde an jeder Ecke falscher Parmaschinken, falscher Parmesan und natürlich auch falscher Aceto Tradizionale verkauft. Aceto, der eigentlich teurer war als so manches Parfüm. Aber gelblicher Schnaps? Il pasticcio! Was für eine verrückte Geschichte. Wahrscheinlich kam jetzt wieder, wie schon vierunddreißigmal vorher, dass die Mafia einen unliebsamen Konkurrenten ausgeschaltet hätte. Aber hier in seiner Romagna gab es keine Mafia. Dass die Deutschen immer so eine Fantasie hatten. Hier gab es die eine oder andere Gaunerei, aber keine Mafia.
»Also ich glaube, dass die Mafia irgendetwas damit zu tun hat.«
Di Zampone beugte sich langsam auf seinem Stuhl nach vorne und sah sie durchdringend an.
»Adresso finito – jetzt ist Schluss, Signorina, und jetzt hören Sie mir einmal genau zu. Hier schaltet die Mafia keinen deutschen Busfahrer aus, weil er ein bisschen gepanschten Wein oder deutschen Schnaps mit falschem Etikett an Sie verkauft hat.« Er machte eine kurze Pause. »Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, SIE, liebe Signorina, SIE allein fühlten sich betrogen. SIE wollten ihn bestrafen und niemand anders …«
Er sah, wie sich das Gesicht der kleinen alten Dame dunkelrot färbte und sie die Augen schloss.
»Aber es war doch nur eine kleine Tablette, Herr Commissario …«
Di Zampone hielt die Luft an. Madonna mia, das konnte doch nicht wahr sein, sie hatte tatsächlich den Busfahrer … »Eine kleine Tablette? Signorina, der Busfahrer ist tot!«
»Es ist alles nur passiert, weil Maria den frisch geriebenen Parmesan für die Pasta auf den Tisch gestellt hat und wenn sie nicht Nessun dorma gesungen hätte …«
»Wenn, wenn, wenn … Signorina, bleiben Sie bei der Sache!«
»Entschuldigen Sie, Commissario, ich versuche, es Ihnen zu erklären. Wenn Willi … also Willi hat das Essen immer so hinuntergeschlungen und … er hat wirklich nichts gemerkt … aber, Herr Commissario, es kann doch nicht sein, dass so eine kleine Tablette«, sie schaute ihn mit großen Augen an, »das kann doch nicht sein, oder?«
Di Zampone schwieg.
»Nun, Herr Commissario, Sie kennen das noch nicht, aber in einem gewissen Alter fällt manchmal das Einschlafen schwer. Vor allem in einer fremden Umgebung und für diesen Fall, nun … der Arzt hat gemeint, es wäre ein vollkommen biologisches Mittel.«
»Signorina, ich verstehe nicht ganz.«
»Herr Commissario, manchmal, aber wirklich nicht sehr oft, trinke ich ein Gläschen Rotwein und dann … dann nehme ich eine kleine Schlaftablette. Und bei Willi, da dachte ich …«
»Si?«
»Willi war doch immer noch völlig außer sich, weil der Ausflug mit der Weinprobe nun jetzt nicht … und außerdem wollte er …, da dachte ich, dass Willi ein kleiner Mittagschlaf gut tun würde.«
»Also, eine Ihrer kleinen Tabletten?«
»Natürlich, Herr Commissario, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur die Tablette mit dem Löffel zerdrückt und über den Parmesan, der vor Willi stand, gestreut.«
Er schloss die Augen und rief sich den Speisesaal noch einmal ins Gedächtnis. Der tote Busfahrer mit dem Gesicht in der Pasta und überall die Tomatensoße.
»Von einer kleinen Schlaftablette stirbt aber niemand!« Di Zampone atmete schwer ein. »Es reicht jetzt, Signorina, raus mit der Wahrheit!«
Das Telefon auf seinem Tisch klingelte. Di Zampone fluchte. »Pronto?«
Der Gerichtsmediziner. Endlich bekam er den Bericht über den toten Busfahrer. Jesubambini! Er konnte kaum glauben, was er da hörte. Ein harter Schlag, vor allem auf seinen leeren Magen. Langsam legte er den Hörer wieder auf.
»Signorina, Ihre kleine Tablette, die …«
»Sie müssen mir glauben, Herr Commissario. Ich habe ihm nur eine Tablette untergemischt. Wirklich nur eine.«
Nessun dorma.
Niemand schläft. Außer Willi.
Di Zampone kratzte sich am Kopf. »Signorina, bitte!«, flehte er und lief in seinem Büro auf und ab. Er hörte, wie die kleine alte Dame anfing zu schluchzen.
»Wirklich nur eine. Ich meine … jeder …«, flüsterte sie.
»Was haben Sie gerade gesagt?« Er drehte sich ruckartig um und starrte sie an.
»Nichts! Ich sage jetzt gar nichts mehr!«
Di Zampone ließ sich auf einen Stuhl fallen und nickte. Nein, er brauchte nicht noch einmal nachzufragen, er hatte verstanden und lachte plötzlich leise auf.
Alle waren von Willi betrogen worden, alle wollten sich ein klein wenig rächen. Alle nur ein klein wenig.
Er hatte noch den Gerichtsmediziner im Ohr, der nicht nur eine kleine Schlaftablette gefunden hatte, sondern auch Rheumapillen, Schilddrüsenpräparate, Abführmittel und Herztabletten. Eine halbe Urlaubsapotheke, die der Busfahrer hinuntergeschlungen hatte. Incredibile, unglaublich.
Jetzt fällt es mir wieder ein, dachte Signorina Münsterländer, zampone heißt auf Deutsch »gefüllter Schweinsfuß«. Schlimm, mit so einem Namen herumlaufen zu müssen.
Nicola Förg
Jessas!
Fanny Lang war wirklich keine, die sich einmischte. Schon gar nicht beim Nachbarn Alois Strobl. Als der Alois Strobl senior noch gelebt hatte, da war der Kontakt ein ganz anderer gewesen. Der Senior war bei den Trachtlern D’ Mittagsstoaner Mitglied und lange Jahre Feuerwehrkommandant gewesen. Er war Jager und mehrfacher Schützenkönig. Ein pfundiger Bursche, wiewohl rein figürlich eher ein sehr zaches, dürres Manderl. Aber sein Herz war eben pfundig gewesen. Als er ablebte, trauerte die ganze Gemeinde. Fast schon der ganze Landkreis. Die Kirche hatte den Ansturm der Trauergäste gar nicht bewältigt. Der Friedhof auch nicht. Der Junior war hingegen seltsam unbeteiligt am Grab gestanden, da war seine Cousine, die im fernen Chiemgau, gut hundert Kilometer entfernt, lebte, ja mehr erschüttert gewesen. Die Mutter vom Alois, die gute Hedwig, war ja schon vor Jahren gestorben, auch sie eine honorige Dorfbewohnerin, keine hatte je mehr eine solche Geranienpracht erreicht! Man musste sich wirklich fragen, wie der Sohn so hatte werden können … Also so ganz anders eben.





























