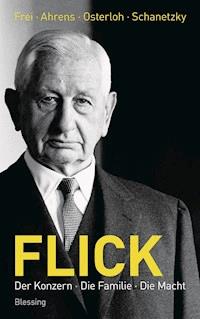Inhaltsverzeichnis
Einführung
I. Ein Konzern entsteht
Aufstieg
Im Siegerland
Inflation und Spekulation
Stabilisierung und Rationalisierung
Auf dem Gipfel
An der Ruhr und in Polen
Im Stahlverein
Gelsenberg-Affäre
Eigene Wege
Energie
Der mitteldeutsche Konzern
Organisation und Entscheidung
Nach neuen Regeln
Autarkie
Aufrüstung
»Arisierung«
II. Krieg und Prozess
Ein saturierter Konzern?
Revirements und Arrondierungen
Verträge und Verfügungsmacht
Grenzüberschreitungen
Oberschlesien
Rombach
Vairogs
Dnjepr-Stahl
Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im Altreich
Kohle für den Krieg
Stahl, Geschütze und Granaten
Räder müssen rollen …
Der Familienkonzern
Entschachtelung
Finale Konzentration
Geld und Macht
Nürnberg
Ermittlungen
Verhandlungen
Revisionen
III. Rückkehr und Auflösung
Unter alliierter Kontrolle
Auf verlorenem Posten
Vor dem Nichts?
Um den Erhalt des Konzerns
»Neuanfang« im Westen
Abschied von der Steinkohle
Der »neue« Konzern
Kontinuität und Aufbruch
Schatten der Vergangenheit
Entschädigungsansprüche
Im Visier der DDR-Propaganda
Krisen und Auflösung
Erbhofkrieg
Probleme im Strukturwandel
Das Ende
IV. Eine deutsche Karriere
Der Spaziergänger
Politik und Privatkastanien
Landschaftspflege
Mythos Flick
Konzernsaldo
Erbgänge
Anhang
Anmerkungen
Zeittafel
Abkürzungen
Quellen
Literatur
Personenregister
Copyright
Einführung
Fragt man im feinen Konstanzer Inselhotel nach Friedrich Flick, bekommt man noch heute eine seltsame Geschichte zu hören: Bei schönem Wetter habe sich der hoch betagte Dauergast früh morgens oft zur Uferpromenade fahren lassen. Dort sei er Richtung Yachthafen spaziert, wo seine Limousine bereits auf ihn wartete. Nicht selten habe der Chauffeur ihn dann zum Ausgangspunkt zurückgebracht – und die Ertüchtigung begann von neuem: mit herrlichem Blick über den Bodensee, vor sich die imposante Alpenkette, der Morgensonne entgegen.
Die vier Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind, mögen die Details der Anekdote ein wenig abgeschliffen haben; aber vielleicht wirkt sie gerade deshalb wie ein Gleichnis auf die Karriere des Friedrich Flick. Im späten Kaiserreich geprägt, seinen Aufstieg im Ersten Weltkrieg nehmend, die schwierigen Jahre der Weimar Republik geschickt überstehend, im »Dritten Reich« von Erfolg zu Erfolg getragen, gelang dem Selfmademan in den fünfziger Jahren nochmals ein sagenhafter Aufstieg. Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, NS-Boom und Krieg, Nürnberger Prozess, Gefängnis und Wirtschaftswunder – unbeirrbar, so scheint es, schritt Flick über alle wirtschaftlichen und politischen Brüche des 20. Jahrhunderts hinweg. Vorwärts, immer nur vorwärts.
Zu Beginn der zwanziger Jahre war Friedrich Flick bereits aus der Siegerländer Provinz in die Spitze der deutschen Wirtschaftselite vorgestoßen. Vom Stahl kommend, engagierte er sich in der Kohleförderung, im Maschinenbau, in der Chemie- und Papierindustrie. Die Unternehmen, an denen er sich beteiligte, produzierten Badewannen und Eisenbahnwaggons, Flugzeuge und Autos, Sprengstoffe, Panzer und Geschütze. Mit den Beteiligungen wechselten die Schauplätze. Der Sohn eines Holzhändlers und Bauern begann im heimatlichen Umkreis, aber schon bald betätigte er sich überall im Deutschen Reich, dann in den Niederlanden, in Polen, Belgien und Frankreich; seine Erben investierten schließlich auch in den USA.
Weil Flick mit keinem Unternehmen, keiner Branche und keiner Region wirklich identifiziert werden kann, blieb seine Karriere das bis heute einzig Fesselnde an diesem Mann. Er gehört nicht in die Reihe großer Gründerfiguren wie Bosch, Siemens oder Krupp. Technologische Innovation, sozialpolitisches Engagement oder auch nur einen einzigen Betrieb, dessen Schicksal über seinen Tod hinaus mit der Familie verbunden geblieben wäre – all das sucht man bei Flick vergebens. Stattdessen ist sein Name zum Synonym für politischen Opportunismus und den skrupellosen Einsatz wirtschaftlicher Macht geworden.
Zweimal überdauerte Flicks Karriere seinen politisch-moralischen Bankrott: 1932, als er den Konkurs nur dank skandalumwitterter staatlicher Unterstützung abwenden konnte, und nach 1945, als ihm die Amerikaner den Prozess machten – zu offensichtlich war sein Erfolg im Nationalsozialismus gewesen, seine Bereicherung an jüdischem Vermögen, der Profit aus Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit. Nicht zuletzt wegen dieser Vorgeschichte schlug Anfang der achtziger Jahre das politische Beben der »Flick-Affäre« die bundesdeutsche Öffentlichkeit über Monate in Bann. Wie es schien, waren sich die Methoden der politischen Einflussnahme im »Hause Flick« seit den zwanziger Jahren auf fatale Weise gleich geblieben. Diesen dritten Skandal überstand der Konzern nicht.
Sich mit Flick zu beschäftigen bedeutet weit mehr, als das Drama der deutschen Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert am Beispiel eines ihrer umstrittensten Protagonisten nachzuzeichnen. Die Karriere des Industriellen – und die seiner Nachkommen – war immer mit der großen Politik verwoben. Die Flicks machten Politik, waren Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und dienten der Politik als Vehikel der Propaganda. Das begann in der Weimarer Republik, setzte sich in Nürnberg fort, wo Flick als erster deutscher Industrieller für sein Handeln in der NS-Zeit zur Rechenschaft gezogen wurde, und endete nicht in der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz des Kalten Krieges. Je mehr Flick sein öffentliches Bild selbst zu bestimmen suchte, desto mehr galt er der Öffentlichkeit als Exponent eines verhassten Kapitalismus.
Flicks öffentliche Wirkung auf die unternehmerischen Tatsachen zurückzuführen: Darin liegt die eigentliche Herausforderung. Es gilt – anders als in älteren, meist journalistischen Darstellungen1 – Friedrich Flick als Unternehmer ernst zu nehmen. Und es gilt, den Konzern als Ganzes im Blick zu halten. Bei aller Unübersichtlichkeit rasch wechselnder Kapitalbeteiligungen muss die Frage nach der individuellen Verantwortung gestellt werden: für »Arisierung« und Zwangsarbeit, aber auch für die vielen anderen Entscheidungen, die Hunderttausende von Menschen tangierten. Wie war Flicks Holding organisiert, wer traf welche Entscheidungen? Wie weit reichte überhaupt der Einfluss der kleinen Zentrale in Berlin, die bereits Ende der dreißiger Jahre Unternehmen mit rund 100 000 Beschäftigten kontrollierte?
Dieses Buch ist nicht das erste, das den Versuch unternimmt, Flicks Imperium zu durchleuchten. Kim Christian Priemel hat unlängst eine »Konzerngeschichte« vorgelegt, die besonders auf Flicks wechselnde Kapitalbeteiligungen und seine Versuche blickt, sich den jeweils geltenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen.2 So lässt sich zwar die Entwicklung des Konzerns erzählen, nicht aber die Geschichte seines Eigentümers. Allein die Gewinnoptimierung kann die Komplexität einer Persönlichkeit wie Friedrich Flick nicht erklären: Auch ein Unternehmer ist kein Mann ohne Eigenschaften. Flick lässt sich weder auf den Typus des risikofreudigen Spekulanten reduzieren, noch war er der traditionsbewusste Eisenhüttenmann, als der er sich selbst so gerne sah.
Flick entwickelte früh ein bemerkenswertes taktisches Geschick im Umgang mit Aktionären, Konkurrenten und Politikern. Und schon bald wollte er seine persönliche Herrschaft als Unternehmer dauerhaft gesichert wissen. Das hatte Folgen für die Führung und Expansion des Konzerns und erklärt am Ende auch dessen Untergang. Während andere Industriellenfamilien wie Quandt, Oetker oder Haniel einen Weg für die Erbfolge fanden, der den Bestand ihrer Konzerne sicherte, zeigte Flicks Lebenswerk nur wenige Jahre nach seinem Tod bereits erste Auflösungserscheinungen. Es überdauerte seinen Gründer nur um 13 Jahre.
Wer die Geschichte von Flick verstehen will, muss deshalb dem Mann an der Spitze, auf den alles zulief – im Konzern, in der Familie und in der öffentlichen Auseinandersetzung -, gebührende Aufmerksamkeit zollen. Dabei muss die unternehmerische Logik seiner Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. Denn ob es um die Beteiligung an der »Arisierung« ging oder darum, staatliche Subventionen einzufordern: Es war Flick, der entschied, und zwar in der Regel aus konkreten ökonomischen Motiven heraus. Diese gilt es aufzuklären und nach ihren politischen und moralischen Implikationen zu befragen.
Eine Darstellung, die zum historisch-politischen Kern vorzudringen sucht, muss die bis heute fortwirkenden Mythen der öffentlichen Debatte über Flick nicht nur aus dem Weg räumen, sie muss diese selbst zum Thema machen. Das verlangt, das gesamte 20. Jahrhundert in den Blick zu nehmen und nicht etwa bei der Betrachtung des Konzerns in der NS-Zeit stehen zu bleiben. Flicks Verhalten in den zwölf Jahren des »Tausendjährigen Reiches« aufzuklären, wie es die Autoren eines weiteren kürzlich erschienenen Buches unternommen haben, hat besonderes Gewicht.3 Aber man wird es befriedigend nur analysieren können, wenn man von Flicks erster Karriere nicht absieht. Denn schon Ende der zwanziger Jahre, während seines Aufstiegs zur beherrschenden Figur des weltweit zweitgrößten Montankonzerns, zeigte Flick, dass er sein Handwerk verstand. Er hatte es im Ersten Weltkrieg gelernt und in den frühen Nachkriegsjahren perfektioniert.
Flicks dritte Karriere schließlich, begonnen nach seiner Haftentlassung 1950, als er schon im Rentenalter war, darf nicht nur als trotziger Reflex auf die NS-Zeit gesehen werden. Sie ist eine Geschichte eigenen Rechts. Aber die Bedingungen des Wirtschaftens in der prosperierenden Bundesrepublik veränderten sich so rasch, dass die Denkmuster des Patriarchen bald immer häufiger zum Hindernis wurden und die notwendige unternehmerische Anpassung unterblieb. Lange vor dem letzten großen Skandal, der sich mit dem Namen Flick verband, konnte von einer Erfolgsgeschichte deshalb schon keine Rede mehr sein.
Dabei hatten sich Flicks Techniken der Macht über vier politische Systeme hinweg als effektiv erwiesen. Seine unternehmerischen Erfolge begannen im Ersten Weltkrieg mit Geschäften, die sich hart am Rande der Legalität bewegten. Der Siegerländer lernte früh, diskret zu disponieren, mit der Politik zu kalkulieren und sich auf Umbrüche einzustellen. Den Weg in die Unternehmerelite des Ruhrgebiets und zur Beherrschung der Vereinigten Stahlwerke fand er über ebenso komplizierte wie bestens abgeschirmte Finanzgeschäfte. Nachdem ihn der Staat in der Weltwirtschaftskrise vor dem sicheren Bankrott gerettet hatte, begann Flick mit dem Aufbau eines eigenen Konzerns. Es lag in der Konsequenz dieses Handelns, dass er seit 1933 zielstrebig und kühl kalkulierend die Chancen nutzte, die Aufrüstung und »Arisierung« boten.
Der Einsatz politischer Netzwerke setzte sich fort bei der Aneignung fremden Eigentums in den besetzten Gebieten, und diese Expansion beruhte ebenfalls auf nüchternem Kalkül. Längst eingespielt war auch die Arbeitsteilung zwischen der kleinen Berliner Konzernzentrale und den großen Tochterunternehmen, die einerseits geschäftspolitische Freiräume genossen, andererseits der laufenden Kontrolle unterlagen und sich im Zweifelsfall der Autorität des Konzernchefs zu beugen hatten. Der massenhafte Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter war Ergebnis dieser Arbeitsteilung: Er fiel zwar in die Verantwortung der einzelnen Unternehmen, beruhte in einigen Geschäftsfeldern aber unmittelbar auf Flicks persönlicher Entscheidung.
Auch nach der Katastrophe hielt Flick am Ideal des persönlichen Regiments in einem nach außen abgeschotteten Familienkonzern eisern fest. Weder der Nürnberger Prozess noch die Landsberger Haftzeit konnten den Alten erschütterten, und die Entflechtungspolitik der Besatzungsmächte bewahrte ihn letztlich davor, in der bald einsetzenden Kohlekrise zum großen Verlierer zu werden. Bei der Abwehr der alliierten Forderungen und mehr noch beim Neuaufbau des Konzerns agierte Flick auf gewohnte Weise; auch sein Comeback während der fünfziger Jahre war geprägt von verdeckten Firmenkäufen und der Verdrängung störender Aktionäre. Ebenso hielt er an der Gewohnheit fest, mit Spenden politische Kontakte zu pflegen und bei sich bietender Gelegenheit zu nutzen – etwa beim erneuten Einstieg in die Rüstungsproduktion.
Flick investierte gezielt in moderne Branchen, und doch trug der erneute Aufstieg bereits Zeichen der Orientierungslosigkeit. Das Ende des Konzerns wird man deshalb nicht allein seinen Erben anlasten können, denen das neue Imperium erst nach dem Ende des Wirtschaftswunders in den Schoß fiel. In ihrem Bestreben, die beim neuerlichen Konzernumbau anfallenden Gewinne mit allen Mitteln am Fiskus vorbeizuleiten, folgten sie freilich ganz den Prinzipien des Gründers.
Friedrich Flick war ein versierter Manipulator, der – nüchtern kalkulierend und doch nicht frei von Sentimentalität – alles tat, um die eigene Souveränität zu garantieren. Diesen persönlichen Herrschaftsanspruch setzte er auch gegenüber seiner Familie rücksichtslos durch. Mit dem gerichtsnotorischen Zerwürfnis zwischen dem Patriarchen und seinem ältesten Sohn begann eine neue Serie öffentlich zelebrierter Affären, die das Interesse eines kritischer werdenden Publikums auf vielfache Weise bedienten. Deshalb genügt es nicht, das Ende des Konzerns als eine bloße Skandalchronik zu beschreiben. Vielmehr muss die Geschichte der Flicks in Beziehung gesetzt werden zum gesellschaftlichen Wandel seit den sechziger Jahren. Dann erst erschließt sie sich: nicht zuletzt als die Geschichte der politischen Öffentlichkeit in einem Land, das sich seiner Vergangenheit zunehmend bewusst zu werden begann.
I. Ein Konzern entsteht
Aufstieg
Anfang der zwanziger Jahre veröffentlichte der Journalist Karl Becker eine Reihe von Presseartikeln, die von einem besonders ruchlosen Unternehmer handelten. Dieser kaufe heimlich Aktien von Montanunternehmen, erobere Hauptversammlungsmehrheiten, kombiniere die Gesellschaften miteinander, schlachte deren Vermögen skrupellos für neue Geschäfte aus und mache auf diese Weise gewaltige Profite. Kaum jemand kannte den Namen, und der Journalist schien besessen davon, ihn endlich bekannt zu machen: Friedrich Flick. Diesem waren solche Artikel unangenehm, Diskretion trug entscheidend zum Erfolg seiner Geschäfte bei. Ob er Becker für einen Querulanten hielt oder für einen kriminellen Erpresser, ist ungewiss. Doch als er erfuhr, dass der Journalist reißerische Dossiers über ihn in Unternehmerkreisen anbot, kaufte er ihm sein Material kurzerhand ab. Während der nächsten zwei Jahrzehnte stattete Flick Becker regelmäßig mit Geld aus und gewährte ihm am Ende noch eine private Rente.
Dass bis heute wenig über die frühen Jahre Friedrich Flicks bekannt ist und sich umso mehr Mythen um seinen Aufstieg ranken, zählt zu den größten und dauerhaftesten Erfolgen eines Unternehmers, der zeitlebens alles daran setzte, sein öffentliches Bild selbst zu kontrollieren. In den ersten Jahren ließ sich das noch leicht mit etwas Geld bewerkstelligen, da Flick tatsächlich ein unbekannter Außenseiter war. Wäre es nach ihm gegangen, hätte sich daran auch nichts geändert. Spätestens 1923 war diese Strategie aber nicht mehr durchzuhalten, weil Flicks Beteiligungsimperium inzwischen eine Größe erreicht hatte, die sich kaum noch verheimlichen ließ.1
Als die Berliner Journalisten sich für den Homo novus zu interessieren begannen, tappten sie lange im Dunkeln. In der Kriegswirtschaft und während des großen Durcheinanders der Inflationsjahre sei Flick wohl »mit beiden Füßen in den Kessel des Umschichtungsprozesses« gesprungen, »ein paarmal tüchtig untergetaucht« und dann als »neuer schwerindustrieller Trustkönig wieder zum Vorschein« gekommen. Fünf Jahre nach Kriegsende, so der Wirtschaftsjournalist Felix Pinner 1923, galt der unbekannte Siegerländer unter seinen Branchenkollegen und bei den Direktoren der Großbanken längst als einer »der Mächtigsten, Erfolgreichsten und Geschicktesten«. In diese Bewunderung mischte sich allerdings auch Skepsis, denn Flick war nicht der einzige Unternehmer, der in dieser Zeit mit spekulativen Aktiengeschäften binnen kürzester Frist zu gigantischem Reichtum gelangte. Doch im Gegensatz zu den »Königen der Inflation« wie Hugo Herzfeld oder Camillo Castiglioni setzte sich Flicks Erfolg unter wechselnden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen über Jahrzehnte fort.2
Mit enormem Fleiß und großer Disziplin, in einer Mischung aus taktischem Geschick und Skrupellosigkeit hatte Friedrich Flick seinen Weg gemacht. Da passte es ins Bild, dass sich der Unternehmer aus einfachsten Verhältnissen emporgearbeitet und eine geradezu amerikanische Karriere hingelegt hatte. Nicht ohne Bewunderung hoben selbst die alliierten Ermittler nach dem Zweiten Weltkrieg Flicks »bescheidene Herkunft aus einer kleinbäuerlichen Familie« hervor. Dabei geriet ein wenig aus dem Blick, dass Flicks familiärer Hintergrund, seine Ausbildung und auch seine ersten Karriereschritte für eine Unternehmerlaufbahn im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts keineswegs untypisch waren. Sieht man von den großindustriellen Dynastien ab, rekrutierte sich der unternehmerische Nachwuchs zu dieser Zeit meist aus Familien, die entweder bereits kaufmännisch tätig waren oder als Beamte und Bildungsbürger für eine gute Ausbildung sorgten.
Der am 10. Juli 1883 in Ernsdorf bei Kreuztal im Siegerland geborene Friedrich Flick genoss neben der Unterstützung durch seine Familie vor allem den Rückhalt eines regionalen Milieus, das seine Entfaltung nachhaltig begünstigte. Der Vater Ernst Flick betrieb die karge Ernsdorfer Landwirtschaft längst nur noch im Nebenerwerb und betätigte sich in dem alten Industrierevier vor allem als Holzhändler. Er muss recht erfolgreich gewesen sein, denn über die Jahre hatte der alte Flick Anteile an einer Reihe Siegerländer Erzgruben erworben. Noch viele Jahrzehnte später sprach Flicks Vetter Konrad Kaletsch mit Hochachtung von seinem Patenonkel, der ein »harter und mit seinen stahlblauen, durchdringenden, beinahe beherrschenden Augen auch hartköpfiger Mann« gewesen sei. Ernst Flick hatte die Namen seiner drei Söhne ganz im Geist des jungen Kaiserreichs gewählt: Der Erstgeborene hieß Wilhelm, der Jüngste Otto. Den protestantischen Kaufmannshaushalt regierten »Bescheidenheit« und »eiserner Fleiß«. Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse in der Verwandtschaft, etwa bei den Eltern Konrad Kaletschs, dessen Mutter aus der Familie Flick stammte. Sie hatte in eine Kreuztaler Kaufmannsfamilie eingeheiratet, die nicht nur eine Gastwirtschaft betrieb, sondern sich auch im Eisenhandel betätigte.3
Friedrich Flicks Ausbildung entsprach diesem bürgerlichen Familienhintergrund: Als »Fahrschüler« pendelte er mit der Bahn zum Siegener Realgymnasium, dem er 1901 nach der elften Klasse mit leidlichen Noten den Rücken kehrte. Dank väterlicher Protektion konnte der »Einjährige« eine kaufmännische Lehre bei der Actien-Gesellschaft Bremerhütte in Kirchen an der Sieg beginnen. Es folgte der einjährig-freiwillige Militärdienst beim 167. Infanterie-Regiment in Kassel. 1905 ging Flick zum Studium an die kurz zuvor gegründete Handelshochschule in Köln, wo er im Sommer 1907 mit durchweg vorzüglichen Noten seinen Abschluss als Diplomkaufmann machte. In Köln studierte Flick unter anderem bei Eugen Schmalenbach, einem frühen Verfechter der modernen Bilanztheorie und einer systematischen Kostenrechnung im Unternehmen. Aufgrund seiner 1919 publizierten »Grundlagen dynamischer Bilanzlehre« gilt Schmalenbach als einer der Gründerväter der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland. Flick hat später zwar betont, dass die Ausbildung in Köln für seinen »Werdegang von außerordentlicher Bedeutung« war; dem Kreis der wesentlich jüngeren so genannten »Schmalenbach-Schüler« kann er gleichwohl nicht zugerechnet werden. Zwar ist belegt, dass Flick die Kölner Universität 1925 mit 100 000 Mark unterstützte. Aber Grund für diese Stiftung waren weder sentimentale Studienerinnerungen noch dauerhafte Verbundenheit mit seinem akademischen Lehrer. Die Spende war ein Mittel zum Zweck und diente dem Erwerb der Ehrendoktorwürde.4
Die Ausbildung an der Kölner Handelshochschule zeichnete sich weniger durch ihren akademischen Charakter aus als vielmehr durch Praxisnähe: Es wurde nicht nur in Volks- und Betriebswirtschaftslehre, sondern auch in Französisch, Rechtslehre und »mechanischer Technologie« geprüft. Daneben standen Schreibmaschinenschreiben und Stenografie auf dem Lehrplan. Die praxisorientierte Ausbildung dürfte Flick gefallen haben, denn er hielt engen Kontakt zu seinem Lehrbetrieb, über dessen Buchhaltung und Selbstkostenrechnung er dann seine betriebswirtschaftliche Abschlussarbeit schrieb. Seine volkswirtschaftliche Arbeit über »Neuere Geschichte und gegenwärtige Lage des Siegerländer Eisensteinbergbaues« befasste sich ebenfalls mit der Wirtschaft des heimischen Reviers. Die »recht tüchtige Arbeit« zeigte, dass Flick sich ein fundiertes eigenes Urteil über die Strukturprobleme des Siegerlandes gebildet hatte. Noch bevor er die letzten Prüfungen absolviert und am Ende mit Auszeichnung bestanden hatte, konnte er einen ersten Arbeitsvertrag unterschreiben – als kaufmännischer Bürovorsteher der Bremerhütte, die ihm schon wenig später Prokura erteilte.5
Im Siegerland
Die gesellschaftliche und politische Bedeutung der Eisen- und Stahlbranche in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ist am ehesten mit der Bedeutung der Automobilindustrie gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu vergleichen. In diesem Wirtschaftszweig trat Friedrich Flick im Alter von 24 Jahren seine erste Führungsposition an. Er blieb fünf Jahre bei der Bremerhütte, die sich während dieser Zeit zwar auf Modernisierungskurs befand, deren finanzielle Lage aber so angespannt blieb, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden konnten. Flick hat in der Rückschau wiederholt betont, seine Lehrjahre bei Unternehmen mit knapper Kasse seien für ihn besonders prägend gewesen. Ein solches Unternehmen war zweifellos auch seine nächste Station, die Eisenindustrie zu Menden und Schwerte AG, die am Nordrand des Sauerlandes ein Stahlund Walzwerk betrieb. Menden und Schwerte war zwar ein Sanierungsfall, aber Flick bot sich hier die Chance auf einen Vorstandsposten, und so wechselte er im Frühjahr 1913 von der Sieg an den Rand des Ruhrreviers. Die neue Position als kaufmännischer Direktor versetzte den 29-Jährigen in die Lage, um die Hand von Marie Schuss anzuhalten, der Tochter eines angesehenen Siegener Textilhändlers und Stadtrats. Einen Monat nach dem Aufstieg in den Vorstand fand die Hochzeit statt: Der Holzhändlersohn und frischgebackene Hüttendirektor hielt Einzug im Establishment des Siegerlandes.6
Der junge Hüttendirektor Friedrich Flick heiratet 1913 Marie Schuss, Tochter aus gutem Siegener Haus.
Weniger erfreulich war die geschäftliche Lage von Menden und Schwerte, denn das Unternehmen war dringend auf frisches Geld angewiesen. Flick veranlasste zunächst einmal einen Kapitalschnitt und akquirierte neue Mittel von über drei Millionen Mark. So konnten die Verluste der Vorjahre gedeckt, neue Rücklagen gebildet und dringend erforderliche Sonderabschreibungen vorgenommen werden. Flick dürfte froh gewesen sein, als sich ihm zwei Jahre später die Gelegenheit bot, ins Siegerland zurückzukehren. Die Aktiengesellschaft Charlottenhütte in Niederschelden an der Sieg war auf der Suche nach einem Nachfolger für den kaufmännischen Vorstand Ernst Schleifenbaum, der die Leitung der Dillinger Hütte an der Saar übernommen hatte. Flicks Berufung bedeutete nicht nur einen weiteren Karriereschritt, sondern war vor allem auch ein Beleg für das Ansehen, das er sich im Siegerland inzwischen erworben hatte; im Aufsichtsrat der Charlottenhütte waren neben den Schleifenbaums mit Heinrich Macco, Adolf Oechelhäuser und Viktor Weidtmann maßgebliche Vertreter der regionalen Wirtschaftselite versammelt. 7
Die Charlottenhütte war eines von vier großen Montanunternehmen im Siegerland und galt als finanziell solide. Von der Kohle abgesehen, verfügte das Unternehmen über sämtliche Einrichtungen der Stahlproduktion einschließlich eigener Erz- und Kalkgruben. In ihren beiden Hochöfen stellte die Charlottenhütte zunächst Roheisen her, wobei zugekaufter Koks als Energieträger diente. Das Roheisen war nur ein Zwischenprodukt, ein stark kohlenstoffhaltiges, sprödes Metall, das weder geschmiedet noch gewalzt werden konnte. Erst im Stahlwerk reduzierte die Charlottenhütte den Kohlenstoffgehalt. Dazu setzte man das sogenannte Siemens-Martin-Verfahren ein, bei dem Roheisen gemeinsam mit Schrott zu Stahl gekocht wird. Der Rohstahl wurde dann zu Brammen vergossen und anschließend im Walzwerk weiterverarbeitet. Dort erst entstanden echte Handelsprodukte wie Bleche, Schienen, Träger und Stabstahl. Daneben unterhielt die Charlottenhütte aber auch eine Schmiede und eine Gießerei, deren Fertigprodukte vor allem bei der Eisenbahn sowie im Schiff- und Maschinenbau Abnehmer fanden.8
Im Gegensatz zu den vielen kleinen Konkurrenten im Siegerland war die Charlottenhütte zwar ein integrierter Betrieb. Aber der Vergleich mit der Konkurrenz in den Montanrevieren an Ruhr und Saar, in Oberschlesien und Lothringen fiel gleichwohl ernüchternd aus. Flick war kaufmännischer Direktor eines Unternehmens, das nicht einmal ein Prozent des deutschen Stahls herstellte. Ein einziges Stahlwerk an der Ruhr übertraf die Erzeugung der Charlottenhütte mühelos um das Zehnfache. Krupp beispielsweise fabrizierte zwanzig Mal so viel Rohstahl, und der Ausstoß der Essener Gussstahlfabrik lag fast doppelt so hoch wie die Gesamtproduktion sämtlicher Unternehmen des Siegerlandes. Zudem fehlte der Charlottenhütte die eigene Kohle, was im deutschen System der über Kartelle und Syndikate organisierten Produktion erhebliche Mehrkosten zur Folge hatte. Während die integrierten Werke an der Ruhr ihre Kokskohle selbst förderten, hatte die Charlottenhütte neben den deutlich höheren Einkaufspreisen auch die Transportgebühren zu tragen.9
Diese strukturellen Nachteile der Siegerländer Industrie waren seit vielen Jahren bekannt und durch Subventionen – vergünstigte Bahntarife, Kohlenbezug von staatlichen Zechen außerhalb des Syndikats – etwas abgemildert worden. Der Krieg jedoch schuf völlig neue Bedingungen. Genau an diesem Punkt setzte der junge kaufmännische Direktor an: Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt präsentierte Flick seinem Aufsichtsrat einen ersten ambitionierten Fusionsplan. Nach Überwindung einigen Widerstands übernahm die Charlottenhütte Anfang 1916 den »in Normalzeiten in ewigen Nöten gewesenen« Cöln-Müsener Bergwerks-Actienverein, der in Kreuztal drei Hochöfen betrieb und bei Müsen über ein eigenes Erzbergwerk verfügte. Noch im gleichen Jahr gliederte sich die Charlottenhütte zwei zusätzliche Eisensteinzechen an, die Gewerkschaft Knappschaftsglück im benachbarten Neunkirchen sowie, etwas weiter entfernt, die Gewerkschaft Louise im oberhessischen Nieder-Ohmen. Mit der Eichener Walzwerk und Verzinkerei AG in Kreuztal kam anschließend ein reiner Verarbeitungsbetrieb hinzu. Im letzten Kriegsjahr kulminierte die Einkaufstour in vier Übernahmen. Neben der Brachbacher Erzgrube Wernsberg waren das drei weitere Verarbeitungsbetriebe: die beiden Feinblechstraßen der Siegener Ax, Schleifenbaum & Mattner GmbH, das Walzwerk der Siegener Eisenindustrie AG, vormals Hesse & Schulte in Weidenau, sowie die Siegener Eisenbahnbedarf AG. Während die Charlottenhütte die kleineren Betriebe mit flüssigen Mitteln einfach aufkaufte, wickelte sie die größeren Geschäfte stets nach demselben Muster ab; sie erhöhte ihr Kapital und entschädigte die Eigentümer der Übernahmebetriebe teils mit eigenen Aktien, teils mit zusätzlichen Barzahlungen. Zwischen Kriegsbeginn und Sommer 1919 vervierfachte sich die Bilanzsumme der Charlottenhütte, während sich ihr Aktienkapital lediglich von 5 auf 12,5 Millionen Mark erhöhte.10
Später ist dieses vom »Neuerer und Gestalter« Friedrich Flick angestoßene Fusionsfieber als weitsichtige strukturpolitische Tat beschrieben worden, die nur wegen der Trägheit und des Egoismus alteingesessener Unternehmerfamilien nicht zum erwünschten Erfolg, zu den angeblich angestrebten »Vereinigten Siegerländer Werken« geführt habe. Richtig daran ist, dass die unter Flicks Federführung von der Charlottenhütte umgesetzte Strategie einem bereits seit Längerem anhaltenden Trend folgte. Schon die in der Vorkriegszeit zwischen Ruhr und Sieg ausgetragenen Konflikte um die Roheisen- und Stahlwerksverbände hatten gezeigt, dass ein Zusammenschluss der kleinen Werke im Siegerland auf mittlere Sicht unumgänglich war. Um die Rationalisierung der Branche voranzutreiben, wollte die Ruhrindustrie dem Siegerland in den Syndikaten nur noch eine Gesamtquote zugestehen, die dann innerhalb der Region auf die einzelnen Werke aufzuteilen war. Ziel dieser Politik waren integrierte Großbetriebe, in denen die einzelnen Produktionsstufen vom Bergbau über die Eisen- und Stahlproduktion bis hin zur Weiterverarbeitung zusammengefasst waren. Mit der Angliederung kleinerer Werke konnten deren Verbandsquoten auf die wenigen zukunftsfähigen Betriebe übertragen werden.
Integrierte Betriebe profitierten besonders von den Syndikaten, die den Markt regelten. Sie vermieden einen ruinösen Wettbewerb, sprachen ihre Preise ab und einigten sich auf Produktionsquoten. Ein reines Hüttenwerk hatte beispielsweise hohe Syndikatspreise für Kokskohle zu bezahlen; indem es eigene Bergwerke erwarb und Kohle künftig im Selbstverbrauch bezog, konnte es seine Kosten senken. Ein reines Walzwerk zahlte Verbandspreise für Stahlblöcke oder Halbzeug; sobald es sich einem Hütten- und Stahlwerk anschloss, konnte es zum Selbstkostenpreis mit Rohmaterial beliefert werden. Gemischte Werke profitierten auf jeder Produktionsstufe von den beträchtlichen Zwischengewinnen. Räumlich integrierte Betriebe konnten zudem sparsamere Techniken einsetzen. Standen die Hochöfen ununterbrochen im Feuer, diente ihr Gichtgas als wichtige Energie- und Kraftquelle für den gesamten Betrieb.11
Die entscheidenden Voraussetzungen für den aggressiven Wachstumskurs der Charlottenhütte schuf der Krieg. Zwar stellte diese kaum direkten Heeresbedarf her, aber sie profitierte, wie die gesamte Branche, von der gewaltigen und bis dahin unvorstellbaren Nachfrage nach Stahl – Stahl für Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände. Im Laufe der ersten beiden Kriegsjahre wurde immer deutlicher, dass der Waffengang nicht länger ein rein militärisches, sondern mehr noch ein industrielles Kräftemessen war, das die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft erforderte. In den großen Abnutzungsschlachten des Jahres 1916 wurde mitunter an einem einzigen Tag mehr Munition verschossen als im gesamten Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Mit dem im Spätsommer 1916 von der Obersten Heeresleitung aufgelegten Hindenburgprogramm sollte die Rüstungsproduktion durch zusätzliche Arbeitskräfte, die Beseitigung von Rohstoffengpässen und mittels einer verbesserten Organisation deutlich gesteigert werden. Zu diesem Zweck wurden die Unternehmen stärker als bisher in die Kriegswirtschaftsverwaltung einbezogen. In einem unübersichtlichen und leicht korrumpierbaren System aus privat-öffentlichen Kriegsgesellschaften, Selbstverwaltungskörperschaften, Zwangssyndikaten und staatlichen Behörden dominierten nun die Repräsentanten der Industrie die Rohstoffbewirtschaftung. 12
Flick nutzt seit 1915 die Chancen, die der Erste Weltkrieg einem kleinen Stahlproduzenten wie der Charlottenhütte bietet.
Die Rüstungsanstrengungen des Hindenburgprogramms waren die eigentliche Grundlage für den Erfolg der Charlottenhütte, deren Direktor Friedrich Flick sich mit Bravour im politischen Geflecht der Bewirtschaftungsgremien bewegte. Hier erst fand er zum selbständigen Unternehmertum. Flicks Erfolg war eng mit der Kenntnis technischer Prozesse verknüpft, die ihm eine ausgezeichnete Verhandlungsposition verschaffte. Vor allem setzte er auf die Förderung von Manganerz, einen für die Legierung hochfesten Waffenstahls unverzichtbaren Rohstoff, der bis zum Beginn der Seeblockade in geringem Umfang zwar auch im Inland gefördert, in viel größeren Mengen aber aus Nordafrika und Südamerika bezogen wurde. Im Krieg fielen diese Importe aus, während der Bedarf enorm anstieg. Plötzlich rückte die Charlottenhütte mit ihrer Manganerzförderung in eine kriegswichtige Position, und Flick verstand es, sie für sein Unternehmen zu nutzen.
Der Erfolg der Charlottenhütte verdankte sich letztlich einem Zufall. Unter der Leitung des technischen Vorstandes Wilhelm Petersen hatte man auf der Hütte in Niederschelden seit geraumer Zeit an einem Verfahren getüftelt, bei dem Stahlspäne und manganhaltige Schlacken im Hochofen eingesetzt werden sollten. Die Schlacke wurde seit Jahrzehnten ungenutzt auf Halde geschüttet, und auch die bei der Weiterverarbeitung in den Drehereien anfallenden Stahlspäne galten als Abfall. Die technischen Versuche zur Weiterverwertung dieser Rohstoffe konnten auf der Charlottenhütte bis Ende 1916 erfolgreich abgeschlossen werden. Flick hatte sie nach Kräften gefördert, bot das Verfahren doch Aussicht auf stark sinkende Selbstkosten. Während die Schlacken praktisch zum Nulltarif vor der Hütte lagerten, lieferten die Drehspäne einen höheren Eisengehalt als jedes Erz. Im Krieg bot sich deshalb ein Tauschgeschäft an, das unter regulären Marktverhältnissen undenkbar gewesen wäre: Während die Charlottenhütte große Teile ihrer Manganerzförderung an die Konkurrenz abgab, wurde sie von dieser mit Drehspänen versorgt, die bei der Waffen- und Munitionsproduktion verstärkt anfielen.13
Die im Herbst 1916 neu gegründeten halbstaatlichen Kriegsgesellschaften waren das Einfallstor für diese Strategie. Binnen kurzer Frist entstand hier ein System neuer Syndikate. So koordinierte die Eisenzentrale in mehreren Untergesellschaften nicht nur die Verteilung der knappen Manganerze, sondern auch die Interessen der Schrotthändler und -verbraucher. Den Händlern wurde eine feste Gewinnmarge zugestanden, wenn die anfallenden Schrottmengen in vollem Umfang wiederverwertet wurden – in Friedenszeiten sorgten die Schrotthändler bei sinkenden Profiten immer wieder für künstliche Angebotsverknappungen, um auf diese Weise den Preis nach oben zu treiben. Im Krieg war das politisch unerwünscht. Für den Handel mit Stahlspänen wurde sogar eine eigene Gesellschaft errichtet, um den wertvollen Rohstoff vollständig erfassen und innerhalb des Bewirtschaftungssystems vom gewöhnlichen Schrott trennen zu können. Zugleich sorgte die Eisenzentrale dafür, dass Schrott und Späne aus den besetzten Gebieten abtransportiert und für die deutsche Kriegswirtschaft nutzbar gemacht wurden. Darunter fiel auch der Kriegsschrott von der Front – für die Unternehmen ein besonders effektiver Verwertungskreislauf. Allerdings lud das Bewirtschaftungssystem zur Selbstbedienung förmlich ein, da die von den Gremien beschlossenen Kontingente mit den tatsächlichen Lieferungen häufig nicht übereinstimmten und auch beim Bahntransport immer wieder Engpässe auftraten.14
Flick repräsentierte die Charlottenhütte persönlich in den Beiräten von Eisenzentrale und Spänehandelsgesellschaft. Dort knüpfte er zum ersten Mal Kontakte außerhalb seines heimischen Reviers. Es gelang dem jungen Hüttendirektor, die mangelnde Transparenz des Systems für sich zu nutzen und die Interessen seines Werkes äußerst wirkungsvoll zu vertreten. Beim Kommissariat der Eisenzentrale baute er auf die Unterstützung durch Rittmeister Walter Tag – ein Geschäftskontakt, der, wie andere Kontakte aus dieser Zeit auch, in Flicks späterer Karriere noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Die Eisenzentrale sorgte dafür, dass die Charlottenhütte, neben der Siegener Rolandshütte, unter den westdeutschen Werken vorrangig mit Spänen beliefert wurde. Diese Vorzugsbehandlung galt selbst dann, wenn der Konkurrenz dadurch Schaden entstand. Die einzigartige Position der Charlottenhütte lässt sich daran ablesen, dass dem kleinen Werk im ersten Halbjahr 1917 fast 17 Prozent aller im Reich verfügbaren Drehspäne zugeteilt wurden.15
Die Bilanz für das Geschäftsjahr 1917/18 fiel entsprechend großartig aus. Trotz der zahlreichen Unternehmensübernahmen schwamm die Charlottenhütte förmlich im Geld. Allein die flüssigen Mittel in Höhe von rund 20 Millionen Mark übertrafen das Aktienkapital um mehr als das Doppelte. Binnen drei Jahren hatten sich die Bankguthaben um das Neunfache, der Wertpapierbesitz sogar um das Zwanzigfache vergrößert. Dabei verschleierte die Handelsbilanz das wahre Ausmaß der Gewinne noch, obwohl die Charlottenhütte inzwischen eine Dividende von 24 Prozent an ihre Aktionäre ausschüttete – dreimal so viel wie im ersten Kriegsjahr. Die Abschreibungen lagen fünfmal so hoch wie 1915, und im Bilanzposten »Vorräte« dürften gegenüber den ausgewiesenen 1,8 Millionen Mark noch erhebliche stille Reserven geschlummert haben. Trotz der offenkundig glänzenden Geschäftslage beklagte der Vorstand in seinen alljährlichen Berichten rituell die kriegsbedingten »Hemmnisse und Erschwerungen des Betriebes«, den Mangel an geeigneten Betriebsstoffen und geschulten Arbeitern sowie die »außergewöhnliche Entwertung der Werksanlagen«.16
Das war eine gezielte Täuschung der Öffentlichkeit, denn beim Volk kamen die hohen Kriegsprofite nicht gut an. Während die Lebensmittelversorgung zusammenbrach, die Bevölkerung im »Steckrübenwinter« hungerte und fror, profitierten die Unternehmen von den verstärkten Rüstungsanstrengungen. Sie provozierten Unruhe an der »Heimatfront« und fanden sich in einer Reihe mit dubiosen »Schiebern« und »Kriegsgewinnlern«. Im Dezember 1916 war bereits eine Reichstagskommission eingesetzt worden, in der die Kriegslieferungen und vor allem die dabei erzielten Gewinne genauer unter die Lupe genommen werden sollten. Dieser Hintergrund erklärt, warum die Charlottenhütte in den von Flick verantworteten Geschäftsberichten immer knappere Angaben über die Gewinnverwendung machte und stattdessen lieber die verhältnismäßig geringen Einzahlungen in den Arbeiterversorgungsfonds hervorhob. Auch gegenüber den Behörden war es nicht opportun, die Gewinnentwicklung offenzulegen. In der Eisenzentrale kam man jedenfalls nach einem gründlichen Bilanzvergleich zu dem Schluss, dass es gar »keinen erhebenden Eindruck« mache, »wenn von einzelnen Werken auch jetzt noch immer die üblichen Klagen über zu niedrige Preise sich in ihren Geschäftsberichten finden«.
Auf die Sicherung des »Burgfriedens« zielte auch das 1916 erlassene Kriegssteuergesetz, das die »Mehrgewinne« der Kapitalgesellschaften zusätzlich besteuerte. Als Berechnungsbasis diente dabei der in den letzten Friedensjahren erzielte Durchschnittsgewinn. Allerdings hatte das Gesetz unbeabsichtigte Folgen – im Fall der Charlottenhütte trug es jedenfalls mit zum Expansionskurs bei. Das preußische Handelsministerium lag durchaus richtig mit seiner Einschätzung, dass bei Flicks Firmenkäufen mitunter sehr hohe Kaufpreisforderungen akzeptiert wurden, nur um »alsdann hierauf beträchtliche Abschreibungen zu machen und so die Höhe der Betriebsgewinne zu verdecken«. Das Kriegssteuergesetz schuf gegenüber diesem Steuersparmodell noch einen zusätzlichen Anreiz zur Expansion: Die Charlottenhütte übernahm nicht nur kleinere Unternehmen, sondern gleichzeitig auch deren steuerlichen Friedensgewinn, so dass auf diesem Wege Kriegssteuern gespart werden konnten.17
Flick dachte über das Kriegsende hinaus. Üblicherweise ließ sich kräftiges Wachstum in der Kriegswirtschaft durch Produktionssteigerung und den Bau neuer Fertigungswerkstätten für den Heeresbedarf bewerkstelligen. Allerdings folgten aus solchen Investitionen auf mittlere Sicht große Risiken, denn ob die neuen Anlagen auch in Friedenszeiten rentabel arbeiteten, war schwer abzuschätzen. Die Charlottenhütte hingegen machte ihre Gewinne vor allem im Einkauf, dank preiswerter Rohstoffe und sinkender Selbstkosten, und schuf sich damit den Spielraum für die Übernahme kleinerer Verarbeitungsbetriebe, deren Produktion zumindest während des Krieges weiterlief. So baute die Charlottenhütte ihre Position innerhalb des Siegerlandes aus und sicherte sich zugleich für die Zeit nach dem Krieg ein großes Rationalisierungspotential. Sollten dann die regionalen Standortnachteile wieder wirksam werden, war es jederzeit möglich, die Neuerwerbungen stillzulegen, ihre Syndikatsquoten auf das Stammwerk zu übertragen und dessen Kapazität nach Bedarf auszubauen. Die steuerlichen Vorteile rundeten diese Strategie ab.
Flick nutzte die ihm sich bietenden Chancen nicht nur zur Vermehrung des Vermögens der Charlottenhütte, sondern auch für sich selbst. Bis heute ist ungeklärt, wie es dem kaufmännischen Direktor gelang, binnen kürzester Zeit zum Hauptaktionär seines Unternehmens aufzusteigen – fest steht nur, dass er die Kapitalmehrheit spätestens 1921 unter seine Kontrolle gebracht hatte. Sobald ein Vorstand einer Aktiengesellschaft in großem Stil deren Aktien privat erwirbt, bewegt er sich grundsätzlich in einer Grauzone. Der Vorstand hat ausschließlich zum Wohle des Unternehmens zu handeln. Falls er im Namen der Gesellschaft Geschäfte macht, bei denen ein unmittelbar privater Nutzen abfällt und das Unternehmen womöglich sogar geschädigt wird, ist die Grenze zur Untreue überschritten. Friedrich Flick hat sich nie selbst dazu geäußert, auf welche Weise er die für seine Karriere entscheidende Hürde vom angestellten Manager zum Mehrheitsaktionär genommen hat. Da die wenigen greifbaren Indizien dafür sprechen, dass sich seine Methoden hart am Rande der Legalität bewegten, schwieg er wohl aus gutem Grund.
Flick begann zunächst heimlich, Aktien der Charlottenhütte zu erwerben. Die Voraussetzungen dafür waren günstig, da die Gesellschaft traditionell einen weit gestreuten Aktionärskreis, aber keinen dominierenden Großaktionär hatte. Hinzu kam, dass Friedrich Flick mit seiner Expansionspolitik selbst entscheidend dazu beitrug, dass sich die Besitzverhältnisse immer wieder wandelten – bei jeder Kapitalerhöhung und bei jedem Aktientausch traten neue Eigentümer auf den Plan. Die vielen Unternehmensübernahmen, bei denen Aktien der Charlottenhütte gegen Anteile der aufgekauften Gesellschaften ausgetauscht wurden, boten besonders günstige Gelegenheiten, um in den Kreis der Charlottenhütte-Aktionäre einzudringen. Flick suchte die Übernahmekandidaten ja selbst aus und führte die Verhandlungen mit den Eigentümern persönlich. Deshalb hatte er es auch in der Hand, sich schon weit vor Abschluss der Fusionsverträge günstig an einem aufzukaufenden Unternehmen zu beteiligen und die so erworbenen Aktien dann in neue Charlottenhütte-Papiere einzutauschen. Dass er so verfuhr, ist freilich durch Quellen nicht belegt. Außerdem lässt diese Erklärung eine entscheidende Frage offen: Woher hatte der aufstrebende Direktor die Mittel, um die Aktien überhaupt erwerben zu können?
Die innerhalb der Familie kursierenden und später auch in mehreren Veröffentlichungen aufgegriffenen Erzählungen, die vor allem auf Flicks eiserne Sparsamkeit und die Mitgift seiner Ehefrau verweisen, geben darauf keine befriedigende Antwort. Die erforderlichen Summen überstiegen diese Ressourcen beträchtlich, belief sich das Aktienkapital der Charlottenhütte am Ende des Krieges doch auf 12,5 Millionen Mark. Plausibler ist die Vermutung, Flicks Familienvermögen habe anfangs eine wichtige Rolle gespielt. Der Grundbesitz in Kreuztal und auch die von seinem Vater über Jahrzehnte hinweg aufgekauften Anteile an einzelnen Erzgruben könnten als Sicherheit für entsprechende Bankkredite hinterlegt worden sein. Mehr noch spricht allerdings dafür, dass Flick tatsächlich hart an der Grenze zur Untreue agierte. Der Unternehmer selbst berichtete später stolz, dass seine Erfolge bei der Charlottenhütte vor allem darauf beruhten, dass er »die Bedeutung des Schrottes richtig erkannte«. Daher wurde vermutet, dass er seine Aktienkäufe aus privaten Erlösen im Schrotthandel bestritten habe, wobei die 1913 in Kreuztal gegründete Flick & Trippe oHG eine entscheidende Rolle spielte.
Diese Firma war im Industrieabbruch tätig und unterhielt die im Schrottgeschäft üblichen Einrichtungen. Neben einem Fallwerks- und Scherenbetrieb verfügte sie über zwei Lagerplätze mit eigenem Bahnanschluss in Kreuztal und Finnentrop. Sie zählte im Spätsommer 1916 zu den Gründungsmitgliedern der halböffentlichen Syndikate, und bereits im Frühjahr 1917 trat ihr »ehrenhafter und im Alteisengeschäft durchaus erfahrener« Gesellschafter Anton Trippe vollständig in den Dienst der Eisenzentrale – unter anderem mit einem von Friedrich Flick ausgestellten Leumundszeugnis. Zum 15. März wurde Trippe der Düsseldorfer Manganversorgungsstelle unterstellt und nahm dort den aus den besetzten Gebieten ankommenden Schrott in Empfang, den er zu bewerten und an die Händler zu verteilen hatte: eine Schlüsselposition par exellence.18
Der zweite Teilhaber an dem Kreuztaler Unternehmen Flick & Trippe war Flicks älterer Bruder Wilhelm, der möglicherweise nur als Strohmann diente. Wilhelm Flick vertrat sein Unternehmen zwar persönlich in den Bewirtschaftungsgremien, schied aber bald nach Kriegsende aus; die Gesellschaft verlegte ihren Sitz daraufhin an Trippes neuen Arbeitsplatz in Düsseldorf, wo sie neutraler als Rheinisches Eisenkontor firmierte. 1922 kaufte Friedrich Flick das Rheinische Eisenkontor auf. Wilhelm Flick übernahm ein landwirtschaftliches Gut bei Lübeck und trat nie wieder im Schrottgeschäft in Erscheinung. Der Händler Anton Trippe hingegen blieb Flick bis in die späten fünfziger Jahre zumindest geschäftlich verbunden.19
Es gibt keinen Beleg dafür, dass Flick & Trippe die Charlottenhütte tatsächlich mit Spänen oder Schrott belieferte. Sicher ist nur, dass Flick mit einem besonders feinen Gespür für die Zeitumstände damit begann, Schrott und Rohstoffe in großen Mengen zu horten. Die in der Bilanz ausgewiesenen Lagerbestände hatten sich allein im letzten Kriegsjahr verdreifacht, während das Effektenkonto rapide zusammenschmolz. Flick rühmte sich später, bei Ausbruch der Revolution sofort mit dem Verkauf von Kriegsanleihen begonnen zu haben, bevor deren Wert ins Bodenlose fiel. Die Erlöse investierte er in wertbeständige Rohstoffe. Dies war ein besonders gutes Geschäft, weil die Einkaufspreise stabil blieben, solange die Kriegsbewirtschaftung andauerte. Das war bis zum Juli 1919 der Fall. Dass die Preise danach explodieren würden, war absehbar. Ihren auf dem Gelände der früheren Brachbacher Hütte eigens angelegten Lagerplatz lastete die Charlottenhütte mit 40 000 Tonnen Schrott, 30 000 Tonnen Koks und 30 000 Tonnen Eisenerz voll aus. Die Stahlspäne lagen so lange auf Halde, dass sie festrosteten und am Ende gesprengt werden mussten.20
Falls Flick & Trippe beim Schrotteinkauf tatsächlich als Zwischenhändler eingeschaltet gewesen sein sollte, müssen große Gewinne abgefallen sein, die vom Gesellschafter Wilhelm Flick womöglich als Kredit an den jüngeren Bruder weitergereicht wurden. Mit diesen Mitteln hätte Friedrich Flick dann Aktien der Charlottenhütte aufkaufen oder eintauschen können. Auch wenn all dies im Ungefähren bleibt, wird man doch davon ausgehen dürfen, dass derartige Formen der »Familienhilfe« wesentlich zu Flicks Aufstieg zum Großaktionär beitrugen.
Besonders anschaulich wird dies bei der Übernahme der Siegener Eisenbahnbedarf AG im Sommer 1918, die im preußischen Handelsministerium noch Jahre später unter dem Verdacht der Vetternwirtschaft stand. Die 1908 gegründete Eisenbahnbedarf war aus der Maschinenfabrik Weiss hervorgegangen und zu einem kleinen Mischkonzern herangewachsen, der jährlich rund 1200 Waggons produzierte. Er unterhielt ein Stanz- und Hammerwerk, ein Presswerk und eine kleine Röhrenfabrikation. Am Aktienkapital von 2,3 Millionen Mark waren die Brüder Carl und Heinrich Weiss mit einer einfachen Mehrheit beteiligt. Die Familien Flick und Weiss waren verschwägert; eine Schwester von Marie Flick war mit Heinrich Weiss verheiratet. Dass die Charlottenhütte den Eisenbahnbedarf-Aktionären einen phänomenalen Kurs von 400 Prozent zahlte, rückte Flick deshalb in ein schlechtes Licht. Allerdings waren die Konditionen durchaus gerechtfertigt: Nach der Übernahme wollten die Gebrüder Weiss ihre Maschinenfabrik aus der Eisenbahnbedarf herauslösen und privat zurückkaufen, so dass die Charlottenhütte mit der Eisenbahnbedarf auch liquide Mittel in Höhe von 5,1 Millionen Mark garantiert übernehmen konnte. Einzelne Betriebe sollten zudem bald stillgelegt und die lukrative Syndikatsquote des Röhrenwerks baldmöglichst verkauft werden. Unter diesen Gesichtspunkten schien der Übernahmepreis also nicht übertrieben hoch.21
Dennoch profitierte Flick zweifellos von seinen verwandtschaftlichen Beziehungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des Verkaufserlöses von der Familie Weiss an den jungen Hüttendirektor zurückflossen. Entscheidend ist jedoch etwas anderes. Gegenüber seinem Aufsichtsrat führte Flick an, dass die Eisenbahnbedarf zwar ein gutes Objekt sei, um überschüssige Mittel der Charlottenhütte anzulegen und auf diese Weise Kriegssteuern zu sparen. Mit Blick auf die Unternehmensstrategie äußerte er sich jedoch zurückhaltend; lediglich der Waggonbau sei für die Hütte interessant, so dass man mit dem Kauf des Betriebes insgesamt wohl »keinen großen Fehlschlag tun« könne.
In Wirklichkeit hatte die Übernahme einen mehrfachen instrumentellen Nutzen. Erneut würde die Charlottenhütte ihr Kapital anheben, was inzwischen vom Staat genehmigt werden musste. Gegenüber dem preußischen Handelsministerium sollte der Erwerb der Eisenbahnbedarf die Ausgabe neuer Charlottenhütte-Aktien rechtfertigen und so für die Genehmigung sorgen. Auch den eigenen Aktionären hatte der Vorstand die Kapitalerhöhung zu erklären, denn anders als in den Vorjahren sollten die meisten von ihnen diesmal leer ausgehen. Flick plante nämlich die Ausgabe von Vorzugsaktien mit einfachem Stimmrecht, die ausschließlich an ein Konsortium aus dem Kreis des Vorstands und des Aufsichtsrates gehen sollten. Auf diese Weise konnten die Hauptaktionäre ihren Kapitalanteil nachhaltig steigern, und Flick selbst durfte nun auch offiziell weitere Aktien der Gesellschaft übernehmen.22
Die neuen Vorzugsaktien sollten in der Hauptversammlung ebenso wie in den Verhandlungen mit dem Ministerium als Vorsichtsmaßnahme präsentiert werden. Seinem Aufsichtsrat hatte Flick schon Monate vorher mitgeteilt, dass in die Aktionärsstruktur der Charlottenhütte Bewegung gekommen sei – ob er bei dieser Gelegenheit seine eigenen Käufe publik machte, ist allerdings fraglich. Im Juni 1918 sorgte er sich jedenfalls noch nicht, dass »Interessenten … der Verwaltung gefährlich werden könnten«. Allerdings mache es der bevorstehende Bilanzstichtag unumgänglich, sich für diese Gefahr zu wappnen, da die vorzüglichen Zahlen womöglich Begehrlichkeiten bei der Ruhrindustrie weckten. Wenige Wochen später segnete die Generalversammlung den Plan ab und beschloss die Schaffung von nominell drei Millionen Mark Vorzugsaktien. Gegenüber dem Ministerium, das sich zunächst strikt gegen das Vorhaben wandte, strich Flick nun heraus, dass »bereits ein außerordentlich großer Besitzwechsel in den Aktien unseres Unternehmens stattgefunden« habe. Er warnte vor einem Angriff August Thyssens auf die Charlottenhütte, die ihre Selbständigkeit zu verlieren drohe und unweigerlich zu einem reinen Zulieferbetrieb der Ruhrindustrie herabsinken werde. Nachdem die Charlottenhütte einige Zugeständnisse gemacht hatte, lenkte das Ministerium ein und genehmigte die Kapitalerhöhung.23
Das Manöver markiert eine wichtige Etappe auf Flicks Weg zum Großaktionär bei der Charlottenhütte, weil auf den Generalversammlungen nun 25 Prozent neue Stimmen auftraten, die dem engsten Führungszirkel sicher waren. Aber auch als Vorstand war er inzwischen in einer komfortablen Position. Dass er seinen Aufsichtsrat im Fall der Eisenbahnbedarf praktisch vor vollendete Tatsachen stellen und es wagen konnte, das Kontrollgremium bei der Übernahme von Ax, Schleifenbaum und Mattner sogar erst nach dem Kauf um Genehmigung zu bitten, bedeutete zwar nicht, dass der Direktor bereits völlig frei über die Charlottenhütte verfügte. Aber seine Führungsrolle war unbestritten. Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich Macco und dem Siegerländer Industriellenspross Fritz Schleifenbaum hatte sich der aufstrebende Direktor vor allem die Unterstützung durch den Kölner Bankier Heinrich von Stein erarbeitet, den er zeitlebens als väterlichen Freund betrachtete. Dieser engste Kreis muss in Flicks Pläne eingeweiht gewesen sein. Deshalb spricht viel dafür, dass er auch den Ausbau seiner eigenen Aktionärsposition bei der Charlottenhütte spätestens seit dem Sommer 1918 mit deren Billigung betrieb. Was als feindliche Übernahme von innen begonnen hatte, wurde nun offenbar als legitimer Besitzanspruch eines überaus erfolgreichen Unternehmers empfunden.24
Am Ende blieb Flicks Expansionsstrategie im Siegerland freilich unvollendet. Der Zusammenschluss mit einem der modernen integrierten Werke innerhalb des heimischen Reviers gelang ebenso wenig wie der Aufbau einer eigenen Versorgung mit Steinkohle. Zu Zeiten der Kriegswirtschaft wäre dies möglich gewesen, danach aber verschlechterten sich die Erfolgsaussichten rapide, weil mit der deutschen Niederlage auch die Produktionsstrukturen und Machtverhältnisse innerhalb der Montanindustrie kräftig durcheinandergewirbelt wurden. Angesichts der von der Ruhrindustrie während der Kriegszieldebatten vehement verfochtenen Annexionspläne, die praktisch auf die gesamte Montanregion zwischen Lothringen und Pas-de-Calais gezielt hatten, musste damit gerechnet werden, dass das Pendel nun in die Gegenrichtung ausschlug. Mit Sicherheit würde die lothringische Industrie wieder an Frankreich fallen. Das aber hieß, dass die Ruhrkonzerne, die im Kaiserreich einen lukrativen Produktionsverbund zwischen lothringischem Minette-Erz und Ruhrkohle aufgebaut hatten – allen voran Stinnes, Thyssen und Klöckner -, zu den strukturellen Verlierern des Krieges gehörten. Sie würden sich verstärkt den verbliebenen deutschen Lagerstätten und vor allem dem Siegerland zuwenden.25
Das von Flick im Spätsommer 1918 gegenüber dem preußischen Handelsministerium noch dramatisch überzeichnete Szenario trat nun wirklich ein und verengte den Spielraum der Charlottenhütte. Mehr noch: Diese wurde nun selbst zu einem höchst attraktiven Übernahmekandidaten für die Ruhrkonzerne. Im wirtschaftlichen Krisenjahr 1919 zeigte sich jedenfalls sehr schnell, dass Fusionsmanöver im Siegerland ungleich schwieriger geworden waren. Flick interessierte sich für die Geisweider Eisenwerk AG – neben der Charlottenhütte das modernste integrierte Werk im Siegerland, das zudem Anteile an einer der wenigen ertragreichen Eisensteingruben hielt. Allerdings kaufte sich nicht nur die Charlottenhütte bei Geisweid ein, sondern auch der Klöckner-Konzern. Auf die gleiche Weise hatte sich Thyssen bei der Friedrichshütte und gemeinsam mit Otto Wolff bei der Vereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener Eisenhütten AG beteiligt. Flicks Fusionsverhandlungen mit den Mehrheitsaktionären von Geisweid zogen sich zwar hin, schienen aber auf dem gewohnt guten Weg zu sein. Dann allerdings machte Peter Klöckner das Geschäft mit Geisweid.
Spätestens im Herbst 1919 wurde offenbar, dass August Thyssen tatsächlich begonnen hatte, Aktien der Charlottenhütte aufzukaufen. Die Lage war damit denkbar unübersichtlich und für Flick bedrohlich geworden. Erschwerend kam hinzu, dass er sich eine naheliegende Verteidigungsstrategie selbst verbaut hatte: Die nun dringend erforderliche Ausgabe von Vorzugsaktien mit Mehrfachstimmrecht, mit denen Thyssens Angriff hätte abgewehrt werden können, erforderte eine erneute staatliche Genehmigung, aber gegenüber dem Ministerium konnte die Charlottenhütte knapp ein Jahr nach ihrem ersten Antrag nicht noch einmal mit der Bedrohung durch ein »großes Werk am Niederrhein« argumentieren.26
Die Zukunft der Charlottenhütte lag jetzt in der Hand des preußischen Handelsministeriums. Dies erklärt, warum Flick im Dezember 1919 »Gefahr im Verzuge« nach Berlin meldete. Anders als im Vorjahr stellte er seinen Antrag schon vor der auf Anfang Januar angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung, in der die Ausgabe von Vorzugsaktien beschlossen werden sollte. Seit dem Sommer hatten Thyssens Aktienkäufe den Kurs der Charlottenhütte von 210 auf 380 Prozent emporschnellen lassen. In seiner Not behauptete Flick, Manganerz sei international gerade besonders gefragt – deshalb drohten »Majorisierungsbestrebungen vom Auslande her«. Auch müsse die Existenz der »ansässigen staaterhaltenden Arbeiterschaft von 4500 Köpfen« gesichert werden. Die Lage war so ernst, dass Flick gegenüber dem Ministerium sogar seine weiteren Pläne offenbarte. Die Vorzugsaktien müssten auch deshalb genehmigt werden, weil er »wegen der Brennstoffversorgung unserer Werke eine Fusion mit einem Kohlenbergwerk angebahnt« habe. Offenbar hatte der Unternehmer den richtigen Ton angeschlagen, denn der Antrag ging diesmal glatt durch. Die Vermischung von unternehmerischen Interessen mit der vermeintlich nationalen Sache war zwar nicht gerade subtil – aber offenbar verfing sie bei den Behörden, und Flick sollte in seiner Laufbahn noch häufig davon Gebrauch machen.27
Trotz der politischen Rückendeckung war die Lage verfahren. Die Fusion mit Geisweid stockte, und die geplante Übernahme der Zeche Königsborn in Unna war ebenfalls noch nicht gesichert. Die Ministererlaubnis versetzte Flick aber immerhin in die Lage, selbst wieder aktiv in das Geschehen eingreifen zu können. Nüchtern hatte er anzuerkennen, dass die Charlottenhütte bei Geisweid so oder so den Kürzeren zog. Allerdings war die bereits zusammengekaufte Beteiligung ein Unterpfand, mit dem man die eigene Unabhängigkeit sichern konnte. Flick bot Thyssen deshalb ein Tauschgeschäft an: Wenn Thyssen seinen Angriff einstellte und die bereits erworbenen Charlottenhütte-Aktien herausgab, sollte er von Flick die für die Mehrheit bei Geisweid erforderlichen Aktien erhalten. Dort würde Klöckner dann den Kürzeren ziehen. Genauso geschah es. Allerdings kam Klöckner der Charlottenhütte danach bei der Zeche Königsborn zuvor. Er versperrte Flick auf diese Weise nicht nur den Zugang zur preiswerten Energieversorgung, sondern errang auch einen Prestigeerfolg.28
Gleichwohl konnte Friedrich Flick nicht unzufrieden Bilanz ziehen. Sein Aufstieg innerhalb der Charlottenhütte kam durch den Aktientausch mit Thyssen zu einem ausgesprochen harmonischen Ende. Die Vereinbarung mit dem Ruhrindustriellen wurde von der Generalversammlung im Januar 1920 wunschgemäß genehmigt. Damit entfiel die Notwendigkeit, die vom Ministerium bereits genehmigten Vorzugsaktien auszugeben. Aber Flick nutzte die abgewendete feindliche Übernahme, um die bereits vorhandenen Vorzugsaktien mit fünffachem Stimmrecht ausstatten zu lassen. Damit hatten sich die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens endgültig zu seinen Gunsten verschoben. Zwar ist unklar, ob Flick persönlich die Charlottenhütte-Aktien von Thyssen übernahm, und auch der Umfang seiner bereits bestehenden Kapitalbeteiligung ist nicht bekannt. Aber der Schlüssel für die vollständige Kontrolle über die Gesellschaft lag nun bei den nominell drei Millionen Mark Vorzugsaktien: Sie allein waren für die einfache Hauptversammlungsmehrheit hinreichend.
Selbst wenn die von Flick gehaltenen Stamm- und Vorzugsaktien zu dieser Zeit noch nicht für die Mehrheit ausgereicht haben sollten, war ihm der Weg zur Kontrolle durch den Beschluss vom Januar 1920 doch erleichtert worden. Wer im engen und vertrauten Kreis der Vorzugsaktionäre lediglich an einer einträglichen Kapitalbeteiligung, nicht aber an der Leitung des Unternehmens interessiert war, dem konnte Flick nun ein attraktives Angebot machen. Für beide Seiten war ein Austausch von Stamm- gegen Vorzugsaktien vorteilhaft. Flick kam damit nur knapp fünf Jahre nach seinem Dienstantritt ans Ziel: Er übernahm die Macht bei der Charlottenhütte. Spätestens im Jahr darauf stieg er endgültig zum Mehrheitsaktionär auf, denn im Sommer 1921 sanktionierte die Hauptversammlung seine starke Position offiziell. Als Generaldirektor mit voller Handlungsvollmacht war der 38-jährige Friedrich Flick künftig berechtigt, das Unternehmen allein zu vertreten.29
Inflation und Spekulation
Unternehmen sind, um erfolgreich wirtschaften zu können, auf verlässliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen angewiesen. Das ist ein Gemeinplatz, aber er muss dringend in Erinnerung gerufen werden, wenn man Flicks atemlosen Expansionskurs der Jahre 1920 bis 1923 betrachtet. In dieser Phase schien nichts berechenbar zu sein: Die junge Republik war politisch fragil, es herrschten zum Teil bürgerkriegsartige Zustände. Zwar trat der Versailler Vertrag Anfang 1920 in Kraft, doch blieb die ökonomisch bedrohliche Reparationsfrage ebenso offen wie die Regelung der deutschen Ostgrenze. All dies hatte unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen, da sich unter diesen Bedingungen ein allgemeiner »Inflationskonsens« herausbildete. Der schon im Krieg begonnene Verfall der Währung schritt weiter voran, weil die Regierung die Offenlegung der zerrütteten Staatsfinanzen scheute.
Auf der anderen Seite gestattete der Geldwertschwund nicht nur die stille Liquidation der Kriegsschulden, er förderte auch den Export und stützte auf diese Weise die Wirtschaft. Durch die Inflation koppelte sich die deutsche Wirtschaft von den Konjunkturkrisen in den Siegernationen ab und vermied nicht nur einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sondern auch die damit zwangsläufig verbundene Zuspitzung der gesellschaftlichen Konflikte. Die Reparationsleistungen konnten unter diesen Bedingungen leichter aufgebracht, gleichzeitig aber für die Misere politisch verantwortlich gemacht werden.
Für risikofreudige und nervenstarke Unternehmer eröffneten sich hier beträchtliche Gewinnchancen. Zwar erforderte der Geldwertschwund immer häufigere Anpassungen. In einem Klima allgemeiner Preissteigerungen ließen sich die Preise jedoch schneller erhöhen als Löhne und Gehälter, die stets mit einigem Abstand hinterherhinkten. Für die Unternehmen war diese Konstellation äußerst lukrativ, solange sie die Gewinne umgehend wieder investierten. Hinzu kam, dass die Gerichte die Gültigkeit des Nominalwertprinzips bestätigten: Eine Mark blieb eine Mark. Wer Schulden hatte oder neue aufnahm, konnte sie in entwerteter Währung faktisch zum Nulltarif begleichen. Unter diesem Rechtsprinzip litten nicht nur die Gläubiger, sondern besonders der breite Rentiersmittelstand, der sein Einkommen aus Vermögenserträgen bestritt. Sofern diese Klientel über keine anderen Einnahmen verfügte, konnte sie von Zinsen und Dividenden nicht mehr leben, sondern musste an die Substanz und Wertpapiere Stück für Stück verkaufen. Auf diese Weise kamen kleinere Aktienpakete auf den Markt, die sonst niemals gehandelt worden wären. Hinzu traten die beträchtlichen politischen Risiken, die viele zur Kapitalflucht animierten und selbst wohlhabende Großaktionäre über einen Verkauf ihrer Beteiligungen nachdenken ließen.
Die Inflation warf die bestehenden Verhältnisse über den Haufen. Sie bestrafte das Festhalten an alten Positionen und belohnte alle, die ihre Dynamik durchschauten und die Mittel besaßen, sich anzupassen. Sie erschien den meisten wie ein großes Durcheinander, schuf zunächst aber durchaus berechenbare Verhältnisse. So war die Kaufkraft der Mark bis Anfang 1920 auf ein Zehntel des Vorkriegswertes gesunken, und nach weiteren zweieinhalb Jahren betrug sie nur noch ein Hundertstel. Aber erst danach steigerte sich der Wertverfall ins Absurde.30
Flick war sich wie viele Unternehmer über die Funktionsweise der Inflation im Klaren, stand er doch schon seit Jahren vor dem praktischen Problem, die Gewinne seines Unternehmens vor Wertverlust schützen zu müssen. Daher beteiligte sich die Charlottenhütte an der allgemeinen Flucht in die Sachwerte. Nach den gescheiterten Expansionsprojekten Geisweid und Königsborn strebte Flick eine Fusion mit der Vereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener Eisenhütten AG an. Die Verhandlungen scheiterten am Dissens mit dem Großaktionär Otto Wolff. Zwar verkörperte der lebensfrohe Rheinländer das genaue Gegenteil des asketischen Siegerländers Flick, aber beide wandten ähnliche Methoden an.
Das Kölner Handelshaus hatte sich vorgenommen, in die Stahlindustrie einzudringen, und wollte van der Zypen an die Ruhrunternehmen Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb und Rheinische Stahlwerke AG angliedern, an denen es sich ebenfalls beteiligte. Flick hingegen interessierte sich vornehmlich für die Wissener Anlagen und sah sich von Wolff getäuscht, der eine mündliche Absprache brach und mit Thyssen abschloss. Das persönliche Verhältnis zwischen Flick und Wolff, ohnehin von vorsichtigem Respekt und gegenseitigem Misstrauen zweier konkurrierender Aufsteiger geprägt, war durch den Streit um van der Zypen auf Jahre hin belastet. Für Flick fiel damit das letzte große Übernahmeobjekt innerhalb des Siegerlandes fort. Die integrierten Werke waren nun ebenso in Konzernbesitz wie die wichtigsten Erzgruben. Die restlichen Betriebe mochten zwar als Geldanlage dienlich sein, boten jedoch keine Aussicht auf ein langfristig erfolgreiches Engagement. Besonders abschätzig äußerte sich Flick über seinen einstigen Lehrbetrieb Bremerhütte, bei dem in jüngster Zeit eine »große Kapitalverwässerung« eingetreten sei.31
In dieser Situation regte Friedrich Schleifenbaum ein Alternativprojekt an, das den Rahmen der bisherigen Pläne und Geschäfte der Charlottenhütte in jeder Hinsicht sprengte. Seine Familie zählte nicht nur zu den Hauptaktionären des Unternehmens, sondern war auch an einer der ergiebigsten Erzgruben des Reviers beteiligt, der Gewerkschaft Neue Haardt in Weidenau. Schleifenbaum leitete dieses Unternehmen, dessen Kapitalmehrheit seit 1917 bei der Bismarckhütte lag. Über die oberschlesische Muttergesellschaft gut informiert, machte er Flick den Vorschlag, die feindliche Übernahme der Bismarckhütte zu wagen. Mit Schleifenbaums Hilfe konnte Flick seinem Aufsichtsrat im Mai 1920 einen ambitionierten Plan vorstellen: ein über 900 Kilometer entfernt tätiges Unternehmen zu majorisieren, das mit rund 15 000 Beschäftigten doppelt so groß war wie das eigene.
Als besonderes Risiko kam hinzu, dass die Bismarckhütte in umkämpftem Gebiet lag. Seit Kriegsende wurde in internationalen Verhandlungen über die Zugehörigkeit des oberschlesischen Industriereviers zum Deutschen Reich gerungen. Der neu gegründete polnische Staat beanspruchte den wichtigsten Teil des Territoriums für sich. Zwar hatte man sich 1919 auf eine Volksabstimmung verständigt; sie sollte aber erst 1921 stattfinden. In der Zwischenzeit tobte in der Region ein Kampf zwischen Deutschen und Polen, der immer wieder zu Streiks führte. Gleichzeitig fürchteten die deutschen Behörden, dass Oberschlesien in die Hände der »Bolschewisten« fallen könnte. Polizeieinheiten und Freikorps schlugen deshalb nicht nur mehrere polnische Volksaufstände blutig nieder, sondern griffen immer wieder auch mit Waffengewalt in betriebliche Auseinandersetzungen ein. Die militärisch aussichtslosen Erhebungen sensibilisierten die europäische Öffentlichkeit zunehmend für das Problem Oberschlesien. Eine Einigung war nicht in Sicht.32
Um sich über die vor diesem politischen Hintergrund höchst unsicheren Perspektiven für die Industrie Oberschlesiens zu informieren, wandte sich Flick an Jakob Reichert, den Geschäftsführer des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, und regte eine Denkschrift an. Ausgearbeitet wurde sie von Otto Steinbrinck, dem intelligenten und energischen Kapitänleutnant a. D., der es als U-Boot-Kommandant auf 202 versenkte Handelsschiffe gebracht hatte und als Träger des Ordens Pour le mérite zu den gefeierten Helden des Ersten Weltkrieges zählte. Seine zivile Laufbahn, die in Reicherts Büro gerade erst begonnen hatte, führte ihn bald darauf an die Seite von Friedrich Flick.
Durch Steinbrincks Denkschrift dürfte Flick deutlich geworden sein, dass ein Engagement in Oberschlesien enorme Risiken barg. Aus denselben Gründen aber standen die Chancen für den Erwerb von Aktienpaketen besonders günstig: Die angespannte wirtschaftliche Lage im Industrierevier, die sozialen Konflikte und die höchst unsicheren politischen Verhältnisse würden zwangsläufig dazu führen, dass Bewegung in den oberschlesischen Industriebesitz kam. Anders als im industriellen Westen des Reiches befand sich ein Teil der oberschlesischen Betriebe noch immer in der Hand adliger Familien, die über großen Grundbesitz verfügten und während des 19. Jahrhunderts erfolgreich in die Industrie investiert hatten. Es bedurfte keiner besonderen politischen Weitsicht, um zu erkennen, dass die Magnaten vom Schlage der Henckel von Donnersmarck, Pless, Schaffgotsch, Ballestrem oder Tiele-Winkler Mühe haben würden, ihren Besitz zu halten, sobald dieser auf polnischem Territorium lag.33
Im Mai 1920 entschied sich die Führung der Charlottenhütte auf einer Sitzung beim Kölner Bankier Stein zum Angriff. Paul Bergmann vom Berliner Privatbankhaus Carl Cahn, das über ausgezeichnete geschäftliche Beziehungen nach Oberschlesien verfügte, sollte zunächst den Markt für Bismarckhütte-Aktien sondieren und diskret erste Anteile zum Nominalwert von einer Million Mark aufkaufen. Dies gelang so zügig, dass Flick bereits im Juni den Auftrag erteilte, die feindliche Übernahme zu starten. Schon einen Monat später kam die Charlottenhütte auf über 40 Prozent des Kapitals der Bismarckhütte von 22 Millionen Mark und damit auf die faktische Mehrheit in der Hauptversammlung.
Der steil ansteigende Börsenkurs zeigte allerdings an, dass Aktien des oberschlesischen Unternehmens im großen Stil aufgekauft wurden, so dass der Vorstand eine Gegenaktion startete. Zur Verteidigung schaltete er ein Berliner Bankenkonsortium ein, das seinerseits mit dem Aufkauf von Bismarckhütte-Aktien begann. Der Machtkampf zog sich bis Ende des Jahres hin; dann gelang es Flick, ein vorteilhaftes Abkommen mit Nationalbank-Direktor Hjalmar Schacht zu schließen. Die Nationalbank gab ihr Paket an die Charlottenhütte ab. Diese brachte die Mehrheit bei der Bismarckhütte damit endgültig unter ihre Kontrolle und konnte ihre Vertreter am 30. Dezember 1920 in die Schlüsselpositionen des Unternehmens wählen lassen. Es war ein typisches Inflationsgeschäft, denn die feindliche Übernahme wurde durch Schulden finanziert. Zunächst nahm die Charlottenhütte vermutlich kurzfristige Bankkredite in Anspruch, die dann im Laufe des Jahres in 20 Millionen Mark Teilschuldverschreibungen umgewandelt wurden – die später wiederum in wertloser Papiermark zurückgekauft worden sein dürften.34
Die Bismarckhütte wurde jetzt regelrecht ausgeplündert und musste ihre eigene Übernahme finanzieren. Als Vehikel dafür diente die Westfälische Stahlwerke AG. In diese Bochumer Tochtergesellschaft hatte die Bismarckhütte nicht nur die Zeche Neue Haardt, durch die der Stein ins Rollen gekommen war, sondern auch ihre Harzer Erzgrube in Elbingerode einzubringen. Anschließend musste die Bismarckhütte ein Drittel ihrer eigenen Aktien kaufen, und zwar von der Charlottenhütte, die dafür sämtliche Westfalenstahl-Papiere erhielt. Schon im Juni 1921 konnte das Geschäft erfolgreich beendet werden: Die Charlottenhütte verkaufte Westfalenstahl an den Koblenzer Industriellen Carl Spaeter, ließ sich aber nicht nur in bar, sondern auch mit den beiden Erzgruben bezahlen. Danach hielt Flicks Unternehmen 53 Prozent der Bismarckhütte-Aktien, was für die absolute Kontrolle völlig ausreichte, da sich weitere 33 Prozent des Kapitals im Eigenbesitz der oberschlesischen Gesellschaft befanden.
Für Flick war das Ganze ein riesiger Erfolg. Sein Unternehmen hatte nicht nur die bedeutend größere Bismarckhütte übernommen, sondern auch seinen Erzbesitz deutlich ausbauen können. Derartige Fusionen weckten überdies das geschäftliche Interesse der Großbanken, die an den Provisionen verdienten. Aus dem ersten Abkommen mit Schacht entwickelte sich bald eine enge Kooperation mit der Nationalbank, die sich unter dem Aufsteiger Jakob Goldschmidt ihrerseits auf spekulativem Wachstumskurs befand und sich – neben der Dresdner Bank und der Privatbank Carl Cahn – auf Jahre hinaus immer wieder an Flicks Geschäften beteiligen sollte.35
Das Westfalenstahl-Geschäft hatte viel Geld in die Kassen der Charlottenhütte gespült, und die Logik der Inflation erforderte es, dieses sofort in neuen Werten anzulegen. Aus Sicht der Bismarckhütte, die ihren Schwerpunkt in der Eisen- und Stahlproduktion hatte, bot sich als Kooperationspartner vor allem die Kattowitzer AG für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb an, die über eine umfangreiche Steinkohleförderung verfügte. Zudem war der Kattowitzer Mehrheitsaktionär verkaufsbereit, da die meisten Betriebe des Unternehmens in Ostoberschlesien lagen.
Über die nationale Zugehörigkeit der Provinz war am 20. März 1921 abgestimmt worden; eine klare Mehrheit hatte sich für den Verbleib im Deutschen Reich ausgesprochen. Kurz darauf entlud sich der Nationalitätenkonflikt im dritten oberschlesischen Volksaufstand, der mit dazu beitrug, dass sich die Siegermächte des Weltkrieges endgültig auf die Seite Polens stellten. Nach langen Verhandlungen wurde daraufhin in Genf eine Teilung Oberschlesiens vereinbart. Dabei fiel Ostoberschlesien an Polen, was zur Folge hatte, dass mitten durch das Industrierevier nach einer Übergangszeit eine Zollgrenze verlaufen würde, welche die bestehenden Konzernstrukturen hinfällig werden ließ. Vor diesem Hintergrund muss die Bereitschaft des Grafen von Tiele-Winkler gesehen werden, seine Kattowitz-Mehrheit an den risikofreudigeren Friedrich Flick abzugeben. Die Nationalbank übernahm dabei erneut eine Vermittlerrolle, so dass der Kauf des Aktienpaketes keine größeren Anstrengungen erforderte.
Nach diesem Geschäft zeigte Flick nicht das geringste Interesse daran, die Liquidität seiner Neuerwerbungen zu schonen und in Oberschlesien eine nachhaltige Unternehmenspolitik zu betreiben – im Gegenteil. Ihn interessierten vor allem »die nicht unerheblichen flüssigen Mittel der Bismarckhütte«, darunter ein beträchtlicher Anteil wertbeständiger Devisen. Die Bismarckhütte musste der Charlottenhütte ihre Beteiligung an Kattowitz für 300 000 Pfund abkaufen. Auf diese Weise konnte die Charlottenhütte »erhebliche Geldbeträge in die Hände« bekommen,