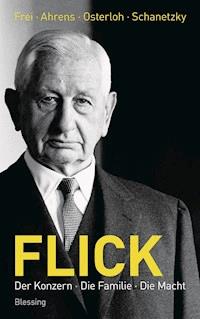21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Bundespräsident spricht qua Amt «im Namen der Deutschen», auch und gerade, wenn es um die NS-Vergangenheit geht. Für Theodor Heuss und seine Nachfolger zu Zeiten der Bonner Republik – Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carsten und Richard von Weizsäcker – war das immer auch ein Sprechen über die eigene Zeitgenossenschaft. Norbert Frei zeigt in seinem glänzend geschriebenen, mitunter atemverschlagenden Buch, wie dabei die persönliche Vergangenheit beschwiegen und zugleich der Ton für das Reden über Nationalsozialismus und Holocaust in einer Gesellschaft gesetzt wurde, die erst lernen musste, sich ihrer Geschichte selbstkritisch zu stellen. Richard von Weizsäcker war der letzte Bundespräsident, der die Jahre des Zweiten Weltkriegs noch als damals schon erwachsener Zeitgenosse erlebt hatte. Der weltweite Ruhm für seine Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 erklärt sich auch vor diesem Hintergrund. Mit Weizsäckers Präsidentschaft endet dieses Buch, das mit Theodor Heuss beginnt, der als erstes Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland Formen und Wege finden musste, «im Namen der Deutschen» über die Verbrechen des «Dritten Reiches» zu sprechen. Norbert Frei, einer der renommiertesten Zeithistoriker der Gegenwart, folgt in seiner brillanten, minutiös aus den Quellen gearbeiteten Darstellung den gewundenen Wegen, auf denen im präsidialen Reden auch zu schweigen zur staatsmännischen Kunst und respektierten Praxis wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Norbert Frei
IM NAMEN DER DEUTSCHEN
Die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit 1949–1994
C.H.BECK
Zum Buch
«Wir haben von den Dingen gewusst.»
Theodor Heuss
Der Bundespräsident spricht qua Amt «im Namen der Deutschen», auch und gerade, wenn es um die NS-Vergangenheit geht. Für Theodor Heuss und seine Nachfolger zu Zeiten der Bonner Republik – Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker – war das immer auch ein Sprechen über die eigene Zeitgenossenschaft. Norbert Frei zeigt in seinem glänzend geschriebenen, mitunter atemverschlagenden Buch, wie dabei die persönliche Vergangenheit beschwiegen und zugleich der Ton für das Reden über Nationalsozialismus und Holocaust in einer Gesellschaft gesetzt wurde, die erst lernen musste, sich ihrer Geschichte selbstkritisch zu stellen.
Über den Autor
Norbert Frei ist Seniorprofessor für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Autor der zum Klassiker gewordenen Studie «Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit» (bsr 2012). Bei C.H.Beck liegen außerdem von ihm vor: «1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen» (2005), «Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945» (bsr 2013) sowie zuletzt, mit Saul Friedländer, Sybille Steinbacher und Dan Diner, «Ein Verbrechen ohne Namen. Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust» (bp 2022).
Inhalt
Einleitung
I. Lernprozesse
Theodor Heuss und die Bürden der Vergangenheit
Die erste Führungsmannschaft
Schuld und Scham, Vergessen und Vergegenwärtigung
Bergen-Belsen, das Mahnmal und die Juden
II. Souveränitätsgewinne
Normsetzendes Gedenken: Der 20. Juli 1954
Ordenspolitik
Traditionsstiftung: «Die großen Deutschen»
Reisen in die Vergangenheit
Zuhause im Amt
III. Systemkonkurrenz
Heinrich Lübke und die präsidiale Kontinuität
Bütefisch und andere «kritische» Orden
Die DDR-Kampagne gegen den «KZ-Baumeister»
Abschiedsqualen
IV. Machtwechsel
Gustav Heinemann und die deutsche Geschichte
«Versöhnungsbesuche» des «Bürgerpräsidenten»
«Kahlschlag in der Villa Hammerschmidt»
Walter Scheel und das neue Deutschland
Präsidentenwechsel
V. Tendenzwenden
Karl Carstens oder: Die Persistenz der gesellschaftlichen Polarisierung
Konservative Lernerfahrungen
Richard von Weizsäcker und der 8. Mai 1985
Deutschland, Israel und «die Rede»
Die Lehren aus der Vergangenheit und das Ende der DDR
Schluss
ANHANG
Nachwort
Anmerkungen
I. Lernprozesse
II. Souveränitätsgewinne
III. Systemkonkurrenz
IV. Machtwechsel
V. Tendenzwenden
Quellen und Literatur
I. Archivalien
1. Bundespräsidialamt (BPrA)
2. Bundesarchiv (BA), Koblenz/Berlin-Lichterfelde/Freiburg
3. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), Berlin
4. Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP), Sankt Augustin
5. Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), Bonn
6. Archiv des Liberalismus (ADL), Gummersbach
7. Bayerisches Hauptstaatsarchiv (BayHStA), München
8. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS)
9. Hessisches Hauptstaatsarchiv (HHStAW), Wiesbaden
10. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Rheinland (LA NRW R), Duisburg
11. Landesarchiv Schleswig-Holstein (LASH), Schleswig
12. Niedersächsisches Landesarchiv (NLA HA), Hannover
13. Staatsarchiv Freiburg (StAF)
14. Staatsarchiv Ludwigsburg (StAL)
15. Staatsarchiv Sigmaringen (StAS)
16. Staatsarchiv München (StAM)
17. Staatsarchiv Amberg (StAAm)
18. Staatsarchiv Augsburg (StAA)
19. Staatsarchiv Bamberg (StABa)
20. Staatsarchiv Bremen (StAB)
21. Archiv der Hansestadt Lübeck (AHL)
22. Stadtarchiv Marburg (StadtA MR)
23. Archiv des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ), München
24. Deutsches Literaturarchiv (DLA), Marbach
25. Historisches Archiv Krupp (HA Krupp), Essen
26. Humboldt-Universität/Universitätsarchiv (HUUA), Berlin
27. Landesamt für Finanzen, Amt für Wiedergutmachung, (LfF), Saarburg
28. Institut für Zeitungsforschung, Dortmund
29. Hebrew University, Jerusalem
30. National Archives (NA), Kew
31. Wiener Library, London
32. Staats- und Senatskanzleien
33. Rundfunk- und Fernseharchive
34. Bayerische Staatsbibliothek, München
II. Gedruckte Quellen und Literatur
Abkürzungen
Abbildungsnachweis
Namenverzeichnis
Einleitung
«Wir haben von den Dingen gewusst.»
Theodor Heuss, 1952
Es war das «Wir» der gemeinsamen Zeitgenossenschaft, das der Bundespräsident am Mahnmal in Bergen-Belsen bemühte, nicht der überkommene Pluralis Majestatis des Monarchen. Dieses «Wir» beschwor die Erinnerung, sieben Jahre nach Hitler, an einem der wüstesten Orte des Menschheitsverbrechens. Aber es unterstrich auch die Verbindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des neuen Staates und ihrem höchsten Repräsentanten. Der Bundespräsident sprach im Namen der Deutschen. So ist es bis heute, so sieht es das Grundgesetz vor, und dafür steht das präsidiale «Wir».
Seit dem Amtsantritt von Theodor Heuss im September 1949 ist die öffentliche Rede das zentrale politische Instrument des deutschen Staatsoberhaupts, und dabei wird es auch bleiben, wenn irgendwann eine Bundespräsidentin das Wort ergreift. Der Bundespräsident handelt, indem er spricht. Gerade weil seine Machtbefugnisse begrenzter sind als in anderen parlamentarischen Demokratien – eine der Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik –, wirkt er vor allem durch das, was er sagt und wie er es sagt: in Reden und Ansprachen, in Interviews und Aufsätzen, im öffentlichen Gespräch und in vertraulicher Runde.
In der Wahl ihrer Themen sind die Bundespräsidenten frei, und im Lauf der Jahrzehnte haben sich manche Akzente verschoben. Aber auf dem Feld des Historisch-Politischen stößt man an einer Stelle auf erstaunliche Kontinuität: Hinter die Formen und Sprechweisen der normativen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die Heuss in seiner ersten Amtszeit entwickelte, ist keiner seiner Nachfolger zurückgegangen. So beruht vieles von dem, was damals unter dem Begriff «Vergangenheitsbewältigung» firmierte und heute «Erinnerungskultur» heißt, nach wie vor auf dem Reden und Wirken des Gründungspräsidenten, im Guten wie im Problematischen. Heuss hat, das Grundgesetz beim Wort nehmend, die Maßstäbe entwickelt, natürlich nicht allein und nicht im luftleeren Raum, wohl aber in empfindsamer Abwägung der Möglichkeiten seines Amtes und der Bedürfnisse der Nachkriegsdeutschen – und mit Gespür für die Erwartungen all derer, die sich das nationalsozialistische Deutschland zum Feind gemacht hatte. Wie für die meisten, die seit 1945, erstmals oder wieder, die politische Arena betraten, war dabei auch für Heuss der eigene Weg durch das «Dritte Reich» von elementarer Bedeutung. Persönliche Erfahrungen flossen in seinen kritischen und selbstkritischen Umgang mit der «jüngsten Vergangenheit» ein.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich ein Teil der Fragen, denen dieses Buch nachgeht – auf den Spuren von Theodor Heuss und jener fünf Präsidenten, die in drei Jahrzehnten auf ihn folgten: Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker. Mit Weizsäcker, der, ebenso wie Scheel und Carstens, die Jahre des Zweiten Weltkriegs als Soldat erlebt hatte, ging die Zeit der NS-Zeitgenossenschaft im Präsidialamt 1994 zu Ende; alle späteren Bundespräsidenten waren bei Kriegsende noch nicht erwachsen oder noch gar nicht geboren. Die vorliegende Darstellung handelt somit von den Präsidenten der «alten» Bundesrepublik; dass Weizsäcker zum Ende seiner zweiten Amtszeit den ersten Dienstsitz des Staatsoberhaupts von Bonn nach Berlin verlegte, von der Villa Hammerschmidt ins Schloss Bellevue, erscheint im Rückblick wie eine symbolische Bekräftigung dieses erfahrungsgenerationellen Einschnitts. Darin und in der Zugänglichkeit der staatlichen Akten, die einer gesetzlichen Sperrfrist von 30 Jahren unterliegen, gründet der hier gewählte zeitliche Rahmen.
In welcher Weise also machten die Bundespräsidenten der Bonner Republik die Verbrechensgeschichte des «Dritten Reiches» zu ihrem Thema? Wo setzten sie die Schwerpunkte, was waren ihre blinden Flecken, worin bestanden individuelle Befangenheiten? Traten sie für innergesellschaftliche Aufklärung ein, für die Anerkennung der Gegner des Regimes, für das Gedenken an die Opfer? Wie dachten sie über die Bestrafung der Täter, wie verhielten sie sich zu den populären Forderungen nach deren Freilassung? Beförderten sie den öffentlichen Diskurs über die Vergangenheit oder begünstigten sie deren Beschweigen? Und wie verhielt sich das eine oder das andere womöglich auch zur je eigenen Biographie?
Schließlich die Frage nach den Auswirkungen einer über die hier betrachteten viereinhalb Jahrzehnte doch signifikant sich verändernden Generationenkonstellation: Nahm – an der Spitze des Staates wie in der bundesrepublikanischen Gesellschaft insgesamt – vor dem Hintergrund des einsetzenden Abschieds von den Zeitgenossen der NS-Zeit die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu? Markierte Richard von Weizsäckers berühmte Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985 in diesem Sinne einen Umbruch? Oder war sie bereits dessen Resultat?
Es ist, aus der Perspektive des protokollarisch höchsten Amts der Republik, eine Geschichte von Schuld und Scham, von Vergessen und Vergegenwärtigung, die dieses Buch erzählt. In den Blick kommen dabei selbstverständlich auch Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung der Rolle und Bedeutung der Bundespräsidenten und in der Beurteilung ihrer Lebens- und Karrierewege während der NS-Zeit. Mehr als deutlich wird dieser Wandel am Beispiel der aufeinanderfolgenden Präsidenten Lübke und Heinemann, mit denen ein sich zunehmend kritisch verstehender Teil der Medien höchst gegensätzlich verfuhr, obwohl beide in durchaus ähnlicher Weise den Funktionseliten der NS-Zeit zuzurechnen sind. Ähnliches gilt für Scheel und Carstens, deren vormalige Mitgliedschaft in der NSDAP praktisch gleichzeitig bekannt und frappierend unterschiedlich bewertet wurde.
Hinter dem Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland steht traditionell ein vergleichsweise kleiner Apparat. Aber wer wissen will, wie und mit wessen Zutun die Reden und Ansprachen der Präsidenten entstanden sind und welchem Kalkül sie folgten, kommt an einem genaueren Blick ins Innere des Bundespräsidialamts nicht vorbei. Denn selbstverständlich waren die politische Herkunft, die Einstellungen und die Vergangenheit der Menschen, die den Bundespräsidenten zuarbeiteten, von Bedeutung. Das galt zumal hinsichtlich der vielfältigen präsidialen Äußerungen, Begegnungen und Korrespondenzen, die die Geschichte und Nachgeschichte der NS-Zeit berührten: die sogenannte «Wiedergutmachung» etwa, die Situation der vormals Verfolgten, Emigranten und Überlebenden des Judenmords, die Wiederbegründung jüdischer Gemeinden in Deutschland, aber auch die Klagen von Vertriebenen und denen, die sich als einstige Mitläufer, Profiteure oder Ex-Parteigenossen nach 1945 zu Unrecht verurteilt fühlten und auf Rehabilitierung drängten. Der NS-Belastung unter den Beamten und Angestellten des Bundespräsidialamts geht diese Studie deshalb im Einzelnen nach; Erwartungen, die Belegschaft der Villa Hammerschmidt in den ersten Jahrzehnten der Republik könnte sich grundsätzlich von jener in den Ministerien und anderen obersten Behörden unterschieden haben, soviel sei schon an dieser Stelle gesagt, wären verfehlt.
Angesichts der Problemlagen einer Gesellschaft, in der die Mentalitäten und Ideologeme der «Volksgemeinschaft» noch vielfach gegenwärtig waren, kamen dem ersten Bundespräsidenten besondere Aufgaben bei der symbolpolitischen Ausgestaltung der neuen Staatlichkeit zu. Vor diesem Hintergrund erklärt sich Heuss’ Entschluss, trotz persönlicher Distanz gegenüber der Idee staatlicher Auszeichnungen (die Weimarer Reichsverfassung hatte sogar ein entsprechendes Verbot festgeschrieben) 1951 einen Bundesverdienstorden zu stiften. Für den Erfolg der Überlegung, auf diese Weise etwas für die Akzeptanz der «Abstraktion Bonn» (Heuss) zu tun, scheint die Tatsache zu sprechen, dass zum Ende seiner zweiten Amtszeit bereits Zehntausende ausgezeichnet waren – und sich die Begehrlichkeiten der Funktionseliten eines wiederaufbaustolzen Bürgertums unvermindert fortsetzten. Mit dieser meritokratischen Großzügigkeit, die 1963 sogar Thema einer Filmsatire werden sollte («Orden für die Wunderkinder», mit Carl-Heinz Schroth), gingen freilich fast zwangsläufig politische Fehlentscheidungen einher, von denen einige exemplarisch betrachtet werden: auch, weil sie auf längere Sicht zu bedeutsamen Anknüpfungspunkten eines kritischeren Umgangs mit der Vergangenheit wurden, dessen Erstarken sich nachgerade regelhaft dem Modus der Skandalisierung verdankte.
Die Dialektik der bundesdeutschen Vergangenheitspolitik erweist sich ebenso im Kontext der Auslandsreisen der Bundespräsidenten, mitunter auch der Besuche ausländischer Staatsoberhäupter in der Bundesrepublik; beidem geht die Darstellung durch die Jahrzehnte hindurch vor der Folie der sich verändernden innen- und außenpolitischen Konstellationen immer wieder nach – von Heuss’ tastender Griechenlandreise 1956 über Lübkes Fahrt mit dem italienischen Staatspräsidenten 1963 nach Dachau und Heinemanns «Versöhnungsbesuchen» in Westeuropa und Skandinavien seit Ende der sechziger Jahre bis zu Weizsäckers Staatsvisite in Israel im Herbst 1985.
Spätestens an dem Punkt der Ansehensgewinne, die für die Bundesrepublik mit vielen der Auslandreisen ihrer Präsidenten verbunden waren, aber auch mit Blick auf von diesen gewürdigte historisch-politische Gedenktage wie den 20. Juli 1944, den 8. Mai 1945 oder – erst nach vier Jahrzehnten – den 9. November 1938 kommt in der scheinbar rein westdeutschen Entwicklungsgeschichte, die hier zu schildern ist, die DDR ins Spiel. Ansporn, Konkurrent und Widersacher war der zweite deutsche Staat im Systemwettstreit des Kalten Krieges natürlich von Anfang an; wie sehr dies aber auch für das Bonner Staatsoberhaupt galt, zeigte sich während der Präsidentschaft Heinrich Lübkes, dessen zweite Amtszeit unter den Angriffen aus Ost-Berlin geradezu im Chaos versank.
Die Geschichte der Bundespräsidenten der «alten» Bundesrepublik und ihres Umgangs mit der NS-Vergangenheit fällt in weiten Teilen und über beachtliche Strecken zusammen mit der Geschichte der Herausbildung der politischen Identität und der politischen Kultur der zweiten deutschen Demokratie: nämlich in der seit 1945 von außen angeleiteten und im Zuge der Staatsgründung feierlich bekundeten Abkehr von der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem Versprechen der kritischen Auseinandersetzung mit ihr. Diese Auseinandersetzung ist, in anderen Worten, integrales Element eines über Jahrzehnte sich erstreckenden politisch-moralischen Lernprozesses. Den Bundespräsidenten kam dabei die Rolle oberster Promotoren zu – mit durchaus unterschiedlicher persönlicher Überzeugungskraft.
I. Lernprozesse
Arg selbstbezogen wirkte es auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen frech, wie Theodor Heuss die Männer und Frauen der Bundesversammlung beschied, die ihn soeben in das Präsidentenamt gewählt hatten: «Es ist für mich mit persönlicher Resignation verbunden; denn manche Pläne wissenschaftlicher und literarischer Natur verfliegen mit ihm.»[1] Geradezu geflunkert aber war seine Behauptung, er habe die protokollarisch höchste Position in der neuen Republik «nicht in einem unruhigen Ehrgeiz erstrebt». Tatsächlich hatte Heuss, seit die Arbeit im Parlamentarischen Rat im Frühjahr 1949 zu Ende gegangen und das Grundgesetz verabschiedet war, zunehmend Gefallen an dem Gedanken gefunden, er selbst könnte das Amt bekleiden, dessen Zuschnitt er als Fraktionschef der Liberalen mitgeprägt hatte.
Doch hinter den Eitelkeiten steckte mehr. Der erfahrene Politiker, Publizist und Politik-Professor, der schon kurz nach Kriegsende auf all diesen Feldern wieder aktiv geworden war und schließlich den Vorsitz der Freien Demokraten übernommen hatte, suchte mit solchen Bemerkungen auch seinen Spielraum zu erweitern. Immerhin waren die Aufgaben des Staatsoberhaupts, jenseits der knappen Festlegungen im Grundgesetz, noch undefiniert. Es ging also darum, aus dem, was er jetzt in typischer Heuss-Manier ein «Paragraphengespinst» nannte, eine Rolle zu formen – am besten eine, die seinem Selbstbild als Homme de Lettres und als Mann der historischen Bildung entgegenkam. Dass dazu auch die Auseinandersetzung mit der «jüngsten Vergangenheit» gehören würde, wie man inzwischen gerne ein wenig beschönigend sagte: Das machte der Bundespräsident in seiner Antrittsrede am 12. September 1949 klar.
Heuss sprach an diesem Montagabend zwar von der «Vergangenheit, die jetzt hinter uns liegt». Aber er griff auch zu einer rhetorischen Figur, derer er sich bereits ein halbes Jahr nach dem Ende der NS-Herrschaft bedient hatte, als «Kultminister» der württembergisch-badischen Staatsregierung, der das traditionelle, heroische Heldengedenken durch einen Gedenktag für die Opfer des Regimes, von Krieg und Gewalt abzulösen suchte. «Wollt ihr denn immer davon reden?», hatte er einen imaginierten Gegner dieser Umwidmung fragen lassen – um in seiner Antwort dem sich schon damals artikulierenden Unwillen zu widersprechen.[2] Nun, vier Jahre später, angesichts einer den großen Schlussstrich lautstark fordernden Öffentlichkeit, setzte Heuss erneut bei den Bedürfnissen des «Einzelmenschen» an. Für den sei es eine Gnade, vergessen zu können: «Wie könnten wir leben als einzelne, wenn all das, was an Leid, Enttäuschungen und Trauer uns im Leben begegnet, uns immer gegenwärtig sein würde! Und auch für die Völker ist es eine Gnade, vergessen zu können. Aber meine Sorge ist, dass manche Leute in Deutschland mit dieser Gnade Missbrauch treiben und zu rasch vergessen wollen.»
Sowohl in der Form wie in der Substanz war das eine Argumentation, die Heuss durch die kommende Dekade tragen sollte. Sie skizzierte bereits den Kurs, den er als Bundespräsident zu steuern gedachte: denen zu widerreden, die es sich mit Blick auf die Vergangenheit «so leicht machen»; jene zu stützen, womöglich sogar mit Deutschland und den Deutschen zu versöhnen, die am meisten gelitten hatten; aber auch das Leid zu sehen, das der von Deutschland ausgegangene Krieg über viele gebracht hatte, die zehn Jahre zuvor noch Hitler zugejubelt hatten. Und dies möglichst alles, ohne neue Konflikte zu produzieren. Das hieß nichts weniger, als einen Lernprozess zu eröffnen: für die feierlich gestimmten «Männer und Frauen von Bonn», denen Heuss, stellvertretend für alle Deutschen, später am Wahlabend auf der Freitreppe vor dem Rathaus versprach, «dass mit diesem Tag ein neues Stück deutscher Geschichte begonnen hat», für alle «Seelen», die sich «wiederfinden und sammeln» – am Ende aber auch für sich selbst.[3]
Am Abend des 12. September 1949 spricht der frischgewählte Bundespräsident Theodor Heuss vor dem Bonner Rathaus zu den Bürgern der Stadt.
Liest oder hört man Heuss’ Rede vor der Bundesversammlung im Abstand eines Dreivierteljahrhunderts, so stechen vor allem die langen historischen Linien hervor und die Art, in der er die eigene Familiengeschichte mit den freiheitlich-demokratischen «Legenden des Jahres 48» verknüpfte. Routiniert evozierte er die Erinnerung an Goethe und Beethoven, zur «Hitlerzeit» hingegen blieben seine Sätze dürr. Und auch hinsichtlich seiner persönlichen politischen Vergangenheit hielt sich Heuss an die inzwischen herrschende Konvention: kein Wort über seine Arbeit oder gar über mögliche Fehler als Reichstagsabgeordneter der Deutschen Staatspartei und als Publizist im «Dritten Reich». Man musste davon wissen, um zu erahnen, dass er in dieser Geschichte nicht nur einen Schatz von Erfahrungen und Verbindungen sah, sondern auch eine Bürde. Zweifellos wog der Schatz aus seiner Sicht viel schwerer als die Bürde, aber diese war doch groß genug, um immer wieder, im Grunde bis zu seinem Lebensende, an ihm zu nagen.
Theodor Heuss und die Bürden der Vergangenheit
Wie und warum Theodor Heuss Ende 1944 auf eine der sogenannten Weißen Listen der Amerikaner geraten war, ist trotz der Bemühungen seiner zahlreichen Biographen nicht ganz geklärt.[4] Auch er selbst scheint nie genau erfahren zu haben, wie er «von den Amis entdeckt» worden war. So jedenfalls lässt sich eine Bemerkung aus den Tagebuchbriefen an Toni Stolper in New York deuten,[5] mit der ihn eine jahrzehntealte, über den frühen Tod seines Freundes Gustav Stolper anhaltende Vertrautheit und eine nach dem Tod von Elly Heuss-Knapp (1952) gewachsene Liebe verband. Und doch wäre die Annahme verfehlt, dass ihn die Bestellung zu einem der Lizenzträger der Rhein-Neckar-Zeitung im Sommer 1945 unvorbereitet getroffen hätte. Denn schon Ende April, die Schlacht um Berlin tobte noch, war der erste US-Jeep vor dem Heidelberger Zufluchtsort der Heussens vorgefahren; seitdem waren die Kontakte zur Besatzungsmacht nicht mehr abgerissen.
Bei allem Interesse, das die zahlreichen amerikanischen Besucher an Heuss und seinen Ansichten nahmen: Für einen Moment sah es aus, als könnte seine Ernennung noch scheitern. Denn jeder Lizenzerteilung durch die Information Control Division ging ein aufwendiges Durchleuchtungsverfahren voraus, das die mit dem Aufbau neuer Zeitungen betrauten Offiziere, zumal in der Anfangszeit, mit großer Ernsthaftigkeit betrieben. Ohne das dezidierte Votum von Major Shepard Stone, der bis 1932 in Berlin studiert und Heuss an der Hochschule für Politik kennengelernt hatte, hätten sich womöglich Leute aus der Intelligence Branch durchgesetzt, die Heuss sowohl seine journalistische Tätigkeit vor 1945 als auch seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 ankreideten.[6]
Letztere mochte, wie Heuss später immer wieder argumentierte, politisch nicht mehr viel bedeutet haben angesichts des schon breitgetrampelten Wegs in die Führerdiktatur. Und doch war es ein ernüchterndes Zeichen, dass neben den reaktionären Kräften der Regierungskoalition auch das Zentrum, die Bayerische Volkspartei und eben die fünfköpfige Fraktion der Deutschen Staatspartei zugestimmt hatten; für die nächsten vier Jahre konnte Hitler nun scheinbar ganz zu Recht ohne Mitwirkung des Parlaments regieren. Wenn nirgendwo sonst, so musste das Verhalten der Liberalen, die zuletzt nur noch dank einer Listenverbindung mit der SPD in den Reichstag gekommen waren (und genau deshalb dann im Sommer 1933 ebenfalls ihre Mandate verloren), in den Reihen der Sozialdemokraten als Verrat betrachtet worden sein. Immerhin hatte sich deren Fraktion – die KPD war schon verboten – als einzige dem Ermächtigungsgesetz verweigert.
Tatsächlich kam die Frage nach seinerzeitigen Reaktionen aus den Reihen der Sozialdemokratie noch einmal auf, als Heuss, der das Amt des württembergischen «Kultministers» nach der Wahlschlappe der Liberalen inzwischen abgegeben hatte, Anfang 1947 vor einem Landtags-Untersuchungsausschuss aussagte. Dieser war eingesetzt worden, um vor allem Ministerpräsident Reinhold Maier aus der Defensive zu helfen, der als Fraktionsmitglied der Staatspartei die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz im Reichstag verlesen hatte und deshalb nun unter heftigem Beschuss von Franz Karl Maier stand, dem kämpferischen Lizenzträger der Stuttgarter Zeitung. Letzterer, in seiner amtlichen Eigenschaft als Öffentlicher Kläger, wollte ersteren vor der Spruchkammer Stuttgart verurteilt sehen. In dieser Konstellation («Maier gegen Maier») gab Heuss nicht nur zu Protokoll, die Vorwürfe von sozialdemokratischer Seite seien «alles Erfindung von heute». Er versuchte auch das beschämende «Ja» zu erläutern, von dem er vermutlich erst jetzt begriff – und nicht schon im Moment des Geschehens, wie es in seinen nachgelassenen Erinnerungen heißt –, dass er es «nie mehr» aus seiner Lebensgeschichte würde «auslöschen» können.[7] Vor der Abstimmung im Reichstag, so also Heuss gegenüber dem Untersuchungsausschuss, habe er im Kreis seiner Parteifreunde einen «Entwurf für eine Neinerklärung» vorgelegt, und aus einem «historischen Stilgefühl» heraus sei er bereit gewesen, diese auch im Plenum abzugeben: «Ich dachte, es macht sich besser für dich und die, die mit dir zusammen sind, wenn du dem Hitler gegenüber nun diese Trennung aussprichst.»[8]
Zu dem am 23. März 1933 versäumten klaren Trennstrich kam es allerdings auch später nicht, und Heuss’ «Neinerklärung» wurde im Nachlass nie gefunden. Bis tief in den Krieg hinein blieb es auch für ihn bei jener charakteristischen Ambivalenz, die das deutsche Bürgertum – das in weiten Teilen, zumal in seiner nationalprotestantischen Ausprägung, spätestens seit der Weltwirtschaftskrise auf einen imaginierten «Führer» hoffte – gegenüber Hitler im Grunde hatte handlungsunfähig werden lassen. Gerade am Beispiel von Heuss ist diese Ambivalenz, genauer: das thematisch und zeitlich gestufte Bemühen um Abstand und Arrangement, eingehend beschrieben worden. Hier muss es genügen, noch auf jenen weiteren Aspekt seines Lebens vor und während der NS-Zeit einzugehen, der nach 1945 wiederholt Anlass kritischer Nachfragen war: seine Arbeit als Schriftsteller und Journalist.
Mit einem rasch niedergeschriebenen Buch über «Hitlers Weg» hatte sich Heuss um die Jahreswende 1931/32 exponiert.[9] Die «historisch-politische Studie über den Nationalsozialismus» war gespickt mit ironisch-bildungsbürgerlichen Distanzierungen und, wie so oft bei ihm, mit großzügig in den Raum gestellten geschichtlichen Analogien. Aber sie war beileibe kein pauschales Verdikt: Weder stellte der Autor die politischen Fähigkeiten des «Führers» in Abrede noch dessen Popularität; er ließ im Gegenteil sogar eine gewisse Bewunderung, ja Sympathie für die plebiszitär unterlegte Durchsetzungsfähigkeit der Bewegung erkennen. (Vor allem Letzteres war wohl der Grund, weshalb Heuss das Buch später für «zu harmlos» erklärte und einen Neudruck ablehnte.[10]) Vor dem Hintergrund der Staatskrise hielt er es nicht einmal für ausgeschlossen, dass es gelingen könnte, die Nationalsozialisten im parlamentarischen Betrieb gleichsam zu zähmen. Und das, obwohl er ihr Ziel klar erkannte: diesen Betrieb zu «stören, wenn es möglich ist, zerstören».[11]
Mehr als alles andere stieß ihn Hitlers Antisemitismus ab. Heuss’ Verachtung für den nationalsozialistischen Blut- und Rassenwahn, dem er ein eigenes Kapitel widmete, vertrug sich jedoch sehr wohl mit einem hartnäckigen Soupçon gegenüber «Ostjuden». Besonders störte ihn das «entwurzelte jüdische Literatentum», das er vor allem in der linken Weltbühne am Werk sah.[12] Dass er wegen «Hitlers Weg» und einer weiteren Schrift bei der Bücherverbrennung im Mai 1933 mit seinem alten publizistischen Gegner Kurt Tucholsky auf dieselben Schwarzen Listen geriet – und alphabetisch in die «Nachbarschaft» von Sexualreformern wie Magnus Hirschfeld und Max Hodann –, das war dem Kulturkonservativen damals und blieb ihm zeitlebens zuwider.[13]
Bereits Anfang Mai war Heuss die Dozentur an der Deutschen Hochschule für Politik genommen worden, Ende Juni 1933 hatte sich die Staatspartei aufgelöst, zwei Wochen später wurden seiner Fraktion die Reichstagsmandate aberkannt. Ende September trat er dann auch als Vorstandsmitglied des Deutschen Werkbunds zurück, dem er seit 1918 verbunden gewesen war. Durch Heuss’ Leben in Berlin zog sich fortan, wie Joachim Radkau prägnant, aber vielleicht doch ein wenig zu dramatisch formuliert, ein «Grundton der Vereinsamung, der zerbröckelnden materiellen Basis, ja der persönlichen Gefährdung».[14] Weiter schreiben zu können, wurde für den fast Fünfzigjährigen jedenfalls zu einer im doppelten Sinn existentiellen Frage. Nicht zuletzt vor diesem psychischen Hintergrund muss man seine journalistische und schriftstellerische Arbeit in den, wie er später gerne formulierte, «bösen Jahren» sehen.
Für eine erste Ablenkung sorgte, dass Heuss zum Jahreswechsel 1932/33 die Mitherausgeberschaft der längst kriselnden, einst von Friedrich Naumann gegründeten Hilfe übernommen hatte, einer Halbmonatszeitschrift für «Politik, Wirtschaft und geistige Bewegung», für die sich der junge Berliner Verleger Hans Bott engagierte (der künftige Eckermann des Bundespräsidenten). Um angesichts der neuen Umstände auch das Redaktionsgeschäft an sich ziehen zu können, beantragte Heuss Anfang 1934 seine Aufnahme in die Schriftleiterliste. «An sich habe ich ja, wenn freilich fast als einziger deutscher Publizist, die Linie gehalten, von der amtlich heute gesagt wird, dass sie erwünscht sei», schrieb er dazu einem Freund.[15] Doch das kleine, kaum tausend Abonnenten zählende Periodikum befriedigte weder Heuss’ publizistischen Ehrgeiz noch seine finanziellen Bedürfnisse. Und da es ihm und Bott, wie dieser sich erinnerte, immer wieder auch Ärger mit der Gestapo bescherte, gab er nach knapp zwei Jahren auf.[16] Der ewig Schreibhungrige – seine ersten Artikel hatte Heuss als Achtzehnjähriger in der Heilbronner Neckar-Zeitung veröffentlicht – besann sich auf seine diversen Zeitungskontakte und kündigte an, er werde sich «jetzt zunächst auf Jubiläen werfen». Das, so schrieb er einem Freund, werde «niemandem wehe tun; ich verbreite damit Bildung bei denen, die in dieser Zeit altmodisch genug sind, noch für Historie sich zu interessieren, nachdem unsereinem die Gegenwart fast verboten ist».[17]
Tatsächlich hielten sich die von Heuss verfassten Texte, die in den nächsten Jahren in den großen Berliner Blättern und bald auch in der Frankfurter Zeitung erschienen, von der Tagespolitik fern. Im Unterschied zu manchen seiner national gestimmten Beiträge in der Hilfe – darunter eine ziemlich fromme Ausdeutung der Pressefreiheit unter Goebbels[18] – kamen die Erinnerungsartikel, Kunstbetrachtungen und Rezensionen kaum je in die Nähe des Systems der Sprachregelungen und fielen auch der Nachzensur nicht auf. Allerdings erbrachten die «Harmlosigkeiten», wie er Toni Stolper schrieb, auch «finanziell gar nichts».[19] Während seine Frau Elly als Werbetexterin reüssierte, setzte er sich nun an die lange liegengebliebene Naumann-Biographie, die mit Billigung der Parteiamtlichen Prüfungskommission Ende 1937 erscheinen konnte. In den nächsten Jahren folgten Bücher über den Architekten Hans Poelzig (1939, Neuauflage 1941 untersagt), den Zoologen Anton Dohrn (1940) und Justus von Liebig (1942). Die große Robert Bosch-Biographie, mit der Heuss gleich nach dessen Tod 1942 begonnen hatte und die dem Ehepaar dank eines Vertrags mit dem Unternehmen finanziell durch die letzten Kriegsjahre half, erschien hingegen erst 1946.
Anders als an seine Tätigkeit für die noch lange gerühmte, einstmals liberale Frankfurter Zeitung mochte Heuss im Nachhinein ungern an seine Mitarbeit bei dem 1940 gegründeten NS-Renommierblatt Das Reich erinnert werden. Die auflagestarke Sonntagszeitung bezahlte nicht nur «vorweltkriegsmäßig opulent», sondern verschaffte seinen Aufsätzen auch eine «erstaunlich große Publizität»; so jedenfalls tönte er Anfang 1941 gegenüber den Frankfurtern, als diese ihm eine feste freie, allerdings auch exklusive Mitarbeit anboten.[20] Und weil Heuss am Ende einschlug, blieben seine Beiträge im Reich Episode – nicht etwa, wie er später behauptete, weil er sich wegen Goebbels’ Leitartikeln dort zurückgezogen hätte.[21] Auch dass sein Name in der Frankfurter Zeitung seit Dezember 1941 auf höhere Weisung nicht mehr gedruckt werden sollte – er selbst wählte daraufhin das Pseudonym «Thomas Brackheim», das auf seinen Geburtsort verwies –, deutete Heuss später etwas sehr zu seinen Gunsten. Die scheinbar beiläufige Erklärung, ihm sei die «Publizistik verboten» gewesen, die er 1954 in seiner Laudatio auf den Friedenspreisträger Carl Jacob Burckhardt in der Paulskirche gab, war jedenfalls nicht die ganze Wahrheit.[22] Selbst nach dem behördlich verfügten Ende der Frankfurter Zeitung im Sommer 1943 konnte Heuss weiter veröffentlichen. Sein letzter nachgewiesener pseudonymer Text in der Presse des untergehenden «Tausendjährigen Reichs» erschien am 23. Dezember 1944 im Neuen Wiener Tagblatt: ein leicht verspäteter Gruß zum 100. Geburtstag seines Doktorvaters Lujo Brentano.[23]
Als der sogenannte Blackout, das von den vorrückenden Alliierten verhängte vollständige Verbot deutscher Zeitungen, im Sommer 1945 endete, gehörte Theodor Heuss zu den ersten aus der kleinen Gruppe handverlesener Journalisten, die sich wieder äußern konnten. In seiner neuen Rolle als einer von drei Lizenzträgern der Rhein-Neckar-Zeitung standen ihm alle Möglichkeiten offen, die politische Entwicklung zu begleiten und zu kommentieren. Heuss machte davon bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten mehr als einhundert Mal Gebrauch, meist in Form von Leitartikeln, die er neben seinen wachsenden Verpflichtungen als Parteipolitiker in Stuttgart und später in Bonn verfasste und nach Heidelberg übermittelte. Doch kaum einer dieser Texte erwies ihn als einen analytisch die Zukunft in den Blick nehmenden Kopf; sein Metier blieb auch jetzt die historische Betrachtung, namentlich der demokratischen Traditionslinien im deutschen Südwesten.
Zum Thema Nationalsozialismus hatte der Leitartikler Heuss erstaunlich wenig zu sagen; prinzipiell präsentierte er sich als die Stimme derer, die von sich glaubten, dem verflossenen Regime mit Distanz und Ablehnung begegnet zu sein. Entsprechend bekundete er angesichts des beginnenden Nürnberger Prozesses im Oktober 1945 «Enttäuschung, dass diese Abrechnung nicht von Deutschen selber vorgenommen werden kann». (Ganz ähnlich dachte, ohne dass er Gelegenheit gehabt hätte, dies damals zu publizieren, der junge Richard von Weizsäcker.) Mit frappierender Direktheit nahm Heuss jene post-volksgemeinschaftliche Stimmung auf, die Besucher wie Hannah Arendt bei ihren Reisen im Nachkriegsdeutschland so empörte: «Hat die ‹Welt› ein Interesse, ein Recht, Ruchlosigkeiten und Gesetzesverletzungen einer Bestrafung zuzuführen, wie viel mehr das deutsche Volk, das in Einzelschicksalen und Massennot das eigentliche Opfer einer verderblichen Politik geworden ist. Wir müssten die Ankläger sein, wir müssten die Richter stellen!»[24]
Die Deutschen als Hitlers erste und «eigentliche Opfer»: Damit bediente der Lizenzträger Heuss jenes zusehends engstirniger werdende kollektive Selbstverständnis, dem die neu entstehende politische Klasse – oft wider besseres Wissen, aber um künftiger Wahlerfolge willen – bald vielfach nachgab. Zwischen dieser Neigung zur Nachsicht und der mal mehr, mal weniger explizit formulierten Mahnung, auch der Millionen nicht-deutschen Opfer zu gedenken und aus der Vergangenheit Lehren für die Zukunft der Demokratie zu ziehen, sollte sich Heuss dann auch als Bundespräsident bewegen: situativ, nicht strategisch geplant und auch nicht frei von inneren Widersprüchen, aber mit einem guten Gespür für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Augenblicks.
Eine seiner in diesem Sinne wichtigsten Formulierungen hatte Heuss bereits gefunden, noch bevor er sein neues Amt antrat: «Erlöst und vernichtet in einem». So lautete die Wendung, mit er am 8. Mai 1949 die Situation der Deutschen bei Kriegsende charakterisierte, zum Schluss seiner mit reichlich Applaus bedachten Rede zur Annahme des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat.[25] Das war nicht der Begriff der «Befreiung», wie ihn 1975 zuerst Walter Scheel verwenden und wie ihn, ein weiteres Jahrzehnt später, Weizsäcker gegen öffentlich leiser gewordenen, jedoch noch keineswegs verschwundenen Widerspruch stark machen sollte. Aber es war eine Perspektive, die über den gewöhnlichen Blickwinkel des «Zusammenbruchs» hinauswies.
Vier Monate später, zum 10. Jahrestag des Kriegsbeginns, tauchten diese Worte als Selbstzitat wieder auf, in einem von Heuss’ letzten Texten als Herausgeber der Rhein-Neckar-Zeitung: «In den Septemberbeginn von 1939 war jener Maitag von 1945 schon eingeschrieben, wo wir ‹erlöst und vernichtet in einem› aus dem längst jeden Sinnes beraubten Krieg heraustraten».[26] An dieser doppelten Lesart hielt der Bundespräsident noch lange fest. Sie erschien ihm sogar angemessen, als er am 5. Mai 1955 die Alliierten Hohen Kommissare aus der Bonner Politik verabschiedete. Jener Seelenlage Rechnung tragend, die er im zurückliegenden Jahrzehnt bei seinen Landsleuten erspürt, aber wohl auch selbst empfunden hatte, stellte er dem «Gefühl des Befreit-Seins» noch einmal die «militärische Zertrümmerung» gegenüber. Und er sprach, ausgerechnet aus Anlass der Aufhebung des Besatzungsstatus, von der «Vernichtung von Jahrhunderte alter deutscher Staats- und Volksgeschichte».[27] Mit Befürchtungen, seine Freude an der expressiven Formulierung könnte Missverständnisse produzieren, musste man dem Staatsoberhaupt nicht kommen.
Die erste Führungsmannschaft
«Die Situation des Bundespräsidialamtes ist ja in den unmittelbaren Möglichkeiten begrenzt. Wir haben nur einen kleinen Personalstab, aber alle Problematik sucht uns auf.»[28] Solche Sätze finden sich nicht selten in der Korrespondenz von Theodor Heuss, vor allem in den ersten Jahren seiner Amtszeit. Doch die regelmäßige Klage über «schauderhafte Arbeitslast» und wenig Unterstützung – hier geführt gegenüber dem Mediävisten und einstigen DDP-Politiker Walter Goetz, einem lebenslangen Freund – ging einher mit einer nicht selten durchscheinenden Zufriedenheit des unermüdlichen Briefschreibers, tatsächlich einen Großteil seiner Post persönlich zu erledigen und fast alle seiner vielen Reden selbst zu schreiben.[29] Der bemessene Zuschnitt seiner Behörde war im Grunde nach Heuss’ Geschmack. Er entsprach dem professoralen Selbstverständnis und passte zum Arbeitsstil eines Präsidenten, der noch nach fast einem Jahr im Amt von sich sagte: «Welches Glück, dass ich einmal Journalist gewesen bin, der außer über Mathematik und Musik so ziemlich über alle Dinge einmal zu schreiben hatte oder geschrieben hat.»
Tatsächlich wäre es eine Übertreibung zu behaupten, nach Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 habe sich irgendwo in der jungen Republik jemand beeilt, für die Arbeitsfähigkeit des kommenden Bundespräsidenten zu sorgen. Im Organisationsausschuss der Ministerpräsidenten, der seit Juni Pläne für die künftige Bundesverwaltung entwarf, ging es ein paar Mal zwar auch um das Staatsoberhaupt und dessen, so die zeittypische Beamtenprosa, «hohen Pflichtenkreis». Doch viel mehr als den Vorschlag, hinter die 1934 von Hitler eingeführte Bezeichnung «Präsidialkanzlei» zurückzugehen und wieder von einem «Präsidialamt» zu sprechen, «um Verwechslungen mit der Bundeskanzlei zu vermeiden», brachten die meist im Kurort Schlangenbad tagenden Ministerialen nicht zu Papier. Einig waren sie sich allerdings, dass die Behörde des Bundespräsidenten, auch wenn dieser «fortlaufend und erschöpfend über die deutsche Politik im weitesten Sinne informiert» bleiben müsse, möglichst klein zu halten sei. Orientierungspunkt war offensichtlich die Präsidialkanzlei unter dem ewigen Staatssekretär Otto Meissner, der im Nürnberger Wilhelmstraßenprozess soeben freigesprochen worden war (und der sich wohl auch deshalb legitimiert wähnte, im Jahr darauf als Sachbuchautor und Ruheständler im Oberbayerischen über den «Schicksalsweg des deutschen Volkes» unter Ebert, Hindenburg und Hitler Auskunft zu geben).[30] Nun, im Sommer 1949, hielten es die Ländervertreter für ausreichend, dass der künftige Bundespräsident über einen Amtschef im Rang eines Staatssekretärs verfügte sowie über zwei Abteilungsleiter, davon einer zuständig fürs Protokoll, einen Pressereferenten und lediglich eine Handvoll weiterer Mitarbeiter. Und noch etwas glaubten sie genau zu wissen: «Einen militärischen Adjutanten benötige der Bundespräsident nicht, wohl aber einen Polizeioffizier mit einer Anzahl uniformierter Beamter.»[31]
Faktisch begann der Aufbau des Bundespräsidialamts erst nach der Wahl von Theodor Heuss, auf die drei Tage später, am 15. September 1949, die Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler folgte. Beides war bekanntlich keine zwingende Konsequenz aus dem Ergebnis der ersten Bundestagswahl, sondern Resultat von Sondierungen mit dem Ziel einer kleinen Koalition. Umso erstaunlicher, dass in Adenauers Absprache mit seinem künftigen Vizekanzler Franz Blücher (FDP) am 26. August bereits der Name eines möglichen Chefs des Bundespräsidialamts fiel: Manfred Klaiber.[32] Als Ministerialrat und Bevollmächtigter des württembergisch-badischen Staatsministeriums hatte Klaiber an den Beratungen in Schlangenbad teilgenommen, wenngleich nicht an den Sitzungen, in denen über das Präsidialamt gesprochen wurde.
Klaiber kam, vom Stuttgarter Ministerpräsidenten Reinhold Maier empfohlen, über das beachtliche Netzwerk der südwestdeutschen Liberalen in der Frankfurter Bizonen-Verwaltung zu Heuss; ob dieser sich freute, «dass ein Schwabe sein wichtigster Mitarbeiter wurde», wie Eberhard Pikart 1976 nach Gesprächen mit Zeitzeugen schrieb,[33] kann getrost offenbleiben. Jedenfalls spricht nichts dafür, dass sich Heuss und Klaiber schon vorher näher gekannt hätten – und dass es sich um mehr als um eine von wechselseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit handelte. Letzteres ist deshalb zu betonen, weil sich aus der Personalie Klaiber im Laufe der nächsten Jahre für Heuss einiges an öffentlichem Erklärungsbedarf ergeben sollte. Denn im Unterschied zu ihm selbst war Manfred Klaiber, 1903 in eine bildungsbürgerliche württembergische Familie geboren, als Staatsdiener alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.
Nach einer juristischen Promotion war Klaiber 1926 in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Zwei Jahre später schrieb er im Rahmen der Attaché-Ausbildung eine als «vorzüglich» bewertete Prüfungsarbeit, die sich mit der Wirtschaftspolitik des italienischen Faschismus befasste. Mussolinis Methode, so der 25-Jährige, seien «Zwang und Diktatur»; das «Verdienst» des Faschismus aber sei es, «mit seiner ganzen jugendlichen Begeisterungsfähigkeit dem italienischen Volk die Idee von der Gleichstellung aller sozialen Gruppen und von ihrem Wert für die Produktion im Interesse der Allgemeinheit eingepflanzt zu haben».[34]
Auch wenn es nicht schwerfällt, aus solchen Formulierungen die in der Kriegsjugendgeneration des Ersten Weltkriegs verbreitete Sympathie für die Idee einer «Volksgemeinschaft» herauszuhören, wie sie Mussolinis Bewunderer Hitler propagierte: Gegenüber dessen Bewegung scheint Klaiber damals noch auf Abstand geblieben zu sein – und sei es nur, weil er bereits seit Januar 1929 in Paris stationiert war. Jedenfalls trat der junge Diplomat der NSDAP erst während seiner Zeit als Vizekonsul in Pretoria bei, wohin er im Herbst 1932 entsandt worden war; seine Mitgliedschaft datiert vom 1. Oktober 1934.[35] Klaiber gehörte damit nicht zu den allereiligsten Konjunkturrittern im Auswärtigen Amt – die hatten es noch vor der Aufnahmesperre im Frühjahr 1933 in die Partei geschafft –, aber er hatte seine Karriere im Blick. Sie führte ihn über Batavia (das heutige Jakarta) und Ankara im Sommer 1943 nach Belgrad zum Bevollmächtigten des AA beim deutschen Militärbefehlshaber in Serbien und schließlich zur Dienststelle des AA für Griechenland, Serbien, Albanien und Montenegro in Wien, wo er, ohne je der Wehrmacht angehört zu haben, das Kriegsende erlebte. 1944 blockierte die Münchner Parteikanzlei Klaibers Ernennung zum Gesandtschaftsrat 1. Klasse; angeblich hatte sich der Botschaftsangehörige in Ankara als nebenamtlicher Parteirichter «schwerwiegende Entgleisungen zuschulden kommen lassen». Zwei Jahre später deutete Klaiber dies gegenüber der Stuttgarter Spruchkammer als Beweis seiner Widerständigkeit, die ihm die «Strafversetzung» nach Belgrad eingetragen habe.[36]
Klaibers beschleunigtes Entnazifizierungsverfahren endete im Januar 1947 mit der Einstufung als «Entlasteter» – wohl auch dank der Unterstützung geneigter AA-Kollegen, die ihn als «Mann von absolut demokratisch-liberaler Einstellung» priesen, von seinem Eintreten für jüdische Emigranten in der Türkei und für serbische Gestapo-Häftlinge in Belgrad zu erzählen wussten und seiner Falschbehauptung folgten, erst 1936 Pg. geworden zu sein. Damit war der Mittvierziger frei für eine (Wieder-)Verwendung im Dienst des württembergisch-badischen Staatsministeriums, das ihn 1948 nach Frankfurt schickte. In der Bizonen-Verwaltung knüpfte Klaiber zukunftsträchtige neue Verbindungen und bekräftigte alte Bekanntschaften. Sie sollten sich alsbald nach seinem Wechsel zu Heuss in der Mannschaftsaufstellung des Präsidialamts abbilden (an Frauen in Leitungspositionen dachte damals – und noch auf lange Zeit – keiner).
Eine erste «Vorläufige Zuständigkeitsverteilung», kaum eine Seite lang, brachte Klaiber am 11. Oktober 1949 zu Papier, drei Wochen nach seiner Ankunft als Amtschef auf der Godesberger Viktorshöhe, dem provisorischem ersten Dienstsitz des Bundespräsidenten in einem eilends freigemachten Erholungsheim der Reichsbahn.[37] Neben Klaiber selbst, der noch in Württemberg-Baden zum Ministerialdirektor hochgestuft worden war (auf seine Beförderung zum Staatssekretär musste er dann aber bis 1953 warten), nennt dieser Geschäftsplan vier weitere verantwortliche Mitarbeiter. Zwei davon, Günther Wawretzko und Luitpold Werz, waren ehemalige AA-Kollegen und Parteigenossen, die Klaiber aus Frankfurt beziehungsweise Wiesbaden nachgeholt hatte; Diplomatensohn Werz, dem einstige Spitzeldienste für den SD nachgesagt wurden, ging 1953 zurück ins Auswärtige Amt und wurde später Botschafter,[38] der gelernte Steuerinspektor Wawretzko (Pg. bereits seit 1932) wurde 1954 wegen Selbstbereicherung aus dem Sozialfonds des Bundespräsidenten suspendiert und später entlassen.[39] Die beiden anderen Referatsleiter hatte Heuss persönlich ausgewählt: seinen langjährigen Vertrauten Hans Bott und den jungen Erich Raederscheidt, der die Aufgaben eines Pressereferenten übernahm. Beide kamen nicht aus dem diplomatischen Dienst und hatten nicht der NSDAP angehört.
Auf ihrer Wochenend-Bilderseite stellt die Süddeutsche Zeitung am 12. November 1949 «Männer und Frauen um Bundespräsident Heuß» vor.
Zählt man den als Hitler-Gegner ausgewiesenen Hans von Herwarth, der zunächst sowohl im Bundeskanzleramt als auch im Bundespräsidialamt als Protokollchef fungierte, noch zu der kleinen Führungscrew hinzu, waren die vormaligen Diplomaten und bürokratischen Profis zwar deutlich in der Überzahl. Aber mit seinem persönlichen Referenten Bott hatte Heuss einen Puffer installiert, der ihm viel Amtsalltag vom Leibe hielt. Botts Nähe zum Präsidenten drückte sich nicht nur darin aus, dass er laut vorläufigem Geschäftsplan gleich nach Klaiber rangierte; aufschlussreich waren auch die formalen Zuständigkeiten des gelernten Buchhändlers, der 1944 als Gefreiter an der Kanalküste in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten war, sich dort als Lehrer betätigt hatte und 1949 als Referent im Stuttgarter Kultusministerium zu einem dreimonatigen Studienaufenthalt in die USA aufbrechen durfte: Neben den Themen, mit denen er aus den zurückliegenden Jahren vertraut war («Kriegsgefangenen- und Rückkehrerfragen», «Heimatvertriebene»), beackerte Bott fortan jenes weite Feld namens «Kulturelle Angelegenheiten», das Heuss am Herzen lag.[40]
Klarer noch als Klaibers erster Aufriss weist der förmliche Organisationsplan vom Sommer 1951[41] aus, wie sehr die NS-Vergangenheit den Bundespräsidenten und seine Behörde von Anfang an beschäftigte – aber auch, wie sprachlich unempfindlich es dabei selbst in höchsten Amtsstuben zugehen konnte. Vier der inzwischen sieben Referate waren mit unmittelbar vergangenheitspolitischen Aufgaben befasst: Ministerialrat Joachim Lehmann, ein Berliner Sozialdemokrat, der noch im selben Jahr als Richter ans Bundesverfassungsgericht wechseln sollte, war als Leiter der Rechtsabteilung (Referat 1) für die bemerkenswerte Kombination «Entnazifizierung – Wiedergutmachung» zuständig. Bei Ministerialrat Bott (Referat 2) lagen weiterhin die «Kriegsgefangenenfragen». Unter den 14 Sachgebieten, die Regierungsdirektor Werz (Referat 3) bearbeitete, firmierte an dritter Stelle das «Judenproblem/DP’s»; außerdem war er zuständig für «Alle Angelegenheiten der sogenannten Kriegsverbrecher» sowie für «Alle Anfragen bezw. Eingaben in Auslieferungsangelegenheiten an fremde Staaten». Letzteres war insofern von besonderer vergangenheitspolitischer Brisanz, als die Besatzungsmächte noch zu Anfang der fünfziger Jahre – ungeachtet des genau deshalb im Grundgesetz verankerten Auslieferungsverbots – vereinzelt deutsche Staatsbürger auslieferten, die im Ausland als mutmaßliche (nicht als «sogenannte») Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden sollten.[42]
Auch Regierungsrat Albert Einsiedler (Referat 4), der im Sommer 1950 zur Gründungsmannschaft in der Villa Hammerschmidt gestoßen war, hatte mit Themen zu tun, deren Bezug zur «jüngsten Vergangenheit» nicht zu übersehen war: «Flüchtlingsfragen» sowie «Soforthilfe und Lastenausgleich». An seiner Ernennung wird exemplarisch deutlich, wie langfristig prägend die frühen personalpolitischen Entscheidungen von Manfred Klaiber waren: Einsiedler, Jahrgang 1914, kam nach vier Jahren Kriegsdienst und fünf Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft ins Präsidialamt, blieb fast zwei Jahrzehnte und stieg unter Heinrich Lübke zum Stellvertretenden Amtschef auf. Nach kritischer, gar selbstkritischer Reflexion über die Vergangenheit stand dem Volljuristen und Ex-Parteigenossen augenscheinlich nicht der Sinn; sein Antrag auf Aufnahme in die NSDAP bei der Gauleitung Schlesien datierte vom 26. November 1938, mithin aus den Wochen nach dem Novemberpogrom.[43]
Komplettiert wurde die Riege der Referatsleiter durch den vormaligen Generalstäbler Hans-Ulrich Krantz, der 1943 als Verbindungsoffizier der Wehrmacht an der Ostfront auch kurz beim II. Panzerkorps der Waffen-SS unter dem berüchtigten SS-General Paul Hausser eingesetzt gewesen war. Als Berufssoldat typischerweise kein Parteimitglied, galt der gebürtige Berliner aus der Kriegsjugendgeneration (Jahrgang 1906) trotz einer Schwerbehinderung, die er sich bei einem Motorradunfall noch zu Zeiten der Reichswehr zugezogen hatte, seinen militärischen Vorgesetzten als Nationalsozialist von einwandfreier Haltung und überragender Leistung. Ins Präsidialamt war Krantz nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft, obligatorischer Internierung und zwischenzeitlicher Tätigkeit als Buchhalter im Herbst 1949 aufgrund seiner Initiativbewerbung gelangt. Dort war er zunächst vor allem für die Organisation der Polizeibegleitung des Bundespräsidenten, dann für die Ordenskanzlei zuständig; 1956 wechselte er zur neugegründeten Bundeswehr.[44]
Bloße Statistiken über die Zahl der vormaligen NSDAP-Mitglieder unter den Bediensteten des Präsidialamts sind von begrenzter Aussagekraft. Die wichtigere Frage lautet, ob und wie sich solche individuellen Belastungen in der dienstlichen Tätigkeit niederschlugen; sie wird uns im Verlauf der Darstellung noch begegnen. Schon an dieser Stelle jedoch ist festzuhalten, dass die vergangenheitspolitische Geschäftsgrundlage in der Villa Hammerschmidt keine andere war als überall sonst im bundesrepublikanischen Staatsaufbau: Eine Ex-Parteimitgliedschaft, im Amtsalltag üblicherweise «kommunikativ beschwiegen» (Hermann Lübbe) und allenfalls auf Druck von außen expliziert, bedeutete Anfang der fünfziger Jahre keinen Makel mehr – jedenfalls dort, wo sie sich als eine lediglich «formale», den einst angeblich regelhaften Anpassungszwängen geschuldete darstellen ließ. Wie hätte es aus Sicht der präsidialamtlichen Führungsebene auch anders sein können? Immerhin zählten neben Amtschef Klaiber und dessen Nachfolger Karl Theodor Bleek (seit Sommer 1957) vier von insgesamt zehn Referatsleitern in der ersten Amtszeit Heuss selbst zum Millionenheer der inzwischen weithin mit Nachsicht betrachteten «Ehemaligen». (In der zweiten Amtszeit waren es sechs von elf, die Fluktuation hielt sich also ziemlich in Grenzen.)
Nimmt man alle präsidialen Amtszeiten von Heuss bis Weizsäcker in den Blick, weitet und verändert sich natürlich das Bild: Unter den dann insgesamt 132 Angehörigen des höheren Dienstes waren 58 aus den Geburtsjahrgängen bis 1929, für die sich die Frage einer Parteimitgliedschaft allenfalls stellt. Von diesen Älteren hatten 20 der NSDAP angehört, davon vier überdies der SA; weitere acht waren Mitglieder der Hitler-Jugend gewesen.[45] Das ist im Vergleich zur generellen Situation auf Bundesebene, die mittlerweile als recht gut erforscht gelten kann,[46] ein eher unterdurchschnittlicher Anteil formal Belasteter, der sich aber typischerweise im Laufe der fünfziger Jahre erhöhte, um dann seit Mitte der sechziger Jahre leicht und in den siebziger Jahren aus generationellen Gründen deutlich zurückzugehen, sprich: in den Amtszeiten der vormaligen Parteimitglieder Walter Scheel und Karl Carstens.
Letztlich gilt auch für die Gesamtbelegschaft des Bundespräsidialamts, die ein Jahr nach den bemessenen Anfängen auf der Viktorshöhe 50 Beamte, Angestellte und Arbeiter umfasste und bis 1960 auf 77 Mitarbeiter anwachsen sollte,[47] was für die bisher untersuchten Bundesbehörden festgestellt wurde: Je höher der Dienstrang, desto dichter die Riege der Ex-Parteigenossen.
Im Gegensatz zum Auswärtigen Amt, aber auch im Unterschied zu anderen Bundesministerien und -behörden, waren direkte personelle Kontinuitäten im Präsidialamt kein großes Thema: In den erhalten gebliebenen Personalakten finden sich lediglich drei Mitarbeiter – allesamt ehemalige Parteimitglieder –, die bereits in der unter Hitler faktisch funktionslos gewordenen Präsidialkanzlei tätig gewesen waren, 1945 ihren «Dienstherren verloren» hatten und nach Zwischenstationen außerhalb des öffentlichen Dienstes 1951 beziehungsweise 1956 in der neugegründeten Ordenskanzlei unterkamen.[48] Im Zentrum aller Kontinuitätsfragen in der Villa Hammerschmidt standen insofern die neuen-alten Verbindungen, die Manfred Klaiber in die Reihen des 1945 aufgelösten diplomatischen Dienstes geknüpft hatte. Das änderte sich auch nach der Wiederbegründung des Auswärtigen Amts 1951 nicht, als dieser Konnex im Gegenteil institutionell ausgebaut und auf Dauer gestellt wurde.
Dass es, jedenfalls in der Frühzeit, beim Wechsel vom AA ins Präsidialamt (später auch in umgekehrter Richtung) keineswegs nur um Angehörige des höheren Dienstes ging, zeigt exemplarisch der Berufsweg von Anneliese Bockmann, die seit September 1949 Elly Heuss-Knapp als Sekretärin diente und nach deren Tod in das Vorzimmer des Bundespräsidenten kam, mit dem sie auch nach seinem Abschied aus Bonn in Verbindung blieb. Zwischen 1932 und 1945 hatte Bockmann für den jeweiligen Leiter der Politischen Abteilung des AA gearbeitet (mithin auch für Ernst von Weizsäcker) und war 1940 in die NSDAP aufgenommen worden. Da sie zunächst nur eine «untergeordnete Stellung» als Sekretärin bei der Reichsbankstelle Husum anstrebte, gelang es ihr, dort im März 1947 vorläufig, im Sommer 1948 dann in Stuttgart endgültig entnazifiziert zu werden.[49] Wie wenig Bockmanns Charakterisierung als Büromitarbeiterin der Realität entsprach, belegen spätere Zeugnisse zweier ihrer einstigen Chefs, die sie zu ihrer Personalakte nehmen ließ; sie loben nicht nur die «unbedingte Verschwiegenheit» der Sekretärin im Umgang mit «Geheimen Reichssachen», sondern auch den Eifer, mit dem sie «arbeitsmäßig einen Beamten ersetzt hat».[50]
Doch weibliche Mittäterschaft war in der Villa Hammerschmidt nicht allein in solcher, im Grunde kollegial willkommener und geschätzter Form präsent. Von der allgemeinen Diskretionsbereitschaft profitierte die ehemalige Führerin eines Reichsarbeitsdienstlagers im Warthegau, die nun als Telefonistin arbeitete, ebenso wie die Berliner Chefsekretärin des Reichsarbeitsdiensts, die im Rechtsreferat unterkam und später das Vorzimmer des Staatssekretärs organisierte; andere langjährige Sachbearbeiterinnen brachten Arbeitserfahrungen aus ihrer Zeit beim Militärbefehlshaber von Belgien und Nordfrankreich mit, beim Marinestab Kopenhagen oder beim Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamts, General Georg Thomas.[51]
In der Regel scheinen solche Vorgeschichten unbeachtet geblieben, bestenfalls als Indizien beruflicher Tüchtigkeit wahrgenommen worden zu sein – kaum anders als die Militärkarrieren der männlichen Belegschaft. Doch als sich herausstellte, dass beim Aufbau des Präsidialamts 1951 auch eine vormalige Mitarbeiterin des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms zum Zuge gekommen war, sorgte dies zumindest vorübergehend für eine gewisse Nervosität in der Amtsspitze: Christel D. hatte seit 1940 im Zuchthaus Brandenburg und später in Bernburg (Saale) sogenannte Trostbriefe an Angehörige von Ermordeten geschrieben und tiefen Einblick in das Tötungsgeschehen erlangt, wohl auch aufgrund ihres Verhältnisses mit Irmfried Eberl, dem ärztlichen Leiter der Anstalten und späteren Lagerkommandanten von Treblinka. Bei ihrer Einstellung verschleierte die unverheiratete Mutter einer 1944 geborenen Tochter diesen Sachverhalt. Auch dass sie ihre Schwester – die nun dafür sorgte, dass D. eine Empfehlung aus dem Büro des Bundestagspräsidenten beibringen konnte –, seinerzeit zur «Aktion T4» nachgezogen hatte, blieb unbekannt. Das änderte sich erst, als D. 1965 im Rahmen neuer Ermittlungen zu den Euthanasieverbrechen vernommen wurde, die Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in Frankfurt am Main veranlasst hatte. Gleichwohl beließ es Albert Einsiedler, inzwischen stellvertretender Amtschef, nach Vortrag bei Bundespräsident Lübke bei einer knappen Nachricht an den Untersuchungsrichter: Man bitte um Mitteilung, sofern sich aus dem Fortgang des Verfahrens «belastende Hinweise über das seinerzeitige Verhalten von Fräulein Christel D. ergeben sollten». In dem, was man bis dahin über die Vergangenheit der Untergebenen erfahren hatte, mochten folglich weder Einsiedler noch Lübke eine Belastung erkennen. Der Vorgang kam unter Verschluss – und wurde augenscheinlich auch nicht mehr hervorgeholt, als Christel D. im Sommer 1974 in Rente ging. Nachdem sie als hochgeschätzte Mitarbeiterin bereits im März 1969 das Verdienstkreuz am Bande erhalten hatte, erhielt sie anlässlich ihres Ausscheidens als Zeichen der Anerkennung – wie damals üblich – das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.[52]
Schuld und Scham, Vergessen und Vergegenwärtigung
Seinen frühesten und vergangenheitspolitisch wohl wirkungsmächtigsten Auftritt als Bundespräsident hatte Heuss bereits am 7. Dezember 1949 im Kurhaus zu Wiesbaden. «Mut zur Liebe» lautete der etwas seltsame Titel seiner weitgehend frei gehaltenen Rede vor den Honoratioren des soeben nach amerikanischem Vorbild und mit amerikanischem Geld aufs Gleis gesetzten Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Während sich die vormalige Lizenzpresse, noch immer papierknapp, zumeist auf Meldungen über die nachmittägliche «Feierstunde» beschränkte, druckte die Neue Zeitung, das offiziöse Blatt der amerikanischen Besatzungsmacht, die Ausführungen des Präsidenten in voller Länge ab. Der Südwestfunk strahlte zwei Tage später einen Mitschnitt der Veranstaltung aus, der Koordinierungsrat schließlich brachte bald schon eine nobel aufgemachte Broschüre heraus, die drei Auflagen mit insgesamt mehr als 60.000 Exemplaren erreichte.[53]
«Mut zur Liebe» war einerseits ein Beispiel für Heuss’ Fähigkeit, sich seiner Zuhörerschaft rhetorisch anzuschmiegen. Andererseits fällt noch im historischen Abstand auf, wie überraschend schnell und direkt der Bundespräsident vor den rund 600 handverlesenen Gästen, unter ihnen der amerikanische Hohe Kommissar John J. McCloy und Vertreter des Landes Hessen, dem er an diesem Tag seinen Antrittsbesuch abstattete, zum Kern seiner Botschaft kam: «Es hat keinen Sinn, um die Dinge herumzureden. Das teuflische Unrecht, das sich an dem jüdischen Volk vollzogen hat, muss zur Sprache gebracht werden und zur Sprache gebracht werden in dem Sinn: Sind wir, bin ich, bist du schuld, weil wir in Deutschland lebten, mitschuld an diesem teuflischen Unrecht? Das hat vor vier Jahren die Menschen, die Seelen, vor allem die Zeitungen bewegt und die Besatzungsmächte, als sie von der ‹Kollektivschuld› des deutschen Volkes gesprochen haben an dem, was geschah. Das Wort Kollektivschuld und was dahintersteht, ist eine zu simple Vereinfachung, eine Umdrehung, nämlich der Art, wie die Nazi gewohnt waren, die Juden anzusehen: dass die Tatsache, Jude zu sein, ein Schuldphänomen in sich geschlossen hat. Aber etwas wie Kollektivscham ist aus dieser Zeit gewachsen und geblieben. Das Schlimmste, was der Hitler uns antat – und er hat uns viel angetan –, ist doch dies gewesen, dass er uns in die Scham gezwungen hat, mit ihm und seinen Gesellen den Namen Deutsche zu tragen.»[54]
In seiner kurzlebigen Allgemeinen Jüdischen Illustrierten druckt Karl Marx die Wiesbadener Rede des Bundespräsidenten nach.
Heuss wusste, dass ihm nach diesen Sätzen Kritik allein schon deshalb ins Haus stand, weil er die – von der postnationalsozialistischen Volksgemeinschaft bei Kriegsende selbst herbeiphantasierte[55] – These von der Kollektivschuld in den Mund genommen hatte. Dass er das Reizwort im Vortrag (anders als später in der Druckfassung) explizit mit den Besatzungsmächten verbunden hatte, änderte daran nichts, ebenso wenig wie die Zurückweisung vermittels einer durchaus heiklen Parallelisierung. Am Ende half auch nicht, dass er ein gleichsam täterloses Verbrechen, das «sich» vollzogen habe, beschrieb, und auch nicht, dass er, wenngleich in wohlgesetzten Worten, die ohnehin allgegenwärtige Selbstmitleidsformel von den Deutschen als Opfer Hitlers bediente. Seine Aufforderung, sich als Kollektiv zu «etwas wie» Scham zu bekennen und nicht zu vergessen, ging, wie er wusste, vielen seiner Landsleute auch viereinhalb Jahre nach Kriegsende zu weit (nicht zuletzt übrigens dem giftigen rechten Flügel der FDP, bei der seine Mitgliedschaft inzwischen ruhte).[56]
Fast trotzig benannte er deshalb im nächsten Schritt die «passive Berufsfunktion» seines Amtes, «anonyme Briefe, auch offene Briefe» zu empfangen – und insistierte: «Wir dürfen nicht vergessen Dinge, die Menschen gerne vergessen möchten, weil das so bequem ist. Wir dürfen nicht vergessen die Nürnberger Gesetze, den Judenstern, den Synagogenbrand, den Abtransport von jüdischen Menschen in die Fremde, ins Unglück, in den Tod. Das sind Tatbestände, die wir nicht vergessen sollen, die wir nicht vergessen dürfen, weil wir es uns nicht bequem machen dürfen.»
Klarer hätte die präsidiale Forderung nach Empathie mit den vormals Verfolgten, den Überlebenden und der Minderheit derer, die auf das Ende des NS-Regimes gehofft und dafür im Innern wie von außen gekämpft hatten, kaum ausfallen können. Dabei nimmt es dem Moment nichts von seiner Bedeutung, dass Heuss diese Forderung vor Menschen erhob – darunter manche, die selbst verfolgt worden waren –, bei denen er dafür auf Sympathie rechnen durfte. Denn es waren unmissverständliche Worte in einer gesellschaftlichen Situation, in der die vergangenheitspolitischen Erwartungen der Mehrheit in eine ganz andere Richtung gingen: Keine Woche zuvor hatte der Bundestag in erster Lesung über eine allgemeine Amnestie beraten, die als eines der ersten Gesetze der jungen Republik – unter dem populistischen Beifall sogar der Kommunisten und gegen die Bedenken der Alliierten Hohen Kommission – zu Jahresende 1949 in Kraft trat; neben Kleinkriminellen aus der Schwarzmarktzeit profitierten davon Zehntausende NS-Täter, darunter vermutlich auch solche, an deren Händen Blut klebte. Und als sei das nicht schon genug, wirkte das Straffreiheitsgesetz darüber hinaus als ein verheerendes Signal an die Justiz – mit der Folge eines die fünfziger Jahre charakterisierenden fast völligen Stillstands bei der Ahndung nationalsozialistischer Verbrechen.[57]
Dass sich das deutsche Volk «kollektiv schämen» müsse, hatte Heuss bereits ein paar Tage vor der Wiesbadener Rede gegenüber einem Vertreter von United Press gesagt; auch dort, wie prompt der New York Times und der Neuen Zeitung zu entnehmen war, mit kritischer Wendung gegen den Begriff der Kollektivschuld.[58] Aber die Prägnanz der Formel «Kollektivscham» war ihm da wohl noch nicht zugeflogen. Als normative Setzung, die fortan immer wieder aufgegriffen werden sollte, war der Begriff jedenfalls der Versuch eines Spagats. Denn weder widersprach er der frühbundesrepublikanischen Schuldabwehr-Erzählung vom «Dämon Hitler» und seinem teuflischen Helferduo Himmler/Heydrich, noch dementierte er die Erwartungen und Ansprüche «des Auslands», die das Bonner Spitzenpersonal, allen voran der Kanzler und der Präsident, von Anfang an genau im Blick behielten. In diesem Sinne war die Kollektivscham-Rede nicht zuletzt Ausdruck von Heuss’ Nähe zu «den Amerikanern», namentlich zu dem in Fragen des Antisemitismus hellwachen McCloy, aber auch zu etlichen, meist emigrierten deutschen Juden, mit denen er zum Teil schon seit den zwanziger Jahren in Verbindung stand und die nun den Kontakt zum neuen Staatsoberhaupt suchten.
Was Adenauer erst ein Jahrzehnt später wagte – im Kontext der weltweiten Empörung über die Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge zu Weihnachten 1959 –, das legte Heuss in Wiesbaden vor einer Zuhörerschaft offen, die sich im Glauben an die Möglichkeit christlich-jüdischer Zusammenarbeit nach der «Endlösung» versammelt hatte: «Und wenn ich meine vier, fünf nächsten Freunde sehe, die mein Leben mit begleitet und aufgebaut haben, so waren zwei oder drei davon Juden. War ich mit ihnen befreundet, weil sie, trotzdem sie Juden waren? Ich war mit ihnen befreundet, weil der Funke der menschlichen Liebe zwischen uns sprang.» Heuss beließ es nicht bei dieser geradezu intimen Selbstauskunft (anders als Adenauer, der sich im Januar 1960 vor der Fernsehnation auf die Andeutung beschränkte, es seien Juden gewesen, die ihm in der Bedrängnis durch die Nationalsozialisten 1933 geholfen hätten[59]). Vielmehr setzte der Präsident, wohl als Ausweis seiner inneren Freiheit, hinzu: «Es hat auch Juden gegeben, denen ich in einem schlichten Bogen ausgewichen bin; nicht, weil sie Juden waren, sondern weil sie mir nicht lagen. Ich weiche auch heute noch manchen Leuten aus, die – also – ‹Arier› sind.»
Indem er von «Ariern» und Zionisten sprach, vor dem «wenig schönen Wort ‹Assimilationsjuden›» nicht zurückschreckte, schließlich auf die Leistungen deutsch-jüdischer Künstler und Nobelpreisträger seit dem Kaiserreich verwies, suchte sich Heuss auch hinsichtlich der «sozialen Strukturierung etwa des deutschen Judentums» als bewandert zu präsentieren – und geriet in ein Schwadronieren, das selbst für die Diskursverhältnisse der späten vierziger Jahre erstaunlich war: «Ich kenne das kleinbürgerliche jüdische Spießbürgertum aus dem Bilderbuch des deutschen Biedermeiers, neben dem, was – sehr scharfsinnig, manchmal verletzend, oft genug höchst interessant – als intellektualisiertes Judentum uns geschildert und dann verzerrt worden ist. Die geistige Fruchtbarkeit der Auseinandersetzung hat in diesen polaren Spannungen unendlich viel gewonnen, was man nicht vergessen darf, wenn man sich nicht selber belügen will.» Dazu passte, dass er Martin Buber und Victor Gollancz als Zeugen aufrief, letzteren als dezidierten Gegner der Kollektivschuldthese.[60] Und dazu passte, dass er die Schändungen jüdischer Friedhöfe, von denen «in der Zeitung» zu lesen sei, nicht als Ausdruck von Antisemitismus begreifen mochte, sondern – darin bis zum Ende seiner Amtszeit ganz im Einklang mit dem Kanzler, dem Innenminister und den Sicherheitsbehörden – als «bewusste politische Lausbüberei» von Menschen, die dem Ansehen der Bundesrepublik schaden wollten.