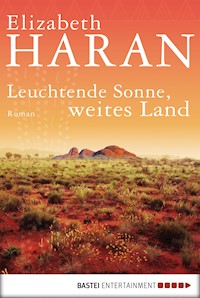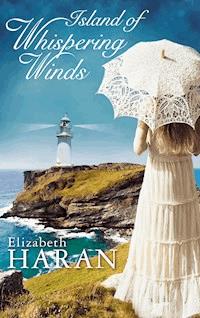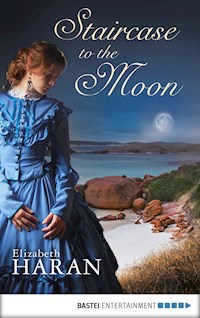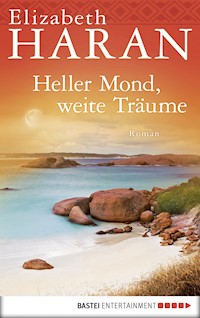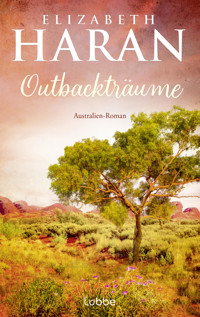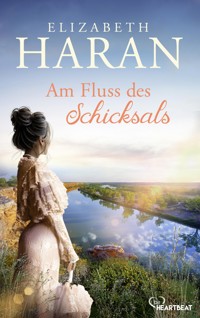9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Leben retten mit den Fliegenden Ärzten
- Sprache: Deutsch
Melville Island, 1942: Die junge Krankenschwester Catherine arbeitet in einem Waisenhaus vor der Küste Darwins. Dort kümmert sie sich um Kinder, die ihren Familien entrissen wurden. Sie ist mit dem Piloten Preston verlobt, und sie planen zu heiraten, sobald der Krieg in Europa vorüber ist. Doch dann kommt alles anders, als Darwin angegriffen wird. Catherine wird schwer verletzt. Prestons Flugzeug wurde abgeschossen, er gilt als vermisst. Catherine wird von den »Fliegenden Ärzten« nach Alice Springs evakuiert. Ihre Zukunftspläne und Träume scheinen zunichte gemacht. Kann sie je wieder glücklich werden?
Ein emotionaler Roman um eine junge Krankenschwester, die im Australien der 1940er-Jahre ihren Weg im Leben findet
Ein in sich abgeschlossener Roman um die »Fliegenden Ärzte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Melville Island, 1942: Die junge Krankenschwester Catherine arbeitet in einem Waisenhaus vor der Küste Darwins. Dort kümmert sie sich um Kinder, die ihren Familien entrissen wurden. Sie ist mit dem Piloten Preston verlobt, und sie planen zu heiraten, sobald der Krieg in Europa vorüber ist. Doch dann kommt alles anders, als Darwin angegriffen wird. Catherine wird schwer verletzt. Prestons Flugzeug wurde abgeschossen, er gilt als vermisst. Catherine wird von den »Fliegenden Ärzten« nach Alice Springs evakuiert. Ihre Zukunftspläne und Träume scheinen zunichte gemacht. Kann sie je wieder glücklich werden?
Über die Autorin
Elizabeth Haran wurde in Simbabwe/Afrika geboren, als das Land noch Südrhodesien hieß. In den 1960er-Jahren zog ihre Familie nach England, später wanderten sie nach Australien aus. Ihr erster Roman wurde im Jahr 2001 veröffentlicht. Für ihre Recherchen besucht sie stets die Orte, die als Kulisse für ihren nächsten Roman dienen. Elizabeth lebt mit ihrer Familie und vielen Tieren an der Küste Südaustraliens. Nach dem Schreiben ist Kochen, vor allem von Curry-Gerichten, ihre zweite Leidenschaft.
Australien-Roman
Übersetzung aus dem australischen Englischvon Sylvia Strasser
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Vervielfältigung dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten
Titel der australischen Originalausgabe:
»The Lavender Club«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Elizabeth Haran
Published by arrangement with Elizabeth Haran-Kowalski
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6–20, Köln
Textredaktion: Marion Labonte, Labontext
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
Umschlagmotiv: © Mark Owen / Trevillion Images; © ilolab / Shutterstock; Brett Andersen / Shutterstock; Leah Pirone / Shutterstock; Igor Grochev / Shutterstock; Paul shuang / Shutterstock
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-5583-2
luebbe.de
lesejury.de
Freunde sind die Familie, die wir uns selbst aussuchen.
Friends are the family we choose ourselves.
Kapitel 1
Melville Island, Australien – 16. Juni 1942
»Heute ist es furchtbar schwül, finden Sie nicht auch, Father O’Reilly?«, fragte Schwester Catherine Thomas, als sie im Schatten der Bäume rings um das Waisenhaus in Garden Point auf Melville Island umherschlenderten. Wann immer sich eine Lücke im dichten Laubdach bot, hielten sie am Himmel nach japanischen Kampfflugzeugen Ausschau.
»Danken Sie dem Herrn, dass Sie als Krankenschwester eine luftige Tracht tragen können, Schwester Thomas«, erwiderte der Geistliche und wischte sich mit einem großen Taschentuch, das schon recht feucht war, den Schweiß von der Stirn. »Meine schwarzen Sachen kleben an mir wie eine zweite Haut.«
»Na ja, eigentlich sollte ich Strümpfe und einen Unterrock tragen, aber bei der Hitze ist das furchtbar unpraktisch, also verzichte ich lieber darauf«, gestand Catherine. »Aber behalten Sie das bitte für sich!«, fügte sie lachend hinzu. Die Hitze war auch der Grund, weshalb sie ihre lockigen blonden Haare kurz trug.
Father O’Reilly schätzte ihren Humor und ihr fröhliches Lachen. Beides war eine Wohltat im eintönigen Alltag auf dieser Insel, siebenunddreißig Meilen von der nordaustralischen Küste entfernt. »Keine Sorge, Ihr Geständnis ist bei mir gut aufgehoben.« Er seufzte. »Am liebsten würde ich ins Meer springen. Der Wunsch nach Abkühlung ist sogar größer als meine Angst vor Krokodilen und Haien!«
»Das geht mir genauso, Father. Die Ordensschwestern tun mir wirklich leid.« Catherine fächelte sich mit einem großen Bananenblatt Luft zu. »Vor allem die älteren, wie Sister Mary Margaret und Sister Beatrice.«
»Und warum, wenn ich fragen darf?«
»Die hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze machen ihnen sehr zu schaffen, und dann noch diese Ordenstracht, die für das Klima hier völlig ungeeignet ist. Wer hat sich so etwas ausgedacht? Wozu braucht man eine Haube, die Wangen, Ohren und Hals bedeckt? Und dazu noch einen Schleier? Und dann sollen sie unter der Wolltunika mit Zingulum und Skapulier auch noch sämtliche Unterkleider tragen. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, dass eine Nonne vom Scheitel bis zur Sohle verhüllt sein muss, um dem Herrn zu dienen?«
»Diese Trachten wurden vor vielen hundert Jahren entworfen, Schwester Thomas, und natürlich hat jeder Orden seine eigene«, entgegnete der Geistliche.
»Dann sollten sie unbedingt an die heutige Zeit angepasst werden! Ich bezweifle allerdings, dass das passieren wird. Wie auch immer – die Nonnen hier auf der Insel sollten einfach bequeme Sachen tragen. Und Sie auch. Hier sieht uns doch niemand. Und die Einheimischen würde es nicht stören, sie laufen selbst fast unbekleidet herum. Ich habe den Nonnen schon einmal den Vorschlag gemacht, ihre Tracht abzulegen, aber da waren sie so schockiert, als hätte ich sie gebeten, nackt über den Strand zu spazieren.«
Father O’Reilly lachte. »An dieser verschämten Einstellung der Schwestern wird sich auch nichts ändern.«
»Das ist wirklich schade.« Catherine wusste, dass mindestens drei der jüngeren Nonnen auf nicht notwendige Unterkleider verzichteten, doch das behielt sie wohlweislich für sich.
»Sie würden Ihnen entgegenhalten, dass es vielen Menschen schlechter geht als uns, Schwester Thomas.«
»Da haben Sie auch wieder recht«, räumte Catherine ein. »Was beklage ich mich hier über Kleidung und das Wetter, wo bei den Bombenangriffen auf den Norden Australiens doch so viele Menschen ums Leben gekommen sind oder ihr Zuhause verloren haben. Gott sei Dank ist Preston nichts passiert! Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde.«
Sie hatte ihren Verlobten, Lieutenant Preston Shipton, an Silvester auf einer Tanzveranstaltung in Darwin kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. Der Air-Force-Pilot war attraktiv und adrett, dazu großzügig und warmherzig. Ein ernsthafter junger Mann mit einer großen Portion Humor, und sie hatten viel Spaß miteinander. Genau wie Catherine wünschte auch er sich eine große Familie. Mit dem Heiraten hatten sie eigentlich bis nach Kriegsende warten wollen, ihre Meinung jedoch nach dem zweiten Luftangriff der Japaner geändert und einen Termin für Ende Juli vereinbart.
»Sie werden uns fehlen, Schwester Thomas«, sagte Father O’Reilly. »Aber wir verstehen, dass Sie uns nach der Hochzeit verlassen und eine Familie gründen möchten.«
»Ich werde alle hier auch schrecklich vermissen«, erwiderte Catherine. »Ich bin zwar erst seit einem Jahr hier, aber die Menschen hier sind wie eine Familie für mich.«
»Die Kinder lieben Sie, und Sie können einfach wunderbar mit ihnen umgehen.« Der alte Geistliche lächelte und schlug dann nach einem Moskito an seinem Hals. »Wie kann es sein, dass die Moskitos die halb nackten Tiwi verschonen, mich aber auffressen, sobald sie auch nur das kleinste Fleckchen unbedeckter Haut finden?«, klagte er.
Die Tiwi waren ein auf der Insel beheimateter Aborigine-Clan. Melville Island, von den Ureinwohnern Yermainer genannt, gehörte ebenso wie Bathurst Island und neun weitere unbewohnte Inseln zu den Tiwi Islands.
»Ich glaube, sie reiben sich mit dem Saft einer Pflanze ein, damit sie nicht gestochen werden.«
»Wissen Sie, welche Pflanze das ist, Schwester Thomas?«
»Nein, leider nicht.«
»Das müssen wir unbedingt herausfinden.«
Mit einem Mal waren sie von einigen Kindern umringt. Insgesamt waren in dem Waisenhaus fünfunddreißig Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren untergebracht. Sie alle entstammten Verbindungen zwischen Aborigines und Weißen und waren gewaltsam aus ihren Familien herausgerissen worden. Catherine brach allein der Gedanke daran das Herz. Sie war strikt gegen die Politik der Regierung, diese Kinder – angeblich zu deren Bestem – von ihren Familien zu trennen, konnte aber nichts dagegen unternehmen. Sie konnte nur hoffen und beten, dass sie eines Tages wieder mit ihren Familien vereint werden würden.
»Ist schon Essenszeit?«, fragte sie die lebhafte Schar.
»Ja, jetzt gleich«, antwortete einer der älteren Jungen. »Sister Beatrice hat gesagt, wir sollen Sie und Father O’Reilly holen.«
In der Ferne waren die Nonnen vor den zwei barackenähnlichen Schlafgebäuden der Kleinen zu sehen. »Nun, dann wollen wir sie nicht warten lassen.« Catherine klatschte in die Hände und versammelte die Kinder, die noch im Schatten spielten, zum Händewaschen bei einem Eimer Wasser.
Die Nonnen deckten unterdessen den langen Holztisch. Nachdem alle auf den Bänken zu beiden Seiten Platz genommen hatten, sprach Father O’Reilly das Tischgebet, und sie machten sich über das Mittagessen her, ein karges Mahl aus Fisch, Gemüse und Reis. Da es so gut wie keine öffentlichen Gelder für das Waisenhaus gab, der Lebensmittelnachschub vom Festland oft erst verspätet eintraf und die Ordensfrauen nur Gemüse anbauten, versorgten die Insulaner die kleine Gemeinschaft freundlicherweise mit Fisch und Früchten.
Seit der Bombardierung Darwins durch die Japaner am 19. Februar und weiteren Angriffen auf das gesamte Gebiet lebten Catherine, die Nonnen und Father O’Reilly in ständiger Alarmbereitschaft. Während der Angriffe hatten sie in den Kellerräumen unter der kleinen katholischen Kirche der Insel, St. Peter’s, Schutz gesucht, aber das Dröhnen der Flugzeuge und das Donnern der Explosionen war dennoch furchteinflößend und verfolgte sie bis heute.
Ein Großteil der Einwohner Darwins war nach dem Luftangriff im Februar, bei dem die Stadt weitgehend zerstört worden war, in den Süden des Landes evakuiert worden. Die Kinder auf Melville Island jedoch waren nach Einschätzung der Regierung in Sicherheit, die Insel sei für die Japaner nicht von Interesse. Father O’Reilly war darüber erzürnt und vermutete, die Regierung wolle schlicht die Kosten für die Evakuierung von Aborigine-Kindern sparen. Er hatte sich deswegen mehrmals direkt an den Leiter der Behörde für Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung in Darwin gewandt, war jedoch mit seinem Hilfegesuch auf taube Ohren gestoßen.
Die Kinder hatten gerade angefangen zu essen, als plötzlich ein tiefes Dröhnen die friedliche, vom Gesang tropischer Vögel und dem Plätschern der Wellen begleitete Ruhe störte. Das Brummen war unverkennbar. Alle hielten den Atem an und starrten angstvoll zum Himmel hinauf. Zwei Minuten später tauchten die Flugzeuge auf. Sie flogen in Formation Richtung Nordküste und Darwin. An den Unterseiten der Tragflächen waren rote Kreise zu erkennen. Ein japanisches Geschwader, siebenundzwanzig Bomber und ebenso viele Jagdflugzeuge.
Catherine war entsetzt. »O nein, nicht schon wieder!«, rief sie.
»In den Keller! Schnell!«, befahl Father O’Reilly.
Die Kinder sprangen auf, und die Nonnen trieben sie eilig zum Zugang auf der Rückseite der Kirche. Der Schutzraum war klein und muffig und mit fünfundvierzig Personen völlig überfüllt, aber es war der einzige auf der Insel. Kaum waren alle drin, schlug Sister Mary Ellen hastig die Tür zu. Durch die Ritzen im Holz fiel ein klein wenig Licht herein, sonst wäre es finster gewesen wie in einer Höhle. Die stickige Luft machte das Atmen schwer. Einige der kleineren Kinder fingen verängstigt an zu weinen, und Catherine und die Ordensfrauen versuchten, sie zu beruhigen. »Alles wird gut«, sprachen sie tröstend.
Catherine dachte an all die unschuldigen Menschen, die dieser Angriff das Leben kosten würde, und flehte im Stillen Gott an, er möge Preston beschützen.
Sister Mary Ellen stimmte Weihnachtslieder an und forderte die Kinder auf mitzusingen. Der Gesang wirkte dem Lärm der Bomben und Explosionen ein klein wenig entgegen, doch manche Detonationen klangen so beängstigend nah, dass Catherine sich fragte, ob sogar die Insel bombardiert wurde. Der Angriff dauerte fünfundvierzig qualvolle Minuten, die ihnen wie Stunden vorkamen. Dann endlich kehrte Ruhe ein.
»Ich glaube, es ist vorbei. Was meinen Sie?«, wandte sich Father O’Reilly an Catherine.
»Ich höre nichts mehr«, antwortete Catherine leise.
»Ich auch nicht«, sagte Sister Beatrice.
»Ich schaue mal nach.« Der alte Geistliche stieg die steilen, ausgetretenen Steinstufen hinauf und öffnete die knarrende Tür einen Spaltbreit. Licht fiel auf die Gesichter der Kinder, die gespannt zu ihm aufblickten. Nachdem Father O’Reilly nichts Auffälliges mehr hörte, forderte er alle auf, den Keller zu verlassen. »Bleibt zusammen und in der Nähe«, schärfte er den Kindern ein.
Als sie um die Kirche bogen, flatterten Vögel vom Mittagstisch auf – vom Mittagessen war nicht mehr viel übrig. Die Kinder waren enttäuscht und streiften durch die unmittelbare Umgebung, während Father O’Reilly, die Nonnen und Catherine mit den Augen den Himmel absuchten. In der Ferne waren Flugzeuge der australischen Air Force, aber keine japanischen Bomber mehr zu erkennen. Catherine wandte sich den Kindern zu und zählte sie durch. Zwei fehlten. Sie zählte noch einmal, doch das Resultat war dasselbe. Jay und Coen waren verschwunden. Das erstaunte Catherine nicht – die beiden Cousins führten ständig etwas im Schilde und wurden nicht selten ausgeschimpft, weil sie nicht gehorchten. Catherine rief nach ihnen und eilte auf die Rückseite der Kirche, doch dort waren sie auch nicht. Ein Mädchen zeigte auf den Weg entlang des Ufers und sagte, die Jungen seien in diese Richtung gegangen.
Melville Island war über fünfeinhalbtausend Quadratkilometer groß und bestand zu einem Großteil aus undurchdringlichem Buschland. Mangrovenwälder voller Moskitoschwärme säumten die Küsten. Es kam vor, dass Salzwasserkrokodile sich auf die Insel verirrten, deshalb hoffte Catherine inständig, dass sich die Jungen nicht allzu weit entfernt hatten.
»Ich gehe sie suchen«, rief sie Father O’Reilly und den Ordensfrauen zu und folgte eilig dem Trampelpfad zum Meer hinunter. So wie sie die beiden Sechs- und Siebenjährigen kannte, hofften die abenteuerlustigen Lausbuben vermutlich, dass Wrackteile eines Flugzeugs oder eines Schiffs angespült worden waren.
Father O’Reilly, der sich um Catherine und die Kinder sorgte, folgte ihr, kam aber, übergewichtig und unsportlich wie er war, sehr viel langsamer voran.
Dann endlich sah sie die Jungen. Die beiden starrten gebannt auf etwas, und bald erkannte auch Catherine, was es war: ein Flugzeugrumpf. Er lag unweit des Ufers inmitten dichten Gestrüpps, die Tragflächen waren gebrochen. An den Seiten waren Einschusslöcher zu erkennen.
Catherine lief schneller. Der Anblick eines Toten, der sich möglicherweise in dem Flugzeug befand, wäre traumatisch für die Kinder.
»Geht da weg, Jungs!«, rief sie energisch. Als sie an einer der Tragflächen einen roten Kreis bemerkte, begann ihr Herz zu rasen.
Hinter ihr tauchte schnaufend Father O’Reilly auf, völlig außer Atem und unfähig, ein Wort hervorzubringen.
Die Jungen starrten fasziniert auf das Flugzeugwrack. »Wo is der Fahrer, Schwester Thomas?«, wollte Jay wissen.
»Du meinst den Piloten«, verbesserte Catherine mit einem schnellen Blick ins Innere des Flugzeugs. Darin war niemand. Sie nahm die Kinder bei den Händen und zog sie vom Rumpf weg, während sie mit den Augen die unmittelbare Umgebung nach einer Leiche absuchte. »Ich weiß nicht, wo er ist«, murmelte sie nervös, »aber ihr habt hier nichts verloren. Father O’Reilly hat doch gesagt, ihr sollt in der Nähe bleiben! Ihr geht jetzt sofort zurück, verstanden?«, fügte sie streng hinzu. Ein Blick zu dem Geistlichen verriet ihr, dass auch er wegen des Piloten beunruhigt war.
»Vielleicht hat er den Schleudersitz betätigt«, stieß er, immer noch schwer atmend, hervor.
»Ich will den Piloten sehen«, quengelte Coen.
»Der ist nicht mehr da. Und jetzt ab nach Hause, sonst bekommt ihr eine Strafe aufgebrummt!«, drohte Catherine.
»Wo is er denn?«, bohrte Jay weiter.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwo im Wasser. Abmarsch, und zwar sofort!«, befahl Catherine energisch.
»Geht endlich, Jungs«, forderte auch Father O’Reilly sie auf.
Mit hängenden Schultern trotteten die beiden davon. Catherine schaute ihnen eine Weile nach, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich nicht stehenblieben. Sie wäre ja mitgegangen, aber sie musste mit Father O’Reilly die Gegend absuchen, denn falls die Leiche des Piloten sich hier irgendwo befand, würden sie die Behörden auf dem Festland darüber benachrichtigen müssen.
Als Catherine sich wieder zu dem Geistlichen umdrehte, schnappte sie erschrocken nach Luft. Ein Mann, bewaffnet mit einem dicken Ast, hatte sich drohend vor ihm aufgebaut. Der japanische Pilot! Sie bemerkte eine blutige Spur zu dem Dickicht in unmittelbarer Nähe, offenbar hatte er sich dort versteckt. Catherine überlief ein eiskalter Schauder bei dem Gedanken daran, wie nahe die beiden Jungen ihm gewesen waren. Seine Fliegermontur war voller Blut, es quoll aus einer Kopfwunde, lief ihm in die Augen und übers Gesicht. Jetzt schwang er den Ast in Father O’Reillys Richtung, der beschwichtigend auf ihn einredete.
»Immer mit der Ruhe«, sagte er mit zittriger Stimme, »wir tun Ihnen nichts.« Er wich soweit er konnte zurück.
Plötzlich warf sich der Pilot auf ihn. Der Geistliche trat einen Schritt zur Seite, strauchelte und stürzte.
Catherine zögerte keine Sekunde. »Aufhören!«, schrie sie zornig. »Es gibt keinen Grund, hier Gewalt anzuwenden!« Der Gedanke, dass der Japaner sie möglicherweise gar nicht verstand, kam ihr nicht einmal.
Der Pilot wirbelte herum, holte aus und schlug mit dem Ast nach ihr, der sie mit voller Wucht quer über den Unterleib traf. Das alles geschah so schnell, dass Catherine keine Zeit blieb zu reagieren. Sie krümmte sich vor Schmerzen, und gerade als sie sich wieder halbwegs aufgerichtet hatte, traf sie die Spitze des Asts mit voller Wucht wie ein Bajonett in den Bauch. Catherine wurde zurückgeschleudert und fiel hart auf den Rücken.
Der Japaner war schmächtig, aber als sich Father O’Reilly aufgerappelt hatte, um ihn von Catherine wegzuzerren, stieß er den Geistlichen mühelos zur Seite. Catherine war überzeugt, dass sie beide sterben würden. Sie war unfähig, sich zu rühren, sie konnte nicht einmal um Hilfe rufen, sämtliche Luft war aus ihren Lungen gepresst.
In diesem Moment tauchten drei große, kräftige Tiwi auf. Sie überwältigten den Piloten und hielten ihn fest, dann kamen weitere Insulaner herbei.
Father O’Reilly war in großer Sorge um Catherine. Er kroch auf Händen und Knien zu ihr, sofort waren auch schon drei Insulanerinnen bei ihr, und dann ging alles ganz schnell. Catherine, die zeitweilig das Bewusstsein verlor, wurde auf einer von den Tiwi gebauten Trage zum Waisenhaus gebracht. Die Ordensschwestern forderten per Funk ein Boot vom Festland an, um sie ins Krankenhaus zu transportieren. Außerdem trafen Bedienstete vom Militär ein und nahmen den japanischen Piloten fest.
»Schwester«, krächzte Catherine heiser.
»Du bist ja wach, Catherine.« Die Frau trat zu ihr, und in diesem Moment erkannte Catherine sie.
»Nancy!« Sie hatte mit Nancy Teagan vor fünf Jahren aus Southampton in England nach Australien abgelegt und dann mit ihr zusammen im Krankenhaus in Darwin die Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. »Wo bin ich?«
»In einem kleinen Krankenhaus in Stuart Park. Das in Darwin ist beim ersten Luftangriff schwer beschädigt worden, wie du sicher weißt. Hast du Schmerzen?«
Catherine nickte und stöhnte. »Was fehlt mir denn?«
»Du hattest innere Blutungen und musstest operiert werden, um sie zu stillen. Und meines Wissens ist auch dein Becken gebrochen. Man hat uns erzählt, dass ein japanischer Pilot dich angegriffen hat, der mit seiner Maschine auf Melville Island abgestürzt ist?«
Wieder nickte Catherine. Das würde sie nie im Leben vergessen. Wenn sie jetzt die Augen schloss, durchlebte sie die Szene aufs Neue. »Werde ich wieder ganz gesund werden?«
»Das musst du Dr. Macintyre fragen. Aber ich bin sicher, du schaffst das, du bist jung und ansonsten gesund. Dr. Macintyre wird auch entscheiden, was wir dir noch gegen die Schmerzen geben können.«
»Ich würde gerne meinen Verlobten sehen, Lieutenant Preston Shipton. Er weiß doch gar nicht, wo ich bin! Kannst du ihn irgendwie benachrichtigen, Nancy?« Catherines Augen füllten sich mit Tränen.
Nancy seufzte. »Ich kann hier leider nicht weg, Catherine. Niemand weiß, wann der nächste Angriff kommt, und dann müssen die Verwundeten versorgt werden, da wird hier jeder gebraucht.«
»Bitte. Ich sehne mich so nach ihm«, beschwor Catherine sie. »Ich brauche Preston jetzt.«
»Also gut, ich schau mal, was ich tun kann«, versprach Nancy voller Mitgefühl. »Und jetzt ruh dich aus. Der Arzt kommt sicher bald.«
In den folgenden Tagen sah Dr. Macintyre regelmäßig nach Catherine und ließ ihr Mittel gegen die Schmerzen verabreichen. Immer wieder fragte sie nach Preston und bat darum, ihn zu treffen. Am liebsten hätte sie das Krankenhaus verlassen, aber schon die geringste Bewegung verursachte ihr unerträgliche Schmerzen, und die Medikamente waren so stark, dass sie bisweilen halluzinierte.
»Die Kinder müssen in den Schutzraum!«, schrie sie Nancy einmal an.
»Es ist alles in Ordnung, Catherine. Father O’Reilly hat uns gesagt, dass es den Kindern gut geht«, versuchte diese, sie zu beruhigen. »Sie machen sich nur Sorgen um dich. Du darfst dich nicht aufregen! Bleib ruhig liegen, damit alles gut verheilen kann«, schärfte sie ihr ein.
Catherine antwortete nicht und schlief kurz darauf ein. Als sie Stunden später aufwachte, war es draußen dunkel. »Ich kann doch nicht untätig hier herumliegen«, jammerte sie. »Preston wird sich allmählich fragen, wo ich bin, und die Nonnen und Father O’Reilly brauchen mich! Die Kinder können ganz schön anstrengend sein.«
»In deinem Zustand bist du ihnen keine Hilfe, Catherine«, argumentierte Nancy. »Du musst erst ganz gesund werden.«
»Dann möchte ich wenigstens Preston sehen! Bitte, Nancy!«
»Ich habe jemanden mit einer Nachricht zum Stützpunkt geschickt. Preston kommt sicher, sobald er kann.«
Das stimmte Catherine zwar ein wenig fröhlicher, steigerte aber auch die Ungeduld, mit der sie auf ihn wartete.
Eines Morgens tauchte ein Mann in Air-Force-Uniform im Türrahmen auf. Nancy, die neben ihm stand, deutete auf Catherine, und der Fremde trat mit ernster, bedrückter Miene näher.
Catherine überkam eine böse Vorahnung. »Wo ist Preston? Geht es ihm gut?«, fragte sie.
»Ich bin Geschwaderkommodore Reginald Scott, Miss Thomas.« Er senkte den Blick, und Catherine sackte das Herz in die Magengrube.
»Ist mit Preston alles in Ordnung? Es geht ihm doch gut, oder?« Die Angst schnürte ihr die Kehle zu.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass sein Flugzeug über der Timorsee abgeschossen wurde, Miss Thomas. Wir haben das ganze Gebiet nach ihm abgesucht, bisher ohne Erfolg.«
Catherine starrte den Geschwaderkommodore an, während ihr Verstand aufzunehmen versuchte, was sie gerade gehört hatte. »Sie werden weiter nach ihm suchen, nicht wahr?«, flüsterte sie.
»In den nächsten vierundzwanzig Stunden auf jeden Fall, aber die Strömung dort ist sehr stark, die Wrackteile könnten bereits meilenweit abgetrieben worden sein.«
»Soll das heißen … Sie geben ihn auf? Er könnte noch am Leben sein und auf Rettung warten!«
Der Kommodore blickte betreten drein. »Ich halte das für unwahrscheinlich, Miss Thomas.«
Catherines Herz setzte einen Schlag aus. »Wollen Sie damit sagen, dass er … tot ist?«
»Ich fürchte, wir müssen das in Betracht ziehen. Aber solange seine sterblichen Überreste nicht gefunden werden, gilt er als vermisst.«
»Seine sterblichen Überreste«, wiederholte Catherine schluchzend. Er sprach von ihrem Verlobten!
»Seine Familie ist bereits benachrichtigt worden.«
Sie lebte in New South Wales und hatte sich, wie Catherine wusste, sehr auf die Reise zu ihrer und Prestons Hochzeit gefreut.
Catherine wandte sich ab. »Nein!«, rief sie gequält. »Er kann nicht tot sein! Wir wollen doch in vier Wochen heiraten!«
»Es tut mir sehr leid«, sagte der Kommodore leise. Er ging zu Nancy, die an der Tür stehen geblieben war, und fragte: »Hat Miss Thomas Angehörige in Darwin?«
Nancy schüttelte den Kopf. »Nein. Ihre Eltern sind gestorben, als sie noch sehr jung war, und die Tante, bei der sie in England aufgewachsen ist, ist ebenfalls seit ein paar Jahren tot. Sie ist auf sich allein gestellt. Das war auch ein Grund, weshalb sie nach Australien gezogen ist und hier Arbeit gesucht hat.«
Der Kommodore nickte niedergeschlagen. »Sie wird Sie jetzt brauchen«, sagte er, dann verabschiedete er sich und ging.
Nancy trat an Catherines Bett. »Es tut mir schrecklich leid, Catherine«, sagte sie voller Mitgefühl.
»Ich kann nicht glauben, dass Preston tot ist! Nicht, solange es keinen Beweis dafür gibt«, stieß Catherine hervor. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie begann hemmungslos zu schluchzen. Heftige Weinkrämpfe schüttelten sie und verstärkten die Schmerzen in ihrem Unterleib. Nancy rief nach Dr. Macintyre, der seiner Patientin sogleich ein beruhigendes Mittel injizierte.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte Father O’Reilly, der seit Stunden an ihrem Bett saß in der Hoffnung, sie werde zu sich kommen, bevor er wieder zurück nach Melville Island musste. Ihn quälten Schuldgefühle, denn Schwester Thomas war nur verletzt worden, weil sie versucht hatte, ihn zu schützen.
Catherine war drei Tage lang ruhiggestellt worden und hatte fast die ganze Zeit geschlafen. In den kurzen Phasen des Wachseins hatte sie mit niemandem reden wollen. »Was machen Sie hier, Father O’Reilly?«, murmelte sie jetzt benommen.
»Ich wollte nach Ihnen sehen. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wir alle haben uns Sorgen gemacht. Ich soll Sie ganz herzlich von den Ordensschwestern grüßen, und die Kinder vermissen Sie.«
»Geht es ihnen gut?«
»Ja, bestens. Und wie geht es Ihnen?« Er zögerte. »Die Sache mit Ihrem Verlobten tut mir sehr leid.«
Catherine wandte das Gesicht ab.
In diesem Moment kam Dr. Macintyre herein. Er trat an ihr Bett, streifte den Geistlichen mit einem kurzen Blick und sagte: »Sie werden morgen nach Alice Springs verlegt, Miss Thomas. Allerdings nicht wie die meisten verletzten Zivilisten und Militärs mit dem Lastwagen, sondern wegen der Schwere Ihrer Verletzungen mit einem Flugzeug des Flying Doctor Service.«
Catherine schwieg. Es war ihr egal, was mit ihr passierte. Ihr Leben war sinnlos, seit sie Preston verloren hatte.
Der Arzt wirkte mit einem Mal verlegen. Nach einem weiteren flüchtigen Blick auf den Geistlichen fuhr er fort: »Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Für den Fall, dass Sie die Absicht haben, irgendwann einmal zu heiraten und eine Familie zu gründen … Aber vielleicht sollten wir das lieber unter vier Augen besprechen?«
Als Father O’Reilly aufstehen wollte, hielt Catherine ihn mit einer Handbewegung zurück, sie brauchte seinen Beistand jetzt dringender denn je. Sie war verwirrt und fühlte sich, als hätte sie ihren Körper verlassen und beobachtete, wie Dr. Macintyre mit einer völlig anderen Person sprach, ohne dass sie selbst anwesend war.
»Der Beckenbruch wird mit der Zeit verheilen«, sagte der Arzt, als sie ihn ansah. »Viel schlimmer sind die inneren Verletzungen im Bauchraum, verursacht durch den brutalen Schlag. Ich habe getan, was ich konnte, und die Spätfolgen lassen sich nur schwer abschätzen, aber ich fürchte, Sie müssen damit rechnen, dass Sie keine Kinder bekommen können.«
Catherine fühlte sich wie betäubt. Fassungslos starrte sie den Arzt an. »Ich kann keine Kinder bekommen?«, krächzte sie heiser.
»Es tut mir sehr leid, Miss Thomas, ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für Sie. Die Hauptsache ist, dass Sie wieder gesund werden und hoffentlich ein langes, glückliches Leben haben werden.«
Catherine hätte ihn am liebsten angeschrien, aber dazu fehlte ihr die Kraft. Sie wandte sich ab und schloss die Augen. Ein Leben ohne Preston, ohne eigene Kinder, war für sie nicht lebenswert.
»Es tut mir sehr leid, Schwester Thomas«, sagte Father O’Reilly, nachdem der Arzt gegangen war. »Ich glaube fest an Wunder, geben Sie also die Hoffnung nicht auf, eines Tages doch noch Mutter zu werden.«
»Mir scheint, Gott hat andere Pläne mit mir, Father«, erwiderte Catherine, und ihr Herz brach.
Den Transport vom Krankenhaus zum Stadtrand nahm Catherine kaum wahr. Der Morgen dämmerte herauf und überzog den Himmel mit prächtigen Farben, als sie auf einem privaten, in Notfällen benutzten Rollfeld auf eine Trage geschnallt und an Bord der De Havilland Moth des Flying Doctor Service gebracht wurde.
»Guten Morgen, Miss Thomas. Ich bin Dr. Curtis von den Fliegenden Ärzten«, sagte eine warme, freundliche Stimme. Catherine blickte in ein Gesicht mit gütigen grünen Augen und einem vertrauenerweckenden Lächeln. »Ich werde mich auf dem Flug nach Alice Springs um Sie kümmern«, fügte der etwa vierzigjährige Arzt hinzu. »Falls Sie Schmerzen haben oder irgendetwas nicht in Ordnung ist, sagen Sie mir bitte Bescheid.«
Catherine nickte und verzog unwillkürlich das Gesicht, als der Motor angelassen wurde, weil er so laut war.
»Wir starten in ein paar Minuten. Unser Pilot heißt Crispin Walters«, fuhr Dr. Curtis fort. Sie waren am Tag zuvor bei Sonnenuntergang gelandet und hatten hier im Flugzeug geschlafen. Der Flugplatz von Darwin war von den Japanern unter Beschuss genommen worden, aber private Landebahnen wie diese galten als ziemlich sicher.
»Ich habe noch nie etwas vom Flying Doctor Service gehört«, bekannte Catherine und schaute sich um. Depotschränke und Aufbewahrungsboxen füllten den beengten Raum aus. Dr. Curtis saß auf dem einzigen Sitz neben ihrer Tragbahre.
»Nun, die Organisation wurde 1928 in Cloncurry von Reverend John Flynn gegründet, um die medizinische Versorgung der Menschen im Outback sicherzustellen. Damals weigerten sich viele Frauen, dorthin zu ziehen, weil es im Outback keine Ärzte gab. Sie hatten Sorge, ihre Kinder zur Welt bringen zu müssen, ohne dass im Notfall Hilfe zur Stelle wäre. Das hat sich mittlerweile geändert«, erzählte Dr. Curtis, während das Flugzeug über die Piste rollte und schließlich abhob.
»Gibt es in der Organisation auch Krankenschwestern?«, fragte Catherine. Ihr Kopf fühlte sich an wie mit Watte gefüllt, als das starke Schmerzmittel, das er ihr verabreicht hatte, zu wirken begann.
»Noch nicht in Festanstellung, aber ich hoffe, dass sich das ändert. Es wäre wunderbar, eine Fliegende Krankenschwester an Bord zu haben. Eine, die nicht Patientin ist«, antwortete er lächelnd.
Catherine dämmerte weg. Sie schlief ein und wachte erst wieder auf, als sie in Alice Springs aus dem Flugzeug getragen und ins Krankenhaus gebracht wurde.
Kapitel 2
Alice Springs, Australien – Februar 1943
»Was sitzen Sie denn hier herum, während im Aufenthaltsraum Karten gespielt wird?« Die Hände in die Seiten gestemmt, stand Schwester Wilson im Türrahmen von Catherines Zimmer im Martindale Genesungsheim. Sarah Wilson hatte täglich ihre liebe Not, Catherine dazu zu bringen, an den angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. »Den ganzen Tag allein in Ihrem Zimmer zu sitzen tut Ihnen nicht gut, Catherine. Das wissen Sie doch.«
»Mir ist nicht nach Kartenspielen«, murmelte Catherine vom Bett aus. Seit ihrer Ankunft in Alice Springs waren Monate vergangen. Körperlich hatte sie sich vollständig erholt, aber ihre Seele krankte noch immer. Die Trauer um Preston und das Gefühl, keine vollwertige Frau mehr zu sein, hatten sie in tiefe Depressionen gestürzt. Eine schwarze Wolke hüllte sie ein, aus der es kein Entkommen gab.
Sarah Wilson fand es jammerschade, dass jemand, der so viel zu geben hatte wie Catherine, sein Leben vergeudete. Die junge Frau interessierte sich für nichts mehr, nicht einmal für sich selbst. Ihre gesunde Bräune war verblasst, und sie lächelte so gut wie nie. Es war ihr egal, wie ihre Haare lagen, sie benutzte weder Lippenstift noch Rouge und trug nur unförmige, bequeme Kleidung. Für Sarah waren diese Nachlässigkeiten Ausdruck tiefer Traurigkeit.
»Das Krankenhaus in Alice Springs sucht verzweifelt Krankenschwestern«, sagte sie, während sie ins Zimmer trat und die Vorhänge zurückzog, um Licht hereinzulassen. »Ich überlege, ob ich mich bewerben soll.«
Catherine blinzelte wegen der hellen Sonne und nickte gleichgültig.
»Dort könnten Sie Ihre Fähigkeiten gut einsetzen«, fuhr Sarah fort. Allmählich verlor sie die Geduld. »Und es würde Ihnen guttun, wenn Sie wieder anfangen würden zu arbeiten.«
Statt einer Antwort drehte Catherine sich zur Wand.
»Wissen Sie was? Ich werde Ihren Namen auf die Liste der Bewerberinnen setzen.«
Catherine fuhr herum. »Das können Sie nicht machen!«, erwiderte sie so energisch wie schon lange nicht mehr.
Sarah wertete das als gutes Zeichen. »O doch, ich kann und ich werde es machen.« Sarah wusste, dass sie Catherines Namen nicht gegen deren Willen auf eine Bewerbungsliste schreiben durfte, aber sie konnte ihr zumindest damit drohen. »Es reicht, Catherine. Ihre Verletzungen sind vollständig verheilt, was also wollen Sie noch hier?«
»Soll das ein Rauswurf zu meinem eigenen Besten sein?«, gab Catherine bissig zurück.
»Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie müssen nach vorn schauen, Catherine. Sie können die Vergangenheit nicht ändern, und Sie können sich nicht ewig hier verkriechen und Trübsal blasen. Ihr Bett wird gebraucht. Fangen Sie wieder an zu arbeiten, und helfen Sie denen, die schlimmer dran sind als Sie.« Als Catherine nicht antwortete, stieß Sarah einen tiefen Seufzer aus. »Und wenn Sie ein bisschen mehr auf Ihr Äußeres achten würden, ginge es Ihnen auch besser.«
Catherine starrte sie ungläubig an, doch bevor ihr eine passende Entgegnung einfiel, eilte Sarah aus dem Zimmer und stapfte durch den Flur davon. Ihre Worte hallten in Catherine nach. Zweieinhalb Monate hatte sie in Alice Springs im Krankenhaus gelegen, bevor sie in dieses Genesungsheim verlegt worden war, und seitdem waren noch viel mehr Monate vergangen. Sie wusste nur zu gut, dass das Pflegepersonal im Krankenhaus vor Arbeit kein Bein mehr auf die Erde bekam. Und natürlich war es längst an der Zeit, dass sie ins Leben zurückfand und sich besser um sich selbst kümmerte. Doch obwohl ihr das alles klar war, brachte sie es einfach nicht fertig zu handeln, und das hatte auch mit einem Erlebnis vor vier Wochen zu tun.
Ein Pilot, der bei einer Bruchlandung westlich von Darwin Verbrennungen am ganzen Körper und zudem zahlreiche Knochenbrüche an den Beinen erlitten hatte, war nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt und etlichen Operationen in das Genesungsheim verlegt worden. Eines Tages, als er im Rollstuhl an Catherines Zimmer vorbeigeschoben wurde, hatte er einen Blick durch die offene Tür geworfen.
»Warten Sie. Ist das Catherine Thomas?«, fragte er die Krankenschwester. Er war sich nicht sicher, die Frau im Zimmer sah anders aus als in seiner Erinnerung, dünner, blasser, und ihre Haare waren länger.
»Ich weiß es nicht. Ich arbeite noch nicht lange hier.«
»Catherine?«, rief er.
»Ja«, antwortete Catherine zögernd. »Kennen wir uns?«
»Ich sehe zum Fürchten aus, ich weiß.« Vernarbte Brandwunden bedeckten sein Gesicht. »Simon Liptak. Ich war in Prestons Einheit.«
»Oh!« Catherine hatte Simon ein paarmal getroffen, als sie mit Preston ausgegangen war, und ihn als gut aussehenden Mann in Erinnerung. Sie war schockiert, ihn jetzt so zu sehen.
»Seit wann bist du hier?«, fragte er.
»Seit einer ganzen Weile«, antwortete sie, verlegen, weil sie keine sichtbaren Verletzungen hatte.
»Bist du bei einem Bombenangriff verletzt worden?«
»Nein.« Sie erzählte von der Attacke des Japaners.
Simon schüttelte angewidert den Kopf. »Die Japaner haben mich abgeschossen, und ich bin abgestürzt. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch lebe.« Er schwieg einen Moment. »Der arme Preston hatte leider nicht so viel Glück.«
»Das weiß doch aber keiner genau, oder?«, erwiderte Catherine, die sich immer noch nicht eingestehen wollte, dass sie ihn vielleicht nie wiedersehen würde.
Simon atmete tief durch und sah sie betrübt an. »Man hat Wrackteile seiner Maschine gefunden, Catherine. Sie wurden etliche hundert Meilen entfernt ans Ufer geschwemmt«, sagte er leise.
»Das wusste ich nicht.« Catherines Herz raste jetzt so sehr, dass sie glaubte, ohnmächtig zu werden. »Aber dann hat er es doch vielleicht auch geschafft, sich ans Ufer zu retten.«
»Das Flugzeug ist beim Abschuss in tausend Stücke gesprengt worden, Catherine. Das kann er nicht überlebt haben. Unmöglich.«
Übelkeit stieg in ihr auf. Sie spürte, wie ihr die Tränen kamen, und wandte sich ab.
»Es tut mir leid«, murmelte Simon. Er gab der Schwester ein Zeichen, ihn weiterzuschieben.
Catherine weinte bitterlich. Simon Liptak hatte soeben den letzten Funken Hoffnung in ihr erstickt.
»Hallo, Miss Thomas«, sagte eine Männerstimme aus Richtung Zimmertür. Eine Woche war vergangen, seit Sarah Catherine gedroht hatte, ihren Namen auf die Liste der Bewerberinnen für das Krankenhaus in Alice Springs zu setzen. Catherine saß auf einem Stuhl und schaute gedankenverloren aus dem Fenster. Es war ein brütend heißer Nachmittag, die Trockenheit hatte fast die gesamte Vegetation dahingerafft, aber die MacDonnell Ranges waren immer ein wunderbarer Anblick, vor allem bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sie hielt ein Buch in den Händen, war aber nicht weiter als bis zur ersten Seite gekommen, die sie zehnmal gelesen hatte, ohne auch nur ein einziges Wort aufzunehmen.
»Erinnern Sie sich an mich? Dr. Fitzpatrick. Sie waren vor vielen Monaten als Patientin bei mir im Krankenhaus von Alice Springs.«
»Ja, natürlich. Hallo, Dr. Fitzpatrick.« Der Arzt war immer freundlich, verständnisvoll und geduldig gewesen. »Was führt Sie hierher?«
»Nun, Sie haben mir damals erzählt, dass Sie Krankenschwester sind. Ich will ehrlich sein. Wir haben viel zu wenig Personal, und da dachte ich, ich frage Sie, ob Sie nicht Lust hätten, uns zu helfen.«
Catherine musterte ihn misstrauisch. »Da steckt doch bestimmt Sarah Wilson dahinter, hab ich recht?«
»Na ja, Sarah wird bei uns anfangen, und als ich ihr mein Leid geklagt habe, dass wir völlig unterbesetzt sind, hat sie mir diesen Tipp gegeben«, sagte der Arzt leicht verlegen. »Wir könnten Ihre Hilfe wirklich gebrauchen, Miss Thomas«, fügte er eindringlich hinzu.
Catherine schlug ihr Buch mit einem Knall zu. »Aber Sie wissen schon, dass mein Verlobter von den Japanern abgeschossen wurde?«, stieß sie voller Bitterkeit hervor. Und schon brach die schmerzhafte seelische Wunde wieder auf.
Dr. Fitzpatrick nickte. »Ja, das haben Sie mir damals erzählt. Und Sie dürfen mir glauben, dass Ihnen mein ganzes Mitgefühl gilt. Mir ist klar, dass die vielen verwundeten Soldaten, die bei uns eingeliefert werden, Sie ständig an Ihren Verlust erinnern würden, deshalb habe ich auch gezögert, herzukommen. Aber betrachten Sie es doch einmal so: Würde Ihr Verlobter eingeliefert werden, würden Sie sich doch sicher eine kompetente, fürsorgliche Krankenschwester für ihn wünschen, oder?«
Catherine schluckte. »Ja, das stimmt.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Arbeiten Sie ein paar Tage zur Probe bei uns. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie das nicht schaffen, sollten Sie das alles tatsächlich an den Nagel hängen. Aber ich vermute stark, dass Sie eine ausgezeichnete Krankenschwester sind und dieser Beruf einfach Ihre Berufung ist.«
Seine Worte brachten in Catherine eine Saite zum Klingen. Sie hatte Dr. Fitzpatrick nichts von der Diagnose erzählt, dass sie vermutlich nie Kinder und eine Familie haben würde. Weshalb sie vermutlich auch nie einen Mann finden würde – ihr Beruf als Krankenschwester war tatsächlich das Einzige, was ihr noch blieb im Leben.
»Sarah hat auch erzählt, dass Sie in einem Waisenhaus gearbeitet haben. Sie können bestimmt großartig mit Kindern umgehen. Wir haben viele kleine Patienten, Weiße und Aborigines. Diese Kinder leiden zu sehen, bricht mir das Herz. Sie brauchen besonders viel Zuwendung, und zwar am besten von einer Frau.«
»Sie ziehen wirklich alle Register, Dr. Fitzpatrick«, bemerkte Catherine schmunzelnd.
Der Arzt lächelte. »Das mag sein, aber ich habe ja auch recht. Und ich brauche jemanden wie Sie im Krankenhaus. Überlegen Sie es sich. Die Arbeit als Krankenschwester ist nicht leicht, das weiß ich, aber es ist eine dankbare Aufgabe und sinnvoller, als den ganzen Tag hier herumzusitzen, finden Sie nicht?«
»Ach, hier ist es doch gar nicht so schlecht«, sagte Catherine und ließ ihren Blick zum Fenster wandern. Und zum ersten Mal empfand sie ihre Untätigkeit als egoistisch.
»Ich habe mir einmal bei einem Motorradunfall beide Beine gebrochen und bin danach auch in ein Heim wie dieses geschickt worden. Nach einer Woche hätte ich mich am liebsten umgebracht!«, sagte er. »Wer sich normalerweise um andere kümmert, wird doch verrückt, wenn er beim Waschen und Anziehen auf fremde Hilfe angewiesen ist!«
Catherine unterdrückte ein Schmunzeln. Er hatte recht, für sie war das auch sehr schwer gewesen.
»Denken Sie über meinen Vorschlag nach, Miss Thomas. Wir brauchen Sie«, bat der Arzt eindringlich und wandte sich zum Gehen.
Und in diesem Moment traf Catherine eine Entscheidung, von der sie nur hoffen konnte, dass sie sie nicht bereuen würde. »Ich fange am Montag an. Dann schauen wir, wie ich zurechtkomme«, erklärte sie. Sie würde vorher ein paar Tage brauchen, um eine Wohnung zu finden und alles vorzubereiten.
Dr. Fitzpatrick strahlte. »Danke, Miss Thomas. Oder soll ich sagen Schwester Thomas?« Er schaute auf seine Uhr. »Meine Mittagspause ist gleich vorbei, ich muss zurück ins Krankenhaus. Dann bis Montag!«
Catherine fand eine kleine möblierte Mietwohnung unweit ihrer neuen Arbeitsstelle. Es hatte ihr im letzten Jahr großen Spaß gemacht, Kinder zu betreuen und zu behandeln, schon deshalb blickte sie der erneuten Arbeit im Krankenhaus mit einiger Nervosität entgegen. Hinzu kam, dass unter ihren Patienten auch verwundete Militärbedienstete sein würden. Ihr Magen zog sich beim bloßen Gedanken daran zusammen.
Schon eine halbe Stunde, nachdem sie ihre Schicht angetreten hatte, brach am Montagmorgen im Krankenhaus die Hölle los. Aus Darwin trafen zwei Lastwagen mit verletzten Zivilisten und Soldaten ein. Sie waren drei Tage und zwei Nächte unterwegs gewesen und, da im Norden Regenzeit herrschte, auf der nahezu unpassierbaren Straße fünfmal im Morast stecken geblieben. Dr. Fitzpatrick warf Catherine einen entschuldigenden Blick zu, für ein tröstendes Wort blieb keine Zeit. Die Patienten waren am Ende ihrer Kräfte. Die dringlichsten Fälle wurden zuerst behandelt, und die Krankenschwestern kümmerten sich um jene, die warten mussten. Catherine hatte keine Zeit nachzudenken, und das war gut, die Stunden verflogen geradezu.
Aus zufällig belauschten Unterhaltungen erfuhr sie, dass die Japaner immer noch den Norden Australiens bombardierten. Catherines Herz raste, wie immer, wenn sie davon hörte, und sie konnte die Gedanken kaum ertragen, aber sie konzentrierte sich darauf, ihre Patienten zu versorgen. Die meisten stammten aus Darwin und Umgebung, aber auch anderswo waren Bomben gefallen.
Am Ende ihrer Schicht, als sie sich Zimmer 6 näherte, drang schallendes Gelächter heraus. Die beiden schwer verletzten Männer darin bogen sich fast vor Lachen. »Was ist denn hier los?«, fragte sie verwundert.
»Gerade war ein Sergeant von einem Stützpunkt in Alice Springs hier. Er hat uns erzählt, dass diese verrückten Japaner North Queensland mithilfe von Wasserflugzeugen bombardiert haben«, keuchte Forrest Whitehall. Eines seiner Beine war eingegipst, und er trug einen Verband um den Kopf, quer über eine Gesichtshälfte.
»Und was ist daran so lustig?«, fragte Catherine erbost.
»Nun, in Townsville gibt es einen großen Militärstützpunkt, Schwester Thomas«, erklärte Jake Simpson, sein Bettnachbar. »Die Japaner haben ein halbes Dutzend Bomben abgeworfen, und alle haben ihr Ziel verfehlt! Sie haben den Stützpunkt nicht getroffen. Und die Stadt haben sie auch nicht getroffen.«
»Die Bomben sind im Meer gelandet«, ergänzte Forrest, der vor Lachen kaum Luft bekam.
»Außerdem wollten sie Mossman in die Luft jagen, aber die Bomben sind im Busch gelandet!«, japste Jake vor Lachen.
Die beiden anderen Patienten im Zimmer begannen ebenfalls zu lachen.
Dr. Fitzpatrick, der hinzugekommen war und alles mit angehört hatte, sagte: »Machen Sie sich nichts daraus, Catherine. So was hebt ihre Moral.«
»Ja, wahrscheinlich«, antwortete Catherine, die immer noch nicht verstand, was so komisch daran war.
»Und, kommen Sie morgen wieder her?«, wollte der Arzt wissen.
Catherine ließ den Tag Revue passieren, dachte daran, wie sie Wunden versorgt und sich die Geschichten der Soldaten angehört hatte. Leicht war es nicht gewesen, aber sie hatte das Gefühl, den Menschen geholfen und sich so um sie gekümmert zu haben, wie ihre Familien sich das wünschen würden. »Ja, ich komme wieder«, antwortete sie.
»Wunderbar. Es geht zum Glück nicht jeden Tag so verrückt zu wie heute. Sie waren uns eine große Hilfe.«
Catherine freute sich über sein Lob. »Dann bis morgen.«
Mehr als die Hälfte der Patienten im Krankenhaus waren Zivilisten, unter ihnen auch viele Kinder. Sich um sie zu kümmern, fiel Catherine leichter, als die Wunden der Soldaten zu versorgen. Sie versuchte zwar jeden Tag, dabei nicht an Preston zu denken, aber sowie sie nach Hause kam, fing sie an zu weinen. Und die Tränen verschafften ihr Erleichterung. Am nächsten Tag erschien sie dann wieder zur Arbeit, und ganz allmählich verheilten ihre Wunden.
Aus Wochen wurden Monate, und ein Monat reihte sich an den nächsten. Ehe Catherine es sich versah, war es Mai 1945, und in Europa endete der Zweite Weltkrieg. In den Straßen von Alice Springs jubelten die Menschen. Catherine freute sich für alle Kriegsheimkehrer, die bald wieder mit ihren Liebsten vereint sein würden, aber der Gedanke an Preston und all die jungen Männer, die so sinnlos gestorben waren, stimmte sie traurig.
Wenige Monate darauf kapitulierte Japan. Am 2. September unterzeichneten die Vertreter Japans an Bord der USS Missouri die entsprechenden Dokumente. Japan war besiegt. Catherine empfand einerseits Freude und Erleichterung, andererseits aber auch tiefe Trauer bei dem Gedanken daran, dass japanische Angriffe auf Australien ihr alles genommen hatten – einen wunderbaren Mann und die Chance, Mutter zu werden.
Dezember 1945
»Schwester Thomas, nicht wahr?«
Catherine, die gerade das medizinische Material in Zimmer 12 durchsah, drehte sich um. Der Mann mit den gütigen grünen Augen und dem freundlichen Lächeln kam ihr irgendwie bekannt vor.
Er wiederum erinnerte sich an die hübsche blonde Frau mit den lebhaften blauen Augen.
»Ja?«
»Erinnern Sie sich an mich? Vermutlich nicht. Bei unserer letzten Begegnung ging es Ihnen gar nicht gut.« Und trotzdem hatte sie sich für die Fliegenden Ärzte interessiert, das war ihm in Erinnerung geblieben.
»Das war an Bord des Flugzeugs von Darwin hierher, oder?«, fragte Catherine.
»Richtig. Ich bin Dr. Curtis. Erstaunlich, dass Sie das noch wissen, so benommen wie Sie von den starken Medikamenten waren. Aber es freut mich sehr, dass Sie wieder vollständig genesen sind.« Sie sah gesund, aber blass aus.
Catherine lächelte. »Hoffentlich habe ich nichts Unanständiges gesagt.« Viele ihrer Patienten faselten unter Medikamenteneinfluss Dinge, die sie bis zu den Haarwurzeln erröten ließ.
Dr. Curtis erwiderte ihr Lächeln. »Keine Sorge, Sie haben sich vorbildlich benommen. Wir haben über die Fliegenden Ärzte geredet, ich habe Ihnen etwas über die Organisation erzählt, vielleicht erinnern Sie sich. Wie auch immer, das ist der Grund, weshalb ich heute hier bin.«
»Sie haben mir erzählt, dass ein gewisser Reverend Flynn die Organisation gegründet hat, das weiß ich noch.«
Der Arzt nickte. »Ich habe Neuigkeiten, die Sie möglicherweise interessieren könnten.«
»Und die wären?«
»Der Stützpunkt des Flying Doctor Service in Broken Hill sucht eine Krankenschwester. Und da habe ich sofort an Sie gedacht, Sie waren damals so interessiert. Hätten Sie nicht Lust, die erste festangestellte Fliegende Krankenschwester zu werden?«
»Ich?«, rief Catherine überrascht. »Ich weiß nicht …« Sie zögerte. »Wie haben Sie mich eigentlich gefunden?«
»Ich hatte gehofft, dass Sie noch in Alice Springs sind, und habe mich umgehört.« Jeder im Krankenhaus, den er gefragt hatte, hatte sie in den höchsten Tönen gelobt. »Also, wäre das nichts für Sie? Der Alltag als Fliegende Krankenschwester ist abwechslungsreich, und in und um Broken Hill leben sehr viele Aborigine-Kinder. Ich will ehrlich zu Ihnen sein: Sie werden auch einer Menge Herausforderungen begegnen, aber ich bin sicher, dass Sie sie bravourös meistern.«
Catherine überlegte. Die Arbeit im Krankenhaus machte ihr Spaß, aber seit Kriegsende ging die Zahl der Patienten zurück. Ein Tag glich dem anderen, und außerhalb des Krankenhauses hatte sie nur wenige Freundschaften geschlossen. Irgendwie war ihr Leben zum Stillstand gekommen.
»Sie haben mich neugierig gemacht, Dr. Curtis«, gab sie schließlich zu. »Aber es gibt doch sicher viele Bewerberinnen für die Stelle.«
»Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Broken Hill ist eine Bergarbeitersiedlung und deshalb für die meisten Frauen nicht besonders attraktiv. Aber der Stützpunkt dort ist einer der größten der Fliegenden Ärzte in Australien. Die Arbeit ist abwechslungsreich, und Sie würden viel in New South Wales herumkommen. Wenn Sie sich bewerben, spreche ich gerne meine Empfehlung für Sie aus.«
»Vielen Dank. Ich werde einen Versuch wagen«, sagte Catherine, auch wenn sie sich keine großen Chancen ausrechnete. »Die Arbeit hier hat mir immer Spaß gemacht, aber ich glaube, es wird Zeit für eine Veränderung.« Es reizte sie, mit einem Arzt Einsätze zu fliegen.
Dr. Curtis lächelte erfreut und reichte ihr ein Bewerbungsformular.
Februar 1946
»Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mich zum Bahnhof bringen«, sagte Catherine Wochen später zu Dr. Curtis. Ihr Zug, der Ghan, wie er nach den afghanischen Kameltreibenden genannt wurde, die den Pionieren bei der Erschließung Australiens geholfen hatten, fuhr um fünf Uhr abends ab und würde am folgenden Mittag im 953 Meilen entfernten Adelaide ankommen.
»Ich freue mich, dass Sie die Stelle bekommen haben«, entgegnete der Arzt.
»Das habe ich sicher nur Ihrer Empfehlung zu verdanken«, sagte Catherine. Das Warten auf den Bescheid der Organisation war eine Qual gewesen, und sie hatte schon befürchtet, sie sei abgelehnt worden. Als die gute Nachricht dann endlich eintraf, war Dr. Curtis der Erste gewesen, dem sie davon erzählt hatte. »Ich bin Ihnen dafür wirklich dankbar.«
»Ich bin überzeugt, dass die Fliegenden Ärzte eine gute Krankenschwester eingestellt haben.« Er lächelte. »Haben Sie Ihren Anschluss von Adelaide nach Broken Hill schon gebucht?«
»Es fährt meines Wissens ein Bus«, antwortete Catherine. »Ich werde mir erst einmal ein Hotel in Adelaide suchen und dann am nächsten Tag weiterfahren.«
»Das klingt nach einer abenteuerlichen Reise. Und das ist vermutlich erst der Anfang. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Thomas! Nicht, dass Sie es brauchen werden.«
»Danke, Dr. Curtis.« Sie stieg in den Zug und winkte zum Abschied.
Catherine machte es sich in ihrem Abteil bequem und betrachtete die vorüberziehende Landschaft, bis es zu dunkel wurde. Nachdem sie die MacDonnell Ranges hinter sich gelassen hatten, fuhren sie durch flaches, ebenes Land. Gelegentlich war ein Känguru oder ein Emu zu sehen, einmal in der Ferne auch Kamele. Catherine mied die anderen Passagiere, sie wollte weder von sich erzählen noch traurige Geschichten hören und aß in ihrem Abteil zu Abend. Einer der Gründe für die Entscheidung, sich zu bewerben, war, dass sie von den Farmern und den Menschen in der Bergarbeitersiedlung keine oder nur wenige Kriegsgeschichten hören würde. Zumindest hoffte sie das. Sie wollte das alles hinter sich lassen und ein neues Kapitel aufschlagen.
Kapitel 3
Adelaide, Australien – Februar 1946
In Adelaide angekommen, nahm sich Catherine ein Zimmer im Grosvenor Hotel an der North Terrace, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Nachdem sie ihr Gepäck auf ihr Zimmer mit Blick auf das Parlamentsgebäude gebracht hatte, brach sie zu einem Spaziergang am Torrens auf, der durch die Stadt floss und bei West Beach ins Meer mündete. Die Sonne brannte vom Himmel, aber am Wasser wehte eine erfrischende Brise. Catherine freute sich über die Trauerschwäne und Enten auf dem Fluss, die sie an ihre Kindheit im englischen Derbyshire unweit des Flusses Wye erinnerten.
Sie dachte wie so oft an ihre Tante Meredith, bei der sie aufgewachsen war, nach dem Tod ihrer Eltern, die gemeinsam mit Catherines kleinem Bruder bei einem fürchterlichen Hausbrand in Shrewsbury ums Leben gekommen waren. Catherine hatte es einem heldenhaften Vierzehnjährigen zu verdanken, dass sie überlebt hatte: Er hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und sie gerade noch rechtzeitig aus ihrem Bett gerissen. Damals war sie erst drei Jahre alt gewesen. An ihre Eltern konnte sie sich nicht mehr erinnern, glücklicherweise aber auch nicht an das Feuer.
Meredith war die um zehn Jahre ältere Schwester ihrer Mutter, unverheiratet, eine sanfte Seele und leidenschaftliche Gärtnerin. An Zuwendung und Liebe hatte es Catherine nicht gefehlt, aber sie hatte sich immer benachteiligt gefühlt, weil sie ohne Eltern und Geschwister aufwachsen musste, und hatte sich deshalb vorgenommen, eines Tages selbst eine große Familie zu haben. Doch das Schicksal hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Pärchen saßen im üppig grünen Gras entlang des Flusses und aßen Eis, andere führten ihre Hunde aus. Catherine beobachtete, wie sie verliebte Blicke tauschten, Händchen hielten und sich gelegentlich verstohlen küssten, und wurde wieder an ihren schmerzlichen Verlust erinnert. Sie bog ab und schlenderte über die North Terrace an der Kunstgalerie, am Museum und dem Krankenhaus vorbei zum Botanischen Garten, wo sie sich auf eine Bank unter einem Großblättrigen Feigenbaum setzte und Leute beobachtete. Es schien, als sei der Krieg spurlos an Adelaide vorübergegangen, und so kam sie schließlich das erste Mal seit langer Zeit innerlich zur Ruhe.
Am nächsten Morgen machte sich Catherine in aller Frühe auf den Weg zur Bushaltestelle in der Franklin Street. Die Fahrt über größtenteils unbefestigte Straßen würde sieben bis acht Stunden dauern, sodass sie Broken Hill am späten Nachmittag erreichen würde. Catherine freute sich auf die Weiterreise, bei der sie einfach nur aus dem Fenster schauen und die Landschaft mit den vereinzelten kleinen Siedlungen betrachten wollte.
Doch daraus wurde nichts, weil eine Frau namens Gina Trimboli sich neben sie setzte und ohne Punkt und Komma und scheinbar auch ohne Luft zu holen auf sie einredete. Sie ließ Catherine keine Chance, etwas zu der Unterhaltung beizutragen, es sei denn, sie erwartete eine Antwort auf eine Frage.
Gina war vor dreiundfünfzig Jahren in Broken Hill geboren worden und hatte nie an einem anderen Ort gewohnt. Und so bombardierte sie Catherine mit Informationen über die Stadt und ihre Bewohner, darunter ihre eigene Familie und die weitverzweigte Verwandtschaft mit einer zum Teil abenteuerlichen Lebensgeschichte. Aber was interessierte es Catherine, dass Ginas Mann seine Unterhosen nur einmal die Woche oder gar nur alle zwei Wochen wechselte? Oder dass ihr jüngster Bruder als Kind Spinnen gegessen hatte? Oder dass einer ihrer Cousins wegen Voyeurismus verhaftet worden war? Oder dass eine ihrer älteren Schwestern während der Wechseljahre in eine Anstalt eingeliefert worden war?
»Sie haben sich sicher über Broken Hill informiert und wissen, dass dort Silber, Blei und Zink abgebaut werden, oder?«
»Ja, das ist mir bekannt«, erwiderte Catherine und hoffte inständig, Gina werde ihr nicht die komplette Stadtgeschichte erzählen.
»Mein Großvater war Bergarbeiter, und nach ihm mein Vater, sobald er dafür alt genug war, außerdem sind oder waren alle meine Onkel und vier meiner Neffen ebenfalls in der Mine beschäftigt. Mum hat immer gesagt, sie fragt sich, woher mein schwer schuftender Dad die Energie genommen hat, sie zu schwängern. Und doch hat er es getan – zwölf Mal.«
Es war heiß und stickig in dem überfüllten Bus, die Sonne knallte durch die Scheiben, und Gina redete ununterbrochen. Catherine hätte schreien können vor Wut. Als der Bus endlich in Broken Hill ankam, hatte sie rasende Kopfschmerzen. Das einzig Brauchbare, was sie von Gina erfahren hatte, war, dass die Frau am Funkgerät des Stützpunktes der Fliegenden Ärzte Alberta Miller hieß.
Catherine klingelten die Ohren, als sie eilig aus dem Bus stieg. Ihr Blick fiel auf die riesige Abraumhalde, die das Landschaftsbild beherrschte. Gina schloss zu Catherine auf und machte sie mit ihrem Ehemann bekannt, der sie vom Bus abholte. Benedetto, kurz Bennie, war ein gedrungener Italiener mit Halbglatze, der von seiner Frau umgehend über die Gründe informiert wurde, die Catherine in die Bergarbeitersiedlung führten.
»Ich habe ihr das The Palace empfohlen, bis sie eine Wohnung gefunden hat«, fügte Gina hochtrabend hinzu.
»Warum nicht das Royal Exchange?«, meinte Bennie vorsichtig. »Die haben vernünftige Preise.«
Gina bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick, und Bennie zog den Kopf ein. »Du weißt doch, dass Molly Brooks dort als Zimmermädchen arbeitet, und ihrem Äußeren nach zu urteilen hat sie es nicht unbedingt mit der Sauberkeit. Außerdem soll sie ein Verhältnis mit dem Nachtportier haben.«
»Das wusste ich nicht«, entschuldigte sich Bennie.
»Du musst ja auch nicht alles wissen«, blaffte Gina.
»Hast du Miss Thomas erzählt, dass das The Palace ursprünglich ein Kaffeehaus der Abstinenzbewegung war? Damals kannte man es auch unter dem Namen Broken Hill Coffee Palace.«
»Wozu?« Gina machte eine wegwerfende Geste mit der Hand und drehte sich dann zu Catherine. »Was wollte die Temperance Movement in einer Bergarbeiterstadt! Können Sie sich vorstellen, dass hart arbeitende Bergleute nach einer Zwölf-Stunden-Schicht Kaffee schlürfen?« Es war eine rhetorische Frage, aber Catherine zuckte vorsichtshalber mit den Schultern, um eventuelle langatmige Erklärungen abzublocken. Sie hatte das ungute Gefühl, dass Benedetto genauso viel quasselte wie seine Frau.
Ihre Befürchtungen bestätigten sich, denn schon sagte er eifrig: »Die Eigentümer waren innerhalb von drei Jahren pleite. Der Pächter tat dann das einzig Vernünftige: Er beantragte eine Schankgenehmigung und änderte den Namen in The Palace Hotel, und von da an ging’s bergauf. Heute zählt es zu den beliebtesten Hotels in Broken Hill. Die Deckengemälde werden Ihnen gefallen. Die sind eine richtige Touristenattraktion geworden.«
Catherine hoffte inständig, dass »beliebt« nicht überfüllt und laut bedeutete; sie wollte nichts weiter als ein bisschen Ruhe und Frieden. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, es hat mich sehr gefreut, Sie beide kennenzulernen, aber ich muss jetzt wirklich los.« Sie wandte sich ab und eilte davon, bevor die Trimbolis auf die Idee kamen, sie zum Hotel zu begleiten. »Alles Gute«, riefen sie ihr nach und ergänzten, dass man bei Gelegenheit doch etwas zusammen trinken könnte. Catherine winkte über die Schulter und lief weiter, ohne sich umzudrehen.
Die Hauptstraße war breit genug, dass ein Ochsengespann darauf wenden konnte, und gesäumt von reizenden kleinen Läden – prächtigen, architektonisch bemerkenswerten Gebäuden, Hotels mit Balkonen, Cafés und Teehäusern. Die Menschen waren gut gekleidet und gingen ihren Geschäften nach wie in jeder anderen australischen Stadt. Einige Frauen, die einen Kinderwagen schoben und quengelnde Kinder dabeihatten, machten einen erschöpften Eindruck, doch die meisten Menschen, denen Catherine auf der Argent Street begegnete, wirkten zufrieden und wohlhabend. Bereits nach kurzer Zeit hatte sie das The Palace Hotel gefunden, bewunderte das wunderschöne Deckengemälde, das Botticellis Venus darstellte, und buchte ein Zimmer. Dann ging sie in die Ladys’ Lounge und bestellte ein eiskaltes Bier.
Die junge Kellnerin sah sie erstaunt an. »Nebenan gibt es ein Teehaus, Miss.«
»Ich habe eine grauenvolle Busfahrt von Adelaide hierher hinter mir, neben einer Frau, die wie ein Wasserfall geredet hat. Glauben Sie mir, ich habe noch nie etwas so dringend gebraucht wie dieses große, eiskalte Bier!«
»Wohnt die Frau hier?«, fragte die Kellnerin, als hätte sie eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte.
Catherine nickte. »Gina Trimboli. Kennen Sie sie?«
Die Kellnerin riss die Augen auf. »Jeder hier kennt sie und ihre Familie! Gina steckt ihre Nase ständig in die Angelegenheiten anderer Leute. Das ist ihr Hobby. Jetzt verstehe ich, warum Sie ein Bier brauchen. Ich bringe es Ihnen sofort.«
»Das ist nett, danke.«
Das kalte Getränk war eine Wohltat. Catherine genoss jeden Schluck. Als die Kellnerin fragte, ob sie ihr ein zweites bringen sollte, war sie versucht zu bejahen, verzichtete dann aber darauf und erkundigte sich stattdessen nach dem Weg zum Stützpunkt der Fliegenden Ärzte.
»Sie können den Bus nehmen, Miss«, sagte die Kellnerin und beschrieb ihr den Weg zur Haltestelle. »Von der Haltestelle bis zum Stützpunkt ist es dann zu Fuß ungefähr noch eine halbe Meile.«
»Gibt es noch eine andere Möglichkeit als den Bus?«
»Ich kann Ihnen mein Fahrrad leihen, wenn Sie möchten, aber es ist ein bisschen zu heiß zum Radfahren.«
»Wie weit ist es denn von hier bis zum Stützpunkt?«
»Ungefähr drei Meilen.«
»Dann nehme ich lieber den Bus«, sagte Catherine, der die Hitze jetzt schon zusetzte.
Es war schon Nachmittag, und sie hätte das Ganze am liebsten auf den nächsten Tag verschoben, aber sie wurde am Stützpunkt erwartet. Also überwand sie sich.
Erleichtert stellte sie fest, dass der Bus fast leer war. An der Haltestelle angekommen, zeigte ihr der nette Fahrer den Weg zum Stützpunkt. Sie war froh, dass sie einen Hut zum Schutz gegen die Sonne trug, dazu solide Schuhe und eine Sonnenbrille.
Das vordere Büro des Stützpunkts war leer, aber aus einem angrenzenden Zimmer hörte Catherine eine Frauenstimme. Sie wartete geduldig.
»Ich kann Dr. Harris rufen, wenn es dringend ist, Lola, aber einen Ausschlag unter den Brüsten würde ich nicht als lebensbedrohlich bezeichnen, oder? Das hört sich nach einem simplen Hitzeausschlag an. Wisch die Stelle mit einem feuchten Waschlappen ab, und lass sie dann an der Luft trocknen. Falls es juckt, kannst du ein bisschen Backpulver in Wasser geben. Wichtig ist, dass die Haut an der Luft trocknet. Over.«
»Du weißt doch, wie groß meine Brüste sind, Alberta. Die Haut darunter hat seit meiner Pubertät weder Tageslicht noch frische Luft gesehen. Over.«
Catherine musste unwillkürlich grinsen.
»Vielleicht hält Claude sie ja hoch, bis die Haut abgetrocknet ist. Over.«
Catherine konnte Alberta zwar nicht sehen, aber das Schmunzeln in ihrer Stimme war deutlich zu hören.
»Du weißt, was dann passieren würde, und dann hätte ich noch mehr Hitzeausschläge an anderen Stellen«, empörte sich Lola. »Nein, danke. Over.«
»Tja, dann wirst du sie wohl selbst hochhalten müssen«, meinte Alberta.
»Dafür bräuchte ich ein, zwei Hände mehr. Wie soll ich meinen Haushalt erledigen?«
Catherine biss sich auf die Zunge, um nicht laut herauszulachen.
»Ich fürchte, da kann ich dir auch nicht helfen. Meld dich, falls es schlimmer wird, Lola. Unsere Fliegende Krankenschwester kommt heute oder morgen, vielleicht kann sie ja einen Blick darauf werfen. Over and out.« Alberta brummte etwas vor sich hin, und Catherine beschloss, sich bemerkbar zu machen.
»Hallo!«, rief sie.
Alberta erschien in der offenen Tür. Sie schien mindestens in den Sechzigern zu sein. Ihre weißen Haare waren einmal blond gewesen, das war an einigen Stellen noch zu erkennen, und die blauen Augen hinter der Brille blickten intelligent. »Ich habe Sie gar nicht hereinkommen hören«, sagte sie verdutzt.
»Ich wollte nicht stören«, erwiderte Catherine lächelnd.
»Brüste, die so groß sind wie Wassermelonen bringen eben gewisse Probleme mit sich.« Alberta verdrehte die Augen. »Da kann ich nicht mitreden, aber ich stelle es mir ziemlich unbequem vor. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin Catherine Thomas. Ich werde hier erwartet, denke ich.«
Alberta stutzte kurz. »Ah, die neue Fliegende Krankenschwester! Oder besser gesagt, die allererste Fliegende Krankenschwester, die in der Organisation fest angestellt ist. Willkommen! Ich bin Alberta Miller. Nennen Sie mich gerne Berta, wir werden eng zusammenarbeiten. Ich bin die Funkerin hier im Stützpunkt, das haben Sie ja gerade mitbekommen.« Sie gab Catherine die Hand, während sie sie ganz ungeniert von Kopf bis Fuß musterte. »Eigentlich habe ich etwas anderes erwartet«, sagte sie schließlich.
»So?« Catherine wusste nicht, was sie von der Bemerkung halten sollte.
»Ja, ehrlich gesagt dachte ich, es kommt ein unscheinbares Mädchen und nicht so ein wohlproportioniertes hübsches Ding.«