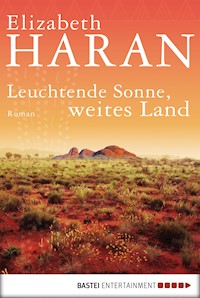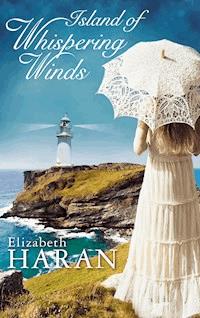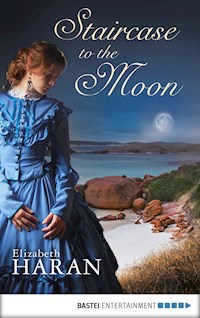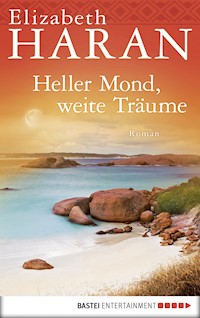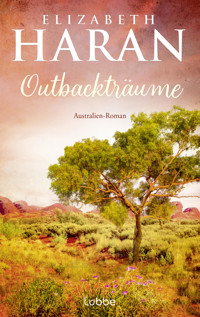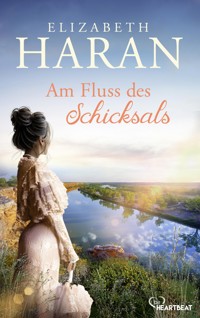9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Leben retten mit den Fliegenden Ärzten
- Sprache: Deutsch
England, 1937: Die junge Krankenschwester Ashleigh umsorgt den kranken Lord Edward. Von seiner Frau ist er getrennt, sein Sohn weilt in Südamerika. Ashleigh findet es schier unglaublich, dass er in Australien eine Stadt besitzt, die er vor vielen Jahren gekauft, aber noch nie besucht hat. Schließlich fasst Lord Edward den Plan, seine womöglich letzten Monate nicht in England zu verbringen, sondern seinen Traum von der Reise zum Roten Kontinent zu verwirklichen. So brechen der Lord und Ashleigh gemeinsam ins Outback auf. Es ist völlig ungewiss, was sie dort erwartet, doch es wird ihrer beider Leben für immer verändern ...
Ein wunderbarer Outbackroman, der von den Gründungsjahren der »Fliegenden Ärzte« Australiens erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
England, 1937: Die junge Krankenschwester Ashleigh umsorgt den kranken Lord Edward. Von seiner Frau ist er getrennt, sein Sohn weilt in Südamerika. Ashleigh findet es schier unglaublich, dass er in Australien eine Stadt besitzt, die er vor vielen Jahren gekauft, aber noch nie besucht hat. Schließlich fasst Lord Edward den Plan, seine womöglich letzten Monate nicht in England zu verbringen, sondern seinen Traum von der Reise zum Roten Kontinent zu verwirklichen. So brechen der Lord und Ashleigh gemeinsam ins Outback auf. Es ist völlig ungewiss, was sie dort erwartet, doch es wird ihrer beider Leben für immer verändern …
Über die Autorin
Elizabeth Haran wurde in Simbabwe/Afrika geboren, als es noch Südrhodesien hieß. In den 1960er-Jahren zog ihre Familie nach England. Später wanderten sie nach Australien aus.
Elizabeth Harans erstes Buch wurde im Jahr 2001 veröffentlicht. Seitdem verfasst sie jedes Jahr einen Roman. Für ihre Recherchen reist sie durch ganz Australien und besucht die Orte, die als Kulisse für ihr nächstes Buch dienen. Elizabeth lebt mit ihrer Familie und vielen Tieren an der Küste Südaustraliens. Nach dem Schreiben ist Kochen, vor allem von Curry-Gerichten, ihre zweite Leidenschaft.
Australien-Roman
Übersetzung aus dem australischen Englischvon Sylvia Strasser
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der australischen Originalausgabe:
»A Moment in the Sun«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Elizabeth Haran
Published by arrangement with Elizabeth Haran-Kowalski
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Textredaktion: Marion Labonte, Labontext
Landkarte: Reinhard Borner
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
Umschlagmotiv: © Joanna Czogala / Arcangel; © Shutterstock / tommaso lizzul; © Shutterstock / TanyaJoy; © Shutterstock / eo Tang; © Shutterstock / Jon Fitton; © Shutterstock / vesta2k
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4241-2
luebbe.de
lesejury.de
Ich möchte diesen Roman Peter Laffrey widmen,der als Autor unter dem Pseudonym Ben Laffra schreibt.
Peter ist der Inbegriff eines großen Lausbuben,dem der Schalk im Nacken sitzt. Bei unserer allerersten Begegnung sagte er, er sei ein alter Mann, der eine Menge Geschichten zu erzählen habe, und damit hatte er nicht zu viel versprochen. Diese Geschichten, die bis in seine Kindheit in Britisch-Indien zurückreichten, wie er sie in seinem Roman FLYING FOX ACROSS THE MOON schildert, bereicherten jede unserer Unterhaltungen. Peter hat einen wundervollen Sinn für Humor, er ist ein wahrer Gentleman, eine Inspiration und ein wunderbarer Freund.
Allein der Gedanke an ihn bringt mich zum Lächeln.
I would like to dedicate this book to Peter Laffrey
(aka author, Ben Laffra)
Peter epitomises the word larrikin. When I first met himhe said he was an old man with stories to tell and that was certainly true. Every conversation was enriched with those stories that went as far back as his childhood growing up under British rule in India, as epitomized in his book FLYING FOX ACROSS THE MOON. He has a wonderful sense of humour, he’s a true gentleman, an inspiration and a very good friendto me and many others.
To think of him is to smile.
Prolog
Outback in Queensland, Australien – Januar 1937
»Himmel Herrgott, Max, ich hab das Gefühl, wir fliegen direkt in die Hölle!« Harry umklammerte fest das Steuerhorn der De Havilland, um das Flugzeug auf einer Höhe von siebentausend Fuß zu halten.
In der Ferne zuckten Blitze in den dunklen Wolken. Harry fluchte leise. Trockene Gewitter waren gefährlich. Der Himmel glühte, der tiefrote Widerschein füllte das Cockpit. Trotz des dichten Rauchs am Boden war das Feuer zu erkennen, das von einem Blitz entzündet worden war. Vermutlich hatte er in einen Baum eingeschlagen und ihn auseinandergesprengt. Die Flammen, angefacht vom heißen Nordwind, hatten sich bis zu einem Weizenfeld ausgebreitet und verschlangen alles, was ihnen in die Quere kam.
Dr. Max Jameson beobachtete die Lage von seinem Platz im hinteren Teil des Flugzeugs aus. Er war nervös. Er versuchte zwar, es sich nicht anmerken zu lassen, aber zum ersten Mal in seiner Zeit beim Aerial Medical Service hatte er Angst, richtig Angst – um sich selbst und seinen Piloten, aber auch um den Mann, der dort unten auf sie wartete.
Die Feuerwalze raste auf Langweil Station zu, die tausend Morgen große Farm, deren Inhaber Burt Cooper sich verletzt hatte, beim Versuch, den Hof zu schützen, der sich seit fast hundert Jahren in Familienbesitz befand. Burt war Anfang sechzig und hatte ein schwaches Herz und andere gesundheitliche Probleme, und zum Glück war es ihm gelungen, über Funk Hilfe anzufordern, nachdem sein Traktor umgekippt war und ihm Arm und Schulter gequetscht hatte. Max war nicht klar, warum Burt angesichts des herannahenden Buschfeuers draußen auf dem Traktor war, aber Harry vermutete, dass er eine Brandschneise anlegen wollte, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nun waren sie auf dem Weg dorthin.
Max flog seit drei Jahren mit Harry, der ein erfahrener Pilot war, jetzt aber sein ganzes Können unter Beweis stellen musste.
»Schätze, ich kann auf der Straße landen, Max, aber dieses Feuer kommt verdammt schnell näher, wir haben also nicht viel Zeit«, sagte Harry.
»Tu, was du kannst«, erwiderte Max. Er sorgte sich um Burt und fürchtete, der alte Mann könnte in dieser äußerst belastenden Situation einen Herzanfall erleiden.
Das Flugzeug stieß durch die Rauchschwaden, dann war die unbefestigte Straße unter ihnen zu erkennen. Das dürre Gras auf beiden Seiten wurde von umherfliegenden Funken in Brand gesetzt. Nie zuvor hatten sie sich in einer so gefährlichen Situation befunden, aber Harry landete die Maschine gekonnt, während er gleichzeitig abzuschätzen versuchte, ob diese provisorische Landebahn auch lang genug für einen sicheren Start war.
»Beeil dich, Max!«, rief er, kaum dass das Flugzeug zum Stehen kam.
»Du bleibst hier, Harry. Flieg ohne mich los, wenn es zu gefährlich wird.«
Der Pilot schüttelte energisch den Kopf. »Kommt nicht infrage.«
Max bedachte ihn mit einem langen Blick, dann schnappte er sich seine Arzttasche, sprang aus dem Flugzeug und lief auf das Haus zu. Bald sah er Burt, der, den verletzten Arm an den Körper gepresst, inmitten des beißenden Rauchs mit einem nassen Sack die Glutnester unweit eines Stapels Heuballen auszuschlagen versuchte. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, und er hustete. Plötzlich sackte er in sich zusammen.
Max rannte zu ihm, kniete sich neben ihn und legte sein Ohr dicht an Burts Mund. Erleichtert stellte er fest, dass Burt atmete, wenn auch sehr flach, der Puls war schnell und unregelmäßig. Er musste ins Krankenhaus, und zwar auf dem schnellsten Wege. Hätte er Harry doch nur nicht gesagt, er solle beim Flugzeug warten!
Max griff Burt unter die Achseln, aber sosehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, dem großen, kräftigen Mann auf die Füße zu helfen. »Komm schon, Burt, wir müssen hier weg!«, ächzte er. Seine Augen brannten vom Qualm.
Burt versuchte aufzustehen, war aber zu schwach.
Plötzlich war Harry da, beugte sich hinunter und legte sich Burts Arm um die Schultern. Max tat es ihm auf der anderen Seite nach, und so zogen sie den vor Schmerzen stöhnenden, halb bewusstlosen Farmer vom Boden hoch und schleppten ihn eilig zum Flugzeug. Sie hievten ihn in die Maschine, deren Motor noch lief, und kletterten schnell hinterher. Harry warf sich in den Pilotensitz und zog schon am Gaszug, während Max die Tür schloss. Das Flugzeug rollte zwischen den bedrohlich herannahenden Flammen über die staubige Piste, die ein Stück vor ihnen in einer dichten Rauchwand verschwand. Max blickte hinter sich. Das Feuer war auch nicht mehr weit von dem alten Farmhaus entfernt. Nur ein Wunder würde es noch retten können.
»Keine Ahnung, was uns hinter dem Rauch erwartet«, knurrte Harry. »Finden wir’s heraus.«
Die Maschine stieß im gleichen Augenblick durch den Qualm, als die Flammen hinter ihr die Straße erreichten. Sekunden später, gerade noch rechtzeitig, bevor sie vom Feuer eingeschlossen wurden, hatte das Flugzeug die zum Abheben benötigte Geschwindigkeit erreicht.
Max und Harry hielten unwillkürlich die Luft an, während sie an Höhe gewannen. Die enorme Hitze des Feuers war jetzt auch im Inneren der Maschine zu spüren. Die Anspannung legte sich erst, als sie den Rauch hinter sich gelassen und freie Sicht hatten.
»Das war knapp«, stieß Harry hervor.
»Allerdings.« Max atmete geräuschvoll aus.
»Wie geht’s dem Patienten?«
»Es sieht nicht gut aus. Ich tue mein Möglichstes.« Burt hatte sich die Schulter ausgekugelt und außerdem eine Fleischwunde. Max injizierte ihm ein Opioid.
Währenddessen steuerte Harry Mount Isa an, wo sich das nächste Krankenhaus befand. Sie flogen jetzt in sicherer Höhe über den Rauschschwaden, die manchmal so dicht waren, dass die Straße unter ihnen kaum zu erkennen war.
Plötzlich bemerkte Harry eine Gruppe von Menschen neben einem stehenden Fahrzeug. Sie schwenkten hektisch die Arme, als wollten sie auf sich aufmerksam machen.
»Ist das nicht Burts Frau mit ihren beiden Töchtern?«, rief Harry über die Schulter.
Max spähte aus dem Fenster. »Ich seh nichts.«
»Warte.« Harry flog in einer Schleife zurück.
»Ach, tatsächlich. Ja, das sind sie.« Max runzelte die Stirn. »Was machen sie denn da?« Burt hatte dem Stützpunkt in Mount Isa zuvor mitgeteilt, dass seine Frau und Töchter die Farm verlassen hatten, also hatte Max sich keine weiteren Gedanken um sie gemacht. Offensichtlich waren sie nicht weit gekommen.
»Keine Ahnung, sieht aber so aus, als bräuchten sie Hilfe. Wir sollten über Funk ein weiteres Flugzeug anfordern. Wenn allerdings der Wind dreht und das Feuer auf sie zutreibt, haben sie keine Chance.«
Als Harry noch einmal über der Gruppe kreiste, bemerkte Max, dass Clara, eine von Burts Töchtern, sich krümmte, als hätte sie Schmerzen. Er wusste, dass sie hochschwanger war. »Geh runter, Harry«, befahl er.
Der Pilot drehte um und landete auf der Straße unweit der drei Frauen. Als Max die Tür öffnete, kam Burts Frau Esme sofort angelaufen.
»Gott sei Dank, dass ihr gekommen seid! Wir haben … eine Panne … und bei Carla haben die Wehen eingesetzt«, keuchte sie. Dann erst fiel ihr Blick auf den Patienten im Innern der Maschine, und sie schnappte erschrocken nach Luft. »Burt! Um Himmels willen! Was ist passiert?«
»Er hatte einen Unfall. Wir bringen ihn ins Krankenhaus, Missus Cooper«, sagte Max so ruhig wie möglich.
»Beeilt euch!«, schrie Harry in diesem Moment. »Der Wind hat gedreht! Das Feuer kommt direkt auf uns zu!«
Max sprang aus dem Flugzeug und rannte zu Carla. Die junge Frau presste sich stöhnend beide Hände auf den Bauch, gestützt von ihrer Schwester Jessica, als eine neuerliche Wehe einsetzte. Sobald sie wieder imstande war zu gehen, half Max ihr zum Flugzeug. Rasch stiegen alle ein.
»In der wievielten Woche sind Sie?«, fragte er, nachdem das Flugzeug abgehoben hatte.
»In der vierunddreißigsten«, antwortete Carla. »Das ist zu früh.«
»Da ist das Baby anscheinend anderer Meinung. Ich vermute, dass die Wehen durch die Aufregung ausgelöst worden sind«, sagte Max. »In einer halben Stunde sind wir im Krankenhaus in Mount Isa.«
»Ich kann mein Kind doch nicht in einem Flugzeug zur Welt bringen!«, rief Carla bestürzt, schrie aber im nächsten Augenblick auf, als eine weitere starke Wehe kam.
»Lieber in einem Flugzeug mit einem Arzt an deiner Seite als am Straßenrand mit einem Buschfeuer im Nacken«, wies Esme sie zurecht.
Doch Carla schien nicht überzeugt. »Ich wäre lieber in einem Krankenhaus mit meinem Mann an meiner Seite.«
»Du selbst bist auf dem Weg ins Krankenhaus auf der Ladefläche eines Fuhrwerks zur Welt gekommen. Das hätte für uns beide fast tödlich geendet.« Esme setzte die Erinnerung sichtlich zu.
»Das hast du mir nie erzählt«, erwiderte Carla stöhnend, ihr Gesicht war jetzt schweißüberströmt.
»Ich hab schon befürchtet, die Geschichte würde sich wiederholen«, gestand Esme schaudernd. »Was für ein Albtraum!«
Max untersuchte Carla. »Ich glaube nicht, dass das Baby warten wird, bis wir im Krankenhaus sind«, fasste er anschließend zusammen.
Carla stöhnte erneut auf. Sie hielt die Hand ihrer Schwester umklammert, während Esme Burts Hand streichelte. »Was ist mit Dad?«, fragte sie. »Wird er wieder gesund?«
»Ich hoffe es«, antwortete Max. »Er hat sich verletzt, und die Aufregung ist nicht gut für sein Herz, aber ich habe ihm etwas gegen die Schmerzen gegeben, damit er sich beruhigt und sein Puls sich normalisiert. Trotzdem wird er eine ganze Weile im Krankenhaus bleiben müssen, fürchte ich.«
»Ich habe ihn angefleht, mit uns zu kommen«, sagte Esme. »Aber er hat sich geweigert, weil er das Haus retten wollte.«
»Werden wir nach Hause zurückkehren können, Mum?«, fragte Jessica weinerlich.
»Ich weiß es nicht. Im Moment zählt nur, dass wir am Leben sind und dass Carlas Baby gesund zur Welt kommt.«
»Du hast recht«, pflichtete Jessica ihr bei. »Dad hätte sterben können. Dass er wieder ganz gesund wird, ist wichtiger als das Haus.«
»Genauso ist es, mein Schatz«, antwortete Esme mit einem besorgten Blick zu Burt.
Carlas Wehen kamen in immer kürzeren Abständen. Max bereitete alles für die Entbindung vor und überwachte gleichzeitig Burts Zustand. Keine leichte Aufgabe unter den beengten Verhältnissen. Carla schrie vor Schmerzen, Burt stöhnte, und Jessica und Esme waren gelähmt vor Angst. Zum Glück ging die Geburt sehr schnell. Als das Flugzeug in Mount Isa landete, hielt Carla ihren kleinen Jungen schon in den Armen.
Nachdem Max seine Patienten der Obhut des Krankenhauspersonals anvertraut hatte, ließ er sich schwer auf seinen Platz im hinteren Teil des Flugzeugs fallen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Er war körperlich und seelisch vollkommen erschöpft.
»Was für ein Tag«, murmelte Harry. »Ich fühle mich wie gerädert.«
»Das war großartige Arbeit, Harry«, lobte Max den Piloten voller Anerkennung. »Du hast uns allen das Leben gerettet. Und das unter schwierigsten Bedingungen.«
»Das war gar nichts im Vergleich zu dem, was du geleistet hast, in dieser Situation, unter diesen Umständen. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast.«
»An solchen Tagen könnte ich gut eine fähige Krankenschwester an meiner Seite gebrauchen.« Max seufzte abermals.
»Das glaub ich gern. Komm, lass uns im Pub ein paar kühle Bierchen trinken. Die haben wir uns verdient, finde ich.«
Max schaute auf seine Uhr. »Unsere Bereitschaft endet erst in einer halben Stunde.«
Harry grinste. »Deine Uhr geht bestimmt nach. Und jetzt komm!«
Kapitel 1
Hertfordshire, England – Mai 1937
»Achtung, Ashleigh, die Hexe hat sich auf ihren Besen geschwungen und ist auf dem Weg hierher«, flüsterte Schwester Jenny Taylor ihrer Kollegin zu, als sich die jungen Frauen auf dem blitzsauberen Korridor im Harpenden Memorial Hospital begegneten.
Ashleigh, beide Arme voll sauberer Wäsche, stöhnte auf und eilte weiter zum Krankenzimmer mit der Nummer 14. Sie liebte ihren Beruf, aber die Oberschwester hatte einen Blick, dass sogar die Milch sauer wurde, und das verdarb Ashleigh die Freude an den ansonsten tadellosen Arbeitsbedingungen. Dummerweise hatte sie Ashleigh auf dem Kieker, der es wichtiger war, die Patienten mit Scherzen aufzuheitern, als auf den richtigen Sitz ihrer Haube zu achten oder darauf, dass ihre Schürze am Ende ihrer Schicht noch so tadellos sauber war wie zu Beginn.
Kurz darauf gesellte sich Jenny zu ihr. Im Nu hatten sie das Zimmer aufgeräumt und die Wäsche, die Ashleigh von dem einen Bett abgezogen hatte, in einen Wäschesack gestopft. Im zweiten Bett lag ein netter alter Herr, Mr Coppelecki, der so gut wie taub war, deshalb konnten die Mädchen ungeniert reden.
»Wir bekommen einen neuen Patienten«, erzählte Jenny. »Aber nicht irgendeinen.«
»Was meinst du? Ein Freund der Oberschwester kann’s ja nicht sein, oder?« Die beiden Mädchen machten sich oft über die Vorstellung lustig, dass eine so herrschsüchtige Person wie die Stationsleiterin einen Freund haben könnte. Sie waren überzeugt, dass sie nicht verheiratet war. Sie rundheraus danach zu fragen traute sich allerdings niemand.
»Er ist ein Lord irgendwas. Deswegen ist sie auch so nervös. Sie will unbedingt einen guten Eindruck machen.«
Ashleigh verdrehte die Augen. »Hoffentlich nicht wieder so ein eingebildeter Fatzke!«
In diesem Moment kam die Oberschwester herein, trat zur Seite und ließ einem gut gekleideten, müde wirkenden Mann den Vortritt. Sie funkelte Ashleigh böse an, vermutlich hatte sie deren letzte Bemerkung gehört, doch Ashleigh konzentrierte sich auf ihre Arbeit.
»Da wären wir, Lord Hamilton«, sagte die Oberin so liebenswürdig, wie es die Mädchen gar nicht von ihr kannten. Immer hielt sie die Arme unter ihrem roten Umhang verschränkt, was sie abweisend und angespannt wirken ließ. Ihr brüskes Auftreten war für neue Angestellte ein Schock, auch weil man es von dieser zierlichen, knapp über einen Meter fünfzig kleinen Person nicht erwartete. Ashleighs Meinung nach versuchte sie mit ihrer herrischen Art auszugleichen, was ihr an Körpergröße fehlte. Ashleigh selbst war groß und schlank und bewegte sich mit natürlicher Anmut und gesundem Selbstbewusstsein. Sie zog alle Blicke auf sich, wenn sie ein Zimmer betrat, begrüßte jeden mit einem freundlichen Lächeln und, sofern die Oberschwester nicht in der Nähe war, auch oft mit einer scherzhaften Bemerkung.
»Das ist unser schönstes Zimmer, von hier haben Sie einen bezaubernden Blick auf den Garten«, sagte die Stationsleiterin stolz, doch die Schwestern wussten nur zu gut, dass das Quäntchen Wärme in ihrer Stimme sich verflüchtigte, sobald etwas ihr Missfallen erregte. Während Lord Edward Hamilton das Efeu, die Blumenbeete und die Vogeltränke bewunderte, musterte sie prüfend das Zimmer. Als sie das ungemachte Bett bemerkte, bedachte sie die beiden jungen Frauen mit einem eisigen Blick.
»Wieso ist das Bett noch nicht bezogen, Schwester Furrows?«, fragte sie in schneidendem Ton. »Was in aller Welt haben Sie die ganze Zeit gemacht?« Die Nachlässigkeit ihres Personals war ihr sichtlich unangenehm.
»Ich musste Mr Russells Bettwäsche wechseln.«
»Das hätten Sie gleich heute Morgen tun sollen«, fauchte die Oberin.
»Das habe ich auch, aber seine Blase hat sich wieder entleert, deshalb musste ich das Bett ein zweites Mal frisch beziehen. Es war ihm schrecklich unangenehm, aber ich habe ihm versichert, dass das nicht weiter schlimm ist.« Ashleigh bemerkte, dass Lord Hamilton sich umgedreht hatte und sie erstaunt ansah.
»Beeilen Sie sich gefälligst, Schwester Furrows«, schnauzte die Oberschwester, als wollte sie Ashleigh aus dem Zimmer haben, bevor sie sie ein weiteres Mal in Verlegenheit bringen konnte.
»Bin gleich so weit.« Ashleigh warf ein sauberes Laken auf das Bett, während Jenny die Kissen bezog.
Lord Hamilton setzte sich in den bequemen Sessel am Fenster. »Es hat keine Eile«, sagte er freundlich und mit klangvoller Stimme. »Sie kennen doch die Redensart: Die meisten Leute sterben im Bett.«
Ashleigh musste unwillkürlich kichern. »Es gibt schlimmere Arten zu sterben«, meinte sie, während sie die Laken über den Ecken so einschlug, wie sie es gelernt hatte.
»Sie machen mich neugierig«, sagte der Lord. »Erzählen Sie.«
»Nun, Sie könnten zum Beispiel von einem Grizzly gefressen werden. Natürlich nicht hier in England, es sei denn, es würde einer aus einem Zirkus ausbrechen. Aber möglich wäre es. Oder Sie könnten im Pazifik im flachen Wasser auf einen Steinfisch treten. Die sind giftig und absolut tödlich. Oder Sie könnten während eines Gewitters vom Blitz getroffen werden. Verglichen damit wäre es doch weniger furchtbar, in einem unserer Betten zu sterben, finden Sie nicht auch?«
»Schwester Furrows!«, blaffte die Oberschwester. »Statt uns mit den Auswüchsen Ihrer Fantasie zu beglücken, sollten Sie lieber Ihre Arbeit machen. Und wenn Sie hier fertig sind, will ich Sie in meinem Büro sehen!«
»Wie Sie wünschen«, entgegnete Ashleigh ärgerlich. Warum musste die Frau immer so verbiestert sein?
Ein Blick zu dem neuen Patienten zeigte ihr, dass ein Lächeln seine Lippen umspielte.
Offenbar hatte das auch ihre Vorgesetzte bemerkt. »Ich versichere Ihnen, Lord Hamilton, dass wir hier alles tun, damit unsere Patienten die Klinik bei bester Gesundheit wieder verlassen.«
»Schwester Furrows hat es bestimmt nicht so gemeint. Außerdem war ich derjenige, der davon angefangen hat. Ich habe nichts dagegen, im Bett zu sterben, aber jetzt ist es mir dazu noch zu früh.«
Ashleigh drehte der Oberin den Rücken zu, um ihr Schmunzeln zu verbergen, sie hatte schon genug Schwierigkeiten. Aber sie hatte das Gefühl, dass sie mit Lord Hamilton, der ein humorvoller Mann zu sein schien, gut auskommen würde. Vorausgesetzt, sie wurde nicht gefeuert!
»Wir werden uns auf jeden Fall gut um Sie kümmern, Lord Hamilton«, versprach die Stationsleiterin. »Sie werden wieder gesund werden. Machen Sie sich keine Sorgen.«
»Das tue ich auch nicht«, entgegnete er.
»Das freut mich.« Sie warf Ashleigh einen bösen Blick zu. »Schwester Furrows neigt leider zu unpassenden Bemerkungen. Das wird ihr eines Tages noch das Genick brechen.«
Als die Mädchen fertig waren, schickte die Oberschwester sie hinaus und zog dann den Vorhang rings um das Bett zu, damit der Patient sich ausziehen konnte. Der Arzt werde gleich kommen, versicherte sie, dann eilte sie mit strammen Schritten zu ihrem Büro, um sich Ashleigh vorzuknöpfen.
»Wie können Sie zu einem Patienten sagen, es gebe Schlimmeres, als in unserem Krankenhaus zu sterben, Schwester Furrows?«, herrschte die Stationsleiterin sie an, als sie das Büro betrat, das alle nur die »Fledermaushöhle« nannten. Die Adern an ihren Schläfen traten hervor, und ihr Gesicht war hochrot vor Zorn. »Was ist denn bloß los mit Ihnen?«
Ashleigh blieb ruhig. Es verging keine Woche, in der die Oberschwester sie nicht wegen irgendeines kleinen Vergehens in ihr Büro zitierte und ihr mit Entlassung drohte. Allmählich vermutete Ashleigh, dass sie damit nur bluffte. »Na ja, das wäre doch besser, als unter tragischen Umständen ums Leben zu kommen, meinen Sie nicht auch?«
»Über so etwas macht man keine Scherze. Und es ist völlig unangebracht, einen Neuzugang mit der Nase darauf zu stoßen, dass wir auch mal einen Patienten verlieren. Ihre taktlosen Bemerkungen tragen nicht dazu bei, den Leuten Vertrauen in unser Krankenhaus einzuflößen. Wollen Sie unseren Ruf ruinieren?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Ashleigh. Sie wusste, dass sie diese Diskussion nicht für sich entscheiden konnte. Ihre Vorgesetzte ließ keine Meinung außer ihrer eigenen gelten.
»Und wie kommen Sie dazu, in Anwesenheit von Lord Hamilton zu sagen, dass Mr Russell sich eingenässt hat!«
»Sie haben mich in seiner Anwesenheit gefragt, warum sein Bett noch nicht gemacht sei, und ich habe Ihnen erklärt, warum.«
»Sie hätten sich etwas anderes ausdenken können. Was macht denn das für einen Eindruck!«
»Dann hätte ich lügen müssen, und ich dachte, Sie legen Wert auf die Wahrheit.«
Die Oberschwester stieß einen entnervten Seufzer aus. Ihre kalten blauen Augen wurden schmal. »Werden Sie nicht frech, junge Dame.«
»Das würde ich nicht wagen.«
»Wenn Sie weiter hier arbeiten wollen, und ich bezweifle, dass das noch lange der Fall sein wird, dann denken Sie nach, bevor Sie den Mund aufmachen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Überlegen Sie sich gut, was Sie zu den Patienten sagen, vor allem zu Lord Hamilton.«
»Jawohl, das werde ich«, erwiderte Ashleigh und verließ das Büro.
»Ist alles in Ordnung, Lord Hamilton?«, fragte Ashleigh, als sie wenig später seine Vitalzeichen kontrollierte und dabei feststellte, dass sein Blutdruck hoch war. »Kann ich Ihnen etwas bringen? Ein zusätzliches Kissen vielleicht?«
»Nein, danke, ich brauche nichts, Schwester Furrows. Hoffentlich hat Ihnen die Oberschwester keine Standpauke gehalten.«
»Natürlich hat sie das, aber das ist nichts Ungewöhnliches.«
»Ich verstehe nicht, warum sie vorhin so wütend auf Sie war. Sie haben lediglich die Wahrheit gesagt.«
»Ja, aber vor Ihnen hätte ich das offenbar nicht tun sollen.«
Edward schüttelte den Kopf. »Dann ist das also meine Schuld. Das tut mir wirklich leid.«
»Nein, nein. Die gute Frau tadelt mich mindestens einmal am Tag. Sie will nicht, dass ich den Patienten Witze erzähle oder überhaupt mit ihnen scherze und lache. Stattdessen soll ich auf Zehenspitzen durch die Korridore schleichen und wortlos Bettpfannen leeren und schmutzige Bettwäsche wechseln.« Ashleigh lächelte. »Aber ich fürchte, so bin ich nun mal nicht.«
»Das freut mich«, entgegnete Edward. »Verbiegen Sie sich nicht, um anderen zu gefallen.«
»Das ist ein guter Rat.« Ashleigh schwieg nachdenklich.
»Halten Sie sich daran, Schwester. Sie sind perfekt so, wie Sie sind.«
»Oh nein, perfekt bin ich ganz bestimmt nicht. Ich sage oft Dinge, die ich nicht sagen sollte, vor allem in Gegenwart der Stationsleiterin. Sie haben es ja selbst erlebt.«
»Ach, wissen Sie, ich bin auch schon oft angeeckt«, gestand Edward.
»Und sonntags gehe ich nicht in die Kirche, wenn es schneit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der liebe Gott es mir nachsieht. Er kann nicht wollen, dass ich auf Glatteis ausrutsche und hinfalle.«
»Nein, das kann er nicht wollen. In dem Fall ist es sicherer, im warmen Bett zu bleiben. Außerdem kann man überall beten.«
»Sie haben recht.« Ermutigt, weil er ihrer Meinung war, fuhr sie fort: »Eigentlich dürfte ich das gar nicht sagen, aber manchmal fluche ich insgeheim.«
»Ich fluche laut und das sogar ziemlich oft«, gab Edward grinsend zu.
Ashleigh lachte. »Ich glaube, wir hören jetzt lieber auf!«
»Ja, das ist vermutlich besser.« Sein Blick spiegelte sein Lächeln.
Er hatte eine warme Stimme, und die Fältchen um seine Augen deuteten darauf hin, dass er viel lachte.
Er sah zu dem zweiten Bett hinüber. »Ich habe versucht, mich mit Mr Coppelecki zu unterhalten, leider ohne Erfolg.«
»Der Gute ist stocktaub, er kann Sie nicht hören.« Ashleigh zwinkerte dem freundlichen alten Mann zu, der ihr Lächeln erwiderte und nickte. »Schnarchen Sie?«, fragte sie unvermittelt.
Edward sah sie erschrocken an. »Ich dachte, wir wollten aufhören, unsere Fehler aufzuzählen.«
»Stimmt, ich wollte nur sagen, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen, falls Sie schnarchen. Sie würden Mr Coppelecki nicht stören, er kann Sie nicht hören.«
»Ich verstehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schnarche. Ich lebe seit Jahren allein, es ist niemand da, der sich beklagen könnte.« Sein Lächeln erlosch, und er richtete den Blick abwesend in die Ferne.
Er sah gut aus für seine zweiundsiebzig Jahre, fand Ashleigh, die sein Alter dem Krankenblatt entnommen hatte. Silberne Strähnen durchzogen sein blondes Haar, er hatte gütige grüne Augen und eine fast makellose Haut. So könnte ihr Großvater, den sie nie kennengelernt hatte, ausgesehen haben.
»Nun, ich habe bis Mitternacht Dienst. Danach kann ich Ihnen gerne sagen, ob Sie schnarchen oder nicht.«
»Ich bezweifle, dass ich dann schon schlafen werde. Ich leide an Schlaflosigkeit, müssen Sie wissen.«
»Weil es zu viel gibt, das Sie beschäftigt?«, fragte Ashleigh und trug seine Blutdruckwerte auf dem Krankenblatt ein.
»Zu viele Sorgen, ja.«
»Das ist nicht gut.« Sie schwieg, während sie seinen Puls maß und auch diesen Wert notierte. »Vielleicht können Sie während Ihres Aufenthalts hier ein wenig Abstand gewinnen. Wir können uns ja gegenseitig aufheitern. Falls ich nicht vorher rausfliege.«
»Das würde ich sehr bedauern. Sie sind wie ein Sonnenstrahl an einem trüben Tag.« Aus dem wolkenverhangenen Himmel fiel ein leichter Nieselregen. Bis jetzt hatten sie nicht viel vom Frühling gehabt.
»Oh, danke!« Ashleigh lächelte erfreut. »Sie haben meinen Tag gerettet.«
»Und Sie meinen«, erwiderte Edward dankbar.
»Das freut mich. Ah, ich glaube, da kommt der Tee!«, rief sie.
Das Klappern von Geschirr war zu hören, als der Wagen auf wackligen Rädern durch den Korridor geschoben wurde. »Wenn Ihnen der Tee nicht schmeckt, kann ich Ihnen morgen auf dem Weg zur Arbeit einen anderen besorgen, einen Earl Grey oder was immer Sie gern hätten.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Schwester Furrows«, sagte Edward.
»Nennen Sie mich doch Ashleigh.«
»Sehr gern.«
Sie lächelte ihm zu und ging hinaus, als der Teewagen ins Zimmer gerollt wurde.
Gegen halb zwölf in dieser Nacht, eine halbe Stunde vor ihrem Schichtende, sah Ashleigh noch einmal nach dem Lord.
»Noch wach?«, fragte sie.
»Ja, ich kann einfach nicht schlafen«, antwortete Edward.
»Kein Wunder«, meinte Ashleigh mit einem Seitenblick auf seinen Zimmernachbarn. Mr Coppelecki schnarchte, als würde er einen ganzen Wald absägen. Ärgerlicherweise verfügte das Krankenhaus nicht über Einzelzimmer.
»Das ist nicht seine Schuld«, sagte Edward. »Und Sie sind doch bestimmt müde, Ashleigh.«
»Ja, das bin ich, aber ich brauche zu Hause trotzdem immer eine ganze Weile, bis ich zur Ruhe komme.«
»Wartet Ihre Mutter mit einem schönen heißen Kakao oder vielleicht einem späten Abendessen auf Sie?«
»Nein. Meine Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Erst Mum und ein halbes Jahr später Dad.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte Edward mitfühlend. »Die beiden können zu dem Zeitpunkt noch nicht alt gewesen sein, oder?«
»Mum war fünfzig, sie starb an einer Sepsis, und Dad fiel auf einer Baustelle vom Dach eines dreistöckigen Turms. Da war er vierundfünfzig.«
»Das ist ja furchtbar! Haben Sie Geschwister?«
»Nein, leider nicht.« Eine Welle der Traurigkeit durchfuhr Ashleigh, und sie schwieg einen Moment.
»Das tut mir leid«, wiederholte Edward ernst. »Und entfernte Verwandte? Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen?«
»Dads Bruder starb, als er noch keine dreißig war, und Mums Schwester wohnt in West Yorkshire. Ich habe sie und meine Cousins zuletzt bei Mums Beerdigung gesehen.« Ashleigh schluckte. »Und Sie? Haben Sie Familie, Kinder?«
»Einen Sohn, ja. Ich bin ziemlich spät Vater geworden. Er lebt in Argentinien.«
»Argentinien! Wie exotisch! Warum ausgerechnet dort?«
»Nach der Scheidung zog seine Mutter dorthin. Ich habe unseren Sohn damals ermutigt, mit ihr zu gehen, damit sie nicht allein ist. Ich hatte gehofft, dass er eines Tages nach England zurückkommt, aber das war bisher nicht der Fall. Später hat seine Mutter wieder geheiratet.«
»Das tut mir leid. Und auch, dass Sie geschieden sind.«
»Nun, ich hätte nicht eine Frau heiraten sollen, die halb so alt ist wie ich. Das konnte nicht gutgehen. Aber sie hat mir einen Sohn und Erben geschenkt, und dafür bin ich dankbar.«
»Und seit wann lebt er in Argentinien?«
»Seit fast zehn Jahren.«
»Und in der ganzen Zeit haben Sie ihn nicht ein einziges Mal gesehen?«
Edward schüttelte den Kopf. »Nicht ein einziges Mal. Wir schreiben uns gelegentlich, aber leider sind wir beide nicht sehr gut im Briefeschreiben. Er ist inzwischen ein erwachsener Mann, in Ihrem Alter, er hat sein eigenes Leben und vermutlich auch ein nettes Mädchen gefunden. Er war ein hübscher Junge, er ist bestimmt ein attraktiver junger Mann geworden. Das gute Aussehen hat er natürlich von seinem Vater«, fügte er augenzwinkernd hinzu.
Ashleigh hatte den Verdacht, dass die scherzhafte Bemerkung über seine Traurigkeit hinwegtäuschen sollte. »Zweifellos«, versicherte sie. Sie hätte zu gern gewusst, warum er erst so spät im Leben geheiratet hatte und nach der Scheidung keine zweite Ehe eingegangen war, fand diese Fragen aber zu persönlich. »Sie wohnen bestimmt in einem riesengroßen Haus, oder?«, fragte sie stattdessen und setzte sich auf den Stuhl neben seinem Bett. Die Stationsleiterin war nach Hause gegangen, die Patienten schliefen, sie konnte sich also entspannen.
»Mein Haus ist fast so groß wie dieses Krankenhaus, aber es verfällt. Das Dach ist undicht, die Wasserleitung klopft. Manchmal kommt Wasser, wenn man den Hahn aufdreht, manchmal nicht. Die Schornsteine müssten gefegt werden, die Steinstufen der Treppen bröckeln, es gibt viel, was gestrichen werden muss. Ich fürchte, ich bin zu alt, alle diese Arbeiten selbst durchzuführen, und Handwerker kann ich mir nicht leisten.«
Ashleigh wusste nur zu gut, was er meinte. »Ich wohne in meinem Elternhaus, da pfeift der Wind auch durch alle Ritzen. Und gestrichen werden muss auch so einiges. Es ist nur ein kleines Reihenhäuschen, ich könnte mich also selbst an die Arbeit machen, aber nach einer Zwölfstundenschicht hier kann ich mich einfach nicht mehr dazu aufraffen.« Sie zuckte mit den Schultern. Dann fragte sie: »Haben Sie keine Angestellten?«
»Nach der Wirtschaftskrise hatte ich noch einige wenige, aber auch denen musste ich dieses Jahr kündigen, weil ich sie nicht mehr bezahlen konnte. Beatrice, meine Haushälterin, und ihr Mann Fred, der sich um die Außenanlage und den Gemüsegarten gekümmert hat, sind als Letzte gegangen. Sie waren mehr als zwanzig Jahre bei mir, sie gehörten praktisch zur Familie. Der Abschied von ihnen war furchtbar. Beatrice hatte in den letzten Wochen eine schwere Lungenentzündung, sicher wegen der Kälte und Zugluft im Haus. Ich selbst leide oft an Bronchitis. Es kostet ein Vermögen, ein Haus in dieser Größe zu heizen.«
Ashleigh nickte wieder. »Es muss einsam sein, ganz allein in so einem riesigen Haus.« Ob er überhaupt richtig gegessen hatte? Oder hatte er sich mit Arbeiten verausgabt, die früher seine Hausangestellten übernommen hatten?
»Ja. Es können Wochen vergehen, ohne dass ich ein Wort mit jemandem wechsle«, gestand Edward seufzend. »Das ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe.«
Mr Coppelecki unterstrich diese Worte mit geräuschvollen Schnarchlauten, und sie mussten beide schmunzeln.
»Ich bin öfter hier als nötig, weil es mir vor meinem leeren Zuhause graut«, gestand Ashleigh leise. »Manchmal übernehme ich sogar zusätzliche Schichten. Aber wenigstens wartet Sammy auf mich.«
Edward sah sie von der Seite an. »Ich hätte mir denken können, dass Sie einen Verehrer haben, der auf Sie wartet.«
Ashleigh schmunzelte. »Sammy ist mein Kanarienvogel. Er zwitschert ganz aufgeregt, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß, es ist nur ein Vogel, aber ich kann mit ihm reden. Wenn ich Selbstgespräche führe, habe ich das Gefühl, dass ich verrückt bin.« Sie seufzte. »Dabei wollte ich eigentlich mit dreiundzwanzig längst verheiratet sein und Kinder haben.«
»Ah.« Edward sah sie nachdenklich an. »Was ist eigentlich mit den Männern in dieser Stadt los? Sind sie alle blind?«
»Wieso?«
»Na ja, sie müssten doch vor Ihrer Tür Schlange stehen.«
Ashleigh spürte, wie die Röte ihr ins Gesicht schoss. »Es gibt da schon jemanden in meinem Leben«, brachte sie hervor. »Er heißt Timothy Ledbetter und ist von Beruf Klempner.«
»Ein Klempner! Das ist praktisch, wenn Sie heiraten und ein eigenes Heim haben.«
»So ernst ist es nicht mit uns beiden. Zumindest mir nicht«, gestand Ashleigh ein wenig verlegen.
»Aber ihm schon?«
»Ja, auch wenn es furchtbar ist, so etwas zu sagen.«
»Das ist nicht furchtbar, das ist die Wahrheit. Außerdem ist es nicht ungewöhnlich in einer Beziehung, dass der eine mehr Gefühle investiert als der andere.«
»Meinen Sie? Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil es mir vorkommt, als ob ich Tim hinhalten würde, obwohl ich keine Zukunft für uns sehe. Ich bin gern mit ihm zusammen, und er ist ein anständiger Mensch, aber ich vermisse dieses Prickeln, das ich mir beim Verliebtsein wünsche. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht verheiratet bin. Ich habe zu hohe Ansprüche.« Normalerweise vertraute sie Fremden derart persönliche Dinge nicht an, aber sie fühlte sich wohl in Edwards Gesellschaft. Vielleicht, weil er etwas Großväterliches an sich hatte.
»Es muss nur der Richtige kommen, Ashleigh. Und bis es so weit ist, sollten Sie die Gegenwart genießen. Alles andere wird sich finden.«
»Das ist wieder ein guter Rat, scheint mir. Sie sind eine wahre Quelle der Weisheit!«
»Ja, nicht wahr?« Edward strahlte.
Ashleigh beschloss, das Thema zu wechseln. »Und, was hat Dr. Marshall gesagt?«
»Er kann sich nicht erklären, warum ich nicht auf die Blutdruckmedikamente anspreche, deshalb will er etwas anderes ausprobieren. Es klang, als würde er ein paar Dinge an mir ausprobieren wollen.«
»Unser Versuchskaninchen«, scherzte Ashleigh.
»Ja, so kommt es mir vor. Aber hier ist es schön warm, und ich habe nette Gesellschaft. Seziert werden möchte ich allerdings nicht.«
»Ich passe auf Sie auf, keine Sorge.« Ashleigh erhob sich. »So, jetzt muss ich leider los, sonst verpasse ich den Bus. Aber morgen habe ich die Tagschicht, dann komme ich gleich zu Ihnen. Vielleicht kann ich Ihnen sogar einen neuen Witz erzählen. Natürlich nur, wenn die Oberschwester nicht in der Nähe ist.«
»Das wäre schön. Gute Nacht, Ashleigh. Kommen Sie gut nach Hause. Es ist spät, man weiß nie, wer sich alles in den Straßen herumtreibt.«
»Die Bushaltestelle liegt direkt vor dem Eingang, und wenn ich aussteige, sind es nur ein paar Schritte bis nach Hause. Gute Nacht, Lord Hamilton. Versuchen Sie, ein wenig zu schlafen.«
»Das werde ich. Ich freue mich schon auf morgen.« Edward schaute ihr lächelnd nach. Was für eine bezaubernde junge Frau! Wie gut man sich mit ihr unterhalten konnte. So eine Tochter oder Enkelin hatte er sich immer gewünscht. Stattdessen wohnte er ganz allein in seinem großen Haus und sein Sohn weit entfernt auf einem anderen Kontinent …
Kapitel 2
»Guten Morgen, Lord Hamilton«, grüßte Ashleigh gut gelaunt am nächsten Morgen.
»Guten Morgen, Ashleigh.« Edward strahlte.
»Guten Morgen, Mr Coppelecki.« Sie lächelte ihm zu, aber er nickte nur und schob Essen im Mund herum.
Ashleigh rückte ihre Haube zurecht und strich die weiße Schürze über der blauen Schwesterntracht glatt. Der Tag konnte kommen. »Haben Sie schon gefrühstückt, Lord Hamilton?«, fragte sie, als sie bemerkte, dass kein Tablett vor ihm stand, vor seinem Bettnachbarn hingegen schon.
»Ja, danke«, erwiderte Edward. »Die Schwester hat das Geschirr vor zehn Minuten abgeräumt. Mr Coppelecki kann sein Gebiss nicht finden, deshalb dauert es bei ihm länger.«
»Was? Hat er es schon wieder verlegt? Hat er schon in den Taschen seines Morgenmantels nachgeschaut?« Es war einfacher, den Lord zu fragen als den fast tauben Mr Coppelecki.
Edward nickte. »Ja, hat er.«
Ashleigh zog die Nachttischschublade auf, schob ihre Hand unter sein Kopfkissen, nahm dann das über der Stuhllehne hängende Handtuch hoch und entdeckte darunter seine Bettsocken. Als sie sie abtastete, spürte sie in einer Socke einen Klumpen. Sie steckte die Hand hinein und zog ein Taschentuch heraus. Darin eingepackt lag Mr Coppeleckis Gebiss.
Edward starrte sie an. »Was haben seine Zähne denn in seiner Socke zu suchen?«
»Er hat Angst, dass sie in der Nacht gestohlen werden, deshalb versteckt er sie, und dann weiß er nicht mehr, wo.«
»Er glaubt doch nicht im Ernst, dass ich sie stehlen würde, oder?« Edward verzog das Gesicht.
Ashleigh musste lachen. »Wer weiß!« Sie spülte das Gebiss am Waschbecken unter fließendem Wasser ab und reichte es Mr Coppelecki. Der war sichtlich überrascht, dann grinste er breit und setzte sich die Zähne wieder ein. »Danke, Schwester Furrows«, brüllte er und widmete sich fröhlich seinem Toastbrot.
»Gern geschehen.« Ashleigh wandte sich Edward zu. »Wissen Sie eigentlich, was ein Dieb im Zirkus macht?«
Er schaute sie verwirrt an. »Nein. Was denn?«
»Clown.«
Es dauerte einen Moment, bis er begriff. Dann lachte er schallend.
»Sehr gut. Aber wissen Sie, warum Bienen summen?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Weil sie den Text nicht kennen.«
»Nicht schlecht, Lord Hamilton«, sagte Ashleigh. Sie mussten beide lachen. In diesem Moment erschien die Oberschwester in der Tür.
»Was ist denn hier los?« Sie blickte misstrauisch von Edward zu Ashleigh.
»Mr Coppelecki hat gerade einen Witz erzählt«, sagte Edward schnell. Er sah den alten Herrn an und reckte den Daumen hoch. »Möchten Sie ihn hören?«
Mr Coppelecki, der immer noch glücklich seinen Toast mampfte, nickte grinsend, vermutlich dachte er, Edward freue sich für ihn über das wiedergefundene Gebiss.
»Nein, danke«, antwortete die Stationsleiterin mit einem argwöhnischen Blick auf den unschuldig lächelnden Mr Coppelecki. »Wie geht es Ihnen heute, Lord Hamilton? Ihr Blutdruck ist nach wie vor zu hoch.« Sie überflog sein Krankenblatt.
»Im Grunde unverändert«, erwiderte Edward.
»Vielleicht sind Ihnen Witze nicht gerade zuträglich.«
»Er versucht nur, mich aufzuheitern. Ich mag seine Gesellschaft.« Er zwinkerte Ashleigh zu, als die Oberschwester gerade nicht hinsah.
»Wenn Sie sich einen Augenblick in den Sessel setzen würden, Lord Hamilton, damit ich Ihr Bett machen kann?«, schlug Ashleigh vor.
»Das ist sehr nett, Schwester Furrows.« Er schob seine Füße in die Hausschuhe, und sie half ihm in seinen Morgenmantel. »Bei Ihnen bin ich wirklich in den besten Händen«, fügte er hinzu, so laut, dass die Stationsleiterin es hören musste.
Als Edward später frisch gewaschen und mit noch nassem Haar über den Flur schlenderte, drang Ashleighs glockenhelles Lachen aus einem der Zimmer. Der Klang ihrer Stimme verzauberte ihn regelrecht.
»Sie sind mir ja eine ganz Schlimme, Shirley«, hörte er sie sagen. »Sie schaffen es immer, dass ich erröte, und das ist wirklich eine Leistung.«
Edward blieb vor dem Zimmer mit der Nummer 10 stehen und spähte durch die offene Tür. Ashleigh stand neben einem Bett, auf dessen Rand eine ältere Frau in einem rosa Morgenmantel und flauschigen Pantoffeln saß. Sie hatte schneeweißes Haar und einen ausgesprochen schelmischen Gesichtsausdruck.
»Ja, ich habe einen beachtlichen Vorrat an schlüpfrigen Witzen«, gestand Shirley. »Kennen Sie den von dem Priester und der Prostituierten?«
»Heben Sie sich den lieber für ein andermal auf, Shirley! Mehr als einen Ihrer Witze am Tag verkrafte ich nicht.«
Shirley kicherte. »Wo bleibt Ihre Courage, Kindchen?«
»Hab ich zu Hause gelassen«, rief Ashleigh, die auf dem Weg zur Tür war, über die Schulter.
Edward lächelte und ging weiter.
Nach wenigen Metern schloss Ashleigh zu ihm auf. »Wohin des Weges, Lord Hamilton?«, fragte sie scherzend.
»Nur ein bisschen die Beine vertreten«, antwortete er. »Wir haben ja bereits festgestellt, dass die meisten Leute im Bett sterben, nicht wahr?«
»Das haben Sie gesagt, nicht ich«, flüsterte Ashleigh, als ihre Vorgesetzte zielstrebig auf sie zukam.
»Sie übertreiben es hoffentlich nicht, Lord Hamilton«, sagte sie streng. »Ihre Gesundheit ist angegriffen, vergessen Sie das nicht.«
Edward warf Ashleigh über den Kopf der Oberschwester hinweg einen vielsagenden Blick zu.
»Haben Sie nichts zu tun, Schwester Furrows?«, blaffte sie. »Marsch, an die Arbeit.«
»Bin schon unterwegs«, erwiderte Ashleigh.
Die Oberschwester führte Edward sanft in die andere Richtung.
Zwei Tage später hatte Ashleigh Nachtschicht im Westflügel. Während Jenny im Schwesternzimmer blieb, machten Ashleigh und ihre Kollegin Susan McDonald die Runde. Sie hatten Patienten in vier Zimmern zu überwachen.
Es war kurz vor Mitternacht, alle schliefen, nur Edward nicht. Er stand am Fenster und blickte in den Garten hinaus, dem das Licht des Vollmonds etwas Märchenhaftes verlieh. Ashleigh beobachtete ihn einen Augenblick. Er wirkte so traurig und niedergeschlagen, dass sie sich unwillkürlich Sorgen machte.
»So spät noch wach, Lord Hamilton?«, fragte sie sanft und betrat das Zimmer. Mr Coppelecki schnarchte leise.
Edward drehte sich kurz zu ihr um. »Ich wünschte, ich könnte schlafen, aber der Schlaf will einfach nicht kommen.« Er schaute wieder in den Garten hinaus.
»Soll ich Ihnen etwas geben, damit Sie einschlafen können?«
»Nein, danke. Ich hoffe, dass ich irgendwann eindöse.«
»Wie wär’s mit einem heißen Kakao?«
»Nein, danke«, antwortete er müde.
Ashleigh trat zu ihm ans Fenster und setzte sich auf den Stuhl. »Bedrückt Sie etwas? Möchten Sie darüber reden? Ich kann gut zuhören.«
Edward sah sie nachdenklich an. »Sie sind wahrscheinlich noch zu jung, als dass es Dinge gibt, die Sie bereuen, aber ich bereue so einiges, wissen Sie.«
»Was bereuen Sie denn am meisten?«, fragte sie ruhig nach. Es würde ihm sicher guttun, sich jemandem anzuvertrauen.
Er zögerte. »Anfang der Zwanzigerjahre habe ich eine Stadt in Australien gekauft, und ich bereue es zutiefst, dass ich mir nie die Zeit genommen habe hinzufahren«, sagte er schließlich.
Ashleigh starrte ihn verblüfft an. »Sie haben eine Stadt gekauft? Eine ganze Stadt? Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich ist.«
»Doch, das geht.«
»Aber warum ausgerechnet in Australien?«
»Nun, ich habe damals nach Möglichkeiten gesucht, mein Vermögen breit zu streuen, weil man in der Landwirtschaft stark vom Wetter abhängig und ein Gut sehr teuer im Unterhalt ist. Durch Zufall bin ich auf Anzeigen mit Angeboten in Übersee gestoßen, dabei entdeckte ich eine Stadt in Australien, die zum Verkauf stand. Das hat mich neugierig gemacht, denn ich wusste damals auch nicht, dass man Städte kaufen kann. Sie war sehr billig, vielleicht weil es kurz nach dem Krieg war. Sie liegt in einer Gegend, die man Outback nennt, und ist ziemlich klein, aber ich war trotzdem schrecklich stolz, als sie mir gehörte.«
»Das glaube ich gern, aber an den Gedanken, Besitzer einer ganzen Stadt zu sein, muss man sich sicher erst gewöhnen. Gehören Ihnen denn auch sämtliche Häuser und Läden?«
»Ja, alles, einschließlich der Bar.« Er grinste breit. »Welcher Mann würde nicht gern einen eigenen Pub haben?«
Ashleigh schüttelte langsam den Kopf. »Unglaublich. Und wie heißt die Stadt?«
»Duchess.«
»Duchess! Was für ein reizender Name.«
»So hat mein Vater meine Mutter oft genannt, das war sein Kosename für sie. Sie finden das vielleicht albern, aber für mich war das ein gutes Omen.«
»Das ist überhaupt nicht albern. Ich glaube fest an Vorzeichen. Aber warum sind Sie nie hingefahren?«
Edward seufzte und senkte den Kopf. »Ich wollte ja. Ich hatte mir sogar überlegt, eine Weile dort zu wohnen, aber dann ist das Leben dazwischengekommen. Und jetzt ist es zu spät.«
»Warum?«
»Liegt das nicht auf der Hand?«
»Für mich nicht, Lord Hamilton.«
»In meinem Alter und mit meinen gesundheitlichen Problemen kann ich unmöglich eine so weite Reise machen«, brachte er betrübt hervor, dann suchte er ihren Blick. »Wenn es etwas gibt, das Sie gern machen würden, Ashleigh, dann tun Sie es. Warten Sie nicht zu lange. Sonst werden Sie es eines Tages bereuen. Es gibt nichts Schlimmeres, als verpassten Gelegenheiten nachzutrauern, vor allem, wenn man merkt, dass einem keine Zeit mehr bleibt.«
»Sagen Sie das nicht, Lord Hamilton. Sie haben noch viel Zeit.«
»Das ist nett von Ihnen, aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt.«
»Im Moment geht es Ihnen nicht gut, deshalb sehen Sie alles so schwarz, aber wenn Dr. Marshall erst einmal Ihre Blutdruckprobleme in den Griff bekommen hat, werden Sie sich wieder wie vierzig fühlen, glauben Sie mir.«
»Das ist lieb von Ihnen«, erwiderte Edward bedrückt. Er schien keineswegs überzeugt.
»Ich muss jetzt gehen, aber ich werde später noch einmal nach Ihnen sehen. Hoffentlich schlafen Sie dann.«
Edward nickte und schaute wieder zum Fenster hinaus.
»Gute Nacht«, sagte Ashleigh sanft.
Sie musste die ganze Nacht an ihn denken. Wie sehr es ihn belastete, dass er seine Stadt in Australien nie besucht und die Hoffnung aufgegeben hatte, das Versäumte nachzuholen. Als sie zwei Stunden später vorsichtig sein Zimmer betrat, schlief er zwar, aber seine Züge waren alles andere als entspannt.
Edwards gleichbleibende Freundlichkeit und sein Lachen über ihre Witze konnten Ashleigh nicht darüber hinwegtäuschen, dass er mit jedem Tag mutloser wurde. Eine Woche verging, dann noch eine und noch eine. Seine Stimmung hellte sich nur auf, wenn sie ihm Fragen über Australien und Duchess stellte, dann lebte er sichtlich auf. Sie wusste inzwischen, dass es in der Stadt ursprünglich zwei Hotels gegeben, eines aber nun geschlossen hatte.
Außerdem gab es ein Theater, eine Schule, einen Laden, eine Post, sogar Tennisplätze und natürlich Wohnhäuser. Die nahe gelegene Goldmine hatte die Menschen in Scharen angelockt, aber als sie geschlossen wurde, zogen viele wieder weg, um anderswo ihr Glück zu versuchen. Ashleigh hätte Edward stundenlang zuhören können, zumal er behauptete, es sei dort das ganze Jahr über sehr warm, was für sie angesichts des trostlosen Wetters in England, selbst jetzt im Frühling, wie das Paradies klang.
»Sehen Sie sich nur diesen grauen Himmel an, Lord Hamilton«, sagte sie, als sie ihm beim Mittagessen Gesellschaft leistete. »In Duchess scheint jetzt bestimmt die Sonne.« Es war auch ihre Mittagspause, und so setzte sie sich auf den Stuhl am Fenster und wickelte ein mit Käse und Tomaten belegtes Sandwich aus dem Papier. Edward hatte eine Portion Shepherd’s Pie bekommen. Sein Appetit ließ zu wünschen übrig, und Ashleigh hoffte, dass es ihm in ihrer Gesellschaft besser schmeckte. Nachdem Jenny Mr Coppelecki ins Röntgenzimmer gebracht hatte, waren sie und Edward ungestört.
Edwards Miene hellte sich auf. »In Nordaustralien ist es selbst im Winter sehr warm, und im Sommer herrschen dort hohe Temperaturen.«
»Wo genau liegt die Stadt doch gleich?«, fragte Ashleigh und biss in ihr Sandwich.
»Im Landesinneren von Queensland. Südlich von Mount Isa, einer recht großen Bergarbeiterstadt mit einigen tausend Einwohnern. Dort wird Kupfer, Silber, Blei und Zink abgebaut.«
»Wie viele Leute wohl noch in Duchess leben?« Ashleigh hatte sich Gedanken darüber gemacht. Wenn die Goldmine nichts mehr abwarf, musste es etwas anderes geben, das die Menschen dort hielt.
»Als der Betreiber des Hotels mir vor ein paar Jahren das letzte Mal schrieb, meinte er, es wohnten noch rund hundert Leute da. Ich habe keine Ahnung, wie es heute aussieht.«
»Wie kommt man denn dorthin? Mit der Pferdekutsche?«
»Nein.« Edward lachte. »Mit dem Zug. Er hält in Duchess. Die Bahn verbindet die Stadt mit anderen größeren Orten.«
Ashleigh war überrascht. »Dann ist es also nicht ganz so abgeschieden.«
»Oh, abgeschieden ist es schon, weil die Entfernungen in Australien so groß sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Bahnfahrt äußerst kurzweilig ist. Denken Sie bloß an die vielen Tiere, die es dort zu sehen gibt – Kängurus, Emus und was weiß ich nicht alles.«
Ashleigh seufzte sehnsüchtig. »Das muss wundervoll sein.« Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort: »Es geht mich zwar nichts an, und Sie müssen mir nicht darauf antworten, aber hat sich Ihre Investition eigentlich bezahlt gemacht?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, aber mir geht es nicht ums Geld.« Seine Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. »Sagt der Mann, dessen Gut pleitegeht. Der Hotelbetreiber hat eine Zeit lang Miete von den Einwohnern kassiert und angelegt, aber während der Wirtschaftskrise hatten die Leute kein Geld und konnten folglich auch keine Miete zahlen. Ich habe mir das Geld nie nach England schicken lassen, deshalb weiß ich nicht, wie viel eigentlich noch da ist.« Er zuckte die Schultern. »Sicherlich nicht genug für die Instandsetzungsarbeiten an meinem Gut. Ich könnte Duchess natürlich wieder verkaufen, aber das widerstrebt mir. Es ist seltsam, aber irgendwie hänge ich an dieser Stadt. Sie müssen mich für einen alten Narren halten«, fügte er schwach lächelnd hinzu.
»Nein, keineswegs, Lord Hamilton«, entgegnete Ashleigh ehrlich. »Der bloße Gedanke, Eigentümer dieser Stadt zu sein, hat Ihnen schon so viel Freude bereitet.«
»Das ist richtig. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass ich etwas so sehr bedauere wie selten in meinem Leben, gerade jetzt im Alter.«
In diesem Moment steckte Jenny den Kopf ins Zimmer. »Die Oberschwester sucht dich, Ashleigh«, flüsterte sie eindringlich.
»Dann gehe ich jetzt besser, Lord Hamilton.« Ashleigh erhob sich. »Bis später!«
»Hey, Mr Lathrop, wissen Sie, welchen Preis besonders friedliche und ruhige Hunde bekommen?«, fragte Ashleigh, als sie sein Laken glatt strich. Der Mann war nur noch Haut und Knochen, aber er lächelte jedes Mal, wenn sie sein Zimmer betrat.
»Nein, keine Ahnung.« Er grinste erwartungsvoll.
»Den No-Bell-Preis!«
Kelvin Lathrop lachte schallend. »Der ist gut!«, keuchte er. »Haben Sie noch einen auf Lager?«
Ashleigh freute sich, dass sie ihn zum Lachen gebracht hatte. Obwohl er ein schwerkranker Mann war, dessen Leben seit Wochen jeden Tag zu Ende gehen konnte, hatte er seinen Humor nicht verloren. »Warum trinken Mäuse keinen Alkohol?«
»Ich weiß nicht.«
»Weil sie Angst vor dem Kater haben.«
Kelvin warf den Kopf zurück und lachte herzhaft. In diesem Moment waren vom Flur eilige Schritte zu hören, dann tauchte die Oberschwester in der Tür auf.
»Was ist denn hier los?«
Plötzlich schnappte Kelvin nach Luft und gab ein Röcheln von sich. Der Blick aus den weit aufgerissenen Augen war starr, sein offener Mund lachte lautlos. Dann rührte er sich nicht mehr.
»Mr Lathrop!« Ashleigh griff erschrocken nach seiner Hand. »Können Sie mich hören, Kelvin?« Sie legte ihr Ohr an seine Brust, lauschte auf seinen Herzschlag, doch da war nichts.
»Holen Sie Dr. Marshall!«, befahl die Stationsleiterin, die ans Bett geeilt war. »Schnell!«
»Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen, Schwester Furrows?« Die Oberin sah mit eisiger Miene auf Ashleigh vor ihrem Schreibtisch herab.
Ashleigh wandte den Blick ab und versuchte, sich über ihre Gefühle klar zu werden. Natürlich war der Tod eines Patienten immer eine traurige Angelegenheit, zumal Mr Lathrop ein so liebenswerter Mensch gewesen war. »Es tut mir wirklich leid«, sagte sie schließlich, »aber es war damit zu rechnen, dass Mr Lathrop sterben wird, und so ist er wenigstens glücklich gestorben.«
»Glücklich!«, schnaubte die Oberin. »Er war sehr krank, und obwohl Sie das wussten, haben Sie ihm Witze erzählt, sodass er einen Lachanfall bekam, der ihn das Leben gekostet hat! Sie haben seinen Tod verursacht!«
Ashleigh zuckte zusammen. »Bei allem nötigen Respekt, aber das ist nicht wahr. Wir haben seit Wochen damit gerechnet, dass er den nächsten Tag nicht mehr erleben wird. Seine Zeit war abgelaufen.«
»Wie wollen Sie das beurteilen können?«
»Er war mein Patient, ich habe ihn gekannt. Und ich weiß, dass er meine Scherze geliebt hat und dass er lachend gestorben ist. Wer würde sich nicht einen solchen Tod wünschen?«
»Ich muss einen Bericht schreiben. Soll ich hineinschreiben, dass Mr Lathrop infolge eines Lachanfalls verstorben ist, nachdem Sie ihm einen Witz erzählt haben?«
»Nein«, erwiderte Ashleigh leise.
»Dieses Mal haben Sie den Bogen überspannt. Ich habe Sie unzählige Male verwarnt, aber Sie haben alle Ermahnungen in den Wind geschlagen. Deshalb ist das Ihr letzter Arbeitstag in diesem Krankenhaus, Schwester Furrows.«
Ashleigh traute ihren Ohren nicht. »Sie werfen mich raus?« Sie wusste, dass sie gut in ihrem Beruf war, und trotz aller Meinungsverschiedenheiten hätte sie nicht erwartet, wegen eines Witzes entlassen zu werden. »Sie wissen ganz genau, dass Mr Lathrop nicht gestorben ist, weil er über meinen Witz gelacht hat! Er war todkrank.«
»Sehr richtig, deshalb hätte er entsprechend gepflegt werden müssen. Sie haben Ihre Pflichten vernachlässigt, Schwester Furrows. Sie sind entlassen.«
Ashleigh erhob sich wie in Trance und ging langsam zur Tür. Die Hand schon auf dem Türknauf, überkam sie eine Welle der Wut. Sie hatte nichts mehr zu verlieren, und so drehte sie sich noch einmal um und funkelte die Oberschwester zornig an. »Sie werden garantiert nicht glücklich sterben. Dafür müssten Sie nämlich erst einmal lachen lernen.«
»Machen Sie, dass Sie rauskommen!«, zischte die Stationsleiterin.
»Mit dem größten Vergnügen«, fauchte Ashleigh zurück.
Der Abschied von den Kolleginnen war tränenreich, und ein weiterer schwerer Schritt stand Ashleigh noch bevor: der Abschied von Edward. Sie würde ihn und ihre langen Gespräche über das Leben und seine Stadt in Australien schrecklich vermissen. Hoffentlich musste sie nicht anfangen zu weinen! In der Tür zu Zimmer Nummer 14 blieb sie stehen. Mr Coppelecki schlief, und Edward schaute aus dem Fenster auf den grauen, regnerischen Spätnachmittag hinaus. Er wirkte traurig und mutlos.
Plötzlich drehte er sich um, als hätte er ihre Anwesenheit gespürt. »Ich werde morgen entlassen, Ashleigh. Dr. Marshall hält mich anscheinend für austherapiert. Er hat mir noch einmal ein anderes Medikament mitgegeben und meint, mehr könne er nicht für mich tun.« Dass der Arzt vermutete, seine quälenden Sorgen könnten der Auslöser für den viel zu hohen Blutdruck sein, und ihm geraten hatte, sein Leben von Grund auf umzukrempeln, bevor es zu spät sei, verschwieg er ihr.
»Vielleicht schlägt das neue Medikament ja an.« Ashleigh trat näher.
»Sie werden mir fehlen, Ashleigh. Die Zeit hier war für mich die beste seit Langem, und das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Ihre Gesellschaft hat mir so gutgetan! Wenn Sie lächeln, ist es, als würde die Sonne aufgehen. Hätte ich eine Enkelin, würde ich mir wünschen, dass sie wie Sie wäre.« Seine Stimme brach vor Rührung.
Ashleigh erwiderte nichts darauf. Sie trat ans Fenster und setzte sich auf den Stuhl dort.
»Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass mir noch viel Zeit bleibt, aber ich will mich nicht beklagen, ich hatte ein gutes Leben.«
Ashleigh brachen seine Worte fast das Herz. »Geben Sie die Hoffnung nicht auf, Lord Hamilton. Ich bin sicher, dass Sie noch ein paar schöne Jahre haben werden.« Es stimmte sie traurig, dass sie nichts für ihn tun konnte.
»Was machen Sie noch hier, Miss Furrows?«, blaffte die Oberschwester in der offenen Tür. »Sie haben hier nichts zu suchen. Unsere Patienten gehen Sie nichts mehr an.«
»Ich gehe, wenn es mir passt«, fauchte Ashleigh. »Sie haben mir gar nichts mehr zu sagen!«
Die Stationsleiterin ballte zornig die Fäuste und stürmte davon.
Edward sah Ashleigh verwirrt an. »Was war das denn?«
»Ich bin gefeuert worden«, gestand sie unumwunden. »Ich werde morgen auch nicht mehr hier sein.«
»Oh, Ashleigh, das tut mir leid! Und da sitze ich und jammere Ihnen etwas vor!« Er sah sie entsetzt an. »Jetzt ist mir auch klar, warum Sie keine Schwesterntracht mehr tragen und Ihre große Tasche dabeihaben, ich dachte, Ihre Schicht ist zu Ende.«
»Ach, schon in Ordnung. Ich werde meine Kolleginnen vermissen, und Sie auch, aber diese alte Hexe ganz bestimmt nicht.«
Edward lächelte leicht. »Sie sind doch eine hervorragende Krankenschwester, wieso hat sie Sie entlassen?«
»Ich habe Mr Lathrop einen Witz erzählt und dann noch einen, weil er mich darum gebeten hat. Er hat ganz furchtbar gelacht, aber dann hat er auf einmal nach Luft geschnappt und sich nicht mehr gerührt.«
Edward schüttelte verwundert den Kopf. »Muss ein guter Witz gewesen sein«, bemerkte er. »Entschuldigung«, fügte er hastig hinzu. »Aber der Mann war doch todkrank, oder?«
»Ja, wir haben jeden Tag mit seinem Ableben gerechnet. Er ist glücklich gestorben, und das finde ich tröstlich. Für die Oberschwester hingegen war es ein willkommener Vorwand, mich zu entlassen.«
»Und was werden Sie jetzt machen?«
»Ich weiß es nicht.« Sie hatte noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. »Ich sollte mich nach einer neuen Stelle umschauen, aber vielleicht ist es besser, die Gelegenheit für eine Pause zu nutzen und in Urlaub zu fahren. Ich habe noch nie eine richtige Reise gemacht.« Sie schaute auf den trüben Tag hinaus. »Irgendwohin, wo es warm ist, das wäre schön. Vielleicht nach Australien«, sagte sie halb im Scherz.
Als sie den bekümmerten Ausdruck über sein Gesicht huschen sah, wurde ihr ihre Taktlosigkeit bewusst. »Entschuldigen Sie, Lord Hamilton.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Ashleigh. Sie können reisen, wohin Sie wollen. Erfüllen Sie sich Ihre Träume! Sonst bereuen Sie es später einmal.«
Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. »Warum reisen wir nicht zusammen?«
»Nach Australien?«
»Ja! Ich könnte mich als Krankenschwester um Sie kümmern, und Sie wären mein Reisebegleiter.«
Edward hatte das Gefühl, dass der Boden unter ihm schwankte. »Das geht nicht.«
»Und warum nicht?«
»Der Zug ist abgefahren, Ashleigh.«
»Unsinn! Sie können nur so lange bereuen, etwas versäumt zu haben, bis Sie es tun, richtig?«
Edward betrachtete sie prüfend. Sie meinte es sicherlich gut, aber sie hatte die Sache nicht durchdacht. »Überlegen Sie sich in aller Ruhe, was Sie mit Ihrem Leben anfangen wollen, Ashleigh. Machen Sie sich um mich keine Gedanken.«
»Ich muss mir überlegen, wie es weitergehen soll, ja, aber nicht heute oder in den nächsten Monaten. Ich kann mir Zeit lassen. Ich bin arbeitslos, und zu Hause wartet niemand auf mich. Und auf Sie auch nicht. Was hält uns also davon ab, nach Australien zu fahren?«
»Na ja …« Edward sah sie schweigend an. Nach einigen Augenblicken fragte er: »Ist es Ihnen wirklich ernst damit, Ashleigh?«
»Und ob! Sie haben mir so viel von Duchess erzählt und mich so neugierig gemacht, dass ich es mit eigenen Augen sehen möchte.«
»Was ist mit Ihrem Kanarienvogel? Sammy, nicht wahr?«
»Meine Nachbarin kann sich um ihn kümmern. Das macht sie auch, wenn ich Doppelschicht habe. Es macht ihr bestimmt nichts aus, nach dem Haus zu sehen, den Briefkasten zu leeren und all so was.«
Edward dachte nach. Das war eine große Entscheidung, und die Last der Verantwortung wog schwer.
»Ich würde mich gut um Sie kümmern, das verspreche ich Ihnen«, fügte Ashleigh hinzu.
»Das weiß ich, aber …«
»Was haben Sie zu verlieren, Lord Hamilton? Allein in einem alten zugigen Haus oder mit mir nach Australien – ist Letzteres nicht die bessere Wahl?«
»Natürlich ist es das. Sie werden mir wirklich sehr fehlen, ich habe mich prächtig mit Ihnen verstanden.«
»Na also! Fahren wir für ein paar Monate nach Australien, wo es schön warm ist. Mich hält hier nichts und Sie auch nicht.«
»Was ist mit Timothy Ledbetter, Ihrem Klempner?«
Ashleigh lachte. »Der wird’s überleben. Ich wünsche ihm, dass er jemanden findet, der seine Gefühle erwidert. Und wir zwei sollten den Sprung ins kalte Wasser wagen, Lord Hamilton. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich bin nie weiter als bis nach London gekommen, deshalb ist das hier eine einmalige Chance für mich.«
»Ich war auf der anderen Seite des Ärmelkanals, aber das war es auch schon«, gestand er verlegen.
»Sehen Sie? Da ist es doch höchste Zeit, dass ein Hamilton die Welt erobert, finden Sie nicht?«
Er lächelte. »Ja, wahrscheinlich haben Sie recht.«
»Ich sehe uns schon in Liegestühlen auf einem Ozeandampfer, Sie mit einem kühlen Bier in der Hand und ich mit einem Gin Tonic. Wäre das nicht wunderbar?«