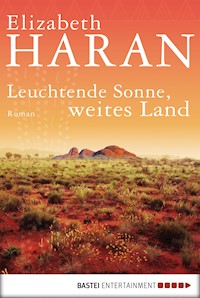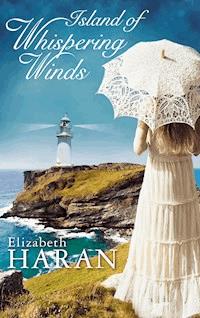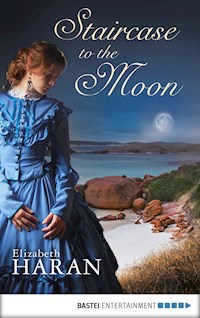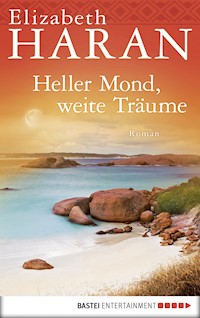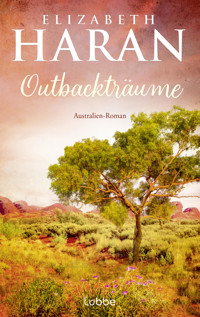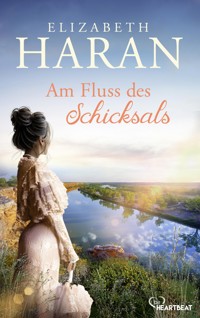7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Emotionen, weites Land - Die Australien-Romane von Elizabeth Haran
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen aus unterschiedlichen Welten - verbunden durch ein dramatisches Schicksal!
Kangaroo Island, 1845: Vor der australischen Küste sinkt ein Schiff in einem gewaltigen Sturm. Wie durch ein Wunder überleben zwei junge Frauen das Unglück: Amelia Divine und Sarah Jones. Sie werden von einem Leuchtturmwärter aus der See gerettet. Doch Amelia erleidet eine Kopfverletzung und verliert dadurch ihr Gedächtnis. Sie kann sich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern - und Sarah nutzt die Gelegenheit, den Lauf des Schicksals zu verändern und ihrer trostlosen Zukunft zu entfliehen ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3KingscoteKapitel 4KingscoteKapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Cape du CouedicKapitel 8Kapitel 9Cape du CouedicKingscoteKapitel 10Kapitel 11Cape du CouedicKingscoteCape du CouedicKingscoteKapitel 12KingscoteCape du CouedicKapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Cape du CouedicKingscoteKapitel 16KingscoteKapitel 17Cape du CouedicKapitel 18KingscoteKapitel 19Cape du CouedicKingscoteCape du CouedicKingscoteKapitel 20Cape du CouedicKingscoteKapitel 21Cape du CouedicKingscoteKapitel 22Cape du CouedicKingscoteKapitel 23KingscoteCape du CouedicKapitel 24KingscoteKapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Cape du CouedicKingscoteKapitel 29KingscoteKapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel Hobart TownKapitel 35AnmerkungÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Kangaroo Island, 1845: Vor der australischen Küste sinkt ein Schiff in einem gewaltigen Sturm. Wie durch ein Wunder überleben zwei junge Frauen das Unglück: Amelia Divine und Sarah Jones. Sie werden von einem Leuchtturmwärter aus der See gerettet. Doch Amelia erleidet eine Kopfverletzung und verliert dadurch ihr Gedächtnis. Sie kann sich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern - und Sarah nutzt die Gelegenheit, den Lauf des Schicksals zu verändern und ihrer trostlosen Zukunft zu entfliehen …
Elisabeth Haran
Die Inselder roten Erde
Aus dem australischen Englischen vonSylvia Strasser
Ich widme dieses Buch unserem kürzlich verstorbenen Hund Scully. Er war uns ein treuer, gutmütiger und cleverer Begleiter. Uns bleiben acht Jahre voll wunderbarer Erinnerungen an die Zeit mit Scully, der in seinen letzten Wochen trotz schwerer Krankheit sehr tapfer war. Du wirst für immer in unseren Herzen sein!
1
Australien, September 1845
Vor der Südküste
»Lucy! Bring mir meinen Sonnenschirm, und beeil dich gefälligst!«, rief die schöne, dunkelhaarige junge Frau ungeduldig. Anscheinend sorgte sie sich um ihre Pfirsichhaut.
»Wäre es nicht besser, die Sonne zu meiden und den Schatten aufzusuchen, Miss Divine?«, erwiderte Lucy freundlich. Die Kraft der vom Wasser reflektierten Sonnenstrahlen durfte man nicht unterschätzen. Niemand wusste das besser als Lucy: Da sie einen hellen Teint und blonde Haare hatte, bekam sie binnen weniger Minuten einen Sonnenbrand. Doch auf dem Achterdeck war sie vor der Sonne und dem aufkommenden Wind geschützt, während die S. S. Gazelle über die Wellenberge stampfte. Die Fahrt ging die australische Südküste entlang in Richtung Backstairs Passage, jener berüchtigten Seestraße, die Kangaroo Island – das Ziel der Reise – vom Festland trennte. Aber nach Einschätzung der Matrosen würde die Gazelle es wegen des starken Gegenwinds nicht vor Einbruch der Dunkelheit bis dorthin schaffen. Dabei war Ende September; eigentlich hätte es mild und heiter sein müssen. Stattdessen wehte ein eisiger Wind.
Amelia Divine, die an der Reling stand, funkelte ihre Bedienstete zornig an. »Mir wird schlecht von diesem schrecklichen Geschaukel, Lucy. Wenn ich mir nicht den Wind um die Nase wehen lassen kann, werde ich bald die Fische mit den widerlichen Hammelkoteletts füttern, die es zum Mittagessen gab.«
Lucy unterdrückte einen gereizten Seufzer. Seit sie vor fünf Tagen mit dem Dampfer Lady Rosalind von Van-Diemens-Land*aus in See gestochen waren, beklagte Amelia sich in einem fort, und allmählich ging Lucy diese Nörgelei auf die Nerven. Es ist zu warm. Es ist zu kalt. Das Essen schmeckt grauenhaft. Die Seeleute sind unhöflich. Ich muss mich mit dem Pöbel vom Zwischendeck abgeben … und so weiter, und so fort. Der kurze Zwischenaufenthalt in Melbourne, wo sie an Bord der Gazelle gegangen waren, hatte Amelias Laune auch nicht bessern können.
Lucy war überzeugt, dass es viel zu windig war, um einen Sonnenschirm halten zu können. Dennoch holte sie ihn, damit ihre Ladyschaft zufrieden war. Kaum hatte sie Amelia den Schirm in die Hand gedrückt, riss eine Windbö ihn auch schon fort und wehte ihn aufs Meer hinaus. Amelia schrie verärgert auf, als der Schirm von den Wellen davongetragen wurde.
»Möchten Sie nicht lieber aus dem Wind kommen, Miss Divine?« Lucy fürchtete, eine starke Bö könnte die zarte Amelia packen und über Bord reißen.
»Ich sagte dir doch, dass mir dann schlecht wird! Sei gefälligst still, wenn du keine vernünftigen Vorschläge hast!«, fuhr Amelia sie an, offensichtlich entschlossen, ihre schlechte Laune weiterhin an ihrer Dienerin auszulassen, wie so oft in den vergangenen Wochen.
Lucy wandte sich ab und ging auf das geschützte Achterdeck zurück, wo eine Mitreisende, die sich ihr als Sarah Jones vorgestellt hatte, die Szene verfolgte.
»Ich verstehe nicht, wie du das Geschimpfe dieser Frau aushältst«, sagte Sarah und warf Amelia, die sich mit hochnäsiger Miene an die Reling klammerte, einen finsteren Blick zu. Sarah hatte im Lauf der Jahre mehrere Frauen wie Amelia Divine kennen gelernt und war oft mit der gleichen Schroffheit abgefertigt worden.
Doch Sarah hatte sich aufgrund ihrer Lebensumstände mit dieser Behandlung abfinden müssen. Weshalb Lucy solche Grobheiten hinnahm, war Sarah ein Rätsel. Das Mädchen mochte zwar eine Bedienstete sein, aber sie war ein freier Mensch – anders als Sarah, die einen Blick dafür hatte, wer zu ihren Leidensgenossinnen gehörte und wer nicht, und Lucy zählte eindeutig nicht dazu. An Lucys Stelle hätte sie dieser Miss Divine ins Gesicht gesagt, was sie von ihr hielt. Das hätte sie vermutlich die Anstellung gekostet, aber es wäre ihr die Sache wert gewesen.
»Ich brauche die Stelle bei Miss Divine«, erklärte Lucy. »Vor anderthalb Jahren bin ich zusammen mit hundertsechsundfünfzig anderen Kindern aus einem Londoner Waisenhaus nach Australien gekommen. Vom sechzehnten Lebensjahr an müssen wir für uns selbst sorgen. Ich bin erst letzten Monat sechzehn geworden und kann von Glück sagen, dass ich gleich die Anstellung bei Miss Divine gefunden habe.«
»Sie kann doch nicht viel älter sein als du«, bemerkte Sarah, den Blick noch immer auf Lucys Brotherrin gerichtet. Deren Eltern waren allem Anschein nach sehr wohlhabend und hatten ihre Tochter zur Hochnäsigkeit erzogen, was Sarahs Abneigung noch verstärkte.
»Miss Divine ist neunzehn«, sagte Lucy, »und hat bisher ein beneidenswertes Leben geführt. Doch vor ein paar Wochen hat sie ihre Eltern und ihren jüngeren Bruder verloren.«
»Oh. Was ist denn passiert?«
»Bei einem schweren Sturm in Hobart Town ist ein Eukalyptusbaum umgestürzt und hat ihre Kutsche unter sich begraben. Sie waren auf der Stelle tot. Ich wurde eingestellt, um Miss Amelia zu ihren Vormündern zu begleiten, die sie zum letzten Mal gesehen hat, als sie elf war. Die Leute wohnen in Kingscote auf Kangaroo Island und sollen sehr nett sein. Miss Amelia wird es bestimmt gut bei ihnen haben. Ich hoffe nur, dass sie mich behält. Auch wenn es nicht immer einfach mit ihr ist, so bin ich doch versorgt.« Lucy war viel zu gutmütig, als dass Amelias herrische Art ihren Zorn geweckt hätte. Lucys sanftes Wesen spiegelte sich auch in ihren freundlichen Zügen und ihrem herzlichen Lächeln.
Sarah bedachte Lucy mit einem vielsagenden Blick. Sie würde lieber Klosetts schrubben, als für jemanden wie Amelia Divine zu arbeiten!
»Hätte ich die Stelle bei Miss Amelia nicht«, sagte Lucy, »müsste ich in einer Fabrik schuften, und das würde mir nicht gefallen.« Verstohlen blickte sie auf Sarahs rote, rissige Hände, die von harter häuslicher Arbeit kündeten. Lucys Hände hatten in den Jahren im Waisenhaus ganz ähnlich ausgesehen.
Der schmerzliche Verlust, den Amelia erlitten hatte, stimmte Sarah keineswegs gnädiger. Sie war sicher, dass Amelia vermögend war, und ihre Vormünder würden sich um sie kümmern. Außerdem machte sie nicht den Eindruck, unter dem Verlust ihrer Eltern und des Bruders zu leiden. Und ihre Zukunft war verheißungsvoll, zumal sie mit ihrem blendenden Aussehen jeden Mann um den Finger wickeln konnte. Sarahs Abneigung rührte vor allem daher, dass Amelia im Gegensatz zu ihr so offensichtlich vom Schicksal bevorzugt worden war. Nur äußerlich gab es gewisse Ähnlichkeiten zwischen ihnen: Sie hatten beide langes, dunkelbraunes Haar, einen hellen Teint und braune Augen. Doch während Sarah eher ein Durchschnittsgesicht besaß, war Amelia eine Schönheit. Und ihre Herkunft hätte unterschiedlicher nicht sein können: Amelia kam aus einem reichen Elternhaus, Sarah stammte aus der englischen Arbeiterschicht. Trotzdem hatte keine Amelia Divine dieser Welt das Recht, Angehörige der Unterschicht wie Fußabtreter zu behandeln!
»Ich bin schrecklich neugierig auf die Insel«, riss Lucys Stimme Sarah aus ihren Gedanken. Das Mädchen blickte auf die dunklen Wolken, die sich über dem Festland zusammenzogen und ein Unwetter verhießen. »Einige Passagiere erzählten mir, es gäbe auf Kangaroo Island herrliche weiße Sandstrände, großen Fischreichtum und eine exotische Tierwelt. Doch Miss Amelia interessiert das alles nicht. Sie war schrecklich wütend, als sie hörte, wie wenig Menschen auf der Insel leben, denn sie liebt Partys und Einkaufsbummel über alles. Ich aber freue mich auf Kangaroo Island. Außerdem soll das Klima dort so angenehm sein wie in Van-Diemens-Land.«
Sarah zuckte mit den Schultern. Ihr war es egal, wie die Insel aussah oder welches Klima dort herrschte. Sie hatte sich ihren Aufenthaltsort nicht aussuchen können.
»Und du?«, fragte Lucy. »Was für einer Arbeit wirst du nachgehen?«
Obwohl die Frage harmlos war, hielt Sarah es für klüger, dem Mädchen nicht die ganze Wahrheit zu erzählen. »Ich werde mich auf einer Farm um Kinder kümmern, die vor einem Jahr ihre Mutter verloren haben.«
»Oh. Was ist der armen Frau denn passiert?«
»Sie ist bei der Geburt ihres siebten Kindes gestorben. Auch das Kind hat nicht überlebt«, erwiderte Sarah. Die Farmersfrau hätte ihren Mann zurückweisen sollen, dann hätten die anderen Kinder ihre Mutter noch. Dieser Gedanke ging Sarah nicht zum ersten Mal durch den Kopf. Doch sie wusste, dass die Frau keine andere Wahl gehabt hatte. Sie hatte mit dem Leben dafür bezahlt.
Lucy dachte an das Kleine, das bei der Geburt gestorben war. »Dann hast du sechs Kinder, um die du dich kümmern musst«, sagte sie. Es war eine einfältige Bemerkung, doch sie bewies, wie sehr die Erinnerung an das Waisenhaus Lucy immer noch gefangen hielt. Sie sah wieder all die kleinen Würmchen vor sich, die von ihr umsorgt worden waren, weil sie niemanden sonst auf der Welt hatten. Der Abschied von diesen Kindern hätte Lucy beinahe das Herz gebrochen. Ein Monat war seitdem vergangen, doch ihr kam es vor, als wäre es erst gestern gewesen. Die Kleinen hatten geweint und geschrien, als Lucy gegangen war, doch die Nonnen waren unerbittlich gewesen. Auch für Lucy gab es keine Ausnahme; sie hatte das Waisenhaus verlassen müssen. Noch immer litt sie unter schrecklichen Schuldgefühlen, weil sie die Kinder im Stich gelassen hatte.
Sarah registrierte mit Erleichterung, dass Lucy ihr den Schwindel geglaubt hatte und sie für eine Gouvernante hielt. Das Mädchen hatte also keinen Verdacht geschöpft. Gut so, denn die Wahrheit war wenig schmeichelhaft: Sarah war eine Strafgefangene, die unter Auflagen aus der Haft entlassen worden war. Im Alter von vierzehn Jahren war sie wegen Diebstahls zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Fünf harte Jahre hatte sie im Cascade Factory abgesessen, dem Frauengefängnis in South Hobart, wo sie in der Wäscherei geschuftet hatte. Da es den australischen Farmen jedoch an Arbeitskräften fehlte, durften Häftlinge bei guter Führung ihre Reststrafe verbüßen, indem sie auf Bewährung freikamen und in der Landwirtschaft arbeiteten.
Sarah war in Hobart Town von einem Aufseher an Bord der Montebello gebracht und nach Melbourne begleitet worden, von wo sie die Fahrt mit der Gazelle fortgesetzt hatte. Sobald sie auf Kangaroo Island eingetroffen waren, musste Sarah sich bei der Polizei in der Kleinstadt Kingscote melden; dann würden die Beamten sie zu Evan Finnlays Farm im westlichen Teil der Insel bringen. Es hatte Sarah anfangs einen Schrecken eingejagt, dass der Farmer sie nicht persönlich abholte. Doch da sich seine Farm am anderen Ende der Insel befand und allem Anschein nach in einer besonders rauen, unwirtlichen Gegend lag, wollte er seine Kinder und sein Vieh nicht allein lassen.
An Bord der Gazelle befanden sich einundachtzig Passagiere und achtundzwanzig Mann Besatzung. Die Ladung bestand aus Kupfer, Mehl und Kolonialwaren. Außerdem waren sieben Pferde an Bord, davon vier Rennpferde, deren Bestimmungsort Adelaide war und deren Besitzer, die Herren Hedgerow, Albertson und Brown, mit den Siegen prahlten, die eines der Tiere beim Flemington-Pferderennen in Melbourne errungen hatte.
Eine Stunde später war der Himmel bedrohlich düster geworden, und der Wind hatte sich zu einem Sturm ausgewachsen. Die Masten und die Takelage ächzten und knarrten, und die Matrosen fürchteten, die Segel könnten losgerissen und zerfetzt werden. Das Schiff war zum Spielball der Wellen geworden, und es gab nichts, was die Mannschaft dagegen tun konnte. Als sie sich fünf Meilen südlich des Leuchtturms von Cape Willoughby auf Kangaroo Island befanden, wurde eines der Pferde in seiner Box zu Boden geschleudert, so aufgewühlt war die See. Der Kapitän befahl daraufhin, Kurs Südwest zu nehmen, aufs offene Meer hinaus, wo die Dünung flacher war.
Doch bald türmten die Wellen sich meterhoch, und erneut wurde die Gazelle von gefährlichen Sturmböen erfasst. Der Kapitän beschloss, die Insel zu umfahren, um nach Kingscote zu gelangen; dort wollte er im sicheren Hafen abwarten, bis das Wetter sich beruhigte, ehe er die Fahrt nach Adelaide fortsetzte.
»Wann sind wir denn endlich auf dieser elenden Insel?«, klagte Amelia zum hundertsten Mal. Sie war seekrank geworden, als sie sich vor dem Regen unter Deck in den Salon flüchten musste. Von der Insel war in der einsetzenden Dunkelheit und dem strömenden Regen nichts mehr zu sehen. Die Stunden vergingen. Der Sturm tobte mit unverminderter Heftigkeit. Während Sarah und Lucy Gebete sprachen, jammerte und schimpfte Amelia.
Plötzlich erblickte Kapitän Brenner das Leuchtfeuer eines anderen Leuchtturms. Offenbar waren sie vom Kurs abgekommen und der Küste sehr viel näher, als er vermutet hatte. Entsetzt beugte er sich über seine Karten. Gab es hier Riffe, die ihnen gefährlich werden konnten?
Sein Erster Maat kam zu ihm geeilt. »Wenn dort das Leuchtfeuer von Cape du Couedic ist, Sir, müssen wir sofort abdrehen!«, rief er voller Panik. Er kannte die Gegend von früheren Fahrten und wusste, dass die Riffe schon manchem Schiff zum Verhängnis geworden waren.
Der Kapitän riss das Ruder herum, doch es war zu spät. Im gleichen Augenblick, als vom Bug der Warnruf eines Seemanns ertönte, ließ ein heftiger Schlag den Rumpf erzittern. Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden zu Boden geschleudert.
»Gott sei uns gnädig!«, stieß der Kapitän hervor. Das Schiff war auf ein Riff aufgelaufen. Das grässliche Knirschen, als der Holzrumpf über die halb unter der Wasseroberfläche verborgenen gezackten Felsen schrammte, ging durch Mark und Bein. Die Kinder an Bord klammerten sich ängstlich schreiend an ihre weinenden Mütter. Stoßgebete wurden zum Himmel geschickt, als das Schiff von der Dünung angehoben, noch ein paar Meter weiter auf die Klippen geschoben und von den scharfkantigen Felsen regelrecht aufgespießt wurde. Ein weiterer gewaltiger Brecher warf das Schiff auf die Steuerbordseite. Passagiere und Matrosen wurden wie Strohpuppen umhergeschleudert. Ihre Schreie erstarben, als das eiskalte Wasser ins Schiffsinnere brach und die unteren Decks überflutete. Die Maschinen wurden gestoppt, damit die Schraube nicht an den Felsen zerschellte. In das Tosen des Meeres mischten sich die markerschütternden Entsetzensschreie der Menschen. Zwei schreckliche Minuten vergingen.
Dann schien es, als hätte das Schiff sich stabilisiert. Kapitän Brenner befahl, die Rettungsboote zu Wasser zu lassen und die Fahrgäste in Sicherheit zu bringen. Sekunden später stürzte der Schornstein der Gazelle krachend um und begrub den Bug unter sich. Das Schiff konnte dem Druck nicht mehr standhalten und zerbrach in drei Teile. Jetzt lagen die Kabinen und Gesellschaftsräume in undurchdringlicher Finsternis. In Todesangst drängten die Passagiere sich aneinander. Menschen und ein Teil der Fracht wurden über Bord gespült, Rettungsboote davongeschwemmt. Dort, wo der vordere Teil des Schiffes lag, war das Wasser über den Klippen sehr viel tiefer als am Heck, das hoch emporragte. In ihrer Panik versuchten die Menschen vom vorderen und mittleren Teil des Schiffes das Heck zu erreichen, indem sie sich an einem Seil entlanghangelten, das von einem Besatzungsmitglied gesichert wurde. Doch kaum jemand schaffte es. Die meisten wurden von den Wellen ins Meer gerissen.
Lucy, Amelia und Sarah Jones befanden sich im Salon im Heck der Gazelle. Sie waren starr vor Angst. Hätten sie gewusst, dass die meisten Rettungsboote losgerissen und fortgetrieben worden waren, hätte ihr Entsetzen nicht größer sein können. Amelia konnte nur an eines denken: dass sie ihrer Familie jetzt wohl ins Grab folgen würde. Lucy war viel zu verängstigt, um sie beruhigen zu können.
Während das Heck des Schiffes in der aufgewühlten See und dem tobenden Sturm gefährlich schaukelte, versuchte die Mannschaft verzweifelt, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Herren Hedgerow, Albertson und Brown mussten mit ansehen, wie drei ihrer kostbaren Rennpferde um ihr Leben schwammen und das vierte gegen die Klippen geschleudert wurde. Sie versprachen den Seeleuten hundert Pfund für einen Platz in den Rettungsbooten. William Smith, einer der Matrosen, war wütend und schockiert über so viel Feigheit und Egoismus. Er fing den fassungslosen Blick einer Mutter auf, die um das Leben ihrer vier kleinen Kinder bangte und das Angebot der Gentlemen ebenfalls gehört hatte.
»Frauen und Kinder zuerst!«, fuhr Smith die Herren zornig an. Zwei andere Matrosen jedoch, Ronan Ross und Tierman Kelly, waren versucht, sich auf den Handel einzulassen. Doch wozu? Tote brauchen kein Geld. Und allen war klar, dass es an ein Wunder grenzte, wenn jemand die Katastrophe überlebte.
Die Mannschaft traf sämtliche Notmaßnahmen. Die Matrosen versuchten, Leuchtraketen abzufeuern, doch es gelang ihnen nicht, weil das Pulver nass geworden war. In der Hoffnung, ein vorüberfahrendes Schiff oder der Leuchtturmwärter würden das Notsignal hören, wurde die Schiffsglocke geläutet. Doch es war eine Tat schierer Verzweiflung. In diesem heulenden Sturm würde niemand sie hören.
Als vom Bug aus eins der Rettungsboote der Gazelle gesichtet wurde, das kieloben im tosenden Wasser trieb, erbot sich einer der Passagiere, ein holländischer Seemann, dorthin zu schwimmen. Mit einem Seil gesichert, das er sich um die Taille gebunden hatte, sprang er in die Fluten und schaffte es tatsächlich, das gekenterte Boot zu erreichen. Schon brandete Jubel auf. Plötzlich aber löste sich das Seil, und der Mann wurde mitsamt dem Boot, an dessen Rumpf er sich klammerte, von der Gazelle weg aufs offene Meer und in den sicheren Tod getrieben.
Zwei Seeleuten gelang es, das letzte noch verbliebene Rettungsboot am Heck des Schiffes zu Wasser zu lassen. Während der eine Matrose ins Boot kletterte, eine Sturmlaterne in der Hand, half der andere den Passagieren das steil emporragende, schlüpfrige Deck hinunter in das knietiefe Wasser, wo sie von dem Matrosen im Rettungsboot an Bord gehoben wurden – in der tobenden See ein lebensgefährliches Unterfangen.
Nach Schätzung der Matrosen mussten sich noch an die fünfunddreißig Passagiere im Heck aufhalten. Da im Rettungsboot für so viele Menschen kein Platz war, brachten sie die Kinder und deren Mütter sowie einige der ältesten Fahrgäste zuerst in Sicherheit.
Lucy, Amelia und Sarah befanden sich noch immer im verwüsteten Salon, in dem das nackte Chaos herrschte. In wilder Panik und voller Angst, in der Dunkelheit von ihren Liebsten getrennt zu werden, drängten die Menschen zur Tür, stießen und schubsten einander, als jeder versuchte, so schnell wie möglich an Deck zu kommen und sich einen Platz im Rettungsboot zu sichern, bevor das Heck der Gazelle von den Klippen gerissen und in tiefes Wasser gespült wurde.
Plötzlich wurde Amelia in dem Gedränge von ihrer Bediensteten getrennt. »Lucy!«, rief sie schrill. »Lucy, wo bist du?«
Mit den Ellenbogen bahnte sie sich einen Weg aufs Deck und starrte angestrengt auf das Rettungsboot hinunter, doch in der tosenden See, über die der Regen peitschte, und dem schwachen Schein der Laterne konnte sie nur Umrisse erkennen.
»Tut mir Leid, Miss.« Ein Matrose hielt sie mit eisernem Griff am Arm fest. »Das Boot ist voll.«
»Lucy!«, schrie Amelia, als sie das Mädchen plötzlich an Bord des Rettungsboots erkannte. Lucy hatte auf ihre Herrin warten wollen, war aber von der Menge mitgerissen und von dem Matrosen an Bord gezerrt worden. Sarah befand sich unmittelbar hinter ihr.
»Lucy! Du kannst mich doch nicht allein lassen!«, rief Amelia und wandte sich an den Matrosen, der sie am Arm festhielt. »Lucy ist meine Dienerin! Sie kann nicht ohne mich ins Rettungsboot steigen!«
»Das Boot ist voll, Miss. Es wird kentern, wenn es überladen ist!«
»Lassen Sie mich los!«, kreischte Amelia hysterisch. Unvorstellbar, dass man sie auf der Gazelle zurückhalten wollte! Hatte sie als Fahrgast der ersten Klasse nicht eher Anspruch auf einen Platz im Rettungsboot als ein Zwischendeckpassagier?
Es gelang ihr, sich loszureißen, doch dabei verlor sie das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Als sie neben dem Rettungsboot prustend wieder auftauchte, klammerte sie sich an die Bordwand. Inzwischen war der Matrose von der havarierten Gazelle ins Wasser gesprungen und versuchte, Amelia wieder an Bord des Schiffes zu zerren. »Nur eine von Ihnen kann mit!«, rief er. Doch Amelia schlug um sich und gebärdete sich wie eine Verrückte. Unter den Menschen im Rettungsboot breitete sich Panik aus. Sie fürchteten, das Boot würde doch noch kentern.
»Das ist mein Platz!«, kreischte Amelia und funkelte Lucy, die zusammengesunken vor Sarah kauerte, voller Angst und Zorn an.
Lucy wollte aufstehen, um ihren Platz für Amelia zu räumen, doch Sarah sagte beschwörend: »Bleib«, und hielt sie am Arm zurück.
Unschlüssig verharrte das Mädchen. Wenn Amelia das Boot zum Kentern brächte, würden sie alle sterben. Lucys gehetzter Blick schweifte über die verängstigten Kinder. Nein, sie konnte nicht verantworten, dass diese Kinder durch ihre Schuld das Leben verloren. »Bitte, lassen Sie Miss Divine ins Boot!«, bat sie den Matrosen inständig.
»Das geht nicht! Wir dürfen es nicht überladen!«
»Lucy!«, schrie Amelia abermals. »Du kannst nicht ohne mich gehen!«
Lucy holte tief Luft und stand auf. »Ich komme!«, rief sie Amelia zu.
»Nein, Lucy! Bleib!«, drängte Sarah.
»Ich kann nicht«, antwortete Lucy. Sie hatte kein Recht auf einen Platz, der Amelia gebührte. Entschlossen schüttelte sie Sarahs Hand ab und kletterte aus dem Boot. Der Matrose half Amelia beim Einsteigen.
»Wo willst du hin, Lucy? Komm sofort zurück!«, rief Amelia zornig und stampfte mit dem Fuß auf wie ein kleines Kind. Ihr war gar nicht bewusst, welches Opfer Lucy für sie gebracht hatte. Wieder schaukelte das Boot bedenklich, und die Menschen schrien in Todesangst.
»Ich bringe das Mädchen in Sicherheit«, rief der Seemann an Bord der Gazelle. Schon wurde Lucy auf das Heck gehoben. Der Matrose im Rettungsboot stieß sich vom Schiffsrumpf ab.
Sarah schaute zu Lucy hinauf, die an der Tür zum Salon stand. Ihr Gesichtsausdruck war der eines Menschen, der wusste, dass er zum Tode verurteilt ist. Sarah hätte mit Fäusten auf Amelia Divine einschlagen mögen, so groß war ihre Wut auf diese eigensüchtige Frau. Doch angesichts der bedrohlichen Lage, in der sie sich befanden, hatte sie vorerst andere Sorgen.
Der Matrose versuchte, das Rettungsboot zwischen den aufragenden Klippen hindurchzusteuern, deren gezackte Umrisse sich schwarz in der Dunkelheit abzeichneten. In der aufgewühlten See war es eine schier unlösbare Aufgabe. Was sie brauchten, war ein Wunder in dieser an Wundern bislang so armen Nacht.
Als das Rettungsboot sich ungefähr hundert Meter vom Schiff entfernt hatte, gab der Vorderteil der Gazelle plötzlich mit lautem Krachen nach und versank in den Fluten. Man konnte hören, wie das Holz gegen die Felsen geschmettert wurde und die Luft mit einem unheimlichen Zischen und Gurgeln aus den Kabinen entwich. Der Wind trug keine Hilferufe zum Rettungsboot hinüber; die Menschen an Bord der Gazelle hatten keine Chance. Amelia und die anderen klammerten sich an das Boot oder an ihren Nebenmann. Jeder fragte sich, ob er zu den Glücklichen zählte, die gerettet würden, oder ob er doch noch zum Tode verurteilt war.
Der Matrose bot all seine Kraft auf, um den schmalen Küstenstreifen zu erreichen, der flach genug war, dass sie gefahrlos an Land gehen konnten. Schon schien es, als würde das Boot von den Brechern ans Ufer getragen, als es plötzlich gegen eine Klippe stieß und zur Seite geschleudert wurde. Bevor der Matrose reagieren konnte, traf eine mächtige Welle mit voller Wucht die Längsseite des Bootes und warf es um.
Amelias Schrei wurde von den Wassermassen erstickt, als sie vom Sog in die Tiefe gezogen und von der Brandung herumgewirbelt wurde. Kaum war sie wieder aufgetaucht, wurde sie gegen etwas Hartes geschmettert. Benommen klammerte sie sich instinktiv an den Felsen fest und sog die Luft tief in ihre brennenden Lungen, als die See zurückwich und ihren geschundenen Körper mit sich zu zerren versuchte. Schon schlug die nächste Welle über ihr zusammen und raubte ihr den Atem. Sie hatte pochende Schmerzen im Kopf, in den Armen und den Beinen. Ihr langes, nasses Haar klebte ihr im Gesicht.
Die Arme fest um einen Felsblock geschlungen, wurde sie von der Brandung abwechselnd gegen das Gestein gedrückt und von ihm weggezerrt. Die Minuten kamen ihr wie Stunden vor. Obwohl sie kein Gefühl mehr in ihren tauben Fingern hatte, krallte sie sich verzweifelt an den Felsen. Sie hatte keine Ahnung, wie weit sie vom Ufer entfernt war. Irgendwann, zwischen zwei anbrandenden Wellen, gelang es ihr, sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen, doch sie konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Mit letzter Kraft zog sie sich an den Klippen hoch, sodass sie wenigstens den Oberkörper auf den Fels legen konnte. Ihre Beine hingen immer noch im Wasser.
Amelia verlor jedes Zeitgefühl. Als sie das nächste Mal die Augen öffnete, dämmerte der Morgen herauf. Sie sah, dass der Felsblock, an dem sie sich festhielt, über und über mit scharfkantigen Entenmuscheln bedeckt war. Sie blutete aus Wunden an den Fingern, Armen, Knien und Schienbeinen und war dermaßen durchgefroren, dass sie mit den Zähnen klapperte. Als sie den Kopf drehte, konnte sie in einiger Entfernung Land ausmachen – einen kahlen Steilhang, der ein Stück weiter von einem schmalen Sandstreifen unterbrochen wurde. Irgendetwas bewegte sich dort im Sand. Amelia schaute angestrengt hinüber. Es war eine Herde Seelöwen. Fasziniert und ängstlich zugleich beobachtete sie die Tiere.
Plötzlich fiel ihr ein, dass es in den Gewässern rings um die Insel angeblich von Haien wimmelte, und hastig versuchte sie, die Beine aus dem Wasser zu ziehen. Vergeblich. Sie warf einen raschen Blick zum Leuchtturm auf dem Kliff hinauf. Das warnende Leuchtfeuer brannte noch immer. Konnte der Leuchtturmwärter sie sehen? Wusste er, dass die Gazelle unmittelbar vor der Küste gesunken war?
Amelia hatte sich schon in der Nacht gefragt, ob die Flut kam oder die Ebbe einsetzte. Da das Wasser ihr jetzt nur noch bis zu den Füßen und nicht mehr bis zum Hals reichte, musste Ebbe sein. Folglich blieb ihr ein wenig Zeit, sich zu überlegen, wie sie sich in Sicherheit bringen könnte.
Sie drehte sich zum Meer hin und schnappte erschrocken nach Luft. Von der Gazelle war nichts mehr zu sehen. Lediglich ein paar Trümmerteile, ein Kissen, ein Schuh, ein Koffer trieben auf dem Wasser – makabre Erinnerungsstücke an die vielen Menschen, die ihr Leben verloren hatten.
»O Gott, bin ich die einzige Überlebende?«, schluchzte sie und schloss die Augen. Möwen kreischten über ihr, und die Wellen brachen sich an den Klippen. Noch nie hatte Amelia sich so verlassen gefühlt. Sie schloss verzweifelt ihre Augen.
Ein Geräusch schreckte Amelia aus ihrem Dämmerschlaf auf. Es hörte sich wie ein Stöhnen an. Verwirrt blickte sie sich um. »Ist da jemand?«, rief sie zaghaft. Sie wagte kaum zu hoffen, dass sie vielleicht doch nicht allein war. Als sie im Wasser ringsum niemanden entdecken konnte, erkannte sie, dass das Geräusch von der anderen Seite des Felsenriffs kommen musste.
»Hier drüben«, antwortete plötzlich jemand. Obwohl in diesem Moment eine Welle gegen die Felsen krachte, war Amelia sicher, eine Frauenstimme erkannt zu haben.
»Lucy?«, rief sie voller Hoffnung. »Bist du das, Lucy?«
»Nein«, erwiderte Sarah, die erkannte, dass die Frau auf der anderen Seite des Felsenriffs nur Amelia Divine sein konnte. Würde sie sonst nach Lucy fragen?
Amelia blickte wieder aufs Meer hinaus. Sie hoffte inständig, dass Lucy überlebt hatte, doch im tiefsten Innern wusste sie, wie unwahrscheinlich das war. Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie fragte sich, weshalb Gott sie zum zweiten Mal vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Hätte sie sich damals, als ihre Eltern und ihr Bruder Marcus in der Kutsche von einem umstürzenden Baum erschlagen worden waren, nicht unwohl gefühlt und wäre zu Hause geblieben, wäre sie mit ihnen gestorben. Hätte sie sich nicht im Rettungsboot befunden, wäre sie mit der Gazelle untergegangen.
Sie schaute aufs Wasser hinunter. Es begann, merklich zu steigen. »Die Flut kommt!«, rief sie und starrte zum Ufer. Der bloße Gedanke, sich schwimmend an Land retten zu müssen, ließ sie schaudern. Sie war keine gute Schwimmerin und fürchtete, von einem Hai attackiert zu werden.
Ein Kopf schob sich um den Felsen herum. Amelia fiel ein Stein vom Herzen, als sie die Frau erblickte, doch Sarah, die an Lucy dachte, funkelte sie zornig an.
»Sind Sie allein?«, fragte Amelia. »Gibt es noch andere Überlebende?«
»Ich glaube nicht. Ich habe nur eine Leiche gesehen, wahrscheinlich einer der Matrosen.« Der Tote hatte eine klaffende Kopfwunde gehabt; Sarah nahm an, dass er gegen die Felsen geschleudert worden war. Blinzelnd schaute sie zum Ufer hinüber. »Was ist das da auf dem Sand?« Sarahs Augen brannten vom Salzwasser und sie konnte deshalb nur dunkle Schemen erkennen, von denen einige sich bewegten.
»Seelöwen«, antwortete Amelia.
»Werden sie uns etwas tun?« Sarah hatte keine besonders gute Schulbildung.
»Das glaube ich nicht, aber soviel ich weiß, dienen sie den Haien als Nahrung.« Ängstlich schaute Amelia sich um. »O Gott, wenn die Flut kommt, werden die Haie uns holen!«, jammerte sie.
»Halten Sie endlich den Mund!«, fuhr Sarah sie an. »Hysterisch zu werden hilft uns auch nicht weiter.«
»Was fällt Ihnen ein, mir den Mund zu verbieten!«, schluchzte Amelia.
»Ich werde jetzt ans Ufer schwimmen«, sagte Sarah entschlossen. »Kommen Sie mit?«
»Nein! Die Haie …«
»Wie Sie wollen.«
»Wagen Sie es ja nicht, mich allein zurückzulassen!«, herrschte Amelia sie an.
»Wollen Sie sich bis in alle Ewigkeit an diese Felsen klammern? Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als an Land zu schwimmen, wenn wir uns in Sicherheit bringen wollen.« Sarah verspürte nicht die geringste Lust, Amelia zu helfen, zumal sie Lucy auf dem Gewissen hatte, doch ihr graute davor, allein zum Ufer zu schwimmen.
Amelia ließ ihre Blicke ängstlich übers Wasser schweifen. Plötzlich stieß sie einen gellenden Schrei aus. »O Gott! Ich habe einen Hai gesehen!«, kreischte sie, die Augen vor Schreck weit aufgerissen. »Haie! Sie umkreisen uns!«
Sarah sah sich um, konnte aber keine der gefürchteten dreieckigen Rückenflossen entdecken. Sie blickte zum Strand hinüber. Zwei Robben verließen fluchtartig das Wasser. Vielleicht sagte Amelia doch die Wahrheit. Dann wäre es tatsächlich viel zu gefährlich, ans Ufer zu schwimmen. Aber hatten sie eine Wahl?
»Die Flut kommt«, bemerkte Sarah. »Wir können nicht hier bleiben, sonst werden wir von den Felsen gespült.«
Amelia schüttelte schluchzend den Kopf. Sie zitterte vor Angst und Kälte. Graue Wolken bedeckten den Himmel, kein Sonnenstrahl wärmte die Luft, und es wehte ein eisiger Wind.
Wieder glitten Sarahs Blicke aufmerksam übers Wasser. Hätte Amelia nichts von einer Haiflosse gesagt, wäre sie schon unterwegs zum Ufer.
»Vielleicht hat der Leuchtturmwärter uns gesehen und kommt uns zu Hilfe«, meinte Amelia hoffnungsvoll.
»Dann wäre er längst hier. Es ist doch schon eine ganze Weile hell.«
»Und was sollen wir tun? Darauf warten, dass die Haie uns holen?«, fauchte Amelia bissig.
Sarah gab keine Antwort, sondern blickte zum Leuchtturm hinauf. Vielleicht würde der Leuchtturmwärter ihnen tatsächlich zu Hilfe kommen. Eine andere Hoffnung schien es nicht zu geben. Doch sie war zu erschöpft, um klar denken zu können, und schloss die Augen. Vielleicht fiel ihr etwas ein, wenn sie sich ein paar Minuten ausgeruht hatte …
Gegen Mittag war das Wasser beträchtlich gestiegen. Die beiden jungen Frauen drängten sich ängstlich aneinander. Als Sarah ihren ganzen Mut zusammennahm und erneut beschloss, an Land zu schwimmen, glaubte diesmal sie, eine der gefürchteten Rückenflossen zu sehen.
»O Gott, diesmal ist es wirklich ein Hai!«, stieß sie hervor.
Amelia wurde vor Angst fast ohnmächtig. Sie schloss die Augen und klammerte sich verzweifelt an die Felsen. Wellen brandeten über sie hinweg. Das Wasser reichte den beiden Frauen jetzt bis zur Taille, aber sie konnten die Klippe nicht höher hinaufklettern.
»Wir werden sterben«, schluchzte Amelia. Wäre sie doch nur mit den anderen ertrunken! Das wäre ein gnädigerer Tod gewesen, als von einem Hai zerfleischt zu werden.
Sarah schwieg. Sie hielt nach einem großen Wrackteil Ausschau, das sie als Floß benutzen könnten. Auf keinem der Trümmer, die bisher in Reichweite vorbeigetrieben waren, hätten ein oder gar zwei Personen Platz gefunden. Aber jetzt hatte sie in etwa fünfzig Metern Entfernung ein Fass entdeckt. Sie hoffte, es würde auf sie zutreiben.
Während sie den Blick unverwandt auf das Fass geheftet hielt, vernahm sie hinter sich plötzlich ein Plätschern, das sich anders anhörte als das Geräusch der Wellen, die gegen das Riff klatschten. Sie drehte sich um. Ein Boot näherte sich. Der Mann an den Riemen hatte ihnen den Rücken zugekehrt, hielt aber geradewegs auf sie zu.
»Da kommt jemand!«, schrie Sarah aufgeregt.
Amelia hob den Kopf und strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht. Im gleichen Moment ergoss sich eine Welle über sie, sie schluckte Salzwasser und musste husten.
»Hilfe!«, rief Sarah. »Hier! Hier sind wir!«
Der Mann im Ruderboot drehte sich zu ihnen um, als er nur noch wenige Meter vom Riff entfernt war. »Ich werde Ihnen ein Seil zuwerfen, damit ich Sie zum Boot ziehen kann«, brüllte er ihnen zu.
Amelia schloss die Augen. »Hier gibt’s Haie!« Sie bibberte vor Kälte und Angst.
»Gleich haben Sie’s geschafft«, rief der Mann. »Ich kann mit dem Boot wegen der Felsen nicht näher heran.«
»Ich hab eine Haiflosse gesehen«, kreischte Amelia.
Der Mann schaute sich um. »Das war bestimmt nur ein Delphin. Davon gibt es eine Menge hier in der Gegend.«
»Haben Sie das gehört?«, sagte Sarah. »Es war nur ein Delphin! Die tun uns nichts.«
»Das war kein Delphin. Das war ein Hai«, beharrte Amelia. »Ich habe es genau gesehen!«
Der Mann hatte Mühe, das Boot in der Brandung in Position zu bringen. Als er es geschafft hatte, ließ er ein Seil über dem Kopf kreisen und warf es zum Riff hinüber. »Los, packen Sie es, und ich zieh Sie zu mir! Aber eine nach der anderen!« Sarah griff nach dem Seil, doch eine Welle spülte es wieder vom Felsen herunter, bevor sie es erwischt hatte. Der Mann holte das Seil hastig wieder ein und drehte das Boot längsseits des Riffs. »Ich kann mich hier nicht mehr lange halten«, rief er und schleuderte das Seil ein zweites Mal zu den Frauen hinüber.
Dieses Mal fing Sarah es mit einer Hand auf. Als die nächste Welle über sie hinwegbrandete, ließ sie sich von ihr mitreißen. Der Mann zog sie zum Boot und half ihr hinein. Amelia, die Sarah beobachtet hatte, fragte sich, wie sie den Mut aufbringen sollte, sich ins Meer zu stürzen. Ihre eiskalten, verkrampften Hände waren gefühllos geworden. Sie würde die Finger nicht einmal dann von den Felsen lösen können, wenn sie es wollte. Amelia war sicher, dass für sie jede Hilfe zu spät käme, und ergab sich in ihr Schicksal. Erschöpft schloss sie die Augen.
Währendessen wurde das Boot von der Brandung hin und her geworfen. Rasch griff der Mann zu den Riemen und brachte es wieder in die richtige Position. Als er Amelia mehrmals vergeblich aufgefordert hatte, auf das Seil zu achten, erkannte er, dass diese Frau zu viel Angst hatte, das Riff zu verlassen. Er knüpfte eine Schlinge und warf das Seil wie ein Lasso zu den Felsen hinüber. Wie durch ein Wunder fiel es genau über Amelias Oberkörper.
»Stecken Sie einen Arm durch die Schlinge«, rief er ihr zu, denn er fürchtete, die Schlinge könnte sich ihr um den Hals legen und sie erdrosseln. »Beeilen Sie sich!« Schon rollte eine weitere riesige Welle heran.
»O nein!« Amelia schüttelte den Kopf.
Der Mann überlegte blitzschnell. »In einer Stunde kommen die Krabben …«
Amelia schaute ihn fragend an.
»Riesenkrabben. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber die werden Sie bei lebendigem Leibe fressen.«
Da endlich löste Amelia eine Hand von den Felsen und hob schwerfällig den Arm, um ihn durch die Schlinge zu schieben. Im gleichen Moment krachte eine Welle auf sie hinunter. Sie verlor den Halt und stürzte ins Wasser. Das Seil straffte sich, und schon wurde sie durch schäumende Gischt gezogen, halb unter, halb über Wasser. Da ihr das Seil um den Hals lag und unter dem einen Arm hindurchging, konnte sie nicht schwimmen. Sie hätte ohnehin nicht die Kraft dazu gehabt. Schlaff hing sie in der Schlinge. Ihre Lungen füllten sich mit Salzwasser.
Als der Mann sie endlich ins Boot zog, rührte sie sich nicht mehr. »Großer Gott«, murmelte er und klopfte ihr ein paarmal auf den Rücken. »Komm schon, Mädchen!«, rief er und schüttelte sie. Plötzlich kam wieder Leben in Amelia. Sie hustete und spie Salzwasser aus.
»Kümmern Sie sich um sie«, sagte er zu Sarah und packte die Riemen.
Sarah warf ihrem Retter einen dankbaren Blick zu. Wie sie bald erfahren sollte, war sein Name Gabriel Donnelly; er war der Leuchtturmwärter von Cape du Couedic. Er hatte die beiden Frauen schon vor einiger Zeit durch sein Fernrohr gesehen, hatte aber die Flut abwarten müssen, bevor er ihnen zu Hilfe kommen konnte. Er hatte Glück gehabt: Der Wind hatte sich gelegt. Doch nun frischte er wieder auf, und der Himmel war erneut voller dunkler Wolken. Gabriel musste sich beeilen. Da war noch der Steilhang, den sie hinaufklettern mussten. Und falls der Sturm vorher losbrach, war vielleicht alles vergebens gewesen.
2
Cape du Couedic
Wie in der Nacht zuvor setzten plötzliche heftige Böen ein. Gabriel fluchte leise vor sich hin, als er sich mit aller Kraft in die Riemen legte, um zu verhindern, dass das Boot gegen die Felsen am Fuß des Kliffs geschmettert wurde. Der Wind fegte die Schaumkronen von den blaugrünen Wellenkämmen und hüllte die drei Menschen im Boot in salzigen Sprühnebel ein.
Sarah und Amelia kauerten mit gesenkten Köpfen auf den Bootsplanken. Beide waren durchgefroren und durchnässt, zerschunden und entkräftet. Aber sie waren am Leben, und das grenzte an ein Wunder. Ihr Retter war ein junger Mann um die dreißig. Von seinem Südwester tropfte Meerwasser auf die breiten Schultern. Sein Gesicht war braun gebrannt; anscheinend hielt er sich viel an der frischen Luft auf. Die dunklen Bartstoppeln am Kinn deuteten darauf hin, dass er keinen großen Wert auf seine äußere Erscheinung legte. Er war ziemlich schweigsam, doch seinen stechenden Augen, die fast die gleiche Farbe hatten wie die aufgewühlte See, entging nichts. Angesichts seiner verschlossenen Miene fragten sich die beiden jungen Frauen, ob er zornig oder nur eisern entschlossen war, sie in Sicherheit zu bringen. Der Gedanke, dass er genauso erschöpft war wie sie selbst, weil er die ganze Nacht auf den Beinen gewesen war und durch sein Fernrohr hilflos den Untergang der Gazelle hatte mit ansehen müssen, kam ihnen gar nicht. Vielleicht, so überlegte Sarah, war es seine Pflicht, Menschen in Seenot zu helfen. Wie auch immer, sie und Amelia waren ihm zutiefst dankbar. Er hatte ihnen schließlich das Leben gerettet.
Gabriel gelang es mit letzter Kraft, das Boot um die Landzunge zu manövrieren, auf welcher der Leuchtturm stand, und in eine kleine Bucht zu fahren. In dieser Bucht – sie hieß Weirs Cove – gab es eine Anlegestelle am Fuß des gut neunzig Meter hohen Kliffs. Nachdem Gabriel das Boot vertäut hatte, half er den beiden jungen Frauen ans Ufer. Sarah und Amelia legten den Kopf in den Nacken und blickten schaudernd die gewaltige Steilwand hinauf.
»Da kö-können wir un-unmöglich hoch«, stammelte Amelia zähneklappernd. Zwar waren Stufen in den Fels gehauen, aber sie führten fast senkrecht nach oben und sahen gefährlich schlüpfrig aus. Amelia war sicher, selbst ein Bergsteiger würde es sich zweimal überlegen, diese Wand zu erklimmen.
»Alle drei Monate werden zwei Tonnen Vorräte hinauftransportiert«, sagte Gabriel sachlich. »Wenn das zu machen ist, werden Sie es auch schaffen.«
Amelia war beleidigt, dass er sie praktisch mit einem Sack Getreide verglich. »Wir sind aber keine Vorräte, die man bündeln, zusammenschnüren und hochwinden kann. Und Bergziegen sind wir auch keine.«
Die Augen des Leuchtturmwärters wurden schmal, und Amelia hatte den Eindruck, am liebsten hätte er sie ins Meer zurückgeworfen, wie einen zu kleinen Fisch. Sie verschränkte die Arme über der Brust und starrte ihn trotzig an. Es war ihr egal, ob er sie unfreundlich fand oder nicht. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, wollte sie mit Glacéhandschuhen angefasst werden. Sie fand, das stand ihr zu.
Sarah ließ den Kopf hängen. Auch wenn Amelia sie mit ihrem Gejammer nervte, musste sie ihr diesmal Recht geben: Sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie diese Steilwand erklimmen sollten.
Gabriel wandte sich ihr zu. »Ich werde jetzt hinaufsteigen. Wenn ich oben bin, lasse ich ein Seil mit einem Geschirr daran herunter. Befestigen Sie es an ihr.« Er deutete mit dem Kinn auf Amelia. »Ich werde sie hochziehen. Sobald sie oben ist, lasse ich das Seil für Sie herunter.«
Sarah starrte ihn nur ausdruckslos an.
»Haben Sie verstanden, was ich gerade gesagt habe?«, fragte er.
Sie nickte langsam. Ihr Verstand war so betäubt wie ihr Körper.
»Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben!« Amelia stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
»Sie können die Stufen hinaufklettern, oder Sie können hier unten bleiben. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Also, wofür entscheiden Sie sich?«
Amelia brach in Tränen aus. »Mir ist kalt, ich wäre Ihretwegen fast ertrunken, und mir tun sämtliche Knochen weh. Hören Sie auf, in diesem unverschämten Tonfall mit mir zu reden!«
»Haben Sie schon vergessen, dass ich Ihnen gerade das Leben gerettet habe?«
»Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich wie einen … einen Sack Kartoffeln zu behandeln!«
»Hören Sie, Lady, ich war die ganze Nacht auf, weil ich mich um das Leuchtfeuer kümmern musste, und ich habe gesehen, wie Ihr Schiff gesunken ist. Ich habe weder die Zeit noch die Kraft, mit Ihnen zu diskutieren. Tun Sie, was ich Ihnen sage, und halten Sie den Mund.« Er war ziemlich laut geworden, und man hörte die Anspannung in seiner Stimme.
Amelia brachte vor Empörung keinen Ton mehr hervor.
Ohne ein weiteres Wort wandte der Leuchtturmwärter sich ab und machte sich an den Aufstieg über die steilen Felsstufen. Die beiden Frauen hielten den Atem an, während sie ihm nachschauten. Zweimal rutschte er auf den glitschigen Stufen aus, konnte sich zum Glück aber gerade noch festhalten.
Kurze Zeit später war er oben angelangt und verschwand aus dem Blickfeld. Sarah und Amelia standen im schneidend kalten Wind und warteten. Minuten vergingen. Dann wurde ein an einem Seil befestigtes Geschirr heruntergelassen. Es schwang im Wind hin und her, sodass es eine Weile dauerte, bis Sarah es mit ihren eiskalten Händen ergreifen konnte. Sie zog an den Riemen und versuchte herauszufinden, wie man das Geschirr anlegte. Schließlich glaubte sie es zu wissen. Sie legte Amelia das Geschirr so um, dass die Gurte über ihre Schultern und um ihre Taille führten. Ein breiter Lederstreifen diente als Sitz.
»Das kann ich nicht!« Amelia blickte ängstlich die Steilwand hinauf. »Warum gehen Sie nicht zuerst?«
Sarah funkelte sie zornig an. »Weil er gesagt hat, dass Sie als Erste hinaufsollen. Hätte er mich ausgesucht, würde ich keine Sekunde zögern, und es wäre mir egal, ob er Sie hier unten zurückließe oder nicht. Aber er scheint ein kluger Mann zu sein. Er weiß, dass Sie keine Ahnung hätten, wie man das Geschirr anlegt, sodass Sie allein hier unten blieben, würde er mich als Erste raufziehen.«
Amelia setzte zu einer gereizten Antwort an, doch bevor sie etwas sagen konnte, rief der Leuchtturmwärter: »Fertig?«
»Fertig!«, rief Sarah zu ihm hinauf.
Mit einem Ruck setzte das Geschirr sich in Bewegung, und Amelia schrie erschrocken auf. Krampfhaft hielt sie sich am Seil fest, während sie langsam an der Felswand entlang in die Höhe glitt. Als sie ein Stück vom Boden entfernt war, wurde sie vom Wind erfasst und hin- und hergedreht. Sie musste das Seil loslassen, damit sie sich mit beiden Händen am Kliff abstützen konnte.
Je höher sie kam, desto heftiger warf der Wind sie hin und her. Zweimal schleuderte er sie mit solcher Wucht gegen die Felswand, dass sie mit den Knien dagegen prallte und vor Schmerz aufschrie. Sarah wollte ihr zurufen, sie solle Arme und Beine ausstrecken, um die Stöße abzufedern, anstatt sich an den Gurten festzuklammern. Doch Amelia war schon zu weit weg; sie hätte Sarah im Heulen des Windes nicht gehört.
Als sie fast oben war, wurde sie von einer Bö erfasst, von der Steilwand weggedrückt, herumgewirbelt und dann rückwärts gegen den Felsen geschmettert. Hart schlug sie mit dem Hinterkopf auf. Sarah sah, wie sie in sich zusammensank. Offenbar hatte sie das Bewusstsein verloren. Zum Glück war sie durch die Gurte gesichert, sodass sie nicht herunterfallen konnte. Einen Augenblick später war sie oben. Der Leuchtturmwärter löste die Riemen und hob Amelia aus dem Geschirr. Kurz darauf ließ er es abermals in die Tiefe hinunter.
Als Sarah die Gurte befestigt hatte, winkte sie zum Zeichen, dass Gabriel sie hochziehen könne. Auch sie war dem böigen Wind ausgesetzt, versuchte jedoch, jeden Aufprall an der Felswand mit den Füßen abzufangen. Es gelang ihr sehr gut, und sie war stolz, als sie ohne Zwischenfälle oben ankam. Der Leuchtturmwärter half ihr aus dem Gurtwerk. Amelia lag regungslos auf dem Boden.
»Was ist mit ihr?«, fragte Sarah, als sie aus dem Geschirr schlüpfte.
»Sie ist bewusstlos und blutet am Hinterkopf. Wahrscheinlich hat sie sich den Kopf am Felsen angeschlagen.«
»Ja, ich hab’s gesehen.«
Gabriel hob Amelia hoch und trug sie die hundert Meter zu seinem Wohnhaus neben dem Leuchtturm. Sarah holte tief Luft und folgte ihm mit letzter Kraft. Von hier oben hatte man einen atemberaubenden Blick aufs Meer, doch von der See hatte sie vorerst genug. Sie betrachtete das kleine, gekalkte Haus mit dem Strohdach. Rechts und links der schwarzen Tür war je ein Fenster in die schlichte Fassade eingelassen. Gabriel verstaute das Geschirr in dem in der Nähe stehenden größeren Haus, das als Vorrats- und Gerätelager diente und Platz für eine weitere Leuchtturmwärterfamilie bot.
Ein heftiger Windstoß riss Sarah fast von den Füßen. Die Kälte ging ihr durch und durch. Sie warf einen Blick zum Himmel. Es sah aus, als würde es bald wieder zu regnen anfangen.
Drinnen im Haus bettete der Leuchtturmwärter Amelia auf ein Sofa und zog seine nasse Jacke aus. Sarah bemerkte eine Tür, die vom Wohnraum in ein anderes Zimmer führte – das Schlafzimmer des Leuchtturmwärters, wie sie vermutete.
»Gibt es noch andere Überlebende?«, fragte er.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Sarah kopfschüttelnd. Im Rettungsboot hatten sich etwa siebzehn Menschen befunden. Was mochte aus ihnen geworden sein? »Ich weiß nur, dass der Matrose, der mit uns im Boot war, tot ist. Ich habe seine Leiche im Wasser treiben sehen.«
»Ich fahre noch einmal hinaus, bevor es dunkel wird, und halte nach Überlebenden Ausschau«, sagte er, trat an den Kamin und legte Holz nach. Dann reichte er Sarah eine Decke. »Vielleicht hat es wider Erwarten doch noch einer bis ans Ufer geschafft.« Er gab ihr eine zweite Decke für Amelia. »Ziehen Sie ihr die nassen Sachen aus, sie werden am Feuer schnell trocknen. Und dann decken Sie sie gut zu. Ich gehe noch mal raus. Ein paar Habseligkeiten sind angeschwemmt worden. Ich hole sie herauf. Und die Lebensmittel auch, falls sie noch verwertbar sind.«
»Ist das nicht … gefährlich?«, fragte Sarah zögernd.
»Ich weiß schon, was Sie sagen wollen«, entgegnete Gabriel. »Ob ich es nicht geschmacklos finde, Dinge von Toten an mich zu nehmen, nicht wahr?«
Sarah nickte bloß. Sie kam nicht umhin, seinen Scharfsinn zu bewundern.
»Es wäre Verschwendung, die Nahrungsmittel verderben zu lassen. Es könnte sein, dass ein Versorgungsschiff wegen eines Sturms nicht anlegen kann, dann rettet diese kleine Extraration uns möglicherweise das Leben. Und was die persönlichen Habseligkeiten anbelangt – was nutzen sie dem Eigentümer, wenn er tot ist?«
Damit hatte er nicht Unrecht, wie Sarah zugeben musste.
»Vielleicht haben Sie ja Glück«, sagte er.
»Wie meinen Sie das?«
»Eins von den Gepäckstücken, die angeschwemmt wurden, könnte Ihnen gehören.«
Sarah dachte an den kleinen Koffer, den sie bei sich gehabt hatte. Die Chance, ihn wiederzufinden, dürfte gering sein.
Der Leuchtturmwärter sah sich Amelias Kopfwunde an und holte Verbandszeug. »Reinigen Sie die Wunde, und legen Sie einen Verband auf. Hoffentlich bleibt nichts zurück.«
»Was könnte denn zurückbleiben?«, fragte Sarah, doch er gab keine Antwort, sondern warf sich seine Jacke über und eilte zur Tür. »Ich habe Tee gemacht. Nehmen Sie sich, wenn Sie möchten«, sagte er. Dann war er fort.
Rasch zog Sarah sich selbst und Amelia die nasse Kleidung aus und hängte sie zum Trocknen in die Nähe des Kamins. Nachdem sie Amelias Wunde versorgt hatte, schenkte sie sich Tee ein und setzte sich nahe ans wärmende Feuer. Wenn sie doch nur ein paar andere Kleidungsstücke für sich hätte, und nicht nur die Decke! Sie dachte an ihren Koffer. Es wäre ein Wunder, wenn er wieder auftauchte.
Als sie den Tee getrunken hatte, überkam sie tiefe Müdigkeit. Sie konnte kaum noch die Augen offen halten. Irgendwann musste sie eingenickt sein, denn nach einer Weile schreckte sie plötzlich hoch, weil Amelia laut stöhnte. Im ersten Moment glaubte Sarah, sie würden immer noch auf dem Felsenriff ausharren. Doch statt der rauschenden Brandung hörte sie nur den Wind, der ums Haus heulte. Sie dachte an den Leuchtturmwärter draußen auf See. Was, wenn er nicht zurückkehrte?
Amelia ächzte abermals. »Wo … bin ich?«, hauchte sie, als sie die Augen aufschlug.
»Wir sind im Haus des Leuchtturmwärters.«
Amelia betastete ihren Kopf und zuckte zusammen. »Mein Kopf tut so weh.«
»Sie haben ihn sich angeschlagen, als der Leuchtturmwärter Sie die Steilwand hinaufgezogen hat.«
»Steilwand?« Amelia machte ein verwirrtes Gesicht. »Was für eine Steilwand?« Sie betrachtete Sarah mit verwundertem Blick. »Wer sind Sie?«, flüsterte sie.
»Ich war an Bord der Gazelle«, antwortete Sarah, die sich über Amelias seltsam ausdruckslose Miene wunderte.
»Gazelle?«
»Wissen Sie nicht mehr? Das Schiffsunglück?«
»Schiffsunglück …?« Sie durchforschte ihr Gedächtnis nach irgendeiner Erinnerung, aber da war nichts. Absolut nichts. »Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt auf einem Schiff gewesen zu sein. Wohin wollte ich denn?«
Sarah musterte sie stirnrunzelnd. »Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben?«
»Natürlich«, erwiderte Amelia sofort, musste dann aber überlegen. »Heute ist … äh …« Sie machte den Mund wieder zu und schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, welchen Monat wir haben oder welches Jahr.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Ruhen Sie sich erst einmal aus«, meinte Sarah.
Amelia schloss erschöpft die Augen. Die Schmerzen in ihrem Kopf waren kaum zu ertragen. Vielleicht fiel ihr das Denken deshalb so schwer. Bestimmt würden ihre Erinnerungen früher oder später wiederkehren.
Sie nickte ein und schlief immer noch, als der Leuchtturmwärter zurückkam. Fast zwei Stunden waren vergangen, wie Sarah mit einem Blick auf die Uhr feststellte. Das Wetter hatte sich inzwischen ein wenig beruhigt. Von den drei Gepäckstücken, die am Strand angespült worden waren und die Gabriel mit heraufgeschleppt hatte, sah eines wie ihr kleiner Koffer aus, stellte Sarah freudig fest.
»Sie haben ihn gefunden! Ich kann es kaum glauben.« Sie sah den Leuchtturmwärter dankbar an.
»Ich sagte doch, vielleicht haben Sie Glück.«
»Gibt es … gibt es sonst keine Überlebenden?«
»Ich habe keine gesehen.« Gabriel hatte auch keine Leichen erblickt, doch in der Bucht waren Haie. Das aber verschwieg er ihr. Stattdessen sagte er: »Und die Toten sind inzwischen von der Strömung die Küste hinuntergetrieben worden.«
Sarah besaß nicht viel: ein paar Kleider, Unterwäsche, ein Paar Schuhe zum Wechseln und einen Mantel. Doch jetzt kamen ihr diese Habseligkeiten wie ein kostbarer Schatz vor. Sie würde sich etwas anderes anziehen können. Das Kleid, das sie beim Untergang der Gazelle getragen hatte, sah arg mitgenommen aus.
Sie nahm ihren Koffer an sich. Der Leuchtturmwärter stellte die übrigen Gepäckstücke, darunter eine Geige in einem Geigenkasten, in eine Ecke und ging dann noch einmal hinaus. Sarah beobachtete durch das winzige Fenster, wie er zwei Fässer in den Vorratsschuppen rollte. Sie sahen wie Weinfässer aus. Wahrscheinlich hatte er sie mit Hilfe eines Frachtnetzes an der Winde nach oben geschafft. Da er lange fortblieb, nahm Sarah an, dass er zum Leuchtturm gegangen war.
Sie wandte sich dem Koffer zu. Das Schloss kam ihr irgendwie anders vor, und der Schlüssel war am Griff festgebunden. Ihren Schlüssel aber hatte sie in den Saum ihres Unterrocks eingenäht. Sträflinge sind misstrauisch, entweder von Natur aus oder aus Erfahrung. Sie betastete den Saum ihres nassen Unterrocks. Der Schlüssel war noch da. Sarah betrachtete den Koffer genauer. Jetzt erst merkte sie, dass er zwar genauso groß war wie ihrer und eine ähnliche Farbe hatte, aber von besserer Qualität war.
Was wohl darin sein mochte? Die Worte des Leuchtturmwärters fielen ihr ein: Den Toten nutzt ihre Habe nichts mehr. So war es ja auch. Sarah musste das Gefühl überwinden, etwas Unrechtes zu tun, wenn sie den Koffer öffnete. Zumal es den Anschein hatte, dass sie und Amelia die einzigen Überlebenden waren. Ein Gedanke durchzuckte sie. Wenn der Koffer nun einem Mann gehört hatte? Dann wäre sein Inhalt nutzlos für sie.
Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und hob den Deckel an. Sie hatte Glück: Der Koffer gehörte einer Frau. Schals, Handschuhe, Unterwäsche und ein Paar Schuhe befanden sich darin. Alles war von bester Qualität. Zwischen den Kleidungsstücken lag ein Tagebuch. Sarah erschrak, als sie den Namen darauf las: Amelia Divine.
Sie warf Amelia, die immer noch schlief, einen verstohlenen Blick zu, klappte das Tagebuch dann auf und blätterte darin. Neben Einträgen enthielt es Gedichte. Das Papier war zwar feucht, aber die Tinte nur stellenweise verlaufen; sonst war es unversehrt.
Sarah seufzte vor Enttäuschung, setzte sich wieder ans Feuer und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Sie verglich ihr Leben mit dem Amelias. Zwei Jahre Knochenarbeit auf einer Farm, wo sie sich obendrein um mehrere Kinder kümmern musste, lagen vor ihr; dann hatte sie ihre Strafe verbüßt. Amelia hingegen konnte sich auf ein Leben voller Annehmlichkeiten freuen.
Während das Feuer sie wärmte, überließ Sarah sich ihren Träumen. Sie überlegte, wie es wäre, in die Haut von Amelia Divine zu schlüpfen. Lucy hatte ihr erzählt, dass die Ashbys, Amelias Vormünder, ihr Mündel viele Jahre nicht gesehen hatten. Sarah stellte sich vor, wie sie an Amelias Stelle willkommen geheißen, umsorgt und verwöhnt wurde. Sie malte sich aus, wie die Ashbys sie bemuttern und alles tun würden, damit es ihr an nichts fehlte …
Es spielte keine Rolle, dass Amelia nur an sich gedacht und Lucys Platz im Rettungsboot für sich beansprucht hatte. Es spielte keine Rolle, dass Amelia die Schuld an Lucys Tod trug. Falls ihr Erinnerungsvermögen nicht zurückkehrte, würde sie sich niemals für ihr Tun schämen müssen. Sie würde nie einen kummervollen Gedanken an Lucy verschwenden. Obwohl Sarah das Mädchen kaum gekannt hatte, verspürte sie ihretwegen maßlose Wut auf Amelia. Lucy stand in ihren Augen stellvertretend für alle Menschen, die von den Reichen mit Füßen getreten wurden.
Sarah war als Viertes von zehn Kindern einer Arbeiterfamilie aus Bristol geboren worden. Ihre Großeltern mütterlicherseits waren wohlhabende Leute gewesen, denen es gar nicht gefallen hatte, dass ihre einzige Tochter den Fabrikarbeiter Reginald Jones heiratete. Doch Margaret hatte ein Kind von ihm erwartet, und so konnten sie nichts dagegen unternehmen. Margaret, eine gebildete junge Frau, war Lehrerin in Bristol. Dort hatte sie Reginald kennen und lieben gelernt. Margaret brachte auch ihren Kindern das Lesen und eine gepflegte Ausdrucksweise bei. Da sie nicht mehr unterrichten konnte, hatte sie damit angefangen, für die begüterten Damen in den besseren Stadtvierteln zu nähen.
Dann verlor Reginald seinen Arbeitsplatz in der Fabrik. Das Geld wurde knapp, und Margaret brachte die damals vierzehnjährige Sarah bei einer der reichen Familien unter, für die sie nähte, bei den Murdochs, für die Sarah zuerst als Küchenhilfe, später als Hausmädchen arbeitete.
Die Murdochs hatten zwei Töchter, Sherry und Louise. Beide waren Amelia sehr ähnlich: verwöhnte Gören mit schlechten Manieren, die Sarah nicht leiden konnten und ständig hänselten. Sie taten alles, um ihr das Leben schwer zu machen. Doch Sarah hielt tapfer durch – bis die Murdoch-Schwestern sie des Diebstahls bezichtigten. Sarah beteuerte ihre Unschuld, doch die Mädchen hatten ein Armband von Louise in Sarahs Manteltasche versteckt, wo ihr Vater es schließlich fand.
Sarah kam vor Gericht und wurde zu sieben Jahren Zwangsarbeit in Van-Diemens-Land verurteilt. Weinend nahm sie Abschied von ihrer Mutter. Der Schmerz, den man ihr zugefügt hatte, brach ihr schier das Herz. Nur die Hoffnung, ihre Eltern eines Tages wiederzusehen, hatte ihr die Kraft gegeben, die Jahre in der Ferne zu überstehen. Auch jetzt wieder kamen Sarah die Tränen, als sie an ihre Mutter und ihren Vater dachte.
Plötzlich hörte sie Stimmen. Neugierig spähte sie zum Fenster hinaus. Draußen, nur wenige Schritte entfernt, stand der Leuchtturmwärter und unterhielt sich mit einem anderen Mann. Sarah zog die Decke enger um sich, ging zur Tür, öffnete sie vorsichtig einen Spalt weit und lauschte.
»Heute Nacht ist ein Schiff am Riff zerschellt«, sagte der Leuchtturmwärter soeben. »Die Gazelle.«
»Die Gazelle? Verdammt, meine Farmhelferin sollte mit diesem Schiff eintreffen!«
Sarah erschrak. Sprach der Mann etwa von ihr?
»Ich habe zwei Überlebende geborgen. Die anderen haben wahrscheinlich die Haie geholt.«
Sarah schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund. Also gab es hier doch Haie! Sie schauderte vor Entsetzen bei dem Gedanken, was ihr hätte zustoßen können.
»Ich konnte meinen Posten erst verlassen, als es hell wurde«, fuhr der Leuchtturmwärter fort. »Es wäre zu gefährlich gewesen, das Leuchtfeuer unbeaufsichtigt zu lassen.«
»Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich hätte dich ablösen können.«
»Du hast schon genug um die Ohren. Ich musste sowieso die Flut abwarten, bis ich den beiden Frauen zu Hilfe kommen konnte. Ein Glück, dass sie so lange durchgehalten haben.«
»Ja, und wie ich mein Glück kenne, ist meine Hilfskraft ertrunken.«
Seine gefühllose Art erfüllte Sarah mit Zorn.
»Du hast eine Frau erwartet, nicht wahr?«
»Ja. Sie sollte sich um die Kinder kümmern.«
Sarah schlug das Herz bis zum Hals.
»Vielleicht ist es ja eine der beiden Frauen, die ich gerettet habe.«
Der Mann, bei dem es sich offensichtlich um Evan Finnlay handelte, drehte den Kopf und blickte zum Haus hinüber. Sarah schob blitzschnell die Tür zu. Als Finnlay sich abwandte, öffnete sie die Tür wieder ein klein wenig. »Sieht eine von ihnen aus, als könnte sie einen Pflug ziehen?«
Der Leuchtturmwärter lachte. »Dafür hast du ein Pferd, Evan.«
»Clyde würde es gut tun, wenn er sich mal ein bisschen ausruhen könnte.«
Der Leuchtturmwärter schüttelte den Kopf. »Die beiden Frauen sehen aus, als würden sie bei einem heftigen Windstoß wegfliegen.«
Der Farmer schnaubte. »Ich habe um ein robustes, kräftiges Weibsbild gebeten. Tja, wenn sie mir stattdessen eine schwache und zerbrechliche Frau schicken, hat sie eben Pech gehabt. Sie wird genauso hart arbeiten müssen.«