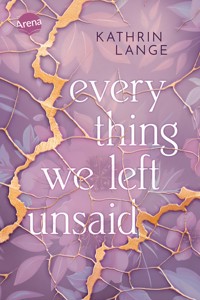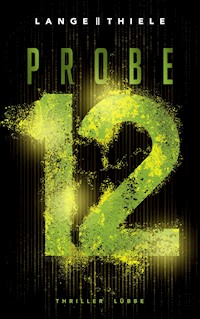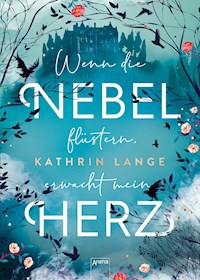8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Historische Fantasy vom Feinsten Nur ein dünner Schleier trennt das Böse vom Guten, trennt Florenturna von Florenz. Noch glaubt Girolamo, dass er mit seinem Sieg über Mercurius, den Herrscher von Florenturna, das Böse besiegt und Florenz vor der Vernichtung gerettet hat. Doch Mercurius hat einen würdigen Nachfolger gefunden, der Florenturna auferstehen lässt und bereits seine mächtigen Arme nach Florenz ausstreckt. 2. Band der Fantasy-Trilogie ›Florenturna‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Kathrin Lange
Florenturna
Die Kinder des Zwielichts
Fischer e-books
Für meine drei Männer:
Stefan, Jan-Iven und Tim
Hervor aus Florenzias Mauern bricht
So holder Schein, dass da, wo er entglommen,
Man Dinge sieht, wie man sie nie vernommen,
Weil hohes, neues Wesen daraus spricht.
(Aus: Dante Alighieri, Il fioretto. Das Blümchen)
I.Der Mori
Irgendwo in Florenz, Februar 1498 n.Chr.
Der dunkelhaarige Mann schlief.
In gleichmäßigem Rhythmus hob und senkte sich seine Brust, und entspannt lagen seine großen Hände auf der Bettdecke. Nur ab und an seufzte er leise, als habe er einen schlimmen Traum.
Das winzige Wesen, das unter seinem Bett hervorkrabbelte, bemerkte er nicht.
Es war kaum länger als eine Handspanne, mit behaartem Körper, einem langen Schwanz, riesigen, goldenen Augen und einem flachen Gesicht. Lautlos huschte es über die Dielen der Schlafkammer, erklomm mit einem geschickten Satz das Fußende des Bettes und blieb auf der Bettdecke hocken.
Es war eingehüllt in sanftes, blaues Licht, das es umgab wie ein feiner Schleier. Einer winzigen Schleppe gleich, wehte das Blau hinter ihm her, wenn es sich bewegte.
Der Mann in dem Bett schien die Gegenwart des Wesens in seinem Traum zu spüren, denn er drehte sich nun unruhig auf die andere Seite. Dabei verrutschte die Bettdecke, die er über sich gezogen hatte, und entblößte seine Brust. Dort, von dichtem Haar fast verborgen, lag ein silberner Anhänger an einer ebenfalls silbernen Kette um seinen Hals.
Als das Wesen diesen Anhänger erblickte, machte es vor Freude einen Satz. Die blaue Aura um seinen Körper verlor für einen kurzen Augenblick ihr Schimmern und leuchtete dann in einem hellen Blau auf.
Die Hände des Wesens, die nur mit jeweils drei Fingern versehen waren, öffneten und schlossen sich in nervöser Anspannung. Es trippelte ein Stück vor, wich dann wieder zurück, als sei es unschlüssig, was es tun sollte. Der schlafende Mann warf seinen Kopf von einer Seite auf die andere.
Das Wesen duckte sich zum Sprung und fauchte, dabei wurden seine goldenen Augen pechschwarz, und zwei Reihen nadelspitzer Reißzähne zeigten sich in seinem kleinen Maul.
Dann wich das Schwarz in seinen Augen wieder dem freundlichen, strahlenden Gold. Auf seinen dreizehigen Füßchen huschte das Wesen näher an den Schlafenden und seine silberne Kette heran. Der Anhänger hatte die Form von drei Mondsicheln, deren Rücken sich berührten. Als das Wesen sich den Monden näherte, begannen sie, blau zu glühen, und der Mann wimmerte im Schlaf.
Das Wesen erklomm die Bettdecke. Im nächsten Moment hatte es die Kette erreicht.
Der schlafende Mann öffnete den Mund und murmelte etwas Unverständliches. Schweiß stand jetzt auf seiner Stirn.
Begierig griff das Wesen nach der Kette und hob den Anhänger an.
Der dreifache Silbermond flammte grell auf, als die blaue Aura des Wesens ihn berührte und einhüllte.
Das Wesen beugte sich vor. Wieder sprossen ihm die spitzen Zähne aus dem Kiefer, und es wollte sich gerade über die Kette beugen, um sie entzweizunagen, als ein leises Grollen aufklang. Ein Flimmern entstand überall dort, wo das Wesen entlanggelaufen war, und Teile von Möbeln erschienen in diesem Flimmern wie Bilder in einer Spiegelung über einem sonnenbeschienenen Feld im Sommer.
Der gleichmäßige Atem des Schlafenden geriet ins Stocken. Das Wesen erstarrte.
Der Mann schlug die Augen auf. Hastig griff er nach dem Anhänger und umschloss ihn mit den Fingern. Das kleine Wesen hüpfte zur Seite, um der großen Hand zu entgehen, und noch bevor der Mann den Kopf wenden oder sich gar aufsetzen konnte, hopste es von der Bettkante und flitzte mit atemberaubender Geschwindigkeit unter das Bett.
Der Mann ließ den Anhänger los. Mit einem verwirrten Brummen setzte er sich auf, ließ seine Blicke durch den Raum schweifen.
Doch er war bereits wieder allein. Das goldäugige Wesen war längst fort und auch die flimmernde Spiegelung aus einer anderen Welt.
II. Es beginnt von neuem
Was bleibt uns Menschen,
als unter der Macht des Schicksals zu erschauern,
wenn wir ahnen,
dass unsere Wege in Finsternis führen?
(Aus: Dante Alighieri, Il fioretto. Das Blümchen)
Ein harter Stoß traf Girolamo mitten zwischen die Schulterblätter und ließ ihn einige Schritte vorwärtstaumeln. Mit Mühe nur blieb er auf den Beinen, und dann fuhr er herum, um den Rempler wütend zurechtzuweisen.
Doch beim Anblick der weißen Maske mit der langen, schnabelförmigen Hakennase, die dicht vor seinem Gesicht schwebte, erstarrte er zur Salzsäule. Er spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Schlagartig waren seine Knie weich wie Grütze, und ein tonloses Ächzen löste sich aus seiner Kehle.
»Bist ein bisschen schreckhaft, was?«, hörte er eine hohle, aber deutlich spöttische Stimme hinter der Maske hervordringen.
Girolamos Herz, das für einen schrecklichen Augenblick lang gedroht hatte stehenzubleiben, schlug weiter, und als die weiße Maske nun abgenommen wurde, kam dahinter das Gesicht eines jungen Mannes zum Vorschein, der ihn leicht besorgt und gleichzeitig belustigt musterte. Lange, sorgfältig in Locken gelegte Haare umrahmten vornehm blasse Wangen, die braunen Augen waren von einem dichten Kranz hellbrauner Wimpern umgeben.
Girolamo schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er. »Ich habe Euch nur kurz für jemanden anderen gehalten.«
Der junge Mann machte eine galante Verbeugung. Dann lachte er hell und voller Lust auf, stülpte sich die Maske wieder über und lief hinter einem Pulk anderer Verkleideter her, ohne Girolamo noch eines weiteren Blickes zu würdigen.
Girolamo starrte den Männern nach und ließ langsam den angehaltenen Atem durch die geschlossenen Lippen entweichen.
Er mochte Florenz um diese Jahreszeit nicht besonders, und das lag am Karneval und diesen elenden und unheimlichen Masken. Zu lebendig waren in ihm noch die Erinnerungen an die Ereignisse vor einem Jahr.
Um sich von seinen düsteren Erinnerungen abzulenken, verließ Girolamo die breiten Straßen, auf denen die Menschen feierten, und schlenderte eine Weile durch die engeren Gassen. Hier war es zwar nicht viel stiller, weil auch hier gefeiert wurde, aber da hier der ärmere Teil der Bevölkerung lebte, gab es weitaus weniger Masken.
Schließlich kam er in einen Stadtteil, der um diese Jahreszeit wie ausgestorben wirkte. Der Arno floss hier trübe durch sein enges Flussbett, und die Luft war erfüllt von dem Gestank, der von dem durch die winterlichen Regenfälle angeschwollenen Fluten in die Luft stieg. Hier lebten nur die Ärmsten der Armen, und viele von ihnen verbargen sich in den düsteren Ecken und Winkeln vor den Augen zufällig Vorbeikommender.
In einer winkeligen Gasse blieb Girolamo stehen. Etwas hatte ihn aufmerken lassen, und ihm war nicht sofort klar, was es gewesen sein mochte. Lauschend legte er den Kopf schief. Die Wände ragten rechts und links von ihm in die Höhe, gemauert aus billigen Ziegeln und bedeckt vom Staub vieler Jahre. In einer flachen Rinne in der Mitte der Gasse floss schmutziges Wasser, das den lehmigen Boden in eine schmierige Masse verwandelt hatte.
Plötzlich richteten sich die Haare in Girolamos Genick auf. Seine Augen weiteten sich, als ein Gefühl von Bedrohung nach ihm griff. Er wich einen Schritt zurück, stieß mit dem Rücken gegen eine der Mauern und drückte sich dagegen. Die Angst, die ihm auf einmal die Kehle zuschnürte, verstärkte sich noch einmal, und dann hörte er ihn.
Den Schrei.
Langgezogen und wehmütig hallte er über die Dächer von Florenz hinweg. Girolamo schlug beide Hände vor den Mund. Seine Bewegungen waren langsam, mühselig, als befände er sich unter Wasser.
Erneut ertönte der Schrei. Girolamo wimmerte auf.
Er musste all seine Willenskraft aufwenden, um den Kopf in den Nacken zu legen und nach oben zu sehen. Die Dächer ließen nur einen schmalen Ausschnitt des Himmels frei, und Girolamo war sich nicht ganz sicher, ob er nicht träumte.
Ein riesiger, geflügelter Schatten schoss durch den schmalen Streifen aus blassem Blau, so kurz nur zu sehen, dass Girolamo verwirrt blinzelte. Waren es wirklich gefiederte Schwingen gewesen, die er gesehen hatte?
Ein Jäger?
Unmöglich!
So schnell er konnte, rannte Girolamo die Gasse entlang, flitzte um zwei oder drei Ecken, bis er einen größeren Platz erreichte. Er kam gerade rechtzeitig, um den geflügelten Schatten hinter dem Dach eines hohen Patrizierhauses verschwinden zu sehen.
Schweratmend blieb er stehen.
Seine Knie zitterten. Es war tatsächlich ein Jäger gewesen, den er gesehen hatte! Die blauen Flügel und die langen, schuppenbewehrten Beine ließen keinerlei Zweifel zu. Doch noch etwas anderes war da gewesen, etwas, das Girolamo vorwärtstrieb, hinein in die nächste Gasse, in jene Richtung, in die der Jäger verschwunden war.
In den Klauen hatte das Monster ein Opfer gehalten!
Ein junges Mädchen, das sich verzweifelt gegen den festen Griff der scharfen Krallen gewehrt hatte.
So schnell er konnte, rannte Girolamo quer über den Platz, umrundete mehrere Frauen, die sich scherzend und lachend unterhielten. Keine von ihnen sah so aus, als hätte sie den Jäger wahrgenommen.
Es beginnt wie vor einem Jahr!, dachte Girolamo im Laufen. Zu Anfang sahen die Menschen die Jäger nicht. Und am Ende … am Ende hatten die Bestien Hunderte Florentiner Bürger getötet.
Das Mädchen! Er musste ihr helfen, musste versuchen, sie aus den Klauen der Bestie zu befreien.
Aber es war zu spät.
Der Schrei ertönte ein drittes Mal, sehr viel leiser jetzt, als sei der Jäger bereits weit entfernt. Und dann verhallte er.
Einen Moment lang blieb es sehr still, aber plötzlich klang ein fernes Grollen auf, ganz ähnlich wie Donner, der sich an den Bergen um Florenz brach. An einer Stelle schien der Himmel über Girolamo etwas dunkler zu werden, eine Nuance nur, und schon hellte er sich wieder auf.
Girolamo blieb keuchend stehen. Seine Knie zitterten stärker, als ihm klar wurde, was geschehen war.
Es kann nicht sein!, schrie eine Stimme in seinem Kopf. Es gab keine Jäger mehr, seit er und seine Freunde, die Kinder der Nacht, vor einem Jahr Mercurius auf seiner Schwarzen Burg besiegt und getötet hatten.
Laute Rufe und fröhliches Lachen rissen Girolamo aus seiner Erstarrung. Eine Gruppe zerlumpt aussehender Menschen kam um die Ecke und ging an ihm vorüber, ohne ihm auch nur einen Blick zu schenken.
Girolamo riss sich zusammen. Es musste eine Täuschung gewesen sein, redete er sich ein. Es gab keine Jäger mehr! Wahrscheinlich hatte einfach der Anblick der weißen Maske ihn so sehr erschreckt, dass er Gespenster sah.
Mit wackligen Knien verließ er die Gasse und machte, dass er davonkam.
Nachdenklich und in sich gekehrt, ging er nach Hause. Er ließ den halbfertigen Palazzo der Familie Pitti hinter sich und marschierte den Hügel hinauf, der sich dahinter erstreckte und der nur dünn besiedelt war. Hier hatten sich mehrere kleine Viertel gebildet, in denen hauptsächlich Handwerker lebten. In einem davon stand das Haus, das Girolamos Vater Piero kürzlich gemietet hatte.
Der Frühling kam zeitig in diesem Jahr, und so zeigten sich auf der Wiese, die sich vor dem Haus erstreckte, bereits die Märzveilchen und sogar einige Büschel Lungenkraut. Eine kleine Hummel summte Girolamo um die Füße, als er über den bunten Teppich schritt.
Vor dem Haus stand eine einfache Holzbank, und bei ihrem Anblick musste Girolamo trotz der Sorgen, die ihn drückten, lächeln. Noch heute Morgen hatte er mit seinem Vater auf der Bank in der Sonne gesessen, hatte einen Becher Milch getrunken und ein Honigbrot gegessen. Sie hatten sich über alles Mögliche unterhalten, über die Nachbarn, die sich am Abend zuvor lautstark gestritten hatten, über die Schafe eines Bauern, die allesamt trächtig waren. Und nachdem Girolamo aufgegessen hatte, hatte Piero ihm über den Kopf gewuschelt, hatte ihm fröhlich zugezwinkert und ihm einen guten Tag gewünscht, bevor er an die Arbeit gegangen war.
Girolamo kostete das Zusammensein mit seinem Vater aus, denn er hatte es viel zu lange entbehren müssen. Die Vorstellung, dass Piero ihn über alles liebte, war ihm noch vor einem Jahr völlig fremd gewesen. Umso mehr genoss er sie jetzt.
»Vater?«, rief Girolamo.
Er erhielt keine Antwort, also ließ er sich auf die Bank fallen und pustete sich gegen die Stirn. Er hatte gehofft, seinen Vater zu Hause anzutreffen, weil er ihm von der unheimlichen Begegnung erzählen wollte. Aber offenbar war Piero unterwegs.
Was nun? Was konnte er tun?
Girolamo versank ins Grübeln, aber kurze Zeit später blickte er auf, weil jemand über die Wiese auf ihn zukam.
Es war nicht sein Vater.
Girolamos Augen weiteten sich. Er hatte den Mann, der dort vollbepackt durch Veilchen und Lungenkraut stiefelte, nicht gleich erkannt.
Mit einem Satz sprang er auf die Füße. »Hieronymus!«, rief er aus. »Was machst du denn hier?«
Wenige Schritte vor der Bank blieb Hieronymus stehen, und Girolamo erschrak. Der Maler sah alt aus, alt und müde. Sein Gesicht wirkte grau, das schüttere Haar noch ein bisschen dünner und farbloser, als Girolamo es in Erinnerung gehabt hatte. Seine Hände hatte der Maler um ein großes, quadratisches Bündel gekrampft, das er unter dem Arm trug. Sie waren faltig, eingefallen und papieren wie die eines Greises.
»Girolamo!«, murmelte Hieronymus. »Ich hatte gehofft, dich hier zu finden.« Er setzte das Bündel neben seinen Füßen ab. Es war in altes Leinen eingeschlagen, und Girolamo glaubte zu wissen, was sich darin befand.
»Setz dich erst mal«, sagte er, trat ein wenig zur Seite und deutete auf die Bank.
Hieronymus seufzte dankbar. Dann nahm er das Bündel, lehnte es gegen die Hauswand und plumpste mit einem langgezogenen Stöhnen nieder. »Danke! Das tut gut!«
Girolamo ging vor ihm in die Hocke. »Was ist los? Warum bist du hier?«
Hieronymus verließ sein Atelier, das er im Kloster San Marco hatte, so gut wie nie. Dass er jetzt hier war, kurz nachdem Girolamo den Jäger gesehen hatte, verursachte dem Jungen eine Gänsehaut.
Hieronymus schwieg.
Einen Moment lang begegneten sich ihre Blicke und saugten sich aneinander fest. Girolamo konnte das Band spüren, das ihn zu dem Maler hinzog. Unwillkürlich legte sich seine Hand auf seinen Brustkorb.
Ein müdes Lächeln glitt über Hieronymus’ Gesicht.
»Ja«, murmelte er. »Es ist noch da, nicht wahr?«
»Hieronymus, w-w-was w-willst du hier?« Auf einmal war das Stottern wieder da, unter dem Girolamo früher gelitten hatte.
Doch noch immer reagierte der Maler nicht auf seine Frage. Stattdessen hob er die Hände, spreizte die Finger weit auseinander und formte mit ihnen eine Kugelschale. Im nächsten Moment flammte in ihr ein schwaches, blaues Leuchten auf.
Girolamo blinzelte.
In dem Blau schwebte ein Schmetterling.
Wie Girolamo war auch Hieronymus ein Narratore. Die Narratori stammten nicht aus dieser Welt, sondern aus einer anderen, einer, die sich Selenes Welt nannte. Sie war von einer Göttin geschaffen worden, und diese Göttin hatte den Narratori die Gabe geschenkt, kraft ihres Geistes Dinge und Lebewesen zu erschaffen. Wie diesen Schmetterling.
»Genau wie damals, nicht wahr?«, flüsterte der Maler. Er streckte Girolamo die Hände entgegen. Früher hatte er genau das Gleiche schon einmal getan, und damals hatte Girolamo seine Hände auch zu einer Kugel geformt und Hieronymus’ Schmetterling darin übernommen.
Doch diesmal rührte Girolamo sich nicht. »Ich benutze die Gabe nicht mehr.«
Stirnrunzelnd blickte Hieronymus ihn an. »Warum nicht?«
Weil sie ihn an seine Freunde erinnerte, die er in Selenes Welt gefunden hatte und die er dort hatte zurücklassen müssen, ging es Girolamo durch den Kopf.
»Darum«, gab er kühl zurück. Und dann sagte er: »Ich habe einen Jäger gesehen.«
Zu seiner Verblüffung reagierte Hieronymus darauf nicht, und Girolamo fragte sich, ob der Maler vielleicht den Verstand verloren hatte. Er wirkte völlig entrückt.
»Nie wieder?«, hakte der Maler nach.
Girolamo war verwirrt. Erst nach einer Weile begriff er, dass Hieronymus noch immer von der Gabe sprach. Er schluckte. Er dachte an dieses eine Mal, als er versucht hatte, den Schleier, die Grenze, die Florenz von Selenes Welt trennte, zu durchschreiten. Es hatte brutal weh getan, und danach hatte er die Gabe nie wieder benutzt.
Mit einem langgezogenen Ausatmen, das klang, als habe er große Schmerzen, ließ Hieronymus das Leuchten zwischen seinen Händen verblassen. Der Schmetterling verschwand.
»Du musst es jetzt tun«, sagte Hieronymus.
Girolamo blickte auf. »Warum s-sollte ich?«
»Weil ich dich darum bitte!«
»Nein!«
»Girolamo …«
»Auf gar keinen Fall!«, zischte Girolamo.
»Ich muss dir etwas zeigen!« Hieronymus beugte sich zur Seite, wo sein Bündel an die Hauswand gelehnt dastand. Mit einer heftigen Bewegung riss er das Leinen herunter, und zwei Bilder kamen zum Vorschein. Sie lagen Rücken an Rücken, so dass Girolamo nur das eine betrachten konnte.
»Das habe ich vor ein paar Tagen gemalt«, flüsterte Hieronymus. »Vor ein paar Tagen, Girolamo!«
Girolamo blieb der Atem weg.
Das Bild zeigte einen Wirrwarr der furchterregendsten Wesen, menschenähnliche Körper mit dürren, rindenüberzogenen Armen und Händen. Seltsame Mischwesen, zusammengesetzt aus Teilen von Fischen und Vögeln. Nackte Männer und Frauen mit durchbohrten Händen und Leibern. Ein Schwein lief auf zwei Beinen und trug einen schwarz-weißen Nonnenschleier. Ein Kaninchen hielt eine spitze Lanze und blies in eine Art Jagdhorn. Ein riesiger blauer Vogel mit kieselsteinschwarzen Augen hockte auf einem Thron und verschlang einen Menschen. All das wirkte unendlich düster und bedrohlich, und nachdem Girolamo es lange angesehen hatte, begriff er endlich, was Hieronymus ihm sagen wollte.
Dieses Bild zeigte Florenturna! Das düstere Reich von Mercurius, das sie im letzten Jahr so mühsam besiegt hatten.
»Warum kann ich es sehen?«, flüsterte er.
»Du meinst, warum du plötzlich das hier nicht mehr brauchst?« Hieronymus hielt ein blaues Etui in seiner Hand und öffnete es.
Der Lapillus – eine dicke Glaslinse in einem verzierten Holzring mit Stiel – lag in seinem Bett aus dunkelblauem Samt. Mit ihm konnte man Dinge vergrößert ansehen. Viele Gelehrte in Florenz besaßen so ein Gerät. Doch dieser Lapillus hier hatte zwei weitere magische Eigenschaften: Dank einer hatte Girolamo früher auf Hieronymus’ Bildern die unheimlichen Monster sehen können. Nur mit seiner Hilfe.
Girolamo starrte auf die gruseligen Kreaturen und nickte. Plötzlich hatte er eine Gänsehaut.
»Es sieht so aus, als würde der Schleier sich verändern«, murmelte Hieronymus. »Irgendwie, glaube ich, wird er dünner. Die Nutzung der Gabe fühlt sich völlig anders an als früher. Jedenfalls bei mir.«
»Und du möchtest wissen, ob es mir genauso geht.« Girolamo schluckte. »Darum willst du, dass ich es ausprobiere.« Er konnte den Blick nicht von den Monstern auf dem Bild lassen. Der Vogel mit seinen blanken Augen verursachte ihm ein Gefühl von Übelkeit, wenn er ihn nur betrachtete. »Mercurius ist tot! Und seine Wesen sind mit ihm gestorben.« Girolamo konnte es nur flüstern. Auf einmal war sein Mund staubtrocken, und er musste husten. »Wir haben ihn getötet!«
»Bist du dir da wirklich sicher? Du hast gesagt, du hättest einen Jäger gesehen, oder nicht?«
Also hatte Hieronymus ihm doch zugehört!
Der Maler nahm die beiden Bilder wieder hoch. Dann griff er nach dem hinteren, das Girolamo bisher noch nicht zu sehen bekommen hatte, und drehte es um.
Girolamo sah ein dunkelrotes Tischtuch. Speisende und lachende Menschen, eine idyllische Tischszene, völlig ohne Monster und groteske Gestalten. Zu Girolamos Verblüffung presste Hieronymus dieses Gemälde nun gegen das erste. Einige Augenblicke später löste er die Bilder wieder voneinander. Ein feines schmatzendes Geräusch zeigte Girolamo, dass beide noch nicht völlig trocken gewesen waren. Kaum wahrnehmbar stieg der Geruch von Leinöl in die Luft.
»Du hast sie zerstört!«, rief Girolamo.
Hieronymus beachtete ihn nicht. Schweigend und mit grimmiger Miene schaute er auf die beiden Gemälde. Ihre Farben waren ineinandergelaufen, ihre vorher kenntlichen Formen zu noch groteskeren Bildern verschmolzen. Es sah plötzlich aus, als habe der blaue Vogel ein menschliches Gesicht auf dem Bauch, und lange, dunkelrote Schlieren liefen durch die mit Messern durchbohrten Menschen. Sie sahen aus wie Blut.
»Ich muss dir noch etwas zeigen«, sagte Hieronymus. Er stellte die Bilder wieder fort. Dann erhob er sich halb, um einen weiteren Gegenstand aus einer Tasche zu ziehen, die er am Gürtel trug.
»Sieh dir das an«, bat er Girolamo.
Girolamo schaute hin und stieß ein verwundertes »Oh!« aus. »Was ist das?«, fragte er.
Auf Hieronymus’ Handfläche lag eine tote Maus. Jedenfalls sah das missgestaltete Wesen zur Hälfte aus wie eine Maus. Doch zwischen ihren Ohren und das halbe Rückgrat hinunter ragte etwas aus ihrem Fell, das eindeutig nicht mausartig war.
Girolamo streckte eine Hand aus und versuchte, das seltsame Ding anzustupsen. Doch Hieronymus zog es fort.
Das Ding, das dem Tier aus dem Leib wuchs, war ein Stück von irgendetwas Geschupptem. Eine Eidechse, vermutete Girolamo.
»Was hat das zu bedeuten?«, wollte er wissen.
Hieronymus legte das tote Wesen neben sich auf die Bank. »Es lag heute Morgen im Atelier. Aber ich habe keine Ahnung, was es zu bedeuten hat, Girolamo.« Er seufzte schwer und bat schließlich: »Benutze deine Gabe. Ein einziges Mal nur!«
Girolamo zögerte noch immer. Sein Herz schlug ihm in der Brust wie eine Trommel, und irgendetwas sagte ihm, dass er dieser Bitte besser nicht nachkommen sollte.
»Tu es!«, drängte Hieronymus.
Da hob Girolamo die Hände und formte sie zu der Kugelschale, die ihm noch vor einem Jahr so vertraut gewesen war. »Factum est autem diebus illis alioque loco«, murmelte er die magischen Worte, die die Gabe hervorriefen. »Es begab sich aber zu jener Zeit und an jenem Ort …« Das blaue Leuchten erschien zwischen seinen Fingern, dann der Schmetterling, auf den er sich konzentrierte. Doch etwas war anders, als er es in Erinnerung hatte.
Damals hatte er seinen Geist anstrengen müssen wie eine Art Muskel in seinem Kopf. Es war gewesen wie eine besonders starke Form der Konzentration. Das galt jetzt auch noch, und dennoch fühlte sich die Gabe plötzlich anders an. Während Girolamo den Schmetterling betrachtete, versuchte er herauszufinden, warum das so war, aber es gelang ihm nicht.
Mit einem Schnaufen ließ er das blaue Leuchten verblassen. »Du hast recht«, bestätigte er. »Es fühlt sich anders an.«
Hieronymus nickte bedächtig vor sich hin, während Girolamo versuchte, einen Ausdruck für dieses Gefühl der Andersartigkeit zu finden. Es war der Maler, der es in Worte fasste: »In meiner Vorstellung war der Schleier früher immer so was wie ein dichter Vorhang. Ein Vorhang, durch den keinerlei Licht dringen, den ich aber mit meiner Gabe durchsichtig machen kann.« Hieronymus hielt inne und betrachtete Girolamo aufmerksam.
»Jetzt jedoch …« Girolamo zögerte. »Es fühlt sich irgendwie so an, als sei der Vorhang fadenscheinig geworden. Nein, anders. Als sei er kein Vorhang mehr, sondern ein … Spinnennetz. Man kann hindurchsehen, aber es ist dennoch schwierig, es zu durchdringen.«
Hieronymus schürzte die Lippen. »Ein guter Vergleich!«, sagte er. »Doch noch etwas ist anders. Versuch, den Schmetterling zurück zwischen deine Hände zu holen!«
Girolamo gehorchte. Wieder formte er die Kugel und murmelte die Worte. Doch diesmal erschien in dem blauen Leuchten … nichts. Girolamo runzelte angestrengt die Stirn, aber sosehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, den soeben erschaffenen Schmetterling zwischen seinen Fingern auftauchen zu lassen. Alles, was er in dem Leuchten sehen konnte, waren ein paar schräg einfallende Sonnenstrahlen, in denen Staubkörner tanzten. Girolamo schickte seine Gedanken auf die Suche nach dem Schmetterling. Doch während sein Geist sich früher völlig ungehindert durch Selenes Welt hatte bewegen können, schien er Girolamo jetzt wie festgenagelt. Alles, was er zwischen seinen Händen schaffen konnte, waren Licht und Staub, mehr nicht.
Er spürte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat.
Kopfschüttelnd ließ er die Arme fallen. »Seltsam!«
Hieronymus nickte. »Ich werde Florenz verlassen«, sagte er.
Girolamos Gänsehaut kehrte zurück, und diesmal war sie so stark, dass er schauderte. Aus weiter Ferne wehte ein Jägerschrei heran. Er war langgezogen und schrill, und das ebenso ferne Donnergrollen, das ihm folgte, machte, dass Girolamos Knie schon wieder anfingen zu zittern.
Hieronymus jedoch schien weder den Schrei noch den Donner zu hören.
Sein Blick lag auf den beiden zerstörten Gemälden, und Girolamo konnte die Angst sehen, die in seinen Augen glitzerte.
»Du willst weglaufen?«, fragte er den Maler mit Flüsterstimme.
»Ich muss Florenz vor mir in Sicherheit bringen.« Hieronymus hielt seinem bohrenden Blick stand. Zögernd griff er in seine Tasche und zog das Etui mit dem Lapillus wieder hervor, das er weggegesteckt hatte. »Nimm ihn«, bat er.
Girolamo rührte sich nicht. »Warum?« Er starrte auf den Lapillus. »Was soll ich damit? Er gehört …«
»… jetzt dir!« Der Maler deutete auf das Etui.
»Warum, Hieronymus?«, fragte Girolamo. »Was hat das alles zu bedeuten?«
»Der Schleier hat seine Beschaffenheit verändert.« Der Maler fuhr sich mit der Zunge über die Unterlippe. Er holte den Lapillus aus dem Etui und hielt ihn Girolamo direkt vor die Nase. Mit einem unguten Gefühl nahm Girolamo ihn.
»Ich träume Nacht für Nacht von Florenturna, und das hier kommt dabei heraus.« Hieronymus packte die beiden zerstörten Bilder und drehte sie so, dass man nur noch ihre Rückseite sehen konnte. Dann wies er auf den Lapillus. »Sagen wir …« Er hielt inne, überlegte. Schließlich legte er das blaue Etui auf die Bank neben die seltsame Maus. Mühsam stemmte er sich in die Höhe. »Sagen wir einfach, ich habe das Gefühl, du wirst ihn in Zukunft nötiger brauchen als ich. Du hast die Jäger gesehen.« Er griff nach den Bildern, schlug sie wieder in das Leinen ein und klemmte sie sich unter den Arm. Dann baute er sich vor Girolamo auf. »Ich muss jetzt gehen, sonst gibt es eine Katastrophe«, murmelte er. »Leb wohl, mein Sohn!«
Er nickte Girolamo hastig zu, drängte sich an ihm vorbei und marschierte mit langen Schritten über die Wiese davon.
Erst lange nachdem er hinter dem Hügel verschwunden war, kehrte Girolamo aus seiner Versunkenheit zurück in die Gegenwart. Den Lapillus hielt er noch immer in der Hand.
Langsam nahm er das Etui von der Bank.
»Wovor fliehst du, H-hieronymus?«, murmelte er. Und tief in seinem Innersten kannte er bereits die Antwort.
Er legte den Lapillus in das Etui, schloss es und steckte es in die Hosentasche.
»Was ist denn mit dem los?«, hörte er eine vertraute Stimme sagen.
Er drehte sich um. Erleichterung durchflutete ihn.
Sein Vater war zurück.
III. Silvio
Der Freunde Hand ist es,
die uns leitet,
wenn die Götter uns
auf finstre Pfade führen.
(Aus: Dante Alighieri, Il fioretto. Das Blümchen)
»Hat Hieronymus einen bösen Geist gesehen, oder was?« Piero blickte stirnrunzelnd in die Richtung, in der der Maler verschwunden war.
Girolamo schüttelte den Kopf. »Aber ich.«
Piero sah ihn an. »Wie meinst du das?«
Und Girolamo erzählte ihm von dem Jäger. Dann, ohne Luft zu holen, erzählte er auch von Hieronymus’ seltsamem Verhalten und von seiner Behauptung, er müsse Florenz vor sich retten.
Nachdem er geendet hatte, schwieg Piero eine ganze Weile. »Ein Jäger«, murmelte er. »Und der Schleier verändert sich.«
Davon hatte Girolamo gar nichts erwähnt, und er begriff, dass Piero die Veränderung des Schleiers ebenfalls spüren konnte.
»Was hat das zu bedeuten?«, flüsterte er.
Piero zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht.« Auch er sprach leiser als sonst. »Aber ich kenne jemanden, den wir fragen können.«
»Wen?«
Grimmig richtete Piero den Blick auf die Wiese. »Den Frater!«, sagte er.
Nachdem Piero fort war, um mit dem Frater, einem der einzigen anderen Narratori, die es außer ihnen und Hieronymus in Florenz noch gab, zu sprechen, blieb Girolamo nachdenklich zurück. Er hatte es vorgezogen, nicht mit seinem Vater zu gehen. Zu gut erinnerte er sich noch an die Rolle, die der Frater in der Sache vor einem Jahr gespielt hatte, und er hatte kein Bedürfnis, ihm unter die Augen zu treten.
Stattdessen starrte er auf die gruslig verunstaltete Maus, bis er ihren Anblick nicht mehr ertragen konnte, sie nahm und in der hintersten Ecke des Gartens vergrub.
Er musste mit jemandem über die Ereignisse sprechen.
Und er kannte nur einen, der sich dafür eignete: Silvio!
Eine Weile lief er kreuz und quer durch Florenz, um Silvio zu finden.
Sein Weg führte ihn zu Santa Margherita, einer der vielen Kirchen von Florenz, die wie ein Wohnhaus einfach in die Häuserzeile eingepasst worden waren und gar nicht wie ein Gotteshaus aussahen. Als er an der dunkel gestrichenen Tür vorbeikam, sah er eine Frau, die mit einer einzelnen roten Rose in der Hand das Gebäude betrat.
Er ließ die Kirche hinter sich und überquerte die Piazza della Signoria, wobei sein Blick an den vergoldeten Türen des Baptisteriums hängenblieb. Sonst blieb er gerne für einige Augenblicke stehen, um sich die Szenen auf den Reliefs der Türen anzusehen. Besonders gefielen ihm die Soldaten mit ihren Posaunen auf jenem Teil der Nordpforte, der den Fall Jerichos darstellte. Heute jedoch ließ er das Baptisterium links liegen und steuerte schnurstracks auf den Ponte Vecchio zu.
Als er einen Tumult bei einem der Fleischerstände hörte, blieb er stehen.
»Dieb!«, schrie ein Mann. »Elender Lump! In der Hölle sollst du schmoren, wenn du mir nicht sofort meine Würste wiedergibst!«
Girolamo reckte den Hals, um zu erkennen, wen der Fleischer da so übel beschimpfte, aber er war nicht groß genug, um über die Menge hinwegzusehen. Alles, was er mitbekam, war, wie mit einem lauten Klirren einige Tongefäße umfielen und zu Bruch gingen.
In das Fluchen des Metzgers mischte sich nun auch noch das einer Frau.
Girolamo überquerte den Ponte Vecchio, und als er auf der anderen Seite in die Gassen eintauchen wollte, hörte er einen lauten, trompetenartigen Ruf.
»He! Paolo! – Girolamo, meine ich!«
Silvio!
Girolamo lächelte, dann drehte er sich um. Er entdeckte den Urheber des Rufes nicht sofort, aber als er einen Moment stehen blieb, schlüpfte ein kleiner und sehr magerer Junge aus einer Lücke zwischen zwei Häusern, die mit einem Bretterzaun nur notdürftig verschlossen war. »Hier bin ich!« Der Junge winkte eifrig. Er war barfuß und trug ein verblichenes, ehemals blaues Wams, dessen Schnüre so durchgescheuert waren, dass es ihm halboffen vor der mageren Brust herumschlackerte. Um seinen Hals, einer Trophäe gleich, baumelte eine Reihe dicker Würste.
Girolamo unterdrückte ein Grinsen. »Hätte ich mir ja denken können, dass du der Wurstdieb bist!«, sagte er, als der Junge näher trat.
Silvio warf sich in die Brust, nahm das Ende der Wurstkette und biss herzhaft hinein. »Hier steht Silvio Clandestino, der Schrecken der Florentiner Unterwelt«, prahlte er mit vollem Mund. »Mir kann keiner was!«
»Wirklich?«, meinte Girolamo und wies auf ein schillerndes blaues Auge, das das Gesicht des Jungen zierte.
Silvio zuckte nur die Achseln. Als Girolamo ihn vor einem Jahr kennengelernt hatte, hatte er keinen einzigen Schneidezahn im Oberkiefer gehabt. Inzwischen waren ihm zwei neue gewachsen, und sie sahen in dem schmalen Gesicht dermaßen riesig aus, dass Girolamo bei ihrem Anblick an ein kleines Nagetier denken musste.
»Du bist immer noch der alte Miesepeter, Paolo!«, sagte Silvio. Girolamo hatte es längst aufgegeben, ihn darauf hinzuweisen, dass er nicht Paolo hieß. Aus irgendeinem Grund hatte Silvio ihm bei ihrem ersten Treffen diesen Namen verpasst, und er schien nicht vorzuhaben, davon wieder abzurücken. »Du machst ein Gesicht, als würde Florenturna in jedem Moment wiederauferstehen.«
Girolamo zuckte zusammen, und Silvio bemerkte es. »Was ist?«, fragte er. »Hast du ein Gespenst gesehen, oder was?«
Girolamo schüttelte den Kopf. »Kein Gespenst …« Er zögerte, dann presste er hervor: »Einen Jäger!«
Da wurde Silvio ein wenig blass um die Nase. »Einen Jäger?«, ächzte er. »Wirklich?«
Wieder schüttelte Girolamo den Kopf, denn die Erinnerung an den Jägerschrei ergriff ihn und presste sein Herz zusammen. »Das dunkle Reich von F-f-florenturna existiert nicht mehr«, brachte er heraus. »Ich habe mich w-w-wahrscheinlich getäuscht.« Aber er dachte an Hieronymus und sein seltsames Verhalten, und er wusste, dass er sich etwas vormachte.
»Du stotterst wieder«, flüsterte Silvio. »Wie vor der Zeit, in der wir in Selenes Welt gewesen sind.«
Selenes Welt.
Girolamo ächzte. Das alles hatte er doch hinter sich gelassen!
»Warst du wieder dort?«, fragte Silvio. »In Florenzia, meine ich!«
Florenzia, die Schimmernde Stadt, war so etwas wie die Hauptstadt von Selenes Welt.
Girolamo verneinte. »Das kann ich nicht, und das weißt du auch!«
»Schon klar«, brummelte Silvio. Er hielt noch immer das Ende der Wurstkette in der Hand, und als würde er sich jetzt erst bewusst, was er da eigentlich gestohlen hatte, starrte er stirnrunzelnd darauf.
Plötzlich hatte Girolamo das dringende Bedürfnis, dem Thema auszuweichen, darum rupfte er eine Wurst ab und biss hinein. Sie schmeckte scharf, und ein wenig Fett lief ihm beim Kauen über das Kinn. Mit dem Handrücken wischte er es fort und wies auf Silvios blaues Auge. »Nun sag schon!«, hakte er nach. »Woher hast du das?«
Silvio verzog das Gesicht, aber jetzt antwortete er. »Nur ein kleiner Zusammenstoß mit Fuch.«
»Fuch?« Girolamo runzelte die Stirn. »Was hast du mit dem zu schaffen?«
Fuch war ein Mitglied einer Bande von Bettelkindern, die die Straßen von Florenz unsicher machten. Unangenehme Gesellen, roh und verwahrlost. Girolamo mochte sie nicht.
Plötzlich sah Silvio ein wenig verlegen aus. »Nichts weiter …« Ihm war an der Nasenspitze anzusehen, dass er log.
Girolamo blickte ihn streng an. »Raus mit der Sprache!«, befahl er.
Silvio bohrte den nackten Zeh in den Dreck der Straße. »Nun …«, meinte er gedehnt, und als Girolamos Gesicht noch finsterer wurde, gab er zu: »Ich versuche, in Tommasos Bande aufgenommen zu werden.«
Girolamo verschluckte sich an einem Stück Wurstpelle. Hustend beugte er sich vor und spuckte es auf den Boden. »Die Kinder des Zwielichts?« Er sprach den Namen voller Hohn aus, den Tommaso seiner Bande gegeben hatte und der jeden Trottel darauf hinweisen sollte, dass sie ein Teil der Unterwelt waren. Zwielichtige Gestalten eben … Girolamo hatte für solche Wortspielereien nur ein müdes Lächeln übrig.
»Warum nicht?« Trotzig schob Silvio die Unterlippe vor. In diesem Moment sah er sehr jung aus, und Girolamo musste sich daran erinnern, dass er das ja auch war. Silvios Großspurigkeit ließ ihn immer wieder vergessen, dass der Junge in Wirklichkeit erst acht war, vier ganze Jahre jünger als Girolamo.
»Weil Tommaso und s-seine Bande Verbrecher sind!« Mit Schaudern dachte Girolamo daran, wie er selbst Tommaso zum ersten Mal begegnet war. Die ganze Sache war nicht sehr schmeichelhaft für ihn ausgegangen, hatte er doch nach wenigen Augenblicken im Staub gelegen …
Noch so eine eine Erinnerung, die er lieber von sich schob. »Warum hat Fuch dich geschlagen?«, brachte er darum das Gespräch auf Silvios blaues Auge zurück.
»War eine Mutprobe.«
»Was für eine? Hinstellen und stillhalten, während die anderen auf dich einprügeln?« Girolamo versuchte herauszufinden, ob Silvios Körper noch an anderen Stellen mit Blessuren versehen war. Er glaubte, eine Prellung an Silvios Brustkorb zu erkennen, aber das blaue Wams verdeckte sie zum Großteil, und er war sich nicht ganz sicher.
»Natürlich nicht!«, empörte sich Silvio. Er klang ein wenig zu gekränkt, und Girolamo glaubte ihm nicht. Er traute Fuch noch viel mehr zu, als einen Jüngeren zu verprügeln und ihm vorher zu befehlen, dabei auch noch stillzuhalten. Er schnaubte wütend.
»Sie werden dich in ihren Sumpf hinabziehen«, prophezeite er. »Bisher bist du nur ein kleiner Dieb, der aus Not stiehlt. Wenn du aber erst zu ihnen gehörst, dann …«
Er wurde mitten im Satz unterbrochen, weil der Karnevalszug um die Ecke bog, in den er heute schon einmal geraten war. Die Musik und das laute Lärmen der feiernden Menschen übertönten seine Stimme, und so hielt er inne und wollte warten, bis der Zug vorbei war.
Plötzlich jedoch fing er einen Blick auf. Neugierig reckte er den Hals, aber zwei übergroße Wesen mit dunkelroten Federn – Männer auf doppelt mannshohen Stelzen – schritten an ihm vorbei und verdeckten ihm die Sicht.
Als sie vorüber waren, suchte Girolamo den gegenüberliegenden Straßenrand ab, aber niemand beachtete ihn. Offenbar war derjenige, dessen Blick er eben gekreuzt hatte, fort. Doch das Gefühl, eine bedeutende Begegnung gemacht zu haben, blieb. Girolamo konzentrierte sich auf dieses Gefühl. Es hatte ein bisschen etwas von dem seltsamen Zupfen in seiner Brust, das er verspürte, wenn sich ein anderer Narratore in seiner Nähe befand. Und doch war es anders gewesen. Wie hypnotisiert ging Girolamo einige Schritte in Richtung des Ponte Vecchio, in die der Karnevalszug jetzt einbog. Er war so von der seltsamen Begegnung in den Bann gezogen, dass er nicht darauf achtete, ob Silvio ihm folgte.
Ein Hufschmied, der seinen Stand mitten auf der Brücke hatte, war gerade dabei, mit einer jungen Frau über das Beschlagen eines schlanken Rotschimmels zu verhandeln. Der Lärm des Umzugs machte das Pferd scheu, aber der Schmied hielt es mit eiserner Hand am Zügel. Einige der Geldwechsler von der anderen Seite standen beieinander und betrachteten den Umzug. Und eine Gruppe junger Männer in den typischen weitfallenden Gewändern des Stadtadels blieb ebenfalls stehen. Keiner dieser Menschen war jener, dessen Blick er eben aufgefangen hatte, das spürte Girolamo ganz genau.
»Eh, Paolo, was hast du denn?«
Undeutlich nur hörte er Silvios Frage, so sehr konzentrierte er sich darauf, den Urheber des unerwarteten Gefühls zu entdecken.
Und dann glaubte er, fündig geworden zu sein.
»Da!« Seine Hand schnellte vor und wies auf ein Mädchen, das mitten in der Menge stand und mit aufgerissenen Augen zu ihm herüberstarrte. Es war das Mädchen, das der Jäger in seinen Klauen gehabt hatte!
Sie war kaum größer als Silvio. Eine ausladende, schwarze Samtkappe hatte sie weit in die Stirn gezogen. Ihr Gesicht wirkte blass, irgendwie durchscheinend, als leide sie unter einer Krankheit. Und ihre Augen lagen tief in den Höhlen, was ihr ein katzenhaftes Aussehen gab.
Girolamo machte einen Schritt vorwärts, aber all die verkleideten Menschen, die grotesken Tiergestalten, in die die Florentiner Bürger sich verwandelt hatten, versperrten ihm den Weg genauso wirkungsvoll, wie es ein reißender Strom getan hätte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Feiernden vorbeigezogen waren. Immer wieder verdeckten ihre Körper die kleine Gestalt, und mehr als einmal verlor Girolamo sie aus den Augen. Doch jedes Mal tauchte sie zwischen den vorbeiströmenden Leibern erneut auf, und fast sah es aus, als werde sie von ihnen mitgetrieben.
Schließlich war der Zug zu Ende.
Ein letzter Stelzenmann machte den Abschluss. Sein Kostüm ähnelte den beiden anderen, nur dass seine Federn nicht dunkelrot waren, sondern pechschwarz. Durch die riesigen, mandelförmigen Schlitze in seiner Maske wirkten seine Augen wie die eines Insekts.
Girolamo unterdrückte ein Schaudern.
Dann sprang er vorwärts, um nach dem fremden Mädchen zu sehen.
Doch zu seiner Enttäuschung war es fort.
Girolamo fasste sich an die Brust.
»He!« Silvio kam ihm nach und rammte ihm den Ellenbogen in die Seite. »Was glotzt du so?«
»Da war …« Girolamo konnte nicht weitersprechen. Plötzlich fühlte er sich atemlos. Schwach. Er hob die Hände. »Nichts. Ich dachte nur, ich hätte jemanden gesehen.« Er rieb sich den Nasenrücken. »Kam mir fast vor wie ein Narratore«, fügte er dumpf hinzu.
Silvio blies sich gegen die Stirn. »Das kann nicht sein, oder?« Er wusste natürlich noch über all das Bescheid, was sie vor einem Jahr erfahren hatten. »Ich meine, wart nicht ihr, dein Vater und du zusammen mit dem Frater die letzten Narratori in dieser Welt?«
Girolamo nickte mechanisch. »Und Hieronymus.«
»Also, wenn das eben nicht Hieronymus war«, meinte Silvio, »würde das bedeuten, dass ein neuer Narratore aufgetaucht ist. Aber wie kann das sein? Wenn wir doch den Schleier verschlossen haben?«
Girolamo kannte die Antworten auf all diese Fragen nicht. Er zuckte die Achseln. Sein Herz war plötzlich so schwer, als habe die Begegnung mit dem fremden Mädchen einen eisernen Ring darum geschmiedet.
Er war so mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, dass Silvio schließlich murrte: »Du bist ja heute ein richtiges Schwatzmaul!«
Und weil er daraufhin nur mit den Achseln zuckte, verabschiedete sich Silvio von ihm, um zu Tommaso und seiner Bande zurückzukehren.
Girolamo beschloss, es ihm gleichzutun und nach Hause zu gehen. Vielleicht war Piero ja inzwischen von seinem Besuch bei dem Frater zurück, und es gab etwas Neues.
Auf seinem Weg sah er dann das fremde Mädchen wieder. Sie stand an einen Mauerrest gelehnt und blickte Girolamo schweigend an. Ihr Gesicht spiegelte eine wilde Mischung der unterschiedlichsten Gefühle: Verwirrung und Angst, aber auch Neugier. Als sie sah, dass Girolamo sie bemerkt hatte, presste sie sich gegen die Mauer.
Und plötzlich weiteten sich ihre Augen in so namenlosem Entsetzen, dass Girolamo einen Augenblick brauchte, um zu begreifen, dass nicht er der Grund dafür war. Es war etwas hinter seinem Rücken.
Ein eisiger Hauch streifte seinen Nacken, und alle Haare an seinem Körper richteten sich auf. Er wagte nicht, sich umzuwenden. Hinter ihm, das spürte er deutlich, befand sich etwas. Etwas Großes.
Seine Hände verkrampften sich zu Fäusten.
Ein weiterer Luftzug streifte ihn, diesmal so kraftvoll, dass er einen Schritt vorwärtstaumelte.
Das Mädchen öffnete den Mund zu einem Schrei, doch es bekam keinen Ton heraus.
»Nein!«, hauchte Girolamo.
Und langsam wandte er den Kopf. Zu spät.
Im nächsten Moment wurde er von den Füßen gerissen, krachte mit der Seite auf die Erde. Dumpfer Schmerz wallte in seinem Brustkorb auf. Etwas war über ihm. Ein massiger Körper rauschte so dicht über ihn hinweg, dass er den Geruch wahrnehmen konnte, der von ihm ausging. Eine Mischung aus Dung und überreifen Früchten, gleichzeitig süßlich und bitter.
Girolamo stöhnte auf.
Der Jäger war zurück!
Girolamo wälzte sich auf den Rücken, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sich der riesige Körper der Bestie im Flug herumwarf. Mit aufreizend langsamem Flügelschlag verharrte er in der Schwebe, und Girolamo hatte Gelegenheit, das Wesen genauer anzusehen.
Große, blaugefiederte Schwingen zerteilten die Luft, und zwei schuppenbedeckte Beine reckten sich Girolamo entgegen. Wie die Bestien von Florenturna hatte auch dieser Jäger keinen Kopf, sondern er besaß nur einen hässlichen, verhornten Knubbel dort, wo eigentlich ein Hals aus dem blaugefiederten Körper hätte herauswachsen müssen.
Girolamo drehte sich der Magen um.
Und dann schoss ihm bittere Galle in der Kehle nach oben, als er sah, was nun geschah. Der Jäger stieß sein hässliches Kreischen aus. Es gellte Girolamo in den Ohren, und gleichzeitig wölbte sich der Knubbel zwischen den blauen Flügeln vor. Ein Zucken überlief ihn, und es sah aus, als bewegte sich etwas unter der verhornten Schicht. Dann stülpte sich diese Schicht nach außen, und während der Jäger zum wiederholten Male schrie, wuchs ihm ein Kopf.
Ein menschlicher Kopf. Ohne Augen, Mund und Nase. Glänzende, graue Haut zog sich über seine Schädelknochen wie ein Trommelfell, und schließlich, als öffne das Wesen darunter seine Kiefer, dehnte sich diese Haut zu langen, hellgrauen Fäden, die entfernt an Zähne erinnerten.
Girolamo ächzte.
Dann schnappten die Kiefer wieder zu. Langsam drehte sich der Kopf im Kreis, als müsse sein Besitzer die Muskeln in seinem neugewachsenen Nacken strecken.
Das Mädchen wimmerte leise und machte den Jäger dadurch auf sich aufmerksam.
Sie stand stocksteif da, die Augen so weit aufgerissen, dass Girolamo selbst auf die Entfernung das Weiße in ihnen sehen konnte. Langsam, wie in einen Bann geschlagen, hob sie die Hand und zeigte auf den Jäger.
Die Bestie kreischte.
Dann ließ sie sich fallen.
Girolamo reagierte, ohne zu überlegen. Er sprang auf die Füße und hechtete auf das Mädchen zu. Er erreichte es den Bruchteil eines Lidschlags vor dem Jäger. Hart krachte er gegen den schmächtigen Körper, riss ihn mit sich zu Boden. Der Jäger fegte über sie hinweg, und Girolamo glaubte zu spüren, wie sich die scharfen Krallen durch sein Hemd bohrten. Der Stoff riss mit einem Knirschen, aber der Schmerz blieb aus. Die Klauen hatten seine Haut nicht geritzt.
Dafür geschah etwas anderes. Das seltsame Donnergrollen, das Girolamo schon zuvor wahrgenommen hatte, erklang, und diesmal schien es ganz in der Nähe zu entstehen. Obwohl der Himmel über der Stadt wolkenlos war, grummelte und bebte die Luft, und beinahe hörte es sich an, als gehe in den Bergen eine Lawine ins Tal ab. Girolamo glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als auf einmal die Luft über ihm zu flimmern begann und innerhalb des Flimmerns Teile eines Gebäudes auftauchten. Kurz hingen sie einfach in der Luft, rechts und links und auch oben und unten wie mit einem Messer abgeschnitten. Dann verhallte das Grollen. Das Flimmern erlosch, und mit ihm verschwanden auch die Mauerteile.
Verblüfft starrte Girolamo die Stelle an, an der sie noch eben geschwebt hatten, doch dann vertrieb der Jäger jeden Gedanken an die seltsame Erscheinung.
Die Bestie stieß einen wütenden Schrei aus, stieg wieder in die Lüfte. Und drehte in Richtung Florenz ab. Keine zwei Herzschläge später war sie nicht mehr zu sehen.
Ächzend rappelte Girolamo sich auf.
Er lag über dem Mädchen, das starr wie ein Stück Holz unter ihm kauerte. Rasch rückte Girolamo von ihr fort.
»Alles in Ordnung?« Ein panisches Lachen drängte in seiner Kehle nach oben, denn ein Blick in die Miene des Mädchens zeigte ihm, dass gar nichts in Ordnung war. Ihr Gesicht war ausdruckslos und so blass, dass es aussah wie aus Eis.
Zu seiner Verblüffung jedoch nickte sie. »Ja.« Sie hatte eine leise, helle Stimme, die etwas tief in Girolamos Innerem zum Schwingen brachte. Langsam richtete sie sich auf, klopfte sich ein wenig Staub von den Ärmeln ihrer Bluse und erhob sich dann.
Rasch tat Girolamo es ihr nach. Er suchte ihren Körper ab, ob der Jäger sie irgendwo verletzt hatte, aber er sah keinerlei Blut. Selene sei Dank!, dachte er und schickte sicherheitshalber noch ein kurzes Gebet an den Gott seiner Welt hinterher.
Dem Mädchen schien das Gleiche durch den Kopf zu gehen wie ihm. »Hat es dich verletzt?«, erkundigte sie sich. Sie machte einen halbherzigen Versuch, einen Blick auf Girolamos Rücken zu werfen.
»Nein«, murmelte er. »Alles gut!«
Er wollte sie fragen, was der Jäger von ihr gewollt hatte, warum er versucht hatte, sie zu entführen, aber dann fiel ihm ein, dass das Biest jederzeit wiederkehren konnte. Mit klopfendem Herzen und zu schmalen Schlitzen zusammengekniffenen Augen suchte er den Himmel ab.
Das Monster jedoch schien fort zu sein.
Er schüttelte sich bei dem Gedanken daran, wie dem Biest dieser ekelhafte, widernatürliche Kopf gewachsen war. Es hatte ausgesehen, als hätte sich etwas, was der Jäger schon immer in sich getragen hatte, nach außen gestülpt wie eine bösartige Geschwulst. Girolamo unterdrückte einen erneuten Würgeanfall.
»Was war das für eine Bestie?« Die Stimme des Mädchens zitterte ein wenig. Ihre schwarze Samtmütze war verrutscht, so dass Girolamo die silbrigen Haare sehen konnte, die sich darunter verbargen. Beim Blick in die dunklen Augen des Mädchens setzte Girolamos Herz einen Schlag lang aus und beschleunigte sich dann. Er lauschte auf das Gefühl in seiner Brust und erkannte, dass es sich von dem Band unterschied, das er in Gegenwart eines anderen Narratore spürte. Dieses Mädchen hier war eindeutig keine Narratrice!
»Ein Jäger«, antwortete Girolamo. Er musste tief Luft holen, um die Worte herauszubringen, denn alles in ihm schrie: Das kann nicht sein!
Es darf nicht sein!
Mercurius war tot. Girolamo selbst hatte ihn getötet, damals auf den Zinnen der Schwarzen Burg, die im Zentrum des dunklen Reiches Florenturna gestanden hatte. Und mit Mercurius waren alle seine Geschöpfe gestorben, die Hüter und Fänger und auch die Jäger. Es konnte kein einziges Exemplar der blaugefiederten Bestien mehr geben, weil sie Florenturna besiegt hatten!
Und doch hatte er den Jäger eben mit eigenen Augen gesehen.
Girolamo zwang sich zur Besonnenheit.
»Er kann jeden Moment wiederkommen«, sagte er. »Wir sollten besser von hier verschwinden. Lass uns woanders reden.«
Alarmiert blickte das Mädchen in den Himmel. Ihr Gesicht war nun so blass, dass Girolamo meinte, das feine Geflecht aus blauen Adern an ihren Wangen erkennen zu können. Er fasste nach ihrer Hand und hielt sie fest.
»Ganz ruhig!«, sagte er und hoffte, dass er sich nicht so verzagt anhörte, wie er sich fühlte. »Komm. Wir sehen zu, dass wir in Sicherheit gelangen.«
Zunächst führte er das Mädchen in einen baufälligen Stall, der ganz in der Nähe in einem alten, verwilderten Garten stand und in dem Girolamo sich ein Geheimversteck angelegt hatte. Unter der Tenne, die von einem halben Dutzend armdicker Holzstreben gestützt wurde, hatte er sich aus Brettern eine Art Verschlag gebaut. Er war nicht besonders groß, aber es reichte gerade so, um zu zweit hier drinnen zu sitzen und sich vor der Welt zu verbergen.
Als sie den Verschlag erreicht hatten, bot Girolamo dem Mädchen einen Holzklotz an, der sonst ihm als Sitzgelegenheit diente. Er selbst hockte sich auf den gestampften Fußboden.
»Wie heißt du eigentlich?«, begann er das Gespräch.
Das Mädchen setzte sich auf den Klotz, zog die Knie vor die Brust und umklammerte die Beine mit den Armen. Eine Weile lang saß sie einfach so da, schaukelte leicht vor und zurück und schwieg.
»Sphaera«, antwortete sie, als Girolamo schon nicht mehr glaubte, dass sie ihn überhaupt gehört hatte. Sie zog die Nase kraus, dann hob sie den Blick und bohrte ihn direkt in Girolamos Augen. In Girolamos Magen begann es zu flattern.
»Wo bin ich hier?«, fragte sie leise.
»In einem Viertel südlich des Arno. Nicht weit vom Palazzo Pitti entfernt«, antwortete Girolamo.
»Arno? Palazzo Pitti?« Sphaera sah verwirrt aus.
»In Florenz«, half Girolamo nach.
Das machte es jedoch nicht besser.
»Du meinst Florenzia, oder? Aber es ist seltsam: Die Stadt sieht plötzlich so anders aus. Viel … grauer.«
»Flo-ren-zi-a?« Girolamo dehnte das Wort zu vier langen Silben auseinander. »Du stammst von dort?« Jetzt war auch er verwirrt. Und dann erst begriff er: Der Jäger hatte Sphaera nicht von hier in Selenes Welt entführen wollen, wie er gedacht hatte. Sondern es war genau umgekehrt gewesen. Er hatte Sphaera von dort hierhergebracht!
Warum, um Himmels willen?
»Dies hier ist nicht Florenzia«, sagte er.
Sphaera sah nicht so aus, als nehme sie ihn für voll.
»Es ist eine ziemlich lange Geschichte, glaub mir!« Girolamo beugte sich vor und tätschelte ihren Arm. Es war, als würde zwischen ihnen irgendeine Energie fließen. Schlagartig begann seine Haut zu kribbeln, und auch Sphaera schien es zu spüren, denn sie zog den Arm fort und rieb sich über die Stelle, die Girolamo berührt hatte.
»Eine lange Geschichte«, flüsterte sie.
»Der Jäger hat dich durch den Schleier getragen.« Girolamo sprach mehr zu sich selbst als zu Sphaera, und die Gedanken wirbelten in seinem Kopf umeinander. Sie war aus Selenes Welt, und das war offenbar auch der Grund dafür, dass er sie in dem Karnevalsumzug so deutlich hatte wahrnehmen können.
Sphaera schwieg und sah ihn nur an. In ihrer Miene spiegelten sich Angst und Neugier gleichermaßen. »Ich möchte zurück nach Hause«, murmelte sie, und sie klang sehr verängstigt dabei.
Girolamo beschloss, ihr zu helfen. Er stemmte sich in die Höhe. »Lass uns zu meinem Vater gehen«, schlug er vor. »Vielleicht weiß der mehr als wir. Und auf dem Weg dorthin erzähle ich dir, was es mit Selenes Welt und dem Schleier auf sich hat.«
Sie verließen den Stall und machten sich auf den Weg zu Girolamos Zuhause. Während sie einen schmalen Feldweg entlangmarschierten, überlegte Girolamo, wie er anfangen sollte.
Er entschied sich für eine Frage: »Was weißt du über die Göttin Selene?«
Sphaera wirkte verblüfft, aber sie antwortete: »Sie hat die Welt erschaffen, den Himmel und die Erde, die Sonnen, die am Tag leuchten, und die Monde, die es in der Nacht tun.«
»Genau.« Girolamo deutete um sich, auf die Bäume, die den Weg säumten, dann in den Himmel, der sich mit grauen Wolken zugezogen hatte und ziemlich düster wirkte. »Das alles, was du hier siehst, ist nicht die Schöpfung deiner Göttin. Es ist eine völlig andere Welt. Meine Welt. Und ihr Schöpfer ist ein Gott, keine Göttin.«
Sphaera runzelte die Stirn, aber sie widersprach nicht, auch wenn Girolamo ihr ansehen konnte, dass es ihr schwerfiel, ihm zu glauben. »Ein Gott? Wie ist sein Name?«
»Er hat keinen. Wir nennen ihn einfach nur Gott.«
Sphaera stieß mit der Fußspitze gegen einen kleinen Stein, der in ihrem Weg lag. Er rollte ein Stück davon. »Ein namenloser Gott. Hübsch.«
»Die beiden Welten, also die deiner Göttin Selene und die meines namenlosen Gottes, liegen ganz dicht beieinander, aber etwas trennt sie. Eine Art Grenze. Wir nennen sie den Schleier.«
»Wer ist wir?«
Girolamo überlegte, dann entschied er sich, Sphaera alles zu erzählen, was er wusste. »Die Narratori.«
Jetzt ruckte ihr Kopf zu ihm herum. »Du bist einer der Narratori?« Das schien sie noch viel weniger glauben zu können als alles andere, was er ihr zuvor erzählt hatte.
Er nickte und beschloss im Stillen, ihr nicht zu verraten, dass er nicht nur ein einfacher Narratore war, sondern darüber hinaus auch noch Alessandras Sohn, jener Auserwählte, der vor einem Jahr Florenzia vom Joch des Mercurius befreit und Selenes Welt dadurch vor dem dunklen Reich Florenturna gerettet hatte.
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinanderher.
»Was denkst du?«, fragte Girolamo schließlich.
»Dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einem Narratore begegne.«
»Und?«