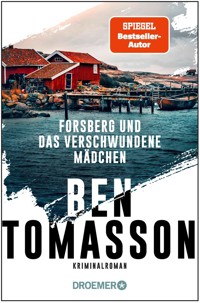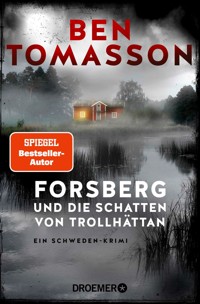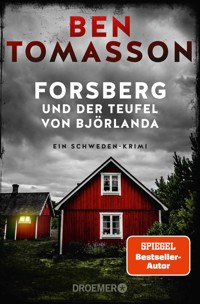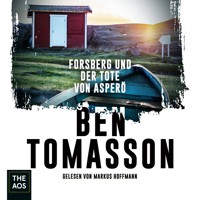
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Frederik-Forsberg-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mord auf der Schären-Insel: Im Schweden-Krimi »Forsberg und der Tote von Asperö« werden ein toter Anwalt und die Geister der Vergangenheit zum 2. Fall für den schwedischen Kommissar Frederik Forsberg aus Göteborg. Ein brutaler Mord erschüttert die idyllische Schären-Insel Asperö: In einem abgelegenen Ferienhaus wird der Hamburger Anwalt Julius Reichenbach mit 18 Messerstichen getötet. Kommissar Forsberg ist sicher, dass der Bluttat ein zutiefst persönliches Motiv zugrunde liegt. Tatsächlich scheinen weder Reichenbachs Frau noch das befreundete Ehepaar Kai und Daniela Schwaiger den Toten sonderlich zu betrauern. Die Ermittlungen fördern schnell eine ganze Reihe von Motiven zutage, von Misshandlung bis zu einem Streit um eine große Summe Geldes. Doch bevor Kommissar Forsberg und seine Kollegin Anna Jordt den Kreis der Verdächtigen einengen können, geschieht ein weiterer Mord. Und was hat es mit dem geheimnisvollen Schattenmann auf sich, der vor dem Mord ums Haus geschlichen sein soll? Atmosphärisch, hoch spannend, nordisch gut: Ben Tomassons Krimi-Reihe aus Schweden ist perfekte Urlaubslektüre! Seinen ersten Fall löst der sympathische Kommissar, der nicht lügen kann, im Schweden-Krimi »Forsberg und das verschwundene Mädchen«.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ben Tomasson
Forsberg und der Tote von Asperö
Ein Schweden-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein brutaler Mord erschüttert die idyllische Schäreninsel Asperö: In einem abgelegenen Ferienhaus wird ein Hamburger Anwalt mit 18 Messerstichen getötet. Kommissar Forsberg und seine Kollegin Anna Jordt übernehmen die Ermittlungen und stoßen bei der Ehefrau des Ermordeten sowie zwei befreundeten mitgereisten Pärchen schnell auf eine ganze Reihe von Motiven, von Misshandlung bis zu einem Streit um eine große Geldsumme. Doch bevor sie den Kreis der Verdächtigen einengen können, gibt es einen weiteren Toten. Und was hat es mit dem geheimnisvollen Schattenmann auf sich, der vor dem Mord ums Haus geschlichen sein soll?
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Danksagung
Der Sarg war viel zu klein. Nie im Leben passte Edvin dort hinein. Und doch stand sein Foto auf dem kleinen Tisch daneben in der Kapelle. Es war das Bild, das sie gemacht hatten, als sie am ersten warmen Frühlingstag des Jahres alle zusammen mit dem Boot draußen gewesen waren. Der Himmel war so unglaublich blau, genau wie Edvins Augen, und das Meer glitzerte verlockend.
Edvin hatte ihn ausgelacht, weil er unbedingt schwimmen wollte, obwohl ihre Eltern ihm abrieten, weil es noch zu kalt war. Er wusste es noch genau. Diese ausgelassene Heiterkeit in Edvins Blick – das war der Moment, in dem er Hemd und Hose abgestreift hatte und hineingesprungen war.
Das Wasser war wirklich viel zu kalt gewesen. Es hatte ihn wie ein Schock getroffen, aber er hatte sich nichts anmerken lassen. Um sich keine Blöße zu geben, war er zweimal komplett um das Boot herumgeschwommen und hatte Edvin und seinen Eltern fröhlich zugewinkt. Danach hatte er vier Wochen lang mit einer Lungenentzündung im Bett gelegen. Ganz schwach hatte er sich gefühlt, als er endlich wieder aufstehen durfte, seine Muskeln wabbelig wie Lakritzschnüre, die in seinen Gliedmaßen schlackerten. Er war wütend auf Edvin gewesen, weil er nur seinetwegen so lange geschwommen war.
Und jetzt war sein Bruder tot.
Er konnte es immer noch nicht glauben. Konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Edvin in dieser winzigen weißen Holzkiste lag, die über und über mit Blumen geschmückt war. Er fühlte auch nichts. Sein Inneres war wie erstarrt, als befände er sich immer noch im eiskalten Wasser wie an dem Tag, als das Bild entstanden war. Der letzte, an dem sie alle glücklich gewesen waren.
Seine Mutter öffnete ihre Handtasche und reichte ihm ein Papiertaschentuch. Er nahm es automatisch, merkte erst jetzt, dass sein Gesicht nass von Tränen war. Sein Vater, der an seiner anderen Seite saß, legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter. Sie fühlte sich an wie ein Bleigewicht.
Der Pfarrer sprach darüber, was für ein wundervoller Junge Edvin gewesen sei. Immer gut gelaunt und fröhlich, mit diesem ansteckenden Lachen. Von der dunklen Seite sagte er nichts.
Er hörte nicht mehr zu, starrte nur immer weiter den Sarg und das Foto an. Das Brot, das er am Morgen hinuntergewürgt hatte, lag ihm wie ein Stein im Magen, der immer größer wurde. Sein Kopf fühlte sich dumpf an, angefüllt mit einer wattigen Leere.
Er bekam gar nicht mit, dass der Pfarrer seine Predigt beendet hatte. Erst als sein Vater ihn sanft von der Bank hochzog, wurde ihm klar, dass er nach vorn gehen und Abschied von Edvin nehmen musste.
Wieder blickte er auf den Sarg, dann auf das Foto.
Geliebter, gehasster Bruder.
Es tut mir so leid.
Er drehte sich abrupt um, trat zurück in die Reihe. Mechanisch folgten er und seine Eltern dem Pfarrer und den Sargträgern hinaus aus der Kapelle zu dem frisch ausgehobenen Grab. Mit gesenktem Kopf trottete er hinter ihnen her und registrierte nicht die Schönheit der Anlage, nicht das frische Grün, das in der Sonne leuchtete, nicht die hübschen Blumen, die den Friedhof zierten. Er sah nur die grauen Pflastersteine zu seinen Füßen, und in seinem Kopf hämmerte unablässig derselbe Gedanke.
Es ist alles meine Schuld.
1
Er hatte schon ein ungutes Gefühl gehabt, als sie sich am Hamburger Flughafen in die Schlange am Check-in-Schalter eingereiht hatten. Jessica hatte dichtgehalten und ihnen bis zum Abflug nicht verraten, wohin die Reise gehen sollte. Und dann war es ausgerechnet Landvetter gewesen. Dabei hatte er auf keinen Fall nach Schweden gewollt, schon gar nicht nach Göteborg.
Während des Flugs hatte er versucht, sie auszuquetschen, doch Jessica hatte nur geheimnisvoll gelächelt. Julius hätte sie am liebsten geschüttelt. Er hasste Überraschungen. Und diese hier versprach eine zu werden, die ihm überhaupt nicht gefiel.
Er hoffte, dass sie wenigstens in der Stadt blieben, doch Jessica dirigierte sie zum Bus nach Saltholmen, gleich nachdem sie ihr Gepäck in Empfang genommen hatten. Julius tauschte einen kurzen Blick mit Kai und sah, dass der sich ebenso unbehaglich fühlte wie er.
»Jetzt sag schon«, drängte er. »Wohin fahren wir?«
»Wart’s ab«, erwiderte Jessica. Sie warf ihre glänzenden goldbraunen Haare zurück, kletterte ihnen voran in den Bus und setzte sich mit Daniela in die erste Reihe. Julius blieb nichts anderes übrig, als sich mit Kai auf die Plätze daneben zu schieben.
Er starrte aus dem Fenster, während der Bus nach Göteborg hineinfuhr, vorbei an der Oper und dem Stenpiren, dem Nahverkehrshafen im Zentrum, dann an den Anlegern der großen Fähren. Hinter ihnen ragte der »Lippenstift« auf, dieses hässliche rot-weiße Gebäude, das zum unattraktiven Wahrzeichen der Stadt geworden war.
Nachdem sie Göteborg im Westen wieder verlassen hatten, ging die Fahrt an der Küste entlang, vorbei an grauen Felsen und lichten Birkenwäldern, bis sie schließlich den Fähranleger Saltholmens Brygga erreichten.
Jessica stieg als Erste aus und strebte auf die Fähre zu. Brännö Husvik stand auf dem Schild über der Brücke.
Julius musste schlucken. Er drehte sich zu Kai um und sah, dass seinem Freund alle Farbe aus dem Gesicht gewichen war. Julius schloss kurz die Augen und versuchte, sich zu beruhigen. Asperö war nur einer der möglichen Ausstiege. Es konnte gut sein, dass sie einfach daran vorbeifuhren. Trotzdem hätte er am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht. Aber dann hätte er seiner Frau erklären müssen, weshalb er nicht dorthin wollte. Und das war vollkommen unmöglich.
Also betrat er die Personenfähre und folgte Jessica auf das offene Oberdeck mit den Sitzbänken. Wieder ließ sie sich neben Kais Frau Daniela nieder, so als wollte sie vermeiden, dass er sie in eine Diskussion verwickelte.
In seinem Innern breitete sich ein unerträgliches Kribbeln aus. Asperö war ein Stück Vergangenheit. Niemals wieder hatte er diese Insel betreten wollen. Natürlich konnte er nicht vergessen, was damals geschehen war, aber er konnte es zumindest verdrängen. Nur mit Mühe schaffte er es, auf seinem Platz sitzen zu bleiben. Er wollte sich bewegen, je schneller, desto besser. Mit dem Quad durch die Wüste bei Abu Dhabi oder mit dem Jetski an der kalifornischen Küste entlang. Wenn er wenigstens ein schnelles Boot mieten könnte. Doch auf diesen winzigen Inseln würde er kaum etwas Passendes finden.
Während seine Gedanken um Flucht kreisten, steuerte die Fähre Asperö Östra an. Jessica stand auf und lief beschwingt die Stufen zum Hauptdeck hinunter. Julius trottete hinter ihr her und fühlte sich wie ein Ochse auf dem Weg zur Schlachtbank. Jessica wollte tatsächlich nach Asperö. Kaum hatte man die Klappe der Fähre hinuntergelassen, lief seine Frau auch schon an Land und winkte ein Taxi heran.
Sie drängten sich zu dritt auf die Rückbank. Julius merkte, wie er sich völlig verspannte. Kai und seine Frau Daniela waren beide nicht besonders schlank, und Julius quetschte sich an die Tür. Dabei hasste er körperliche Beengtheit mehr als alles andere.
Die Fahrt dauerte nur knapp fünf Minuten. Dann hielt das Taxi vor einem großen Gebäude im Schwedenstil, rot gestrichen, mit weißen Fensterrahmen und Umrandungen.
Julius starrte bestürzt zwischen den Vordersitzen durch die Windschutzscheibe. Nicht wegen des Hauses, sondern wegen der beiden Personen, die davor warteten.
Das hatte ihm gerade noch gefehlt.
Im selben Moment, als sie Julius’ Miene sah, wusste sie, dass es ein Fehler gewesen war, herzukommen. Obwohl er sich Mühe gab, seine Emotionen zu verbergen, stand ihm der Schock ins Gesicht geschrieben.
Sie hatte ja auch gar nicht gewollt. Nicht nachdem sie den Wettstreit gegen Julius und Kai so schmählich verloren hatte. Dabei war sie die aussichtsreichste Kandidatin gewesen. Sie war jünger, hatte die besseren Zeugnisse, einen guten Draht zu den Klienten. Doch als es wirklich darauf ankam, waren ihr plötzlich am laufenden Band dumme Missgeschicke unterlaufen. Verpasste Termine, nicht eingehaltene Fristen, verlegte Notizen. Erst als es längst zu spät war, ging ihr auf, dass es nicht ihre eigene Schusseligkeit war, derentwegen ihr Julius und Kai den Jackpot vor der Nase weggeschnappt hatten. Die beiden hatten an der Sache gedreht. Und sie hatte es nicht bemerkt.
Seit Pia das klar geworden war, fühlte sie sich vollkommen leer. Monatelang hatte sie ihre gesamte Energie in das Projekt Aufstieg gesteckt. Sie hatte weit über ihre Grenzen gelebt. Zu wenig geschlafen, sich zu wenig bewegt, die falschen Dinge gegessen. Sie hatte etliche Kilos abgenommen, und ihr eigentlich hübsches Gesicht wirkte ausgemergelt.
Burn-out, hatte die Therapeutin festgestellt, an die Pia sich schließlich gewandt hatte, und ihr eine Auszeit verordnet. Das war der Grund, weshalb Jessica ihr vorgeschlagen hatte, sie in den Urlaub zu begleiten. Pia hatte sich gesträubt. Ausgerechnet mit den beiden Männern verreisen, die die Schuld an ihrer Misere trugen? Doch Jessica hatte nicht lockergelassen. Es sei die perfekte Gelegenheit, die beiden zur Rede zu stellen. Jessica war empört darüber, was Julius und Kai sich geleistet hatten. Sie wollte mit den beiden ein Hühnchen rupfen, nicht Pia, der fehlte dazu die Kraft. Doch ausgerechnet ihre Therapeutin hatte Jessicas Plan unterstützt. Die Konfrontation würde ihr helfen, das Erlebte zu bewältigen und ihre Energie zurückzugewinnen, hatte sie gemeint. Was für ein Blödsinn!
Immerhin, Jessicas Augen leuchteten, als sie aus dem Taxi sprang, und sie schloss Pia stürmisch in die Arme.
»Wie schön, dass du da bist.«
Pia entspannte sich ein wenig. Vielleicht würde ihr die Nähe ihrer besten Freundin tatsächlich guttun.
Julius kam auf sie zu und reichte ihr die Hand. Er lächelte sogar. Dann verfinsterte sich sein Blick jedoch wieder. Er schaute den Mann an, der mit derselben Fähre wie Pia auf der Insel angekommen und die ganze Zeit hinter ihr hergelaufen war, bis sie schließlich das Haus erreichten und feststellten, dass sie dasselbe Ziel hatten. Erst da war ihr eingefallen, dass Jessica gesagt hatte, sie hätte noch jemanden eingeladen: Julius’ alten Freund Steffen.
Sie hoffte nur, dass Jessica keine romantischen Ideen hegte. Dieser Steffen sah zwar nicht schlecht aus mit seinen braunen Locken, den dunklen Augen und dem Dreitagebart, aber er hatte etwas Rohes an sich. Wild, ungezügelt, abenteuerlustig wirkte er. Die Sorte Mann, bei der so manche Frau ins Träumen kam. Pia gehörte nicht dazu. Sie mochte Männer, die weicher waren. Sensibel, fürsorglich, verständnisvoll. Leider hatte sie bisher noch keinen gefunden, der ihren Wünschen entsprach.
»Steffen.« Julius reichte dem Abenteurer die Hand. Seine Stimme war so kalt, als hätte er mit Eiswürfeln gegurgelt, und Pia ging auf, dass seine versteinerte Miene nicht ihr gegolten hatte, sondern dem Mann neben ihr.
Wusste Julius überhaupt, dass sie begriffen hatte, was Kai und er ihr angetan hatten? Oder dachte er immer noch, dass sie die Schuld bei sich selbst suchte? Immerhin hatte sie es über Monate getan, zu gutgläubig und blind, um sich vorstellen zu können, dass ihre beiden Kollegen, die so freundlich und charmant waren, zu solchen Mitteln greifen würden, um sie zu überflügeln.
Mobbing hatte es ihre Therapeutin genannt.
Pia hatte sich mit dem Begriff schwergetan. Bedeutete das nicht, dass man ein Opfertyp war? Ein Mensch, dessen soziales Unvermögen dazu führte, dass er zum Spielball seiner Kollegen wurde? Ihre Therapeutin hatte sich den Mund fusselig geredet, um sie zu der Einsicht zu bewegen, dass Mobbing jedem passieren konnte. Egal, ob man in Ordnung war oder nicht. Manchmal reichte es, etwas zu besitzen, das jemand anders haben wollte. Oder schlichte Konkurrenz, so wie in ihrem Fall. Pia hatte dazu genickt, doch tief im Innern war sie nach wie vor davon überzeugt, dass es etwas mit ihr zu tun hatte. Mit der Person, die sie war.
»Julius.« Steffen nahm Julius’ Hand und drückte sie. Zu fest für dessen Geschmack, wenn Pia das Zucken in Julius’ Mundwinkeln richtig deutete. Als Steffen ihn wieder losließ, schüttelte er verstohlen die Finger aus.
Steffen wandte sich an Kai, der kaum weniger entsetzt wirkte als Julius.
»Kai.« Steffen ergriff auch dessen Hand. »Schön, euch wiederzusehen.«
»Ja.« Kai rang sich ein mühsames Lächeln ab. »Ich wusste gar nicht, dass du wieder draußen bist.«
Bei Pia läuteten die Alarmglocken. Jessica hatte gesagt, Steffen sei ein Freund, der eine schwere Zeit hinter sich habe. Von einem Gefängnisaufenthalt war nicht die Rede gewesen. Aber wie sonst sollte man Kais Worte interpretieren?
»Seit zwei Monaten«, erklärte Steffen und drehte sich zu Daniela um. Sie schien ihn nicht zu kennen, zumindest war ihre Miene eher fragend als ablehnend.
»Du musst Daniela sein, Kais Frau.«
»Richtig.« Sie schüttelte ihm die Hand.
»Ich bin Steffen, ein alter Freund von Julius und Jessica. Sie hat gesagt, du bist Krankenschwester?«
»Stimmt.«
»Dann kann uns ja nichts passieren«, witzelte er. In Pias Ohren klang es fast wie eine Drohung. Hatte Steffen etwa noch eine Rechnung mit Julius und Kai offen?
Vielleicht wäre es das Beste, sofort die Heimreise anzutreten, doch Jessica ließ ihr keine Chance. Sie lächelte strahlend und zog einen Schlüssel aus ihrer Handtasche.
»Also. Willkommen auf Asperö. Wir werden uns hier zwei wunderbare Wochen machen«, sagte sie und öffnete die Haustür.
Pia kannte Jessica seit vielen Jahren, doch sie hätte nicht sagen können, ob ihre Freundin das ernsthaft glaubte. Falls ja, war sie wahrscheinlich die Einzige.
2
Die Luft war so klar, wie sie es zu Hause in Hamburg nie erlebte. Am Morgen war die Sonne hinter zarten Dunstschleiern aufgegangen, doch im Laufe des Vormittags hatten sich die Wolken verzogen. Für Ende September war es außergewöhnlich schön.
Jetzt stand die Sonne fast im Zenit, und die Temperatur schien mit jeder Minute zu steigen. Daniela wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Sie hoffte, dass es im Laufe des Nachmittags abkühlen würde.
Behutsam pflückte sie einen der Pilze, die zwischen Moos und Flechten auf dem steinigen Waldboden wuchsen, und legte ihn zu den anderen in ihrem Korb. Die Bäume um sie herum warfen wohltuende Schatten. Es ging kaum ein Lüftchen, doch hier in dem kleinen Wald konnte man es aushalten.
Es war das erste Mal, dass sie auf den Schären war, und sie musste zugeben, dass die Landschaft einmalig war. Buckelige Felseninseln in einem blau schimmernden Meer, so ruhig und friedlich, dass man glaubte, alle Ängste und Sorgen vergessen zu können. Vielleicht hätte es sogar funktioniert, wenn sie mit Kai alleine hergekommen wäre. Doch die Konstellation, in der sie sich hier zusammengefunden hatten, sorgte dafür, dass sich nichts von der wohltuenden Atmosphäre in ihrem Innern ausbreiten konnte.
Daniela fühlte sich nicht frei, sondern eingesperrt. Weil sie hier nicht einfach wegkonnte, und weil die Insel so klein war. Es gab ja nicht einmal Ferienunterkünfte.
Jessica hatte natürlich trotzdem eine gefunden. Ein Freund und Kollege ihres Vaters, ein Anwalt für internationales Wirtschaftsrecht mit eigener Kanzlei, siedelte gerade von Göteborg nach Stockholm über. Sein Haus auf Asperö war bereits von persönlichen Gegenständen entleert, aber die Möbel waren noch dort. Er hatte Jessicas Vater angeboten, es über den Sommer als Ferienhaus zu nutzen, ehe im Herbst die Möbelpacker kamen. Für die Tochter seines alten Freundes machte er einen guten Preis.
Das Haus lag einsam in der Mitte der Insel, umgeben von einem dichten Ring aus dunkelgrünen Bäumen. Es verfügte über drei Schlafzimmer, ein großzügiges Wohnzimmer, eine komfortabel eingerichtete Küche, zwei Bäder und eine große Terrasse. Für ihre Reisegruppe fehlte eigentlich ein Zimmer, aber Steffen hatte sich sofort bereit erklärt, im Wohnzimmer auf dem Sofa zu schlafen.
Es war die perfekte Kulisse für einen Traumurlaub, doch Daniela wäre trotzdem lieber zu Hause geblieben. Oder anderswo hingefahren. Je weiter von Julius entfernt, desto besser. Aber Kai war natürlich Feuer und Flamme gewesen, als Jessica den Vorschlag gemacht hatte, gemeinsam zu verreisen.
Die beiden Männer waren so gut wie unzertrennlich. Seit sie sich am ersten Tag ihres Jurastudiums kennengelernt hatten, unternahmen sie einfach alles zusammen. Besuchten jede Vorlesung und jedes Kolloquium gemeinsam, büffelten zu zweit für die Prüfungen. Fingen nach dem Abschluss in derselben Kanzlei in Hamburg an.
Daniela verstand bis heute nicht, warum Julius nicht bei Jessicas Vater eingestiegen war. Wirtschaftsanwälte verdienten überdurchschnittlich gut, und sein Schwiegervater hätte Julius sicher den roten Teppich ausgerollt. Aber Julius hatte sich entschieden, Strafverteidiger zu werden, genau wie Kai. Wahrscheinlich wollte er beweisen, dass er es auch aus eigener Kraft zu etwas brachte.
Mittlerweile hatten sie es beide geschafft. Seit dem letzten Monat waren Julius und Kai Teilhaber in der Hamburger Kanzlei. Ein Ereignis, das es zu feiern galt, fand Jessica, und hatte deshalb diese Reise organisiert. Sie hatte ihnen das genaue Ziel nicht verraten, nur dass es Schweden sein sollte, wahrscheinlich, weil Julius’ und Kais gemeinsamer Urlaub nach dem Examen sie dorthin geführt hatte. Auch dass sie nicht zu viert, sondern zu sechst sein würden, hatten sie erst erfahren, als sie bereits vor Ort waren.
Dass Jessica ihrer besten Freundin Pia vorgeschlagen hatte, die beiden Ehepaare zu begleiten, konnte Daniela gerade noch verstehen, auch wenn sie an Pias Stelle sicherlich abgelehnt hätte. Immerhin hatte sich Julius’ und Kais junge Kollegin ebenfalls Hoffnungen auf eine Teilhaberschaft gemacht, war aber von den beiden Männern ausgestochen worden.
Was sie dagegen überhaupt nicht begriff, war, weshalb Jessica auch Steffen eingeladen hatte. Einen Mann, der bis vor Kurzem im Gefängnis gesessen hatte, und, wie sie inzwischen erfahren hatte, ein ehemaliger Klient von Julius und Kai war. Angeblich ging es Jessica darum, ihm den Wiedereinstieg in ein normales Leben zu erleichtern, weil Steffen ein alter Freund von Julius war. Doch Jessica hatte eigentlich keine ausgeprägte soziale Ader. Es musste noch irgendetwas anderes dahinterstecken.
Daniela holte tief Luft. Letztlich war es auch egal. Jessicas Plan war ohnehin nicht aufgegangen. Die ausgelassene Stimmung, die auf der Fahrt zum Hamburger Flughafen geherrscht hatte, war verflogen, als sich herausstellte, dass die Reise nach Göteborg ging, und die Atmosphäre war geradezu eisig geworden, als sie bei ihrer Unterkunft auf Asperö auf die beiden Überraschungsgäste stießen, die mit der Fähre von Kiel gekommen waren.
Daniela konnte sich keinen Reim darauf machen, und sie hatte auch aus Kai nichts herausbekommen, aber das Ende vom Lied war, dass sie nichts gemeinsam unternahmen, sondern jeder seiner eigenen Wege ging.
Ihr war das ganz recht. So war sie zumindest nicht die ganze Zeit mit Julius konfrontiert. Und sie hatte etwas gefunden, das ihr Freude machte. In dem Gehölz, das das Haus umgab, wuchsen zahlreiche Pilze. Weil sie für ihr Leben gern kochte, hatte sie vor einigen Jahren einen Volkshochschulkurs besucht und gelernt, welche giftig und welche essbar waren. Sie hatte auch eine ganze Reihe toller Rezepte gelernt.
Mittlerweile war der kleine Korb, mit dem sie sich nach dem zweiten Frühstück auf den Weg gemacht hatte, gut gefüllt. Wenn sie im Supermarkt im Ort ein paar Zutaten kaufte, könnte sie am Abend ein wunderbares Geschnetzeltes mit Röstkartoffeln und Pilzen zubereiten. Vielleicht würde das die Stimmung verbessern.
Ganz kurz durchzuckte sie der Gedanke, dass sie auch ein paar giftige Exemplare einsammeln und sie Julius unters Essen mischen könnte. Sie tat es natürlich nicht, aber die Vorstellung, wie er sich auf den Tisch übergab und unter Krämpfen zuckend vom Stuhl stürzte, hob ihre Laune beträchtlich.
Mit mehr Optimismus als noch vor ein paar Stunden machte sie sich auf den Weg zurück zum Haus. Sie sang sogar vor sich hin, einen alten ABBA-Song von dem Album, das ihre Eltern rauf- und runtergehört hatten, als sie mit dem Wohnwagen nach Dänemark gefahren waren. Acht oder neun musste sie da gewesen sein. Sie hatte die Musik gemocht, auch wenn sie schon damals nicht mehr up to date gewesen war. Aber die Lieder waren so beschwingt, und sie erinnerten Daniela an die glücklichen Tage. Ehe es zwischen ihren Eltern ständig Zank und Streit gegeben hatte.
Als sie aus dem Wald hinaustrat, fiel ihr auf, dass die Haustür offen stand. Sie klapperte im Wind, und in der Luft hing ein seltsamer Geruch, irgendwie metallisch. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie einen Schatten, ein Huschen am Waldrand, doch als sie den Kopf drehte, war nichts zu sehen. War dort ein Mann gewesen, eine schlanke, dunkel gekleidete Gestalt? Oder hatte ihre Fantasie ihr einen Streich gespielt?
Wahrscheinlich war es nur ein Ast gewesen, der sich im Wind bewegte. Trotzdem hatte sie das bedrückende Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie packte den Henkel ihres Korbs fester und beschleunigte ihre Schritte. Was immer es war, sie würde der Sache auf den Grund gehen.
Er wusste nicht, wie lange er schon auf den Schwimmer starrte, der träge auf den Wellen dümpelte. Vor zweihundert Jahren hatte man hier auf Asperö vom Fischfang gelebt, doch dann war der Hering ausgeblieben, und die Menschen hatten sich neu orientieren müssen. Statt selbst die Früchte des Meeres einzubringen, hatten sie sich auf den Handel verlegt.
Aber mit was?, fragte sich Kai. In den Stunden, die er seit dem frühen Morgen hier saß, hatte noch nicht einmal der winzigste Fisch angebissen. Aber die großen Kutter machten wohl weiter draußen auf der Nordsee immer noch ihren Fang. Ihm selbst dagegen blieb der Erfolg verwehrt.
Es kam ihm wie ein Sinnbild seines Lebens vor.
Dabei hatte doch alles so hoffnungsvoll begonnen. Damals, als er Julius begegnet war, gleich auf der ersten Party des Einstiegssemesters. In der Schule hatte er keine richtigen Freunde gehabt, nur eine Clique, mit der er sich regelmäßig traf. Doch die Jungs waren ihm immer fremder geworden. Alle hatten nach der zehnten Klasse mit der Schule aufgehört, verdienten Geld, redeten über Fußball, Markenklamotten und Frauen. Themen, bei denen er nicht mithalten konnte. Er war nicht sportlich, hatte kein Geld für teure Labels, und die Frauen interessierten sich nicht für ihn. Immer mehr hatte er sich als Außenseiter gefühlt. Bis Julius ihm vor Augen geführt hatte, dass er etwas aus seinem Leben machen konnte.
Es war verdammt harte Arbeit gewesen. Er war kein Überflieger wie Julius, aber er hatte es geschafft. Die ganze Büffelei hatte sich ausgezahlt. Julius hatte es fertiggebracht, dass sie ihr Referendariat gemeinsam in der Hamburger Kanzlei absolvieren konnten, und anschließend hatte man sie beide übernommen.
Julius war sein großes Vorbild gewesen. Viel zu spät hatte er kapiert, dass sein Freund ihn nur manipulierte. Aber da war schon alles aus dem Ruder gelaufen. Und Julius hatte seine Schwäche gnadenlos ausgenutzt.
Fast hätte Kai gelacht. Nach außen hin schien sein Leben perfekt. Eine glänzende Fassade, von anderen mit Anerkennung, manchmal auch mit Neid betrachtet. Doch dahinter befand sich ein Abgrund.
Es war diese Reise damals nach Schweden gewesen, der Trip nach dem Studium, der größte Fehler seines Lebens. Danach waren weitere gefolgt, als wäre dieser erste der Dominostein gewesen, der eine ganze Reihe anderer zum Umfallen gebracht hatte. Seitdem hatte Julius ihn in der Hand. Mit einem einzigen Fingerschnipsen könnte er alles, was Kai sich in den letzten dreizehn Jahren aufgebaut hatte, zum Einsturz bringen. Der Gedanke daran quälte ihn jede Nacht.
Er hätte auf Daniela hören sollen. Sie hatte Julius nie gemocht. Doch er hatte diese Tour unbedingt machen wollen. Das erste und wahrscheinlich letzte halbwegs große Abenteuer seines Lebens. Gerade weil sie beide plötzlich keine Singles mehr waren. Ein halbes Jahr vor Ende des Studiums hatte Julius Jessica kennengelernt. Kai war zuerst eifersüchtig gewesen und dann wütend auf sich selbst, weil es einfach zu albern war. Um sich zu beweisen, dass er auch ohne Julius Spaß haben konnte, war er in einen Klettergarten gegangen. Obwohl man dort bestens gesichert war, hatte er es geschafft, sich den Fuß zu brechen.
Im Krankenhaus hatte ihn Schwester Daniela umsorgt, und er hatte sich in sie verliebt. Julius hatte sich den Mund fusselig geredet, um ihn von diesem Unsinn, wie er es nannte, zu kurieren. Was er denn mit diesem naiven blonden Pummelchen wolle? Einer Frau völlig unter seinem Niveau? Diese angebliche Verliebtheit könne doch nur eine Folge der Narkosemittel sein, die ihm das Hirn vernebelten.
Kai hatte seinen bissigen Spott ignoriert. Ein Jahr später hatte er Daniela geheiratet, zwei Monate nachdem sich Julius und Jessica das Jawort gegeben hatten.
Natürlich konnte Daniela nicht mit Jessica mithalten. Jessica war attraktiv, stammte aus gutem Haus und hatte ihr Examen als Steuerberaterin mit Bestnoten abgeschlossen. Daniela kam aus einfachen Verhältnissen wie er selbst. Sie war nicht schlagfertig, ironisch und witzig wie Julius und Jessica. Aber sie war herzlich und treu. Und sie liebte ihn. In schwachen Momenten fragte er sich, ob für ihn dasselbe galt, oder ob er Daniela nur aus Trotz geheiratet hatte, um vor Julius nicht als Versager dazustehen. Doch diesen Gedanken verdrängte er jedes Mal schnell. Auf manche Fragen suchte man besser keine Antwort.
Der Schwimmer begann plötzlich auf der Wasseroberfläche zu tanzen. Kai hob eilig die Angel und drehte an der Kurbel. Die Leine wickelte sich auf, und gleich darauf kam der Haken zum Vorschein. Er war leer.
Kai seufzte enttäuscht.
Als sie auf der Insel angekommen waren und die beiden anderen getroffen hatten, war ihm klar geworden, dass er etwas unternehmen musste. Auch wenn es ihm wehtat. Er wollte seinen besten Freund nicht verlieren. Obwohl er ihn längst durchschaut hatte, war er immer noch einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Aber ihm blieb keine andere Wahl.
Er schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es bereits früher Nachmittag war. Zeit, zum Haus zurückzukehren und nachzusehen, ob sein Plan aufgegangen war.
Sorgfältig wie immer packte er seine Sachen zusammen. Er rollte die Angelschnur auf, entfernte den Haken und verstaute ihn in einem separaten Etui. Anschließend steckte er die Angel in ihre Hülle und zog den Reißverschluss zu. Als alles erledigt war, nahm er die Ruder des kleinen Bootes auf und fuhr zurück zur Insel. An einer flachen Stelle zog er es auf die Felsen und marschierte zwischen den Bäumen hindurch zum Haus.
Seine Frau stand vor der Eingangstür, als hätte sie der Blitz getroffen. Ihr Gesicht war weiß wie eine Wand. Hinter ihr auf der Schwelle lag etwas, ein umgekippter Weidenkorb. Ringsherum waren zahllose Pilze verstreut. Einige sahen aus, als hätte sie sie zertreten.
Erst als er näher kam, bemerkte er, dass die gesamte Vorderseite ihres Kleids mit etwas Rotem verschmiert war. Es zog sich in dunklen Streifen an den Ärmeln entlang, und auch an ihren Händen klebte die zähe Flüssigkeit. Kai wusste sofort, was es war, auch wenn sein Verstand sich weigerte, es zu akzeptieren.
Blut. Alles war voller Blut.
Sie keuchte, als sie zum dritten Mal den Weg um die Insel herumlief. Immer noch hielt sie ein hohes Tempo, als ob sie davonrennen wollte, dabei führte der Weg unweigerlich immer wieder zurück zum Haus. Jessica wischte sich den Schweiß ab, der ihr vom Haaransatz in die Augen rann. Der Rücken ihres Laufshirts war komplett durchnässt, genau wie die Achselhöhlen. Es war heiß; die Sonne stand hoch am klaren blauen Himmel. Das Licht funkelte auf dem Wasser des Kattegat, das überall zwischen den Bäumen hervorblitzte.
Es war noch viel schöner, als sie es sich erhofft hatte. Trotzdem war ihr alles andere als fröhlich zumute.
War es falsch gewesen, die Sache derart zu forcieren? Hätte sie sich und den anderen mehr Zeit geben sollen? Aber das Warten lag ihr nicht. Sie glaubte nicht daran, dass sich Dinge von selbst klärten. Wenn man etwas erreichen wollte, musste man daran arbeiten. Genau das hatte sie getan.
Sie näherte sich dem dichten Ring aus Bäumen, der das Haus umgab, und ihre Schritte wurden langsamer. Plötzlich war sie sich gar nicht mehr sicher, dass sie die Konfrontation durchstehen würde. Aber nachdem sie die Sache nun einmal ins Rollen gebracht hatte, musste sie sie auch durchziehen. Es durfte nur niemand merken, dass ihr fast schlecht vor Angst war.
Als sie zwischen den Bäumen hervortrat, entdeckte sie Kai und Daniela. Sie standen vor dem Haus wie verlorene Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Daniela schien zu zittern und fuhr sich immer wieder mit beiden Händen übers Gesicht. Kai war vollkommen erstarrt. Er machte keine Anstalten, sich ihr zuzuwenden und sie zu trösten.
Jessica beschleunigte ihre Schritte wieder. Kai und Daniela wandten ihr die Köpfe zu, und sie erkannte die Panik in ihren Blicken.
»Jessica.«
Kais Stimme klang dumpf. Sie schaute erst ihn, dann Daniela an. Jetzt, aus der Nähe, sah sie, dass ihr Gesicht nass von Tränen war und ihr Kleid und ihre Hände mit irgendetwas Rotem verschmiert waren. Hatte sie nicht eigentlich Pilze sammeln wollen? Aber vielleicht hatte sie sich ja stattdessen für Himbeeren oder Brombeeren entschieden. War sie dabei ins Dornengestrüpp gestürzt und hatte sich verletzt? Angesichts der großen Menge roter Flüssigkeit erschien ihr diese Erklärung allerdings nicht sehr plausibel. Doch was war es dann?
»Was ist denn los?«
Die beiden antworteten nicht. Daniela gestikulierte nur hilflos in Richtung des Schwedenhauses. Jessica setzte sich in Bewegung.
Kai war mit zwei Schritten bei ihr und griff grob nach ihrem Arm.
»Nein. Geh da nicht rein.«
Jessica riss sich unwillig los. Sie ließ sich nichts vorschreiben, schon gar nicht von einem Waschlappen wie Kai. Energisch strebte sie zur Haustür. Kai folgte ihr nicht. Er blieb mit hängenden Armen neben seiner Frau stehen, genauso passiv und durchsetzungsschwach, wie sie ihn kannte.
Ein unangenehmer Geruch schlug ihr entgegen. Eine Mischung aus rohem Fleisch und noch etwas anderem, irgendwie Metallischem. In ihrem Hinterkopf schrillte eine Alarmglocke. Die beiden mussten etwas wirklich Übles angestellt haben.
Vom Hauseingang aus konnte sie durch den Flur und die offen stehende Tür in die Küche sehen.
Jessica blieb wie angewurzelt stehen. Ein schriller Schrei gellte ihr in den Ohren. Erst mit Verspätung begriff sie, dass sie selbst es war, die geschrien hatte.
Wie von einer unsichtbaren Hand geschoben, bewegte sie sich durch den Flur zur Küche. Sie blinzelte, als könnte sie so das grässliche Bild vertreiben, das sich ihr bot, doch egal, wie oft sie die Lider senkte und wieder hob, es änderte sich nichts.
Julius lag rücklings auf dem Boden. Mund und Augen standen offen, die blonden Haare waren wie ein Fächer um seinen Kopf ausgebreitet. Das weiße Hemd war zerrissen und mit Blut getränkt. Neben ihm auf dem Boden lag ein Messer mit blutverschmierter Klinge.
Jessica wandte sich abrupt ab und stürzte ins Bad. Eine eiserne Hand würgte sie und presste ihren Magen zusammen. Sie schaffte es gerade noch, den Toilettendeckel hochzuklappen.
Das hatte sie nicht gewollt.
3
Frederik Forsberg stellte seinen Elektroroller vor der weißen Villa ab und ging die Stufen zum Eingang hinauf. Wie immer genoss er die Stille dieses Ortes, der abgeschieden in einem hellen Birkenhain in der Nähe von Lilleby lag. Er öffnete die Eingangstür und lief durch die Halle und den langen, in hellen Pastelltönen – Gelb, Rosa, Orange – gestrichenen Flur zu Emmas Zimmer. Er freute sich darauf, das Mädchen zu sehen, auch wenn es ihn schmerzte, dass Emma in dieser Einrichtung leben musste. Andererseits könnte er sie vermutlich gar nicht treffen, wenn sie bei ihrer Mutter und deren Mann wohnte.
Er hatte Arvid Ekström seit dem letzten Sommer nicht gesehen, doch ihre letzte Begegnung in der Göteborger Oper stand ihm immer noch wie ein grelles Zerrbild vor Augen. Ekström hatte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass es ihm nicht gut bekäme, wenn er sich weiter in seine Angelegenheiten einmischte.
Auch Lea hatte er seitdem nur wenige Male getroffen. Nachdem Ekström herausgefunden hatte, dass sie sich kannten, war es noch gefährlicher geworden. Immerhin glaubte er nicht länger, dass seine Frau Informationen über seine Geschäfte an die Polizei weitergegeben hatte, vor allem wohl deshalb, weil sie schlicht nichts wusste. Aber er ahnte, dass es zwischen ihnen eine Anziehung gab, auch wenn ihm sicher nicht klar war, wie gut sie sich kannten. Andernfalls hätte er Lea wahrscheinlich eingesperrt.
Viele Gelegenheiten, allein das Haus zu verlassen, gewährte er ihr trotzdem nicht mehr. Im Gegensatz zu früher begleitete er sie fast immer, wenn sie ins Theater oder zu irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen ging. Lea informierte ihn darüber mit dem geheimen Handy, das Frederik ihr besorgt hatte.
Seine Gedanken kreisten ständig um sie. Er liebte diese Frau, doch solange sie bei ihrem Mann blieb, konnte er nichts tun. Natürlich verstand er, dass sie Angst hatte. Ekström war skrupellos und gewaltbereit. Frederik hatte drei Jahre lang vergeblich versucht, den Spediteur wegen seiner illegalen Waffengeschäfte hinter Gitter zu bringen. Er vermutete auch, dass Ekström für den Anschlag verantwortlich war, den man im letzten Sommer auf sein Boot verübt hatte. Aber er konnte es nicht beweisen.
Lea war eine wunderschöne Frau, doch ihr Körper wurde fast immer von blauen Flecken verunstaltet. Frederik wusste, dass ihr Mann sie schlug. Deshalb, aber auch wegen Emma, wünschte er sich, sie würde ihn endlich verlassen. Doch Lea fürchtete sich viel zu sehr davor, dass er ihr die Tochter wegnehmen könnte.
Frederik schob die Gedanken beiseite. Er wollte Emma nicht mit seiner düsteren Stimmung belasten. Das Mädchen war hochsensibel und reagierte extrem auf Irritationen. Bei Emma musste alles seine Ordnung haben. Das war der zentrale Bestandteil ihrer Persönlichkeit.
Sacht klopfte er an und drückte leise die Klinke. Emma mochte keine lauten Geräusche. Er öffnete die Tür und trat ins Zimmer. Dann blieb er überrascht stehen.
Er hatte erwartet, Emma beim Sortieren ihrer Legosteine vorzufinden. Sie spielte nicht mit ihnen, sondern ordnete sie nach Größe und Farbe. Ihr Zimmer war stets so aufgeräumt, wie es sich die Eltern anderer Kinder nur wünschen konnten, doch jetzt sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Die Legosteine waren über den ganzen Raum verstreut. Die Boxen, in denen Emma sie gewöhnlich verwahrte, lagen überall auf dem Boden herum, statt wie sonst in Reih und Glied zu stehen. Der Kleiderschrank war offen. Etliche Kleidungsstücke hingen schief auf den Bügeln, andere waren leer. Als hätte jemand in aller Eile ein paar Sachen herausgerissen. Jemand, der keinen Wert auf Ordnung legte.
Erst jetzt entdeckte Frederik Emmas Lieblingsspielzeug, ein gelbes Plastikauto mit großen, beweglichen Rädern samt passendem Anhänger. Es lag auf der Seite, in der Ecke neben dem Schrank. Das rechte Vorderrad war abgebrochen.
Der Anblick versetzte ihm einen Stich. Niemals hätte Emma das getan. Er spürte, wie seine Handflächen feucht wurden und sich seine Atmung beschleunigte. Was, um alles in der Welt, war hier geschehen?
»Herr Forsberg?«
Frederik zuckte erschrocken zusammen. Er hatte nicht bemerkt, dass jemand den Raum betreten hatte. Es war eine der Betreuerinnen. Sie hatte die Tür wohl ebenso behutsam geöffnet, wie er selbst es zu tun pflegte.
Er musste schlucken, weil sein Mund so ausgetrocknet war.
»Wo ist Emma?«
Die junge Frau schaute ihn traurig an.
»Ihre Eltern haben sie abgeholt. Ihr … Vater meint, es sei besser, wenn Emma bei ihnen zu Hause aufwächst.«
Frederik blinzelte. Die Auskunft traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube.
»Sie bringen sie nicht zurück?«
Die Pflegerin zupfte an ihrem Pullover. Er war hellgelb und harmonierte gut mit ihren blonden Haaren, die ihr in einem langen Zopf über den Rücken fielen. Sie hatte ein offenes Gesicht, und ihre Mundwinkel wiesen ganz leicht nach oben. Ihr Lächeln war sicher ansteckend, doch im Augenblick war alles Fröhliche in ihrem Blick erstickt.
»Ich fürchte, nein. Ihr … Vater war sehr ungeduldig. Emma wollte erst ihre Legosteine in die Boxen sortieren, aber er hat sie einfach weggetreten. Er hat auch ihren Laster kaputt gemacht.« Ihre Augen glänzten feucht. »Emma war ganz steif, ihr Gesicht vollkommen starr. Sie kann sich ja nicht wehren. Ihr … Vater hat sie einfach hochgenommen und weggetragen.«
Was sie sagte, traf ihn mitten ins Herz. Trotzdem war ihm natürlich schon beim ersten Mal die kleine Pause nicht entgangen, die sie bei der Erwähnung von Emmas Vater einlegte.
Er sprach sie nicht darauf an, sondern hob nur leicht die Augenbrauen. Das reichte schon.
Die junge Frau errötete.
»Entschuldigen Sie. Es geht mich ja nichts an. Aber ich habe Sie gesehen. Sie und Frau Ekström, meine ich. Draußen im Hof. Da war so viel …«, sie stockte, wusste wohl nicht, wie direkt sie ihm gegenüber werden durfte, »Vertrautheit zwischen Ihnen«, entschied sie sich schließlich für die Variante, die nicht geradewegs in ein Fettnäpfchen führte. »Ich dachte, vielleicht sind ja Sie …?« Wieder führte sie den Satz nicht zu Ende. »Weil Sie immer kommen und so liebevoll mit Emma umgehen. Ihre Besuche tun ihr gut. Sie ist immer viel ausgeglichener, wenn Sie bei ihr waren.«
»Danke.« Frederik freute sich über ihre Worte, weil sie ihm zeigten, dass er zumindest bei Emma etwas richtig machte. Er beschloss, ihre Offenheit mit gleicher Münze zurückzuzahlen.
»Ich weiß es selbst nicht«, sagte er ehrlich. »Aber ich wäre es gern.«
Er sah, wie es hinter der Stirn der Pflegerin arbeitete.
»Sie könnten … Ich meine, wenn Sie einfach ein paar Haare aus ihrer Bürste mitnehmen? Dann könnten Sie einen Test machen lassen. Sie sind doch bei der Polizei?«
»Ja.« Frederik erinnerte sich, dass er seinen Beruf angegeben hatte, als er sich in die Liste der Besuchsberechtigten hatte eintragen lassen. Hier im Haus gab es genügend Kinder, deren Symptome die Folge häuslicher Gewalt waren. Zumindest bei denjenigen, die das Glück hatten, dass ihren Peinigern vonseiten der Behörden der Kontakt untersagt war, wollte man sicherstellen, dass diese sich nicht heimlich Zutritt verschafften. In Emmas Fall nützte es nichts. Lea hatte die Misshandlungen nie zur Anzeige gebracht, die sie selbst erlitten hatte. Emma war von Ekström zwar nicht geschlagen worden, doch sie hatte sicher mitbekommen, wie er ihre Mutter behandelte. Frederik war davon überzeugt, dass dieses Trauma einen Anteil an ihren Entwicklungsschwierigkeiten hatte.
Natürlich hatte er selbst schon darüber nachgedacht, heimlich einen DNA-Test machen zu lassen. Er hatte Zugriff auf alle kriminaltechnischen Verfahren der Göteborger Polizeibehörde. Es wäre kein Problem, einen Kollegen um eine Analyse zu bitten. Die Wahrheit aber war, dass er sich vor dem Ergebnis fürchtete.
Was, wenn Emma tatsächlich nicht seine Tochter war?
Er hatte sich so daran gewöhnt, sich als ihr Vater zu fühlen, dass es ihn schwer träfe, wenn er es nicht wäre. Obwohl das natürlich albern war. Er könnte sich ebenso um sie kümmern wie bisher. So oder so war sie schließlich Leas Tochter, und Frederik liebte sie beide.
Die junge Pflegerin konnte ihm seine Gedanken offenbar vom Gesicht ablesen.
»Ich verstehe. Aber wir hier … Wir würden uns freuen, wenn Emma bei Ihnen und Frau Ekström leben könnte.«
Was exakt sein größter Wunsch war, zugleich aber auch vollkommen unmöglich. Dazu müsste er erst Ekström hinter Gitter bringen, und davon war er weit entfernt.
Er fragte sich, was er jetzt unternehmen könnte. Solange Arvid Ekström vor dem Gesetz Emmas Vater war, hatte er jedes Recht, Emma aus dem Heim zu holen, in das man sie freiwillig gegeben hatte. Frederik konnte überhaupt nichts dagegen tun. Dabei konnte er sich ausmalen, was geschehen würde, wenn Emma dauerhaft in Ekströms Haus lebte. Arvid hätte sicher keine Freude an diesem Kind. Er würde sie schlecht behandeln und weiter traumatisieren. Und die Chancen, dass Emma jemals aus ihrem Schneckenhaus herauskam, dramatisch verschlechtern.
Mitten in seine Überlegungen hinein klingelte sein Smartphone. Frederik zog es aus der Tasche und schaute auf das Display.
»Verzeihung. Das muss ich annehmen, ich bin im Dienst.« Der Anrufer war Birger Holm, der Chef des Göteborger Polizeipräsidiums. Frederik wandte sich halb von der Pflegerin ab, und diese trat rücksichtsvoll ein paar Schritte beiseite.
»Hallo, Frederik«, sagte Birger. »Entschuldige, wenn ich dich bei deinem spontanen Besuch bei Emma störe. Aber wir haben einen Toten auf Asperö.«
Frederik presste die Lippen zusammen. Ungünstiger hätte der Anruf nicht kommen können. Andererseits: Vielleicht war es gut, wenn er eine Aufgabe hatte. Weil er sonst vielleicht etwas sehr Dummes tat.
Im Grunde hatte er ja schon vorher geahnt, dass irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Warum sonst hatte er an einem Dienstag ganz gegen seine Gewohnheit am frühen Nachmittag das Büro verlassen, um zu Emma zu fahren? Normalerweise besuchte er sie am Wochenende, immer zur selben Zeit, weil sie keine Überraschungen mochte. Wie bei allen Asperger-Autisten waren Routine, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit entscheidende Faktoren in ihrem Leben. Und trotzdem hatte er plötzlich den unbezwingbaren Wunsch verspürt, sie zu sehen. Birger hatte nichts dagegen gehabt, dass er eine ausgedehnte Mittagspause einlegte. Es war ohnehin nicht viel zu tun gewesen.
»Sie ist gar nicht da«, berichtete er. »Ihre Eltern haben sie abgeholt.«
Birger, der mit der Situation vertraut war, seufzte leise.
»Das tut mir leid für dich.«
»Danke.« Frederik fühlte sich nicht in der Lage, mehr zu sagen. Birger verstand ihn auch so.
»Ich habe die Kollegen schon informiert. Kriminaltechnik und Rechtsmedizin sind unterwegs. Und Anna Jordt ist auf dem Weg nach Asperö. Ich hoffe, das ist dir recht?«
Frederik dachte an das zusammengewürfelte Team, mit dem er seit einem guten Jahr arbeitete. Kämpfte, wäre wahrscheinlich die treffendere Bezeichnung. Noch nie hatte er eine solche Anhäufung von Befindlichkeiten und Rivalitäten in einer Arbeitsgruppe erlebt.
»Ja. Von all den schwierigen Fällen geht es mit Anna immer noch am leichtesten.«
»Du brauchst nur etwas zu sagen«, erinnerte ihn Birger. »Ich kann jederzeit jemanden aus der Gruppe ausmustern und neue Leute anfordern.«
»Nein.« Frederik war entschlossen, es mit diesen Kollegen zu schaffen. Ein Team wie jenes, das er vor vier Jahren verloren hatte, als seine gesamte Mannschaft bei einem Einsatz ums Leben gekommen war, würde er ohnehin nie wieder finden. Das war der Grund, weshalb er Arvid Ekström unbedingt hinter Gittern sehen wollte. Es waren seine Waffen gewesen, die sich in dem geheimen Lager befunden hatten, das sie ausheben wollten. Niemand hatte geahnt, dass es Kriegswaffen waren, gegen die die normalen Schutzwesten der Polizei nichts ausrichten konnten. Frederik hatte Glück gehabt, er war als Einziger verschont geblieben, weil er zum Zeitpunkt des Angriffs beim Wagen gewesen war und Verstärkung angefordert hatte. Mit den Schuldgefühlen, die er deshalb hatte, plagte er sich bis heute.
»Wir bekommen das hin«, sagte er zu seinem Vorgesetzten.
»Okay.« Birger machte eine kleine Pause. »Du solltest mal wieder zu uns zum Essen kommen«, schlug er dann vor. »Meine Frau würde sich freuen.«
Frederik nickte. »Das tue ich«, erwiderte er. »Aber erst kümmere ich mich um den Toten.«
Asperö war eine der kleineren südlichen Göteborger Schären. Die gesamte Insel stand unter Naturschutz. Im Norden wohnten etwa vierhundert Menschen. Der Süden war weitestgehend unbesiedelt. Es war eine wilde Landschaft; graue, glatt geschliffene Felsformationen, die weit aus dem Meer herausragten. Eine üppige, sattgrüne Vegetation, Büsche, Laub- und Nadelgehölze und Lebensbäume. Unzählige Vogelarten lebten hier. Es gab Badestellen, einen kleinen See und eine Vielzahl von Bootsstegen, außerdem zwei Fähranleger. Vom Göteborger Hafen Saltholmen aus war man in einer knappen Viertelstunde hier.
Autos und Motorräder waren auf der Insel verboten, nur ein paar Taxis verkehrten. Die Touristen, die den etwa fünf Kilometer langen Wanderweg rings um die Insel nutzten, kamen am Morgen und fuhren am Abend zurück zu ihren Unterkünften auf einer der anderen Schären oder auf dem Festland. Auf Asperö gab es keine Ferienhäuser.
Frederik winkte dem Kapitän der Fähre und lenkte seinen Elektroroller mit Beiwagen auf das kleine Vordeck. Die Radfahrer und Fußgänger machten ihm höflich Platz. Einige beäugten sein Gefährt misstrauisch, doch niemand sagte etwas. In Schweden war man zurückhaltend. Frederik unterdrückte den Impuls, sich trotzdem zu erklären. Er war niemandem Rechenschaft schuldig.
Während der kurzen Überfahrt studierte er die Informationen, die ihm Hedda auf sein Smartphone geschickte hatte. Bisher war es ihm nicht gelungen, sie aus ihrem Schneckenhaus zu locken, aber sie erledigte ihre Arbeit gründlich und gewissenhaft. Nach wie vor beschäftigte ihn die Frage, weshalb sie immer so traurig aussah. Birger hätte es vermutlich gewusst, doch er wollte ihn nicht fragen. Er hoffte, dass Hedda es ihm eines Tages selbst sagte.
Das Haus, in dem man den Toten gefunden hatte, gehörte Stig Stensted, einem Göteborger Anwalt für internationales Wirtschaftsrecht. Er selbst war allerdings nicht vor Ort, sondern verbrachte den Sommer mit Frau und Kindern in San Francisco, ehe er im Herbst in eine Wohnung mit angegliederter Kanzlei im Stockholmer Luxusviertel Östermalm übersiedeln würde. Das Haus auf Asperö hatte er an die Tochter eines befreundeten Kollegen vermietet. Jessica Reichenbach, die Frau des Toten. Außerdem hielten sich noch vier weitere Personen dort auf. Alle hatten ihren Wohnsitz in Hamburg.
Frederik versuchte, sich die Namen einzuprägen. Zugleich wappnete er sich. Der Tote war Anwalt, genau wie einer der beiden anderen Männer und eine der Frauen. Er hoffte, dass sie nicht zu der Sorte gehörten, die schon aus Prinzip die Arbeit der Polizei infrage stellten. In den letzten Jahren hatte er nicht die besten Erfahrungen mit dieser Berufsgruppe gemacht. Wenn er an die geschniegelten Advokaten dachte, die ohne jeden Skrupel einen Freispruch für den Schwerverbrecher Arvid Ekström erwirkt hatten, kam ihm die Galle hoch.
Der dritte Mann in der Reisegruppe hatte acht Jahre in einer Strafanstalt gesessen, nach dem, was Hedda herausgefunden hatte, wegen bewaffneten Raubs. Er hatte sie gebeten, sich mit der Hamburger Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen zu erhalten. Er selbst wollte sich zunächst den Toten ansehen und mit der Reisegruppe sprechen. Dass sie alle aus Deutschland kamen, machte die Sache zusätzlich kompliziert. Frederik hoffte, dass sie einigermaßen Englisch sprachen, sonst wäre er der Einzige, der sich mit ihnen unterhalten könnte, und er müsste alles für seine Kollegen übersetzen. Soweit er wusste, beherrschte niemand aus seinem Team die deutsche Sprache.
Kurz ließ er das Mobiltelefon sinken und dachte an seine Großeltern in Kiel, bei denen er nach dem Tod seiner Mutter aufgewachsen war. Ihnen verdankte er die Liebe zu ihrer Heimat. Trotzdem war er nach der Schule in das Land seines Vaters zurückgekehrt. Den Kontakt zum Vater, den er damals abgebrochen hatte, hatte er allerdings bis heute nicht wieder aufgenommen. Lange Zeit hatte er geglaubt, der Vater sei schuld am Tod seiner Mutter. Mittlerweile wusste er es besser. Aber es war schwer, über seinen Schatten zu springen.
Die Fähre steuerte Asperö Östra an, und Frederik steckte sein Handy in die Umhängetasche und verstaute sie im Beiwagen. Er entdeckte Anna an der Anlegestelle, wie stets von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Ungeduldig trat sie von einem Fuß auf den anderen und strich immer wieder ihre halblangen roten Haare zurück. Sie konnte es wohl kaum erwarten, an den Tatort zu kommen.
Frederik steuerte den Roller von der Fähre und reichte Anna den zweiten Helm.
»Wartest du schon lange?«, erkundigte er sich.
»Eine halbe Stunde.«
»Tut mir leid. Ich konnte nicht schneller kommen. Du hast ja gesehen, dass ich nicht im Büro war.«
»Verlängerte Mittagspause, nicht wahr? Eine Frau?«, fragte sie bissig.
Er dachte an Emma, und sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen.
»Ja. Eine, die ich sehr liebe.« Ihm war klar, dass er damit falsche Assoziationen provozierte, aber es war ihm egal. Außer Birger wusste niemand von Emma, und es ging auch niemanden etwas an.
Anna wirkte ein wenig bestürzt, vielleicht auch enttäuscht. Sie fragte nicht weiter, sondern stülpte sich den Helm über den Kopf und kletterte hinter ihm auf den Sozius. Im Beiwagen mitzufahren lehnte sie kategorisch ab.
Frederik lenkte den Roller über den Anlegeplatz mit dem Kiosk zum Gålebergsvägen, der ein paar Hundert Meter zwischen Felshügeln und Bäumen hindurchführte, ehe die ersten Wohnhäuser auftauchten. An der Kreuzung bog er nach links in den Körevägen, genau wie Hedda es ihm beschrieben hatte. Sie passierten ein halbes Dutzend weiß und rot gestrichener Häuser, dann ging es wieder zwischen Felsen und Bäumen entlang, bis nach einem weiteren halben Kilometer der Zufahrtsweg zum Haus auftauchte. Hätte nicht ein uniformierter Polizist an der Stelle gestanden, Frederik wäre vermutlich an dem schmalen Durchlass vorbeigefahren, der sich zwischen den Bäumen auftat.
Der Beamte hob grüßend die Hand an den Mützenschirm. Frederik erwiderte die Geste und rollte mit gedrosseltem Tempo durch das kleine Waldstück die letzten Meter zum Haus.
Es war groß, im typisch schwedischen Falunröd gestrichen, mit weißen Fensterrahmen und Umrandungen. Genau wie sein eigenes Haus in Forsbäck, nur dass dieses hier weitaus größer war und so gepflegt, wie es sich Frederik für seines erträumte, aber trotz umfangreicher Renovierungsarbeiten noch immer nicht geschafft hatte. Ihm fehlte einfach die Zeit.
Neben dem Haus gab es zwei kleinere Gebäude, Geräteschuppen, vielleicht auch ein Bootshaus, obwohl es praktischer wäre, ein Boot näher am Ufer zu lagern. Doch vielleicht war dies der Platz für den Winter. Die Türen waren geschlossen und mit Vorhängeschlössern gesichert. Am linken der beiden Gebäude lehnte ein rotes Mountainbike, das vermutlich nicht dem Hausbesitzer gehörte. Es sah teuer aus; Stig Stensted hätte es sicher eingeschlossen.
Vor dem Haus hatte sich eine Reihe von Menschen versammelt, blau uniformierte Polizisten und Sanitäter in grünen Uniformen mit gelben Schulterklappen, dazu fünf Personen, die man schon an ihrer Kleidung als Touristen identifizieren konnte. Kein Schwede würde eine schlabberige Outdoor-Hose mit einem Dutzend Taschen, einen neonfarbenen Jogginganzug oder ein bunt gemustertes Hawaiihemd und gestreifte Bermudashorts anziehen. Die Gruppe stand neben dem gelben Krankenwagen mit dem umlaufenden, gelb-blau gewürfelten Streifen. Es war eines der kleineren Modelle mit Elektroantrieb.
Spurensicherung und Rechtsmedizin waren demzufolge noch nicht eingetroffen, würden aber sicher bald kommen. Frederik stellte den Roller ab und winkte einen Polizisten heran.
Knapp stellte er sich und Anna vor. »Wie ist die Lage?«
»Eine leblose Person in der Küche. Die Kollegen vom Rettungsdienst«, der Polizist zeigte auf die Sanitäter, »konnten nur noch den Tod feststellen. Der Mann wurde offensichtlich erstochen. Wir haben siebzehn Einstiche im Oberkörper gezählt. Das Messer lag neben dem Leichnam.« Er zog ein Smartphone aus der Tasche und zeigte Frederik und Anna ein paar Bilder. »Sein Name ist Julius Reichenbach.«
Frederik hörte, wie Anna neben ihm schluckte, und auch er selbst musste einmal tief durchatmen. Der Täter hatte ein Blutbad angerichtet. Der Körper des Mannes war an einigen Stellen regelrecht zerfetzt. Er lag in einer riesigen Blutlache, die mittlerweile getrocknet zu sein schien. Frederik entdeckte mehrere Hand- und Schuhabdrücke in der roten Fläche.
»Die Frau dort hat ihn gefunden.« Der Polizist deutete zum Krankenwagen. In der geöffneten Hintertür saß eine Mittdreißigerin, eine goldene Rettungsdecke um die Schultern, eine Blutdruckmanschette am Oberarm. Nun nahm Frederik auch das Blut auf ihrem Kleid wahr. Es war komplett damit verschmiert.
»Hat sich neben ihn gekniet und versucht, ihn zu reanimieren. Sie ist Krankenschwester«, erläuterte der Polizist. »Es war aber schon zu spät. Das Blut muss aus ihm rausgesprudelt sein wie aus einem Brunnen, als sie es mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung versucht hat.« Er drehte sein Handy wieder zu sich und wischte ein paarmal über das Display. »Sie heißt Daniela Schwaiger.«
Frederik betrachtete die Frau. Mittelgroß, blond und deutlich übergewichtig. Sie wirkte scheu und hilflos, aber das mochte auch daran liegen, dass sie so erschüttert war. Selbst wenn sie mit Krankheit und Tod von Berufs wegen vertraut war, war es sicher ein Schock, einen derart übel zugerichteten Toten zu finden. Umso mehr, da es sich um einen Freund handelte.
»Die Frau daneben in dem gelben Jogginganzug ist Jessica Reichenbach, die Ehefrau des Toten, von Beruf Steuerberaterin.«
Groß, schlank, brünett, registrierte Frederik. Die Sportbekleidung war für seinen Geschmack zu grell, vermutlich aber teuer. Ihr Gesicht war eine starre Maske. Ablesen konnte er daran nichts.
»Der in den Angelsachen ist Kai Schwaiger«, erläuterte der Beamte weiter und hob den Kopf leicht in Richtung des Mannes mit der beigefarbenen Outdoor-Hose und passender Weste, die ebenso viele Taschen aufwies. Wie seine Frau war er kräftig gebaut. Er hatte dunkle Haare und einen üppigen Vollbart. In seiner Freizeitkleidung wirkte er ein wenig unbeholfen, doch im Talar vor Gericht war er sicher eine eindrucksvolle Erscheinung.
»Die beiden anderen sind Steffen Brandt« – der Mann im Hawaiihemd – »und Pia Frenzen.«
Frederik betrachtete die beiden. Brandt war ein muskulöser und nicht unattraktiver, aber etwas düsterer Charakter, nicht untypisch für jemanden, der acht Jahre hinter Gittern gesessen hatte. Braune Locken, ausrasierter Nacken, Dreitagebart und die obligatorischen Tätowierungen an Armen und Beinen und vermutlich auch an anderen Körperteilen.
Pia Frenzen war eine hübsche junge Frau mit langen dunklen Haaren. Sie trug ein graues Geschäftskostüm und hochhackige Pumps, die für das steinige Gelände komplett ungeeignet waren, so als sei sie noch gar nicht richtig angekommen.
Natürlich war es Brandt, der sich aus der Gruppe löste und auf sie zukam.
»Hey. Are you … police? I mean … crime … unit?« Damit schien sein englischer Wortschatz im Wesentlichen erschöpft.
»Frederik Forsberg und Anna Jordt von der Reichspolizei Göteborg«, sagte Frederik auf Deutsch.
Steffen Brandt wirkte erleichtert, allerdings nur für ein paar Sekunden. Im nächsten Moment wanderte sein Blick misstrauisch zu den Polizisten und Sanitätern, die bei seiner Gruppe standen.
»Sprechen alle Schweden deutsch?«
Frederik fragte sich, was die Kollegen wohl hätten aufschnappen können, wenn es so wäre.
»Nein.«
Tatsächlich war das eines der Probleme, die das Land aktuell beschäftigten. Früher hatte fast jeder Zweite in der Schule Deutsch gelernt. Heute war es nur noch ein Bruchteil. Wirtschaftsexperten sahen darin einen Faktor, der den Austausch Schwedens mit seinem größten Handelspartner Deutschland behinderte, weil man in Schweden nicht nur die Sprache, sondern infolgedessen auch die deutsche Geschäftskultur zunehmend weniger verstand.
Sein Gegenüber wartete offenbar darauf, dass er noch etwas hinzufügte, doch Frederik tat ihm den Gefallen nicht. Brandt war der Typ, der sich Macht verschaffte, indem er seine Gesprächspartner zu Erklärungen und Rechtfertigungen nötigte.
»Okay. Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Brandt defensiv.
Frederik schaute sich rasch um. Das Haus konnte vorerst nicht betreten werden. Zunächst mussten Spurensicherung und Rechtsmedizin ihre Arbeit verrichten. Anschließend musste es gereinigt werden, ehe es wieder bewohnbar war. Das Fehlen von Ferienunterkünften auf Asperö stellte sie vor ein Problem. Man könnte die Leute in einem Hotel in Göteborg unterbringen, doch Frederik hätte sie lieber gemeinsam vor Ort. Anna präsentierte ihm eine Lösung.
»Ich habe herumtelefoniert«, berichtete sie und hielt ihr Smartphone hoch. »Der Betreiber des örtlichen Supermarkts wohnt mit seiner Familie in einem großen Haus an der Südspitze der Insel. Sie haben ein paar Zimmer, die sie uns provisorisch zur Verfügung stellen können, als Unterkunft und für die Vernehmungen.« Ihre Augenbrauen wanderten ein Stück nach oben. »Ich musste gar nichts erklären«, fügte sie hinzu. »Der Mann wusste schon Bescheid. Der Supermarkt ist offenbar auch der Treffpunkt der Bewohner. So eine Art Inselcafé.«
Der Ort, an dem man die Waren des täglichen Bedarfs bekam und sich mit den Nachbarn traf. Und ein Umschlagplatz für Informationen. Nicht untypisch für die Schären und die kleinen Küstenorte, wusste Frederik.
»Er kommt mit seinem Lieferwagen vorbei und holt die Angehörigen ab. Andere Fahrzeuge gibt es ja auf der Insel nicht.« Sie schaute auf das Display ihres Smartphones. »Sein Name ist Kennet Olsson.«
Steffen Brandt, der von ihrer auf Schwedisch geführten Unterhaltung nichts verstand, blickte ungeduldig zwischen ihnen hin und her.
»Was ist los?«
»Wir sorgen für Ihre Unterbringung«, erwiderte Frederik ruhig. Er spürte Brandts unterschwellige Aggression und wollte sie nicht unnötig anheizen. »Hier können Sie nicht bleiben.« Er wandte sich wieder an Anna. »Ich will einen Blick auf die Leiche werfen, wenn die Kollegen von der Spurensicherung kommen. Danach fahre ich zu den Olssons und unterhalte mich mit Reichenbachs Mitreisenden. Du kümmerst dich um die Kriminaltechnik und die Rechtsmedizin. Wenn irgendwas Interessantes herauskommt, schick es mir aufs Handy.«
Annas Gesicht verfinsterte sich erwartungsgemäß. Sie argwöhnte ständig, dass man sie ausbooten wollte.
»Wäre es nicht besser, wir machen die Befragungen gemeinsam?«
»Das wird nicht gehen. Ich will mit den Leuten deutsch reden.« Sein Englisch war zwar nicht schlecht und hätte vermutlich ausgereicht, um Informationen auszutauschen, doch bei der ersten Vernehmung ging es um mehr. Jede winzige Nuance, jeder Zwischenton konnte wichtig sein. Und der entging einem in einer Fremdsprache allzu leicht.
Anna wusste das, deshalb widersprach sie nicht. Dass es ihr trotzdem nicht gefiel, sah er daran, dass sie die Lippen zusammenpresste.
»Okay.«
Frederik ging zu der Gruppe neben dem Rettungswagen. Anna und Steffen Brandt folgten ihm. Er stellte sich und Anna vor und wandte sich dann an Jessica Reichenbach.
»Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen«, sagte er. »Sicher war es ein furchtbarer Schock für Sie. Ich kann verstehen, wenn Sie sich im Augenblick nicht in der Lage fühlen, mit uns zu sprechen. Aber es wäre gut, wenn wir so schnell wie möglich ein paar Informationen bekämen. Desto größer ist die Chance, dass wir denjenigen finden, der Ihrem Mann das angetan hat.«
Jessica Reichenbach stand stocksteif. Ihre braunen Augen blickten hart.
»Fragen Sie.«
»Wir möchten Sie gerne zunächst von hier wegbringen.« Er schaute die anderen vier Mitglieder der Reisegruppe an. »Sie alle. Vor morgen werden Sie das Haus nicht wieder betreten können. Wir haben Ihnen eine vorübergehende Unterkunft besorgt. Man wird Sie gleich abholen.«
Er erntete von allen Seiten ein mechanisches Nicken. Nur Steffen Brandt pumpte sich auf.
»Was ist mit unseren Sachen? Zahnbürste? Wäsche zum Wechseln?«
»Ich fürchte, Sie müssen sich für die Nacht mit dem begnügen, was Sie am Leib tragen.«
»Ach ja? Macht man das in Schweden so?«
»Das wäre in Deutschland nicht anders.«
Brandt schnaubte verächtlich und verschränkte die Arme vor der Brust. Kai Schwaiger ging dazwischen.
»Jetzt tu doch nicht so, als wärst du verwöhnt.«
Frederik nahm an, dass er auf Brandts Gefängnisaufenthalt anspielte. Es war eine interessante Konstellation. Was brachte eine Gruppe von Rechtsanwälten dazu, gemeinsam mit einem verurteilten Straftäter in den Urlaub zu reisen? Hatten die Anwälte Brandt verteidigt? Oder gab es eine persönliche Verbindung? Er wollte Brandt nicht vorverurteilen, doch er war der Einzige in der Gruppe, dessen Vita ein Gewaltverbrechen aufwies.
Brandt funkelte Kai Schwaiger wütend an.
»Was soll das werden? Willst du mich vorsorglich schon mal in Verdacht bringen?«
Kai hob müde einen Mundwinkel.
»Denkst du im Ernst, die Beamten hier wüssten es noch nicht?«
Steffen Brandt blinzelte. Dann zog er sich ein paar Schritte zurück und murmelte irgendetwas, das Frederik nicht verstand.
Daniela Schwaiger erwachte aus ihrer Starre. Sie stand auf, streifte Rettungsdecke und Blutdruckmanschette ab und ging zu ihrem Mann.
»Du meinst doch nicht, dass es einer von uns war?«
Kai starrte auf ihr besudeltes Kleid.
»Was soll ich denn sonst glauben? Hier ist doch weit und breit niemand.«
»Aber da war jemand.« Daniela hob ihre blutverkrustete Hand und deutete zitternd zum Waldrand. »Dort. Als ich mit den Pilzen zurückgekommen bin. Die Tür stand offen, und ich habe einen schwarzen Schatten gesehen. Er ist irgendwo da im Gebüsch untergetaucht.«
Frederik schaute zur Haustür und registrierte, dass dort ein umgekippter Korb lag. Ringsum verstreut etliche Pilze, einige davon zertreten.
Er nahm sein Notizbuch aus der Umhängetasche.
»Können Sie die Person beschreiben?«, erkundigte er sich.
Daniela drehte sich zu ihm um, und er blickte in hellblaue, rot geränderte Augen.
»Nein. Ich habe den Mann ja gar nicht richtig gesehen. Wenn es ein Mann war. Da war nur eine Bewegung. Ein Schemen. Ich dachte erst, ich hätte mich vielleicht getäuscht. Aber als ich dann ins Haus kam …« Sie brach ab. Kai tätschelte ihr unbeholfen den Arm. Pia Frenzen trat dazu.
»Meinen Sie, es war ein Raubüberfall?«
Frederik hob die Hände. »Dazu können wir noch nichts sagen. Wir müssen die Ergebnisse der Spurensicherung abwarten.«
Seiner Meinung nach kam allerdings ein Zufallstäter nicht infrage. Wenn jemand siebzehnmal zustach, ließ das auf heftige Emotionen schließen. Wut, Hass, Eifersucht, Neid – irgendetwas, das eine enge persönliche Beziehung voraussetzte.
»Julius war ja kein einfacher Mensch«, bemerkte Pia leise. Frederik hätte nicht zu sagen gewusst, ob die Worte überhaupt für ihn bestimmt waren. Er neigte den Kopf zu ihr.
»Wie meinen Sie das?«
»Nun ja.« Pia war es offensichtlich unangenehm, dass sich plötzlich die gesamte Aufmerksamkeit auf sie richtete. »Er war … ein Snob. Hat die Leute immer so von oben herab behandelt. Wenn ich nur an unsere Sekretärin denke …«
Kai runzelte die Stirn. »Und jetzt meinst du, Frau Meyerdierks hat sich in den Flieger gesetzt, die Fähre nach Asperö genommen und Julius erstochen, weil er manchmal nicht nett zu ihr war?«
»Nein. Natürlich nicht.« Pia ballte die Fäuste. Frederik hatte den Eindruck, dass die Interaktion eingespielt war. Pia versuchte sich zu behaupten, Kai machte sie klein, indem er ihre Äußerungen ins Lächerliche zog.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: