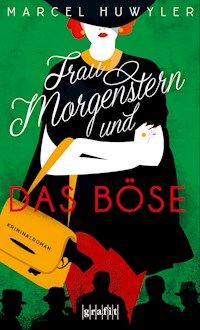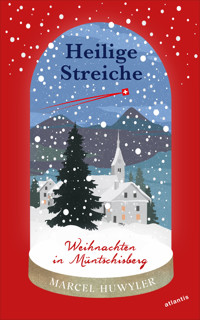Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frau Morgenstern
- Sprache: Deutsch
Schwarzhumorig, bissig und herrlich unkorrekt. Violetta Morgenstern, pensionierte Lehrerin und Auftragsmörderin im Namen des Staates, hat ihre mörderische Berufung an den Nagel gehängt und genießt den Ruhestand. Doch dann wird sie für einen letzten Auftrag vom Killerministerium »Tell« zurückgeholt: Ihr Ex-Kollege Miguel Schlunegger hat ohne ersichtlichen Grund einen Menschen umgebracht. Nun sitzt er im Gefängnis, schweigt eisern – und soll bald eliminiert werden. Morgenstern versucht verzweifelt herauszufinden, warum er gemordet hat. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit – und eine Reise in die dunkelsten Abgründe von Miguels Seele.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Marcel Huwyler
Frau Morgenstern und das Vermächtnis
Der sechste Fall der Mordslady
Kriminalroman
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt von der Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung der Motive shutterstock.com/Clash_Gene, shutterstock.com/sharpner
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98708-018-0
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Marcel Huwyler wurde 1968 in Merenschwand/Schweiz geboren. Als Journalist und Autor schrieb er viele Jahre Reportagen über seine Heimat und Geschichten aus aller Welt. Er lebt heute an einem See in der Zentralschweiz.
Prolog
Sein Erfolgsgeheimnis ist, so zu denken wie der Wind.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind …
Nur wer mit den Luftbewegungen eins wird, sie versteht und mit ihnen verschmilzt – so denkt wie sie, macht wie sie, facht wie sie –, trifft ins Schwarze. Oder noch treffender: ins Rote; in eines der gut durchbluteten, lebenswichtigen Körperorgane. Am besten jenes in der Mitte des Thorax, leicht links versetzt, hinter dem Brustbein, unterhalb der Schulter – ins faustgroße Herz.
Er hat für sich die verschiedenen Windarten in Spezies unterteilt, als wären sie biologische Lebewesen. Es gibt Luftströme mit der grimmigen Beständig- und Anspruchslosigkeit von Amöben, andere besitzen die kaltblütige Anpassungsfähigkeit von Pilzen oder die Agilität von Efeupflanzen oder sind so listig, verschlagen und unerwartet zuschlagend wie ein kleiner, pelziger Nager.
Die Kreatur Wind. Organismus Luftstrom. Ventus vulgaris.
Er hat ihnen Namen gegeben, der Intensität nach aufsteigend: beginnend mit dem Hauch, dann folgen Lüftchen, Luftzug, Brise, starker Wind, steifer Wind, stürmischer Wind bis hin zu Sturm und schließlich der Orkan.
Wobei man seiner Erfahrung nach bei den letzten drei Kategorien gar nicht erst versuchen sollte, einen Volltreffer zu platzieren. Weil nahezu unmöglich, bei solch ungestümen Bedingungen die Flugbahn eines Projektils exakt zu berechnen. Der Schütze würde sein Ziel verfehlen oder verstümmeln. Beides unprofessionell. In solchen Fällen gilt es, die Elimination umgehend abzubrechen. Zu viel lebendige Luft bedeutet Weiterleben – für die Zielperson.
Ideal ist natürlich, wenn Flaute herrscht, Windstille, totale tote Windhose.
Umgekehrt arbeitet es sich am allerschlimmsten bei Böen, diesen kurzen, heftigen, plötzlich aufkommenden und darum absolut unberechenbaren Blasbiestern.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind …
Diese Passage aus dem Märchen seiner Kindertage ist ihm bei seiner beruflichen Tätigkeit in all den Jahren zum Mantra geworden. Einer Endlosschlaufe gleich mückt ihm dieser Satz durch den Kopf … während er jeweils durch das Präzisionszielfernrohr linst, durch die Nase ein-, durch den Mund ausatmet, tief in den Bauch hinunter, den Ruhepuls überwacht (an guten Tagen kann er ihn problemlos auf unter fünfzig drücken), seine Arme, Schultern und Hände verschraubstockt, schließlich den Atem anhält, durchzieht, abzieht, die Kugel losschickt mit einer Mündungsgeschwindigkeit von neunhundertachtzig Metern pro Sekunde, er alsdann ins Rote trifft, Leben auslöscht und seinen Auftrag erfüllt.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind …
Der Säuselsoundtrack eines Scharfschützen. Sniperlyrik. Pistoleroparole.
Das ist schon immer so gewesen. Damals bei seinen Kriegseinsätzen unter der glutheißen Staubsonne im Nahen und Mittleren Osten. Und auch jetzt, heute, hier vor dem Stadttheater, dem Glory Palast, wo der Affenzirkus bald stattfinden soll. Bei idealen Bedingungen übrigens. Trockene Witterung, leichte Bewölkung (ergo keine Blendung oder Spiegelungen) und Windkategorie »Flaute«. Kinderspiel für ihn.
Und dennoch sein schwierigster Auftrag ever.
Weil sehr persönlich.
Vor über drei Stunden ist er in Position gegangen. Hat sich eingerichtet im siebten Stock eines Parkhauses, das seit zwei Wochen wegen Renovationsarbeiten geschlossen ist. Das fünfzehn Kilo schwere, eineinhalb Meter lange Spezialgewehr aus finnischer Produktion mit Spezialmunition des Kalibers .408 ist auf einer Dreibeinlafette arretiert. Hochpräzise Werkzeuge, Spezialanfertigungen mit allerlei Modifikationen, zusätzlich eingebauten Hinrichtungsraffinessen, mordsmäßig individualisiert gemäß dem Wunsch des anonymen Kunden. Als wär’s die waffenölige Weihnachtswunschliste eines Elite-Snipers.
Im Kopf hat er das genaue Drehbuch. Er schaut auf seine Armbanduhr, in einunddreißig Minuten wird der Event beginnen. Seine Zielperson sollte laut Ablaufplan um neunzehn Uhr zwanzig mit einem Wagen vorfahren. Sollte. Das hier heute ist eine Ansammlung von Künstlern, Musikern, sprich kreativen Chaoten – undisziplinierter und somit unpünktlicher geht gar nicht. Darauf muss er sich einstellen. Improvisation könnte vonnöten sein.
Er kontrolliert nochmals mittels Laserentfernungsmesser die Distanz zwischen Parkhaus und Promenadentreppe des Stadttheaters. Zwölfhundertnullsechs Meter. Checkt dann die anderen Parameter, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und den Luftdruckwert in Hektopascal. Alles im sehr dunkelgrünen Bereich.
Genau in dem Moment spürt er eine Luftbewegung an seiner linken Wange. Ganz kurz nur, ein Kräuseln, lausamtwarm, wie der Federschlag eines wegflatternden Jungsperlings. Typische Abendthermik, leichte Verschiebung der Luftmassen. Kategorie Hauch. Allerhöchstens.
Kein Problem für ihn. Weil er denkt wie der Wind.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind …
Er ist einsatzbereit, er ist feuerbereit.
Und in seiner ganzen Zeit als Auftragskiller noch nie so nervös gewesen.
Weil zum ersten Mal überhaupt persönlich betroffen. Sehr, sehr sogar.
***
MC Frostbite trinkt einen großen Schluck Wodka direkt aus der Flasche. Die ist bereits zu zwei Dritteln leer, obwohl er sie erst vor einer halben Stunde angebrochen hat. Aber Wodka geht. Wodka ist promitauglich, also showtauglich und ergo medientauglich. Weil man davon keine Fahne kriegt, es sind nämlich keine Fuselöle drin. Nicht wie beim Whisky oder Brandy, wo jeder gleich riechen kann, dass man was in der Beule hat. Nicht, dass es dann morgen in der Presse hieße, er hätte seinen »Swiss Sound Award« in der Kategorie »Bestes Rap-Album des Jahres« angetrunken auf der Bühne des Glory Palastes abgeholt. Wobei … Für sein Rap-Ratten-Image wäre so ein Süffelskandälchen vielleicht sogar ganz hilfreich. MC Frostbite, die hackevolle Frostbeule. Er schnaubt belustigt und schluckt noch mehr vom Frostschutzmittel.
Für den vor zweiunddreißig Jahren als Paul »Päuli« Frost in Bimlisbach im südöstlichen Thurgau geborenen Musiker ist ein Award der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere. Und sein Management raunt, die Chancen stünden gut. Verdammt gut sogar.
Frostpäuli grinst in sich hinein, wenn er sich vorstellt, was für Flötengesichter die Konkurrenz machen wird, wenn er die begehrte Trophäe auf der Bühne – begleitet von Applaus, Donnerwinnerbeats und Blitzlichtgewitter – mit einer Triumphgeste gen Scheinwerferhimmel stemmt. Mit ihren Blicken töten werden sie ihn, die im Auditorium versammelte Rap-Elite des Landes: Fünfzig Franks, TsüriMüli, GUZ, Toxy, dieser Milchbubi, oder La Täubchen, mit der er vor Jahren einen kurzen, unendlich langen Monat lang etwas Wildschräges gehabt hat.
Er genehmigt sich einen letzten Riesenglucker, ehe er die Flasche zuschraubt und sie neben sich auf das schneeweiße Lederpolster wirft. Die affige Stretch-Limousine hat ihm der Veranstalter aufs Auge gedrückt. Muss sein. Steht sogar so im Tagesvertrag. Jeder Nominierte hat an diesem Galaabend mit solch einer spendierten Protz-Limo vorzufahren. Alles bloß für die Show und die Medien und die Massen zu Hause vor der Glotze; die »Swiss Sound Awards« werden live im Staatsfernsehen übertragen. Samstagabend ist Primeshinetime und Einschaltquotenhimmel.
Päuli hat seiner alten Mutter versprochen, ihr via Fernsehkamera Kusshandgrüße zu schicken. Hat Freddie Mercury auch immer gemacht. Gibt eine gute Presse, so was finden Fans und Medien rührend; MC Frostbite mit Warmherz für Greisenmutti. Wenngleich er ziemlich sicher ist, dass seine Mum seinen Trainingsanzug aus kükengelbem Glattpolyester unschicklich bis grässlich finden wird. Aber MC Frostbite ist halt nun mal auch eine Rap-Fuckfashion-Ikone und darum moneymakende Markennutte. Und die Kids würden nächste Woche genauso herumlaufen wollen wie er.
»Ankunft in zwei Minuten«, verkündet der Typ auf der Limousinen-Sitzbank gegenüber und tupft sich den Minisender in seiner Ohrmuschel noch etwas tiefer hinein.
Noch so eine spleenige Idee des Veranstalters. Jedem Nominierten für den Abend einen Bodyguard zur Seite zu stellen. Oder zumindest einen Typen, der so tut und aussieht wie einer. Soll angeblich die Wichtigkeit der Promis aufwerten. Ich brauche Schutz – also bin ich. Irgendwie lächerlich, findet Päuli, anderseits aber auch irgendwie cool. Schließlich benötigen nur Superpromis Leibwächter.
Sein Gorilla hat sich ihm als »Oscar mit c« vorgestellt. Nur mit Vornamen, wie es Teenies tun, oder Friseurinnen, Bedienungen im Coffeeshop und Escortgirls. Oscar mit c ist groß und kräftig gebaut; die dunkle Sonnenbrille, die Granitvisage und der Astronautenhaarschnitt gehören wohl zwingend zur DNA jedes Personenschützers. Wie im Film, amüsiert sich Päuli. Doch der Kerl hier scheint tatsächlich echt zu sein. Wie er sich gibt, bewegt, redet. Klipp und klar und mit dieser Knallhartcoolness. Päuli fragt sich schon die ganze Zeit über, ob der Kerl wohl eine Kanone unter seinem schwarzen Anzug trägt.
Und ob er tatsächlich bereit wäre, im Ernstfall an MC Frostbites Stelle zu sterben.
»Wir sind gleich da«, sagt Oscar mit c. Der livrierte Fahrer der Limousine verlangsamt bereits die Fahrt.
Päuli schaut aus dem getönten Seitenfenster. Er sieht die lange, zum Glory Palast hochführende Promenadentreppe mit dem roten Teppich in Babyhellblau (die Veranstalter versuchen wirklich krampfhaft, kreativ anders zu sein). Sieht die wogende, Handy-hochhaltende Fanmeute auf der gegenüberliegenden Straßenseite, von Absperrgittern und Security in Schach gehalten. Und er sieht die Kameraleute, Fotografen und Interviewmikrofonhalter, die sich beidseits der Treppe breitbeinig aufgebaut haben, fickrig wie Treibjäger, bereit zum Promiabschuss.
»Ich steige zuerst aus, dann Sie«, sagt Oscar mit c. »Danach bleibe ich die ganze Zeit über dicht links hinter Ihnen. Alles okay?«
MC Frostbite nickt grinsend und bewegt die Augenbrauen auf und ab, als habe der Bodyguard eben einen Megawitz gerissen. Der Gorilla nimmt seinen Witzjob hier doch tatsächlich ernst. Jaaa, schon klaaar, Rapper und Hip-Hopper werden gern mal erschossen. Gehört zum Image. GangstaRappa sind eben wahre Shootingstars. Passiert aber in real nur in den USA. Dort allein elf Künstler in den vergangenen Jahren. So wie beispielsweise McMonsta MC, Päulis musikalisches Vorbild, der mit gerade mal achtundzwanzig getötet worden ist bei einer Schießerei in einer Bowlingbahn nahe Dallas. Tja, die Brüder auf der anderen Seite des Ozeans sterben, wovon sie singen. Rappakarma.
Von solch einem glamourmordösen Ende können die heimischen Rapper bloß träumen. Und trotzdem tut MC Frostbite jetzt exakt das, was sein Bodyguard gesagt hat. Und – ihm ist tatsächlich plötzlich etwas flau im Magen. Kann natürlich auch am Wodka liegen. Die Limousine stoppt vor der Treppe. Oscar mit c stößt die Tür auf und steigt aus dem Wagen, dicht gefolgt von Päuli.
Die Fans auf der anderen Straßenseite kreischen, MC Frostbite winkt ihnen erst zu, besinnt sich dann auf sein Image und grüßt mit zum Himmel gereckter Ghettofaust. Ein paar Mädchen rufen seinen Namen im Chor. Er grinst den Groupies zu und taxiert sie kurz. Alle viel zu jung. Auf der falschen Seite des Schutzalters. Noch einmal würde er sich nicht so einen Miss- beziehungsweise Girltritt erlauben. Nicht wie letztes Jahr.
Oh, Mann, ja, der Päuli hat seine Lektion gelernt. Stockbesoffen ist er damals gewesen, und die zugedröhnte Kleine hat gesagt, sie sei zweiundzwanzig. Ihr Vater hat zwei Tage später vor Päulis Tür gestanden, ihm gedroht, alles publik zu machen, ihn dann erpresst, worauf Päuli kräftig Tausendernoten abgedrückt und die leidige Sache damit vom Tapet gewischt hat. Himmel, wenn die Medien je davon Wind kriegen würden …
»Und weitergehen, jetzt die Treppe hoch«, raunt der Bodyguard hinter ihm und stößt ihn sanft, aber bestimmt in Richtung der Medienallee.
MC Frostbite steigt die Stufen hoch, reckt sein Kinn, kneift die Augen etwas zusammen, nickt denen zu, die er von Interviews oder Presseterminen her kennt, und versucht dabei, gelassen-lässig zu wirken, aber keinesfalls leutselig oder etwa gar kumpelhaft.
»Langsamer, nicht zu schnell. Sonst laufen wir auf.« Oscar mit c zupft ihn am Polyesterärmel. Päuli schaut die Treppe hoch und sieht, wie ein Dutzend Stufen weiter oben ein Wesen in hummerroter Robe und silbermondblonder Explosionsfrisur mit sämtlichen Kameras schäkert und in jedes Mikro lacht. Das muss diese Nadine Marleen sein, so viel weiß er aus dem Drehbuch der Veranstalter. Die defiliert direkt vor ihm in der Promi-Aufreihung. Ist so ein Folk-Pop-Prinzesschen, wird derzeit von allen Radiostationen rauf und runter gespielt. Fadnetter Sound, findet MC Frostbite, aber auch nicht mehr. Ziemlich sicher wird Nadine heute Abend in der Kategorie »Best Female Talent« abräumen. Mit ihrem Dünnpfiffohrgewürmel. MC Frostbite atmet geräuschvoll aus.
Er steigt jetzt, entgegen der Anweisung seines Bodyguards, doch weiter die Treppe hoch. Laut Drehbuch wird hinter ihm demnächst DJ Leandro vorfahren und über den Teppich wandeln. Mit dem Wattebäuschchensänger will er keinesfalls zusammen fotografiert werden.
»Hey, ich sagte doch, nicht zu schnell.« Oscar mit c packt ihn von hinten am Ellbogen.
Ziemlich rüde. Zu rüde, findet MC Frostbite. Was bildet der sich eigentlich ein, wer hier wo in der Hackordnung steht?
Mitten in seiner Vorwärtsbewegung treppauf hält MC Frostbite jetzt unvermittelt inne und dreht den Kopf mit einem Ruck nach hinten, um seinen Aufpasser kurz anzufletschen.
Dieser winzige Stopper in seinem bis dahin fließenden Bewegungsmuster, diese minimale Verzögerung in seinem persönlichen Universum, der halbsekündige Rumpler im Lebenslauf, rettet dem Rapper MC Frostbite alias Paul »Päuli« Frost aus Bimlisbach im südöstlichen Thurgau das Leben.
Stattdessen trifft das Projektil seinen Bodyguard.
Und das weiße Hemd von Oscar mit c bekommt auf Herzhöhe einen roten, schnell wachsenden runden Fleck. Wie die japanische Flagge.
***
Als sie ihn verhaften, trägt er lila-weiß längs gestreifte Boxershorts und ein schwarzes Muskelshirt. Der Scharfschütze schreckt aus dem Tiefschlaf hoch und leistet bei der Festnahme keinerlei Gegenwehr.
Nur sechseinhalb Stunden nach dem Attentat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, stürmt ein Spezialkommando der Polizei eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in einem Vorstadtbezirk und überwältigt den mutmaßlichen Täter in seinem Bett.
In einem Schrank im Nebenzimmer stellen die Beamten ein Präzisionsgewehr sicher sowie mehrere Ladestreifen mit Patronen desselben Kalibers wie jenes Projektil, das am Abend zuvor vor dem Glory Palast einen Personenschützer getötet hat. Die noch gleichentags im Polizeilabor durchgeführte Gaschromatograf-Analyse der Projektil-Legierung wird den Verdacht dann zu hundert Prozent bestätigen. Außerdem findet man in der Wohnung schwarze Kleidungsstücke – Cargohose, Langarmshirt, taktische Weste sowie Handschuhe –, die mit den am Schützenstandort entdeckten Textilfasern (auch das wird die Forensik im Laufe des Sonntagnachmittags herausfinden) übereinstimmen.
Er lässt sich widerstandslos festnehmen. Ihm werden Hand- und Fußschellen angelegt, seine Rechte vorgelesen, und er erfährt, welches Verbrechens man ihn beschuldigt. Er weiß genau, dass er nichts falsch gemacht hat. Er ist ein Profi, hinterlässt keine Spuren. Also muss ihn jemand verpfiffen haben. Und er weiß auch, wer.
Zum Erstaunen der Polizeikräfte sowie des anwesenden Generalstaatsanwaltes bestreitet der Mann seine Tat nicht eine Sekunde lang.
»Sie haben den Richtigen erwischt«, sagt er.
»Sie … geben die Tat also zu?«, hakt der Generalstaatsanwalt nach, dem ob so viel Geständnisglück beinahe schwindlig wird.
»Ja, ich war es.«
»Warum diese Tat?«
»Dazu sage ich nichts.«
»Möchten Sie jemanden anrufen?«
»Nein.«
»Sie haben das Recht auf einen Anwalt, der …«
»Ich sagte Nein.«
»Wie Sie meinen. Dann frage ich Sie jetzt nochmals: Warum diese Tat?«
Der Mann schweigt.
»Okay, Ihre Entscheidung. Können Sie uns wenigstens Ihre Identität bestätigen?«
Der Mann atmet schwer ein und aus und nickt dann bitterknapp. »Mein Name ist Miguel Schlunegger.«
1
Gegen so viel Böses, fand Violetta Morgenstern, half nur brutal viel Liebe.
Hätte der Fischhändler namens Guzepp Mizzi vom It-Tokk-Markt bloß Menschen geplagt, wäre sie damit problemlos zurechtgekommen. Machte sie ja selbst oft genug. Strafe muss sein – war ihr Glaubensbekenntnis. Am liebsten urteilte, richtete und vollstreckte sie in Personalunion.
Morgensheriffstern.
Violetta Selbstjustizia.
Nach wie vor bedurften so viele Mitunmenschen einer Abreibung, Lektion, Züchtigung, Sanktionierung, hatten einen Denkzettel nötig oder brauchten einfach mal wieder eines hinter die Löffel.
Wie gesagt, hätte Guzepp Mizzi Menschen gepiesackt … sei’s drum. Aber, Teufel noch mal, doch nicht solch samtwildedle Tierchen.
Ganz anders hätte die Sache ausgesehen, wäre der Fischhändler Hunden gegenüber garstig gewesen. Hunde, ja. Diese Art Antipathie hätte Violetta sofort verstanden. Mit unterschrieben. Mit unterstützt.
Kot – Köter – am giftködersten.
Gopfridstutz und Sack Zement! Wie viele Pfund darmdampfwarmen Hundedreck schippte sie selbst jeden Morgen vom Rasen ihres Grundstücks? Schon in ihrem früheren Leben, als sie noch im Haus ihrer verstorbenen Eltern wohnte, hatte sie sich tierisch aufgeregt über die gehäuften Hinterlassenschaften der Quartiertölen in ihrem Garten. Aber hier jetzt, in ihrem neuen Zuhause, im so weit südlichen Süden, auf dieser Mittelmeerinsel – tausenddreihundert Kilometer weit weg von der alten Heimat, ihrem alten Leben, den alten Geschichten und den vielen, leider noch nicht sooo alten Sünden –, war alles noch viel schlimmer. Die Haufen häufiger. Die Insulaner ließen ihre Kläffer den ganzen Tag frei herumlaufen und sich noch freier entleeren. Darum: Vergeltungsmaßnahmen gegen Hunde: Ja, klar, unbedingt, hätte Violetta sofort gutgeheißen.
Aber, Teufel noch mal, doch nicht gegen solch samtwildedle Tierchen.
Nicht gegen Katzen.
Sie hatte diese Geschöpfe schon immer gemocht. Wegen ihrer eleganten, eigensinnigen, unabhängigen und rebellischen Art. Selbst wenn man diesen Fell-Diven Zuwendung schenkte, ordneten sie sich nicht unter und blieben sture Einzelgänger. So etwas imponierte Violetta. Kam ihr irgendwie … bekannt vor.
Übrigens, world facts: Folgendes hatte Violetta mal gelesen und nachts um schlaflos-drei-Uhr auf einem kruden TV-Sender gesehen. Hitler hatte Angst gehabt vor Katzen. Kein Scheiß. Bei Katzen – im Gegensatz etwa zu blondierten Schäferhunden – funktionierte Gehorsam nämlich nicht.
Darum: Nein, Gewalt gegenüber Katzen – ging gar nicht. Sie würde Guzepp Mizzi, diesen Miezenpeiniger, bestrafen. Und zwar heute Morgen noch. Mit einem Übermaß an gewaltiger Zärtlichkeit.
Dreimal die Woche besuchte Violetta den It-Tokk-Markt in der Hauptstadt Victoria, um frische Lebensmittel einzukaufen. Für die zwanzigminütige Fahrt von ihrem Anwesen am Meer bis in die Altstadt in der Inselmitte benutzte sie den kleinen, feigenlilafarbenen Fiat mit den vielen Beulen, Rostbatzen, Doofspruchaufklebern und der daumendicken Straßenstaubpatina. Der Wagen war im Grunde ein Wrack und genau darum perfekt – weil absolut unauffällig. Schrott zur Tarnung, Lackschäden als Camouflage. Die meisten Einheimischen fuhren mit solchen Karren herum; Neuwagen oder allzu exklusive Modelle hätten sofort Aufsehen und Neugierde ausgelöst, was Violetta nun ganz und gar nicht brauchen konnte. Weil bedrohlich. Womöglich gefährlich. Schlimmstenfalls tödlich.
Falls die sie hier aufspüren sollten.
Sie quälte ihren Feigenfiat bis zur Ecke Triq-il-Katincani und Triq-San-Marco, wo es um die frühe Zeit noch freie Parkplätze gab, und zwängte ihn mit Hilfe ihres Blechsonargehörs in eine handtuchgroße Lücke. Vom Beifahrersitz angelte Violetta sich ihre Handtasche – ein Riesenteil in der Farbe Resolutrot –, stieg aus dem Wagen und schloss ab.
Die Tasche war etwas von den ganz wenigen Dingen, die sie in ihr neues Leben mitgenommen hatte. In ihr Versteck. Violetta hing an dem angejahrten, abgeschossenen Lederding. Zum einen, weil die Tasche enorm geräumig war, ihr manche Dienste geleistet, ja sogar das Leben gerettet hatte – und sie an viele, spezielle Momente auf Eliminationstour für ihren ehemaligen Arbeitgeber »Tell« erinnerte. Und zum anderen, weil die Tasche sie an Miguel denken ließ. Wie oft hatte der Kerl sie getriezt, wenn sie beim Darin-Herumkramen beinahe mit Kopf und Oberkörper in der Tasche verschwunden war. Morgenstern, suchst du nach einer verlegten Kaffeemaschine oder einem alten Sofa? Falls da übrigens ein Toaster drin sein sollte … Ich kann meinen zu Hause nicht mehr finden.
Miguel …
Violetta lächelte in sich hinein, seufzte und schüttelte kurz ihre Schultern, als könnte sie auf diese Weise allzu sentimentale Gedanken von sich abwerfen. Dann machte sie sich zu Fuß auf den Weg zum Markt.
Um acht Uhr morgens war die Temperatur noch gnädig, später am Tag würde es sengend heiß werden. Die afrikanische Küste war nah, Tunesien und Libyen lagen quasi vor der Haustür. Ja, der Sommer auf Maltas Schwesterinsel Gozo konnte brutal einheizen. Violetta schaute zum Himmel hoch, der war wolkenlos, weit und unfassbar blau. Sie atmete tief ein und wieder aus und roch das würzige Meer. Es gab schlechtere Orte, um sich zu verstecken. Das Leben war schön – von einfach war nie die Rede gewesen.
Sie lief die Triq-ir-Repubblika entlang, eine von Victorias asphaltierten Hauptschlagadern, vorbei am mikroprotzigen Opernhaus und dem Burghügel mit der uralten Sandsteinzitadelle, kaufte an der Straßentheke der Pastizzeria eine Tüte Blätterteigtaschen mit Erbsenpüree, zeigte beim Überqueren der Straße einem hupenden Taxi die Faust und erreichte schließlich den Markt. Der fand auf der Pjazza Indipendenza statt, einem weitläufigen Platz, eingegrenzt von gestutzten Aleppo-Kiefern sowie den hier so typischen Flachdachsteinhäusern, diesen bulligen, senfhoniggelben Bauten im arabischen Stil. Aberdutzende laute Händler boten – von knallbunten Sonnenschirmen und gestreiften Markisen beschattet – frisches Obst und Gemüse an, Fisch und Fleisch, Kleidung, Stoffe und Haushaltsgeräte sowie Souvenirs für die Touristen.
Der Verkaufsstand von Guzepp Mizzi lag in der östlichen Ecke des Marktes, gleich neben dem engen, herrlich kühlen Gässchen, das zur Pjazza San Gorg mit seiner Basilika führte.
Der Fischhändler war um die fünfzig, nicht größer als ein Fünftklässler, wog aber bestimmt so viel wie vier von ihnen. Er war nicht unbedingt der Hellste, aber gschaffig und geschäftstüchtig und darum übereifrig freundlich zu seiner Stammkundschaft. Sein sonnenverbrannter Glatzkopf wurde von einem dürren, grauhaarigen Heiligenschein umkränzt, ein Stoppelbart kaschierte das schwammige Gesicht, und er sprach ein hundsmiserables Maltaenglisch. Da parlierte sogar Neo-Gozoanerin Violetta noch gewandter. Sie hatte – und darauf war sie ein wenig stolz – in dem Dreivierteljahr, seitdem sie nun schon hier lebte, riesige Fortschritte gemacht. Mittlerweile ging sie schon fast als Engländerin durch. Noch ein Vorteil, wenn man nicht auffallen wollte. Oder gefunden werden.
Es hieß, Guzepp Mizzi verkaufe den besten Fisch. Konnte Violetta nur bestätigen. Goldmakrelen, Schwertfisch, Meeräsche, Barsch und Thunfisch – alles stets fangfrisch, picobello geputzt, tipptopp ausgenommen, entschuppt und entgrätet. Mizzis Theke bestand aus einer drei Meter langen Holzplatte auf zwei Böcken, die von einem billardgrünen Stoffdach beschattet wurde; die Meeresbeute selbst bot er seiner Kundschaft in tiefen, mit Eisflittern gefüllten Styroporboxen feil.
Fischduft zog nun halt mal Katzen an.
Und Mizzi hasste Miezen.
Hatte Violetta schon mehrfach beobachten können. Von schwarzkatholischen Flüchen begleitet und mit windmühligen Gesten verscheuchte er die Tiere.
Und … mit Fußtritten.
Das fand Violetta dann doch total daneben. Hatte sie ihm schon mehrmals so gesagt, an sein Gewissen appelliert – doch Mizzi hatte nur blöd gegrinst und etwas auf Urmaltesisch gehöhnt, was für Violetta (sowie den Rest der Welt) sprachlich unmöglich zu verstehen war, aber von der Tonalität her sehr nach Altweibervermaledeiung geklungen hatte.
Bei ihrem Marktbesuch vorgestern dann hatte Violetta gar zusehen müssen, wie der Fischhändler eine Katze regelrecht weggekickt hatte. Mit Anlauf, Fußspitze und Linksdrall. Als sei das Tierchen ein Kinderfußball aus Weichschaum. In hohem Bogen war das arme Ding durch die Luft gesegelt, hatte dabei herzzerreißend geschrien, ehe es auf allen vieren gelandet und davongehuscht war.
Das war zu viel gewesen für Violetta.
Blutrote Linie klar überschritten. Diesmal war Guzepp Mizzi zu weit gegangen. Derart brutal … Nein, das durfte sie ihm auf keinen Fall durchgehen lassen. Also hatte sie abends zu Hause bei einer Tasse Baldriantee lange darüber nachgedacht, wie sie den Katzenkicker bestrafen konnte.
Und dann eine geradezu biblische Lösung ersonnen: Überwinde das Böse mit Gutem. Stand doch so im Brief an die Römer, Kapitel 12,21. War ihr grad einfach so eingefallen. Kindheitsprägung. Ja, die Bibel kannte sie praktisch auswendig. Schließlich war ihr Papa in seinen jungen Jahren – bevor er die Mama anbetete – katholischer Priester gewesen. Da blieb halt selbst bei einer Teufelstochter wie Violetta mal was Neutestamentarisches hängen.
Guzepp Mizzi schaltete sofort auf Schleim: »Ah, Madame Violetta, meine treueste Kundin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wird ein heißer Tag heute. Was darf es sein, Verehrteste? Den Lampuki kann ich heute besonders empfehlen, haben die Sultanna-Brüder in der Xlendi-Bucht heute vor Sonnenaufgang gefangen. Frischer geht nicht.«
Violetta formte mit der Hand einen Trichter hinter ihrem rechten Ohr, verzog das Gesicht, als habe sie leichtes Kopfweh, und fragte: »Wie war das? Bitte noch mal. Welche Brüder wo?«
»Die Sultannas. Draußen vor Xlendi.«
Violetta zog die Brauen hoch und nickte zum Zeichen, dass sie diesmal alles mitbekommen hatte.
Man konnte Guzepp wirklich nicht vorwerfen, unfreundlich seiner Kundschaft gegenüber zu sein. Machte die Sache nur noch schlimmer, fand Violetta. Der scheißnette Tierquäler. Vorne so, hinten so rum. Menschenfreund und Katzensadist.
Sie sagte: »Dann geben Sie mir doch bitte vier von den Lampuki.«
»Sehr gern, Madame Violetta. Sind alle schön entgrätet. Haben Sie ihn schon mal zubereitet mit Kapern, Zucker, Minze und Balsamico? Macht meine Maria-Eliza immer.« Er küsste sich die Fingerspitzen und machte dabei ein lang gezogenes Schmatzgeräusch, so wie wenn man eine riesige Nacktschnecke von einer Fensterscheibe wegzog.
Violetta nickte, lächelte vielleicht eine Spur zu süß und umklammerte ihre resolutrote Mordshandtasche mit beiden Händen. Guzepp Mizzi angelte die vier gewünschten Fische aus der Styroporbox, schüttelte die Eisflitter von ihren goldsilbrig schimmernden Leibern, legte sie auf ein Pergamentpapier, hob alles auf eine Gemüsewaage – guckte, rechnete, murmelte, runzelte –, ehe er das Papier über den Fischen zusammenfaltete, das Päckchen in eine durchsichtige Plastiktüte steckte, diese mit Doppelknoten zuband und schließlich seinen Preis nannte, der fair, aber wirklich sehr fair war, fand Violetta.
Dauerte alles zusammen keine Minute.
Mehr als genügend Zeit, um Rache zu versprühen.
Aus ihrer Tasche zog Violetta eine kleine, braune Glasflasche mit Sprühpumpverschluss. Ohne den Fischhändler auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, streckte sie die Flasche unter die Holztheke und begann zu sprühen. Bewegte die Flasche dabei in großem Bogen hin und her, damit auch wirklich die ganze Marktstandbreite eingesprayt wurde. Inklusive der Schuhe und Hosenbeine von Katzensaddam Guzepp Mizzi.
Violetta rechnete sich aus, dass der Zuneigungs-Tsunami in etwa fünf Minuten erste Wirkung zeigen würde. Sie zahlte, dankte und verabschiedete sich. In einem Laden um die Ecke hatte sie noch eine Bestellung abzuholen. Auf dem Rückweg würde sie den Erfolg ihres Rachefeldzugs dann überprüfen. Und hoffentlich genießen.
Zu Spitieri’s ging, wer die Dinge in seinem Leben wieder in Fluss bringen wollte. Verstopfte Toiletten, verpfropfte Küchensiphons, verknorzte Türangeln, verfuselte Tumblerfilter oder verklemmte, weil eingerostete Schrauben – oder Ehen. Im Spitieri’s fand man die richtigen Gegenmittel dafür: Hilfreiches aus den Abteilungen Haushaltgeräte, Eisenwaren und Kleidung (je nach Problem elegant bis forciert aufreizend).
Das Geschäft wurde in dritter Generation von den beiden gleichnamigen Schwestern geführt. Mina war geschätzte hundert, Fina hundertfünfzig Jahre alt. Beide waren groß, blasshäutig und besaßen Schilfrohrfiguren; sie hatten eine Vorliebe für spöttischen Humor, Lavendelparfums und Pfefferminzpastillen und trugen ausschließlich knöchellange schwarzgraue oder grauschwarze Roben – wie alle ewigen Witwen.
Dabei hatte keine von ihnen je geheiratet. Nicht etwa mangels Gelegenheiten, wie die Schwestern Violetta gegenüber einmal stolz erklärt hatten, sondern aufgrund rationaler Lebensplanung. Das Wort »ehemals« stamme von »Ehe«, hatten die Spitieri-Sisters kichernd behauptet. Und wenn Heiraten etwas so wahnsinnig Vernünftiges und Kluges wäre, warum, bitte schön, heiße es dann nicht »Verstandesamt«? Eben.
Mina stand hinter dem Verkaufstresen aus schalttafelgelbem Resopal, wie er schon Ende der Sechziger total außer Mode gewesen war. »Meine liebe Violetta, guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Die gewünschte Puppe steht für Sie bereit.«
»Wunderbar. Ich nehme sie gleich mit. Und Sie sind auch wirklich ganz sicher, dass Sie sie nicht mehr benötigen?«
Mina hob ihre dürren Runzelarme und winkte ab. »Uns steht sie nur im Wege. Zudem haben wir noch genügend andere Puppen. Wir sind froh, wenn es Platz gibt im Lagerraum hinten.«
Wie aufs Stichwort kam Fina aus dem rückwärtigen Raum geschlurft – mit einer lebensgroßen Schaufensterpuppe unter den Arm geklemmt.
»Hier ist der Nackedei«, krächzte sie. Wenn Fina grinste, konnte man ihre verbliebenen Zahnstummel an einer Hand abzählen. »Muss ich Ihnen den ein wenig einschlagen, damit die Leute draußen nicht so gucken? Ich könnte es mit Packpapier probieren.«
Violetta formte mit der Hand einen Trichter hinter ihrem rechten Ohr, verzog das Gesicht, als habe sie leichtes Kopfweh, und sagte: »Lieb von Ihnen, aber danke, nein: Bier ist nicht so meines.«
»Nicht ›Bier‹ – Packpapier«, wiederholte Fina. »Ob ich die Puppe darin einwickeln soll?«
Violetta zog die Brauen hoch und nickte zum Zeichen, dass sie diesmal alles mitbekommen hatte. »Nein, passt schon so«, sagte sie und übernahm die Plastikperson. Sie war ein Er, ein Mann, wie von ihr ausdrücklich bestellt. Mit Flexgelenken – was ganz wichtig war. Eine steife Puppe wäre für Violettas Vorhaben nutzlos gewesen. Dann stutzte sie und spitzte den Mund.
»Etwas nicht in Ordnung?«, fragte Mina.
»Wenn ich es mir recht überlege, brauche ich eigentlich nur den halben Mann, nämlich den Unterbau.«
»Kostet aber genau gleich viel. Mann ist Mann, selbst um die Hälfte verringert«, antwortete Mina. »Wobei … Eigentlich sollte ich sogar mehr verlangen. Ist wie im richtigen Leben: Die halben Portionen kosten einen doppelt so viele Nerven.« Beim Lachen rasselte ihr chronischer Katarrh.
»Wahre Worte«, meinte Violetta. »Was bin ich Ihnen schuldig?«
Während Mina einkassierte, löste Fina die Steckverbindung der Schaufensterpuppe auf Hüfthöhe und überreichte Violetta die gewünschte, untere Herrenhälfte. »Würde mich jetzt doch noch wundernehmen, was Sie damit anstellen«, fragte sie. »Benötigen Sie vielleicht einen Liebhaber im Haus?«
Violetta blinzelte den alten Damen verschwörerisch zu. »Ich muss einem Kerl Beine machen.«
Mit dem Männerunterleib unter dem Arm verließ sie das Spitieri’s und lief zurück zum Marktplatz und dem Stand des Fischhändlers.
Sie hatte ja gehofft, dass ihre Sprührache wirken würde – dass aber das Mittelchen so viel Liebesbombardement auslösen würde …
Szenen wie aus einem Disney-Tierfilm. Oder Horrorstreifen.
Ihr obligater Gute-Nacht-Tee hatte Violetta auf die Idee gebracht. Selbstverständlich stellte sie das Baldriangebräu selbst her; Valeriana officinalis, das Wurzelwunder, baute sie im eigenen Garten an. War einer der Vorteile ihres nicht ganz freiwilligen Umzugs nach Gozo, endlich wieder Zeit für ihr altes Hexenhobby zu haben: einen Naturgarten mit Heilpflanzen, Teufelskräutern und Bösestpilzen. In einem der beiden Geräteschuppen neben der Villa hatte Violetta sich sogar eine neue Giftküche eingerichtet, ein Zauberlabor, in dem sie gern herumexperimentierte. Wie einstmals daheim … Nun ja, auch im Mittelmeerraum gab es Personalprobleme, die man am effektivsten mit dem passenden Pflänzchen löste.
Dank der abendlichen Tasse Baldriantee hatte Violetta zu einem erholsamen und tiefen Schlaf gefunden. Endlich wieder. Nach den aufwühlenden Ereignissen vor einem Dreivierteljahr – als sie glaubte, ihren Verstand zu verlieren – hatte sie wochenlang nachts keine Ruhe gehabt. Eine Baldriantinktur im Tee hatte dann geholfen. Gewisse Stoffe darin setzten an den Neurotransmittern im Gehirn an und beeinflussten unter anderem das Schlafhormon Melatonin; der psychomotorische Bereich des Zentralnervensystems wurde dabei gedämpft, was auf Violetta sedierend wie auch hypnotisch wirkte.
Baldrian beruhigte, entspannte und wirkte krampflösend – jedenfalls bei Menschen.
Katzen hingegen verwandelte er in Sexfurien.
Guzepp Mizzi fluchte und jammerte und versuchte, sich gegen all die Katzen und deren Zuneigung zu wehren. Es mussten Dutzende Tiere sein, die seinen Fischstand belagerten – und ihn selbst. An ihm hochzuklettern versuchten, sich an seine Hosenbeine krallten, ihm mit amourös-vibrierendem Antennenschwanz um die Füße strichen, dabei wohlig schnurrten, wollüstig miauten oder schon mal paarungsbereit vormarkierten. Nie zuvor in seinem Leben war Guzepp Mizzi derart heftig umschwärmt und bedrängt worden. Er war gerade wahnsinnig beliebt.
Ein Hornissenschwarm auf Samtpfoten. Eine Rugbymannschaft mit Feuchtnasen. Fell-atio mal anders.
Die Katzen machten Mizzi fix und fertig, das konnte Violetta klar erkennen. Sie blieb stehen, stellte den Männerunterleib auf den Boden, stützte sich mit beiden Händen auf dessen Hüftteller ab, als wär’s ein Bistro-Stehtisch, und genoss das Schmusemassaker. Sie war gerade sehr zufrieden mit sich.
Seltsamerweise bewirkte Baldrian bei Katzen das pure Gegenteil wie beim Menschen. Baldrian war für sie der geilste Lockstoff, ein Sexualduft, ließ sie durchdrehen, machte sie giggerig und geil. Lustzombies. Triebbüsi. Rattige Katzen. Lag am Wirkstoff namens Actinidin, hatte Violetta gegoogelt.
Guzepp Mizzi – der lebende Katzenbaum – wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Amorterror. Auf Armen, Schultern, Hals, ja sogar im Gesicht bluteten Liebesbisse und -kratzer, und er versuchte gerade verzweifelt, mit der einen Hand eine sich in seinem Haarkranz festgekrallte Katze wegzuzerren und mit der anderen ein Dreiergespann in seinem Schritt. Mizzi zeterte aus voller Kehle. Es klang, fand Violetta, wie das Miauen einer gequälten Katze.
Das wird dem Kerl auf alle Fälle eine Lehre sein, dachte sie. Dann kicherte sie in sich hinein. Auf alle … Felle.
Ou, der hätte jetzt Miguel gefallen.
2
Der Weg nach Hause haute Violetta jedes Mal beinahe um.
Sie lebte jetzt seit gut acht Monaten auf Gozo, doch von diesem Ausblick würde sie nie genug kriegen. Wenn sie von Victoria kommend auf der Flickenteppichstraße voller Asphaltbatzen, Spurgräben, Bitumenschlieren, Platteidechsen, Schlag- und Sandlöchern hinunter in Richtung Steilküste und Meer fuhr … wow. Einfach jedes Mal nur atemberaubend augenüberquellend oberwow.
Es kam ihr vor, als sitze sie im Kino, der Vorhang gehe auf und ein 3D-Naturpanoramablockbuster umarme sie. Was für ein Bild sich da jeweils vor ihr auftat … Die aberhundert Graubrauntöne der verdorrten Landschaft, da und dort etwas kummergrüner Steppenrasen, Kapernbüsche oder die Fransen wilden Schnittlauchs, vereinzelt Olivenbäume, Steineichen oder Johannisbrotbäume. Und dann, zwischen all der kärglichen Botanik, die staubweißgleißende Straße, die pfeilgerade abwärtsführte und direkt im indigoblauen Meer zu enden schien – als wär’s die Landebahn für eine Urlaubsmaschine von Air Angels. Violetta war jedes Mal aufs Neue schockverliebt ob ihres Anflugerlebnisses.
Die Küstenlinie hier im Süden bestand aus hundert Meter hohen, aus dem Meer aufragenden Kalksandplateaus, an deren senkrechte Wände sich das Mittelmeer donnernd warf.
Die Straße endete als Sackgasse auf einem Wendeplatz nahe den berühmten Sanap-Klippen. Ab und zu parkten hier Touristen ihre Mietwagen, wenn sie das Naturmonument besuchen wollten. Doch um die Tageszeit jetzt war der Wendeplatz leer. Violetta bremste ihren Feigenfiat ab, hielt an und schaute auf die Straße zurück, von wo sie eben gekommen war.
Um auch ganz sicherzugehen, dass ihr niemand folgte.
Zufrieden ruckte sie den Wagen wieder an, verließ die Straße und das Bankett und rumpelte bis zu einer dichten Buschreihe von Terpentin-Pistazien – hinter der sich ein Naturweglein verbarg, das noch weiter in Richtung Meer führte. Gerade mal knapp Fiat-breit. Auf keiner Landkarte eingezeichnet, von keinem Autonavi angezeigt, von keiner Behörde bewilligt, geschweige denn in einem Straßennetzkataster erfasst. Noch so ein positiver Punkt, wenn man nicht gefunden werden durfte.
Violetta fuhr jetzt in Rollatorgeschwindigkeit. Zum einen, weil das Weglein dem Waschbrettbauch eines Muckibudenkerls mit Hang zum Anabolikamissbrauch glich. Zum andern, um nur ja keinen Staub aufzuwirbeln. Dann hätte sie nämlich genauso gut eine Signalflagge an ihrem Wagen hissen können. Schaut mal, dort vorne fährt die Morgenstern. Wird ein Kinderspiel. Wir müssen einfach nur ihrer Staubfahne folgen.
Das Meer kam immer näher. Und der Abgrund. Und ihr Zuhause – keine zwanzig Meter vom Klippenrand zurückversetzt hingebaut.
Ihr neues Domizil und gleichzeitig ihr Versteck – in dem sie vor einigen Jahren schon einmal gewesen war. Ja, exakt hier. Ausgerechnet … War das Ironie des Schicksals? Karmabumerang? Oder einfach nur ein weiteres aberwitziges Kapitel im Leben der Violetta Kuriosa Morgenstern?
Das hätte sie sich nun wirklich nicht einmal in ihren bösesten Träumen vorstellen können: nochmals an diesen Ort zurückzukehren. Und dann sogar hier zu wohnen. Hingen üble Erinnerungen an dem Haus. Ganz zu Beginn ihrer Karriere bei Tell war das gewesen. Unter dramatischen Umständen. Und Violetta damals der festen Überzeugung, hier sterben zu müssen. Erwischt, hingerichtet und dann über die Klippen geworfen zu werden.
Und zwar von diesem Kerl, den sie und Miguel damals auf Gozo im Auftrag Tells gesucht, gejagt und nach wochenlangen Nachforschungen aufgespürt hatten. Ihre Zielperson.
Carlsberg hatte er geheißen.
Beinahe hätte der Kerl am Schluss doch noch gewonnen. Er hatte das Tell-Duo in eine Falle gelockt und dann vorgehabt, sie ein für alle Mal loszuwerden. Miguel hatte den Schurken erst in allerletzter Sekunde überwältigen können. Und ihn zu Fischfutter gemacht.
Carlsbergs Immobilie war danach vom Tell-Ministerium still, heimlich und nicht ganz dem internationalen Recht entsprechend übernommen worden. Man konnte nie genug Safe-Houses auf der Welt besitzen, sagte sich das Tell-Ministerium. Wer hätte gedacht, dass man Jahre später dann ausgerechnet Morgenstern dieses noble Versteck als Bestandteil eines schier unglaublichen Zeugenschutzprogramms anbieten würde …
Kurz vor ihrer Ankunft betätigte Violetta eine kleine Fernbedienung im Ablagefach der Mittelkonsole, worauf sich ein Doppelgaragentor im rückwärtigen Hausteil öffnete. Es stand bereits ein Wagen drin, ein dunkelblauer Kleintransporter, mit dem Violetta Größeres herumfuhr. Sie fuhr hinein, parkte und verließ eilends und in gebückter Haltung die Garage, da sich das Tor bereits wieder schloss. Die halbe Schaufensterpuppenportion ließ sie vorläufig noch im Kofferraum.
Das Anwesen hatte Carlsberg in eine natürliche Senke bauen lassen, die wie eine Zahnlücke in der Kreidefelsenkante der Sanap-Klippen klaffte. Hervorragend vor dem Ghibli, dem libyschen Wüstenwind, geschützt. Und vor den Blicken Neugieriger.
Die Villa war modern gebaut und großzügig dimensioniert. Vom Baustil her ein kurioser Mix von Mykonos-Architektur, Mojave-Wüstenlodge, futuristischem Firmensitz einer New-Tech-Bude und Gozo Hinterlandbunker. Mehrere ineinandergeschachtelte Baukörper aus weiß getünchtem Sichtbeton, wuchtiges Flachdach, teure Materialien, viel Glas, Stahl, Mitternachtsquarz, Schiefer und überall Kunst am Bau. Carlsberg, der schöngeistige Dreckskerl, hatte sich sein Schmucktruckli ein paar Millionen kosten lassen.
Violetta lief über die weitläufige Rasenfläche, die, trotz Hitze und Trockenheit, akkurat getrimmt, manikürt und hinreichend gewässert war – das Verdienst der Sultannas. Das pensionierte Ehepaar aus dem Nachbarort Xewkija kam immer dienstags und donnerstags her und verrichtete ein paar Dinge, die getan werden mussten. Jacob Sultanna kümmerte sich um den Garten, während seine Gattin Helena Hausarbeiten übernahm, die Wäsche besorgte und manchmal auch kochte.
Violetta schritt über die Terrasse und schob eine der großflächigen Glastüren einen Durchschlüpfspaltbreit zur Seite. Das Innere des Hauses war dank der dicken Betonhülle angenehm temperiert. Sie kickte ihre Espadrilles in eine Ecke und genoss die Kühle des cremehellen Schiefers unter ihren Füßen.
Auch die Möblierung stammte größtenteils vom eliminierten Vorgänger. Carlsberg selbst oder sein Innenarchitekt schienen einen Narren an biederen beigen Wohlfühltönen gefressen zu haben. Es gab keinen einzigen grellen, aufregenden oder synthetischen Farbtupfer im Raum. Alles – Wände, Decke, Esstisch, Stühle, Teppiche, Sideboards, Couchtische, Lesesessel, Lampenschirme, Deko-Krimskrams, ja sogar die abstrakten Landschaftsmalereien und Actionpaintings an den Wänden – war in verschiedenen Sandtönen gehalten. Violetta hatte das aus Neugierde mal gegoogelt. Naturfarbene Inneneinrichtungen waren offenbar der letzte Schrei. Wohnstilexperten nannten es »Sad Beige« und gaben den Farbnuancen Namen wie Biskuit, Knochen, Bulgur, Katzenstreu, Kork, Kamel oder Haferbrei.
Und Carlsbergs riesige Sofalandschaft musste demzufolge Gottschalk-blond sein.
Fand Violetta ja so was von affig, dieses affektierte Getue um die Farbbetitelungen. Obwohl: Das traurig-beige Wohnen an und für sich schätzte sie als gar nicht mal so übel ein. Hatte was Aufgeräumtes, Gemütliches und kühlte optisch die bleierne Gozohitze herunter.
Ihre staatlichen Verstecker hatten anfangs ja gar angeboten, die Villa nach Morgensterns Geschmack und Gutdünken umzugestalten, aber sie hatte abgewinkt. Ja, wirklich, oioioiii, die hätten doch tatsächlich ziemlich viel Geld ihretwegen investiert. Was zeigte, wie hochrangig ihr Status in diesem Zeugenschutzprogramm war.
Und der ihres Mitbewohners sowieso.
»Hallooo!«, ließ sie es durchs Haus hallen. »Ich biiin’s! Bin wieder da-aaa!« Sie zehenspitzelte durch das Wohnzimmer, dann weiter bis zur Küche, wo sie ihre Tasche auf die beige Marmoranrichte hievte. Sie packte die Einkäufe aus, Lampukis, Gemüse, Brot, Obst, zwei Weinflaschen, drehte sich zum Kühlschrank um – und tat einen Schrei.
»Musst du mich so erschrecken?« Violetta atmete genervt aus und presste beide Handflächen auf die Brust, als versuche sie, das Galopporgan darin zu besänftigen.
»Das wollte ich nicht, entschuldige, meine liebe Lila-Lady. Sehe ich denn heute so … schrecklich aus?«
Er wieder! Violetta verdrehte die Augen und merkte, wie jeder Anflug von Ärger in ihr sich augenblicklich verflüchtigte. Schaffte nur er. Allein mit seiner Präsenz, seinem Aussehen und der kratzsonoren Bassstimme wickelte er sie im Nu um den Finger. J-e-d-e-s Mal. Dazu sein kurz geschnittenes, silbern meliertes Haar, die frech-hellwachen Augen, das feinironisch ziselierte Gesicht und sein entwaffnender Old-Shatterhand-Charme. Null Chance auf Widerstand für Violetta.
Und wie er heute wieder auftrat. Ganz der Grandseigneur mit diesem eisgrünen Leinenanzug samt mandarinenfarbenem Einstecktuch. Lediglich auf die Krawatte verzichtete er, seit sie zusammen hier lebten.
»Du gewährst mir doch diese thermoregulatorische Schwäche«, hatte er Violetta gebeten. »Ein Zugeständnis an die Hitze unseres Gastlandes; tout petit seulement, ja? Ich hoffe doch, du bist d’accord damit?« Wohl wissend, wie wehrlos Violetta dahinschmolz, wenn er mit französischen Sprachflittern um sich streute wie eine Lamettakanone auf der Silvesterparty.
Maurice von Brandenberg.
Auferstanden von den Toten.
»Was bin ich heute aber auch schreckhaft wie ein Kätzchen«, sagte Violetta, lachte und warf den Kopf in den Nacken. »Apropos – gutes Stichwort.«
Sie packte weiter ihre Einkäufe aus und wollte Maurice gerade von ihrer Baldrian-Rache erzählen, als sie seinen vorwurfsvollen, da leicht zugespitzten Mund bemerkte. Dazu zuckte auch noch seine linke Augenbraue, was in seiner Dandy-Liga als untrügliches Zeichen für Aufgebrachtheit galt.
»Ist was?« Violetta war verunsichert. Maurice hatte sonst eigentlich immer gute Laune.
»Vermisst du etwas?«, fragte er streng.
»Du meinst, mal abgesehen von meinem wunderschönen, antiken Holzkochherd aus Umbrien, den ich in der alten Heimat …«
»Das meine ich nicht, Lila-Lady.« Maurice legte die Hände an die Greifreifen seines Rollstuhls und fuhr lautlos auf sie zu. Dazu raunte er mit gedämpfter Stimme: »Ich glaube, du hast heute Morgen vergessen, etwas Wichtiges mitzunehmen.«
»Was sagst du …?« Reflexartig fächerte sie wieder die Hand hinter dem Ohr – und realisierte im gleichen Augenblick, wie Maurice sie eben auf das Glatteis geführt hatte. Was etwas heißen wollte, bei dem Klima hier.
Er lächelte und zog ein Lammgesicht.
Sie lief rot an und stammelte herum. »Ich … Ja, jaaa, hast ja recht. Aber ich kann mich einfach nicht an die Dinger gewöhnen. Zudem verlege ich sie immer und weiß dann nicht, wo …«
Maurice griff in seine linke Sakkotasche und zog etwas heraus, das er ihr auf dem Handteller entgegenstreckte.
Zwei winzige, leicht gebogene Glänzdinger. Sahen aus wie zwei von Köderpulver aufgedunsene und zu Tode geplatzte Silberfischchen.
Hörgeräte.
»Hier sind sie«, sagte Maurice. »Möchtest du sie gleich einsetzen?«
»Nein, danke, ich stehe lieber.«
Beide starrten sich einen Moment lang an. Und prusteten dann los.
»Der war nicht schlecht«, lobte Maurice, nachdem er sich mit dem Einstecktuch ein paar Tränen aus den Augenwinkeln getupft hatte. »Und trotzdem ist die Sache ernst. Du hörst schlecht, Lila-Lady. Deswegen warst du ja beim Akustiker und hast diese nicht ganz billigen Gerätchen gekauft.«
»Ich fühle mich halt einfach … behindert damit.«
»Und ohne bist du es tatsächlich.«
»Zudem finde ich es unheimlich, andauernd zwei Knopfbatterien am Kopf zu tragen. Ich meine, weiß man da etwas wegen der Strahlung?«
»So etwa um die tausendmal weniger, als wenn du dein Handy benutzt.«
Violetta knurrte.
»In deinem Alter ist so eine Hörhilfe ja auch keine Schande.«
»Was heißt ›in meinem Alter‹?«
»Beruhige dich, so alt meinte ich natürlich nicht. Es sei denn, deine Schwerhörigkeit hast du dir beim Urknall geholt.«
Violetta murrte.
»Meine Allerliebste, jetzt sei aber wieder lieb, ja? Ich versuche lediglich, mit etwas feinfiesem Witz die Situation für dich erträglicher zu machen. Und weißt du was? Das dürfte dir doch schmeicheln: Mit so einem Hörgerät hast du es … noch faustdicker hinter den Ohren.«
Gegen ihren Willen musste sie glucksen. »Elender Charmeur, wenn dir mal keine Süßholzraspelei mehr in den Sinn kommt …«