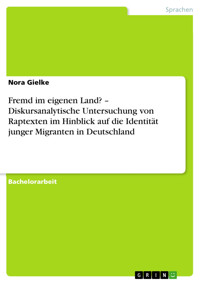
Fremd im eigenen Land? – Diskursanalytische Untersuchung von Raptexten im Hinblick auf die Identität junger Migranten in Deutschland E-Book
Nora Gielke
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Sprachwissenschaft / Sprachforschung (fachübergreifend), Note: 1,3, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Sprache: Deutsch, Abstract: This paper explores the problem of identity in ethnic minority hiphop youth culture in Germany. Using the Foucault-oriented Critical Discourse Analysis (Kritische Diskursanalyse) by Jäger (2001), rap texts are being examined with resepct to the relevant concepts of ethnicity, diaspora and the so-called “Kanaken-Kultur”. The latter characterizes a German version of black stereotyping used in hip hop culture as a means of distinction from the German “Mehrheitsgesellschaft” (major society). The derogative term “Kanake”, now transformed into a self-referential description with a positive connotation, provides the basis for the concept of identity arriving with the abstract figure of the bricoleur. The fundamental idea of Lévi-Strauss’ (1968) concept of bricolage is derived from a syncretic notion of culture, as Kaya (2001) states - as well as for the concept of hybridity. The data, created by ethnic German hip hop artists, is being qualified by the named method to show if the abstract figure of the Bricoleur and the social practice of being “Kanake” correspond.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 3
Abstract
This paper explores the problem of identity in ethnic minority hiphop youth culture in Germany. Using the Foucault-oriented Critical Discourse Analysis (Kritische Diskursanalyse) by Jäger (2001), rap texts are being examined with resepct to the relevant concepts ofethnicity, diasporaand the so-called “Kanaken-Kultur”. The latter characterizes a German version of black stereotyping used in hip hop culture as a means of distinction from the German “Mehrheitsgesellschaft” (major society). The derogative term “Kanake”, now transformed into a self-referential description with a positive connotation, provides the basis for the concept of identity arriving with the abstract figure of thebricoleur.The fundamental idea of Lévi-Strauss’ (1968) concept ofbricolageis derived from asyncreticnotion of culture, as Kaya (2001) states - as well as for the concept ofhybridity.The data, created by ethnic German hip hop artists, is being qualified by the named method to show if the abstract figure of the Bricoleur and the social practice of being “Kanake” correspond.
Page 4
1 Einleitung
Im Februar 20082erregt das Unglück eines Brandes in einem Ludwigshafener Wohnhaus, bei dem neun Menschen alevitischen Glaubens ums Leben kommen, die Gemüter. Die Tragödie wird rasch zum Medienereignis. Politiker müssen Stellung beziehen. „Es darf um Himmelswillen kein Brandanschlag gewesen sein“, mahnt der Vorsitzende des Rates der Türkischstämmigen in Deutschland.3Das Thema ‚Brandanschlag’ aktualisiert vergessen geglaubte Diskurse. Es wird zum Prüfstein für die Öffentlichkeit und wirft Fragen auf, die auch das Problem der Identität von Migranten in Deutschland ansprechen. In der Diskussion über Integration ist dieses Thema noch immer ein diskursiver Brennpunkt. Diese Arbeit widmet sich daher der Frage nach dem Selbstbild junger Migranten in Deutschland und durchleuchtet dazu eine Reihe von Texten, die aus dem HipHop-Genre des Message-Rap stammen. Mittels der Kritischen Diskursanalyse nach Jäger (2001) soll der Struktur des Diskurses zur Identität auf den Grund gegangen werden. Auf dieser Basis wird versucht ein Identitätskonzept zu entschlüsseln, das sich aus den Aussagen der Raptexte ergibt. Dieses Konzept äußert sich als Gegendiskurs des „Kanaken“ gegenüber dem Diskurs über ‚Ausländer’. Hier findet sich die abstrakte Bildfigur desBricoleur,die die Identität junger Migranten in Deutschland abbildet. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, werde ich folgendermaßen vorgehen. Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen für ein Verständnis der HipHop-Kultur alsJugend-undSubkulturgelegt. Weiterhin wird unter dem Aspekt der Minderheitenjugend und unter Einbeziehung derafroamerikanischen Ursprüngedes HipHop die Entwicklung derHipHop-Kultur in Deutschlanderläutert. Im zweiten Teil lege ich mit Bezug auf Kaya (2001) zweiIdentitätskonzeptedar, die m.E.4eine wichtige Rolle in der Betrachtung der Identität von Migranten spielen. Es wird gezeigt, wie das Identitätskonzept derEthnizitätim Laufe seiner Entwicklung modifiziert wird. Mit dem Konzept derDiasporaerläutere ich zwei politische
Page 5
Strategien (migrant/minority strategy), die sich aus dem Prozess der Migration entwickeln können und verweise im darauf folgenden Teil auf eine weitere Strategie, die in der HipHop-Kultur wirksam wird. Das Identitätskonzept des „Kanaken“ wird, als politische Strategie, in den Raptexten deutlich.
Auf Grundlage dessynkretistischenKulturbegriffs werde ich im dritten Abschnitt die für meine Interpretation relevanten Konzeptionen derHybridität(Bhabha) und derBricolage(Lévi-Strauss) behandeln und aus ihnen die abstrakte Bildfigur desBricoleurableiten.
Diese theoretische Vorarbeit ist die Grundlage für ein akkurates Verständnis des in den Raptexten sichtbaren Identitätsdiskurses. Der Analyseleitfaden derKritischen Diskursanalysenach Jäger (2001) dient der Orientierung, um das Datenmaterial der Raptexte auf diesen Diskurs hin zu untersuchen. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Diskursanalyse gegenübergestellt und mit einem Interpretationsansatz verknüpft.
2 HipHop
Die HipHop-Kultur wird in der Forschung aus den verschiedensten Blickwinkeln näher betrachtet. Toop (1991), Rose (1994) und Gates (1988) liefern musikgeschichtliche, sozial- und sprachwissenschaftliche Standardwerke über den afroamerikanischen HipHop.5In Deutschland befasst sich z.B. Androutsopoulos (2003) mit dem soziolinguistischen Aspekt des Rap. Menrath (2001) und Kaya (2001) beleuchten HipHop besonders unter dem Aspekt der Identität und ihrer Repräsentativität. Dabei nehmen sie die HipHop-Kultur vor allem auch als Minderheitenphänomen wahr.
Natürlich wird HipHop in Deutschland auch von Weißen rezipiert, aber insbesondere die zweite Generation von Migranten identifiziert sich mit dieser Kultur. Zu Pop-Kulturen wiePunkundNew Wave,die ebenfalls Anfang der 80er entstehen, besteht für Migranten kein greifbarer Zugang. HipHop ist die einzige Jugendkultur, die sie für
Page 6
sich ernst nehmen können. In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung des HipHop in Deutschland als Jugend- und Subkultur und ihr Bezug zum afroamerikanischen Ursprung dargelegt.
2.1 HipHop als Jugend- und Subkultur
HipHop ist eine internationale Jugendkultur, die im Zuge ihrer Globalisierung besonders Jugendliche ethnischer Minderheiten anzieht und bewegt (vgl. Klein/Friedrich, 2003). In Deutschland begeistern sich vor allem die Migranten der zweiten Generation, also die Kinder der so genannten Gastarbeiter, die in den 1950er Jahren aus Italien, Portugal, dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und anderen Ländern nach Deutschland kommen, für die afroamerikanische Jugendkultur. Als Teil der Arbeiterklasse und mit ethnischer, d.h., nicht-deutscher Zugehörigkeit stellen sie in Deutschland eine Minderheit dar, die mit sozialen und ökonomischen Problemen und gesellschaftlicher Ausgrenzung zu kämpfen hat. Kaya beschreibtethnic minority youth cultureals eine vonoutsiderismgeprägte Kultur (2001: 48). Dieses spezielle Merkmal des ‚Outsidertums’ findet sich auch im Ursprung des HipHop in der afroamerikanischen Jugendkultur wieder. Seit den Anfängen in der Bronx und Harlem wird HipHop von Jugendlichen gemacht, die mit den neuen Realitäten ökonomischer und politischer Veränderungen („deindustrialisation, (…), consumerism, economic restructuring and resurgence of racism and xenophobia“6; ebd.) konfrontiert sind.
Auch die jungen Migranten in Deutschland müssen mit einer sozialen Situation umgehen, die sie in das gesellschaftliche Abseits drängt:
„Unwanted as workers, underfunded as students, undermined as citizens, and wanted only by the police and the courts, minority youth recently seem to be subject to a state of structural outsiderism. Structural outsiderism can create minority youth cultures that offer the youngsters an identity and sense of belonging in a harsh world.” (Ebd.)Als gemeinsame Erfahrung wird dieser Zustand mit Hilfe von zum Beispiel Rap und Graffiti kreativ verarbeitet. Kaya spricht der jugendlichen Expressivität hohe soziale
Page 7
Kompetenz und ein politisches Bewusstsein zu. Die Jugendlichen seien „socially conscious and critical of the increasing discrimination, segregation, exclusion and racism in society” (ebd.: 49).
HipHop bietet den Jugendlichen eine Öffentlichkeit, um ihre Reflektionen über die Gesellschaft, in der sie leben, zu artikulieren. Der RapperTorchvonAdvanced Chemistry,beschreibt die Bedeutung des HipHop für viele türkischstämmige Jugendliche in seinen Worten:
„Es (HipHop) hat viel repräsentiert, was ich hätte runterschlucken müssen, was ich sonst niemandem hätte sagen können, was sonst gar nicht gefragt war, wie es bei den türkischen Kids auch war. Bei den türkischen Kids hat sich keiner für ihre Probleme oder für ihre Welt interessiert. Die waren halt da, aber sie waren nicht gefragt, Punkt.“ (Menrath, 2001: 114)Karrer (1995) spricht hier von einer „doppelten Artikulation“ der Jugendlichen, die sich einerseits von ihrer eigenen Klasse, also ihrem Elternhaus, andererseits von anderen Jugendkulturen abgrenzen wollten. Damit formulieren sie, seiner Meinung nach, ihren Widerstand gegen die Hegemonie - ein zentrales Element innerhalb des subkulturellen Ansatzes:
„(…), dass die expressive Innovation der Jugendlichen, die sich weitgehend als Stil, als Montage verschiedener kultureller Zeichen darstellte, nicht nur die ambivalente Klassenzugehörigkeit der einzelnen Jugendkulturen ausdrückte, sondern auch ihre Differenz, ihren Konflikt mit anderen Jugendkulturen. Widerstand gegen Hegemonie und Differenz gehören zusammen. Jugendliche artikulieren diese Widersprüche der doppelten Artikulation in Ritualen, die die Zugehörigkeit zur Bezugsgruppe stärken, und die Strategien für Aushandeln, Widerstand und Kampf festlegen.“ (Ebd.)7
Klein und Friedrich (2003) werfen in diesem Zusammenhang eine interessante Frage auf, die sich mit dem Verhältnis von „sozialer Erfahrung und ästhetischer Produktion“ bzw. Produktivität beschäftigt: Wie komme es, dass es ausgerechnet jugendliche Minderheiten und nicht andere soziale Gruppen, wie Obdachlose oder Alkoholiker, fertig brächten, eine ästhetische Praxis zu entwickeln, in der sie ihre sozialen Erfahrungen von gesellschaftlicher Benachteiligung ausdrücken könnten? Dieser Ausdruck ermögliche ihnen sogar ein (symbolisches und reales) Überschreiten ihres „sozialen lokalen Kontextes“ (ebd.: 102).
Ist die Antwort im Elan, der Dynamik, der Neugier und dem kreativen Potential der Jugend zu suchen, die ja immer schon Nährboden für neue Lebens- und Kunstformen war? Von der Swingjugend in Deutschland, den Beatniks über die Hippies zum Punk
Page 8
in den USA und England waren es immer populäre Jugendkulturen, die Veränderungen in Kunst und Gesellschaft anstießen.
Ein weiterer Punkt, den Klein und Friedrich ansprechen, ist die Konsumorientiertheit der HipHop-Kultur. Wie geht diese zusammen mit der kreativen Praxis? Klein und Friedrich stellen fest: „Die HipHop-Kultur veranschaulicht, dass Medienkonsum und eine eigenständige jugendkulturelle Praxis nicht zwangsläufig in Widerspruch stehen müssen“ (ebd.: 10). Das Konsumieren beinhaltet auch die gegenseitige Anerkennung der Kreativität des Anderen und fördert, besonders in der HipHop-Kultur, gleichzeitig den Aktionismus der Beteiligten.
Der „kreative Widerstand“8der innerhalb der Jugendkultur HipHop generiert wird, beschreibt HipHop gleichzeitig als Subkultur. Der in denCultural Studiesdiskutierte Begriff der Subkultur bezeichnet, laut Kaya (2001), „some groups of people, who had something in common with each other and had a different way of life from members of other social groups” (ebd.: 44). Dieser “different way of life” gestaltet sich oft als Protestverhalten gegenüber konventionellen, gesellschaftlichen Regeln. Albert K. Cohen (1955) benennt in seiner Untersuchung delinquenter Jugendbanden in New York den wesentlichen Aspekt des Widerstandes, den eine Subkultur von der dominanten Kultur unterscheidet. Bei Jugendlichen aus der Unterschicht stellt er fest, dass diese
„gegenüber den Werten und Zielen der Mittelschichten ambivalente Gefühle entwickeln: d.h., sie halten sie zwar für grundsätzlich erstrebenswert, sehen aber zugleich die Schwierigkeiten, diese aus ihrer sozial benachteiligten Situation heraus erreichen zu können.“ (Schwind, 2004: 137)
Die Kluft zwischen Mittel- und Unterschicht ruft bei den Jugendlichen verschiedene Reaktionen hervor, z.B. kriminelles Verhalten, das aus einer Ablehnungshaltung gegenüber der Mittelschicht entsteht. Der Kriminalität wird dabei, innerhalb des subkulturellen Werte- und Normensystems, ein Wert beigemessen, der Ruhm und Überlegenheit repräsentiert (vgl. ebd.). Diese positive Bewertung richtet sich gegen die (kulturell) dominierende, also hegemoniale Kultur.
Stuart Hall (1976)9versteht unter kultureller Hegemonie die „’soziale Autorität’“ einer „Allianz gewisser gesellschaftlicher Gruppen (…) über andere, untergeordnete Gruppen“ (bei Hebdige, 1983).





























