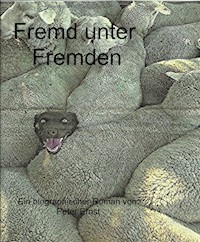
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hineingeboren in die Kriegswirren des 2. Weltkriegs. Flucht und Vertreibung. Fünf Jahre in einem Barackenlager an der Kieler Förde. Nach der Volks-und Mittelschule e Lehre auf einer Werft. Mit 21 Jahren heiratete er. Mit 30 Jahren gründete eine Firma für Energietechnik. Nach 17 Jahren Selbständigkeit Aufgabe allen Besitz. Reisen mit seiner Frau durch Westeuropa auf der Suche nach einem richtigen Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FREMD unter FREMDEN
1. Kapitel
Wir schreiben das Jahr 1989, das Ende der Geschichte. Für P und R war es der Beginn einer neuen Geschichte, der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. 1989 verkündete der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, die Demokratie und der Kapitalismus sind auf dem Siegeszug, und die Zeit der Ideologien ist für alle Zeit vorbei. Recht behielt er nur, was den Kapitalismus betraf. Die kapitalistische Einheitszivilisation breitete sich mit ungeheurer Geschwindigkeit über den ganzen Globus aus. Er irrte jedoch gewaltig, was Ideologien, Religionen und die Demokratie betrafen. Das 21. Jahrhundert ist von religiösem Fundamentalismus und Gewalt geprägt. Ob religiöse Fundamentalisten oder illiberale Demokratien, es werden die sogenannten Werte des Westens bekämpft, diese westlichen Werte, werden von Politikern ständig in ihren Reden betont. Die Werte der Aufklärung werden als erste genannt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gefolgt vom christlichen Abendland und der christlich-jüdischen Kultur. Betrachten wir die Freiheit. Wir haben sie verkauft für Sicherheit, Bequemlichkeit, und Komfort. Die digitalen Konzerne versprechen uns die Erlösung von der Freiheit. Übriggeblieben ist die Konsumfreiheit. Wir feiern xMass, kaufen in seelenlosen globalen Shoppingmalls, in den Bling Bling Tempeln der Einkaufzentren. Wie steht es mit der Brüderlichkeit? Es gibt sie noch. Die Hilfsbereitschaft in liberalen Demokratien ist hoch. Doch die Solidarität zwischen Gruppen und Staaten ist gering. Der zivilisatorische Lack der osteuropäischen Gesellschaften ist dünn. Die Zivilgesellschaft konnte sich unter der kommunistischen Diktatur nicht entwickeln. Auch die Gleichheit als Wert der Aufklärung bleibt eine Illusion, gerade die ökonomische Ungleichheit in der globalisierten Welt ist die Ursache für die meisten Krisen. Francis Fukuyama irrte, weil es unmöglich ist, kommende Geschehnisse vorauszusagen. Und auch diese Aufzeichnung hat ein ungewisses Ende.
Sie beginnt als P 48 Jahre und R eineinhalb Jahre jünger war, und als sie sich entschlossen ihr altes Leben abzulegen und ein neues zu beginnen. Der Fall der Mauer und der Zusammenbruch der UDSSR war welthistorisch eine Zäsur, für ihr neues Leben hatten diese Ereignisse so gut wie keine Bedeutung. Sie waren Kinder des Westens, der Osten hatte sie wenig interessiert.
Mit einem gewissen westlichen Hochmut hatten sie immer schon auf Dunkeldeutschland geblickt.
P war der Meinung, dass die meisten DDR-Bürger von einer Unfreiheit in die andere stolperten, von einem repressiven Staat in eine Plutokratie. Von der Herrschaft eines Staates in die Herrschaft von Dingen und den Konzernen, die diese Dinge herstellten.
Bei Freiheit geht es jedoch darum, nicht beherrscht zu werden. Weder von einem Staat, den Dingen oder dem Willen eines Anderen. Diogenes in seiner Tonne demonstriert auf anschauliche Weise, dass der wahrhaft Freie der Bedürfnislose ist. Aber so einfach ist es wohl auch nicht, zumindest hatte er das Bedürfnis, dass Alexander ihm nicht das Licht der Sonne versperrte.
Sie waren in Portugal, dem Land ihrer Sehnsucht. Auf der Westküstenstraße von Grandola Vila Morena bis Budens begegnete ihnen kaum ein Auto. P. begann sofort mit dem Aufbau des Zeltes, er studierte die Gebrauchsanweisung, ordnete die einzelnen Gestänge nach Durchmesser und Länge, steckte alles ineinander. Das Gestänge stand. Mit der Plane gab es Schwierigkeiten. Der Wind hatte zugenommen, bauschte die Plane zu einem Ballon.
P versuchte sie über das Gestänge zu ziehen und über die Ösen mit dem Gestänge zu verbinden. Endlich hatte er es geschafft. Doch nun freute sich der Sturm über die größere Angriffsfläche, spielte fröhlich mit der Plane; hob das Gestänge leichtwindig empor. P stemmte sich dagegen, rief R um Hilfe. Sie unterbrach ihre Arbeit am Gasherd und hielt jetzt ihrerseits das widerspenstige Gestell. P schlug Pflöcke in den harten Boden, spannte Leinen, triumphierte über die Naturgewalten. Es gab Pfannkuchen zu Mittag. Von den Eingeborenen hatte sich noch niemand gezeigt. In der Ferne blökten Schafe. Der Kurzwellensender brachte Nachrichten. Die Erdlinge zerfleischten sich, die Aktienkurse stiegen.
Nachts steigerte sich der Sturm, holte lange Atem, die Stille war trügerisch, dann, als er voll war von Luft, Regen, Energie, spie er alles aus, fiel triumphierend heulend über Eukalyptus und Mimose, brachte das Wohnmobil zum Schwanken. Regenfluten prasselten auf die lehmige Erde.
Die beiden Fremden zogen die Vorhänge zu, entkorkten die zweite Flasche grünen Weins. Stampfender Blues brachte den Regen zum Schweigen.
Spät in der Nacht schrak R aus dem Schlaf, die Schiebetür ihrer autarken Einheit knallte zu. P kam zum zweiten Mal vom Pinkeln. Nackt, die Füße im lehmigen Schlamm, klappte er den Regenschirm zusammen und kroch wieder unter die Decke. Er hörte die Schiebetür klappen, R huschte nach draußen.
Am Morgen hatte sich das Zelt davon gemacht, lag kläglich mit dem Gestänge im Gras, alle Füße von sich gestreckt, den Bauch voll Regen.
Sie duschten aus der Regentonne, und frühstückten.
Der Sturm fegte den Rest Wolken aus dem Gesicht der Sonne. Sie sahen sich lächelnd an.
P schüttelte den Regen aus dem Bauch des Zeltes, reparierte das gebrochene Gestänge, schlug längere Pflöcke ein, und band es am Camper fest. Es war Sonnabend. Sie wollten auf die Piste. Doch vorher schlürften sie Mut aus dem grünen Wein. Jetzt waren sie keine Mumien mehr unter den jungen Eingeborenen. Die Beatles törnten sie an, ließen das Tanzbein zucken. Sie fuhren los, das Zelt lag wieder auf der Nase. P hatte vergessen, es loszubinden. Im Golfinho stand ein kleiner dicker Frank Sinatra mit Halbglatze auf der Tanzfläche und trieb die Eingeborenen in den hellen Wahnsinn. P. und R. schauten befremdet, und verließen das fröhliche Treiben. Im Zapata gähnende Leere, die Musik wie üblich, eintöniges Stakkato, rhythmischer Lärm. Der pockennarbige Diskjockey deutete ein flüchtiges Lächeln an, als P und R hereinschauten, und legte eine neue Scheibe auf. Sie lehnten noch unschlüssig an der Theke, bestellten erstmal Bier. Aus der Pendeltür des WCs stürmten zwei farbige Mädchen auf die kleine Tanzfläche, wiegten sich im stampfenden Rhythmus. Ein Alter schrie wilde Anfeuerungsrufe in den Raum, klatschte in die Hände, umtänzelte die Mädchen. Nach und nach füllte es sich. Alle waren sie wieder da. Das bebrillte Unschuldslamm, das es faustdick hinter den Ohren hatte und sich mit einem Mädchen in der Damentoilette einschloss, und noch so ein paar Sumpfschnecken. Der Diskjockey flippte aus. Mit seinen Abzeichen auf der Baskenmütze und seinen hageren und fast brutalen Zügen machte er einen beklemmenden, futuristischen Eindruck. Die Wirtin quatschte P. die Ohren voll. Er grinste stupide zwischen zwei Schlucken Bier, murmelte irgendetwas, schwankte auf die Tanzfläche, zappelte sich nüchtern. Punkt zwei Uhr erstarb der Lärm. Gemurmel in allen Nischen. Die Kneipe leerte sich, alle strömten ins Phönix. In den Ecken standen Bullen. Der Morgen war ein Mittag. Ekel strömte aus den Klamotten. Die Brise vom Meer brachte Linderung. Im Meeressaum, in knöcheltiefer Gischt tanzt ein Mann, den Rücken gebogen, einen seltsamen Tanz. Er durchpflügt mit kescherartigem Netz, das sich zu einem Schlauch verjüngt, den Meeressand. Um die Hüfte hat er einen Gurt geschlungen, mit dem er den Kescher zieht. Den langen Kescherstiel hat er an die Schulter gepresst. Seine braunen, sehnigen Beine staken aus kurzen Hosen und trommeln rückwärts stemmend einen Rhythmus in den Sand.
Hin und wieder hält er inne, spült den Sand aus dem Netz und schau nach seiner Beute, die sich im Netzstrumpf ansammelt. Dann pflügt er wieder den Sand, tanzt seinen Muscheltanz. Im Gegenlicht, vor gleißendem Meer harkt ein rundlicher Mann die krausen Wellen glatt. Seine vielköpfige Familie folgt seiner Harkspur und sammelt die Muscheln auf.
Oft bleiben zwei dicke Frauen in der Brandung stehen und schwatzen.
Der Harker muss ihnen dann immer die Muscheln zeigen, die sie zerstreut aufheben. Ein Pärchen dreht hüftschwenkend mit den Hacken im Sand, zieht Furchen, fühlt Hartes mit den Zehen, bückt sich, sammelt ein. Auch sie tanzen den Muscheltanz.
Mitte März fallen sie ein, heuschreckengleich überfluten sie das Land. Lärmend quellen sie aus Autobussen, schnatternd strömt ihr madenweißes Fleisch durch enge Gassen. Mit ihrer fettbäuchigen und fettschenkeligen Allgegenwart verdrängen sie die Alten auf dem Platz in die zweite Reihe. Mit dem Fuß auf dem Helm des jungen Königs blicken sie mit dem Lächeln des Eroberers in klickende Kameras. Andere wissen nicht wohin mit ihren Händen, doch die Hände erinnern sich, wie selbstverständlich finden sie die imaginäre Hosennaht. An den Tischen der Restaurants befehlen sie mit fremden Zungen, halbnackt schlürfen sie das kalte Bier in des Mittags Glut. Die Sonne lässt ihre feisten Gesichter erglühen. Hier können sie die Sau rauslassen, dann schwirren sie wieder ab in ihre grau genormte Alltagswelt. Doch schon schwappt die nächste Woge über das arme Land, der Rubel muss rollen, rollt in große, gierige Hände. Die kleinen streichen suchend durch benzingetränktes Gras im Straßengraben, finden Schnecken gegen den Hunger. Was machen wir hier, fragt P. Weiß ich auch nicht, antwortet R. Viel reden sie nicht miteinander, was soll man schon sagen, wenn man immer beisammen ist und alles zusammen erlebt. So sitzen sie bis weit nach Mitternacht nebeneinander gedrängt in ihrem Minimobil und lesen. P liest aus der Zeit vor. Ein witziger Artikel. Bedeutungsvoll sehen sich die beiden über die Ränder ihrer Lesebrillen an, dann prusten sie los. Doch nicht immer ist das Einverständnis so spontan. Worte kommen auf Krücken daher, verschlüsselt, passen nicht ins weibliche Ohr. Auch das männliche Hirn entkleidet sie der weiblichen Botschaft. Ein Verstehen scheint unmöglich, kann nur auf einer intuitiven Ebene erfolgen. Nur was man bereits in sich trägt, wird in Schwingungen gesetzt, findet Anklang und wird verstanden, resümiert P. Unmöglich eine fremde Kultur zu verstehen, wenn man die Menschen, ja wenn man sich selbst nicht versteht. Vielleicht, wenn man genau beobachtet, zuhört, sich in das Gegenüber versetzt, ist es möglich, dass eine Resonanz anklingt und die Fremdheit zu Vertrautheit wird.
Man müsste in die Haut der Menschen schlüpfen, so wie es Schauspieler tun, um ein Anderer zu werden.
Am Strand von Salema, alles ist friedlich, still, nur die Wogen des Meeres rollen gurgelnd an den Strand. P blickt hinaus auf das gleißende Meer. Ein schwarz-weiß gefleckter Hund ist ihm zugelaufen und hat sich neben ihm niedergelassen. Der erste und treueste Freund des Menschen. Bald wird er sich einen neuen Herrn suchen müssen. Der Strand ist menschenleer, auch im Ort kaum Betriebsamkeit. Zwei Jungen spielen bei den Fischerbooten.
Aufröhrend vertreibt das Geknatter eines Treckers die Stille des Ortes. Er pflügt durch den Sand auf das Ufer zu. Kurz vor den Wellen wendet er. Ein weiß-grünes Fischerboot mit zwei alten Fischern tuckert an den Strand. Einer der Fischer springt ins seichte Wasser und befestigt ein Seil an dem Trecker. Dieser ruckt an und zieht das Boot aus dem Wasser und über den breiten Strand und neben die anderen Boote. Der Trecker fährt zurück in seine Parkposition. Der Motor erstirbt. Wieder Stille. Einer der Fischer entlädt den Fang in eine blaue Kunststoffkiste. Zwei andere tragen die Kiste mit den Fischen in einen Schuppen. Der Hund hat P verlassen und läuft schweifwedelnd zu den spielenden Kindern. Inzwischen sind es vier, drei Jungen und ein Mädchen. Zwei von Ihnen schlecken Eis und klettern am Geländer des Restaurants herum. Die anderen beiden streicheln den Hund. Jetzt kommen auch die Eisschlecker hinzu und der Hund glaubt, er bekomme etwas ab von dem Eis. Er wird von einem der etwas größeren Jungen am Halsband zurückgehalten. Ein alter Mann tritt aus dem Restaurant und trottet langsam zu der Gruppe der Fischer bei den Booten. Der Hund folgt ihm. Aus einem Hinterausgang des Restaurants tritt eine dicke Frau und ruft den Namen eines der Kinder. Kaju geht langsam über den Strand zum Restaurant. Die anderen Jungen folgen ihm. Das Mädchen spielt allein weiter im Sand, während die Jungen um die leeren, aufgestapelten Bierkästen herumspökern. Das Mädchen ist blond und steigt nun die Treppe zum Restaurant hinauf. Es nimmt immer nur eine Stufe und setzt die Füße nebeneinander. Auf der Terrasse sitzen ein Mann und eine Frau und trinken Kaffee, offenbar die Eltern des Mädchens. Es läuft kurz zu ihnen, wechselt ein paar Worte, die Mutter wischt der Kleinen den Mund ab. Danach springt es wieder zu den tollenden Jungen. Wieder tritt die dicke Frau heraus und ruft ihren Jungen. Er kommt gelaufen. Die Mutter kniet vor ihm nieder und zieht dem Jungen die Turnschuhe aus, klopft den Sand an der Mauer heraus und verschnürt sie wieder ordentlich. Sodann nimmt sie ihren Sohn bei der Hand und verschwindet mit ihm zwischen den Häusern.
Die Eltern des blonden Mädchens haben inzwischen das Restaurant verlassen. Der Ober kommt heraus und räumt den Tisch ab. Die Kinder sind verschwunden. Auch die Gruppe der Fischer hat sich aufgelöst. Die Boote liegen verlassen.
Nur der Hund döst auf der Mauer. Es ist Mittag.
I really don”t know what to do, yeah- singen die Stones. Der Sturm fällt wieder über das arme Zelt her. Es flattert und ächzt erbärmlich, aber es steht. Noch. Der Mond, mit einer Schar Sterne im Gefolge, rast über das Himmelszelt. R hat sich lang gemacht. Auch P ist bös angeschlagen. Entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten waren sie gestern, am Freitag auf der Piste. Was soll nur heute werden? Die Stones geben die Antwort: just wait and see .Die Zipperleins sind kaum noch zu ignorieren. Nach den permanenten Schmerzen im rechten Fußgelenk geht es aufwärts. Jetzt kommt das linke Knie hinzu. Time is on my side, höhnen die Stones. Kann man mit gebrochenen Flügeln fliegen?
Say yeah!
Der immer frohgelaunte Barkeeper tanzt die Treppe rauf und runter. Der Discjockey ist neu, fetzt rein. Der Barkeeper kann sich bei Mick Jagger nicht mehr halten. Er macht einen Jump über die auf der Treppe Sitzenden mitten auf die Tanzfläche, wird umarmt von einer Farbigen, macht sich los, tanzt seinen Schwebetanz. Gegen Mitternacht strömt es wieder herein. Nun gibt es kein Halten, auch der Discjockey springt auf die Fläche. Der Keeper kommt kaum noch die Treppe rauf, nimmt vier Stufen im Sprung und rückwärts wieder runter, tanzt ein paar Windungen, springt erneut.
P kommt die Sache spanisch vor.
Muss wohl an der Musik liegen. Doch es war nur ein spanisches Intermezzo. Jetzt gibt es Portugiesenrock, die Mädchen flippen aus, schreien den Text mit. Die Knutschfreundin kommt rein. Es werden Küsschen ausgetauscht. Auf der Tanzfläche wird wieder Luftgitarre gespielt. Die heißen Miezen kommen rein getänzelt, die Zigarette lässig im Mundwinkel. Der Discjockey kann das Cover nicht mehr erkennen, lässt das Feuerzeug schnippen. Die Musik wird immer seltsamer, keiner traut sich mehr auf die Bühne. Nur der Keeper macht seine Kapriolen, jongliert mit leeren Bierflaschen. Jetzt springen sie wieder wie die Gummibälle. Und immer wieder die Stones. Die Fläche wogt, alle umfassen sich, springen im Rhythmus. I want you. One more time. Portugals Jugend ist erwacht. Die Woge brandet gegen den Barhocker, kugelt sich auf dem Boden.
P verspottet den Luftgitarrenspieler mit einer Posaune. Dieser verlässt die Tanzfläche, verschwindet im WC, muss sich den Frust abpinkeln.
Gerade sind die drei Nornen reingeschneit. Schwarz wie die Nacht. Die Schminke vom Karneval haben sie weggelassen, ist auch nicht nötig. Dafür tragen sie silbernes und goldenes Klimbim um die Hüften. Verschwitzt vom Tanz ziehen P und R sich auf die Barhocker zurück. Da ist das ausgelassene Treiben auch schon zu Ende.
Doch noch haben sie nicht genug. Im Keyhole üben ein paar Jungen am Rande der Tanzfläche den Rap. Der Mann aus Angola am Tisch fantasiert von Alaska, doch irgendwann will er zurück nach Angola, in die Heimat. Heimat deine Sterne.
Was bedeutet uns Heimat? Heimat ist kein Ort, sondern eine Zeit, die Zeit der Jugend, sinniert P, die Zeit der Backpfeifen und Blutsbrüderschaften. Es ist auch ein Ort, an dem man verstanden wird, und versteht. Ein Ort, in dem man aufwuchs und geborgen war. Was aber ist, wenn man an dem Ort und in der Zeit, als man aufwuchs, nicht geborgen war? Dann ist man fremd in der Welt sein Leben lang. Das Einzige, was mich mit dem gegenwärtigen Deutschland verbindet, ist die Sprache.
Vielleicht ist es doch etwas mehr, entgegnete R. Erinnerst du dich an unseren Lissabon Aufenthalt vor eineinhalb Jahren? Wir besuchten ein Konzert, junge deutsche Nachwuchsmusiker spielten die Brandenburgischen Konzerte. Ich habe fast die ganze Zeit geheult, hatte richtiges Heimweh nach unserer Kultur. Vielleicht habe ich mich auch daran erinnert, als wir zusammen an einem Sonntagmorgen im Bett aus einem Transistorradio zum ersten Mal die Brandenburgischen Konzerte gehört haben. Vielleicht auch nur, weil ich mir so fremd vorkam, abgeschnitten von allen Wurzeln. Ich glaube, dass das Heimatgefühl in früher Kindheit und Jugend geprägt wird. Es ist das Urvertrauen in die Sicherheit der Familie, später in die Zugehörigkeit in eine Gruppe. In der Pubertät wird vieles infrage gestellt. Im jungen Erwachsenenalter dann können sich einige nicht mehr mit ihren Mitmenschen identifizieren. Sie fühlen sich fremd unter Fremden und werden zu Außenseitern und Einzelgängern. Mit Traditionen und Gebräuchen können sie nichts mehr anfangen. Heimat-deine Sterne. Für den Seemann ist die Heimat das Meer, so singt es Freddy Quinn. Eine Braut in jedem Hafen, das ist einleuchtend. Sören, Ps und Rs ältester Sohn sagt: Heimat ist, wo meine Liebste ist. Aber eigentlich waren seine Liebsten immer bei ihm.
In Deutschland hatten sie Heimweh nach Portugal, nachdem sie das Land kennengelernt hatten. Es erinnerte an die fünfziger Jahre, die Zeit ihrer Kindheit, kaum Autoverkehr, die Errungenschaften der Zivilisation hatten das Land noch nicht deformiert. Die Menschen waren fröhlich, freundlich und trotz ihrer Armut mit ihrem Leben zufrieden.
Dann der Sprung von der Vormoderne ohne Übergang in die Moderne, ausgelöst durch den EU-Beitritt. Der darauffolgende Massentourismus stürzte viele, meist ältere Portugiesen in eine Identitätskrise. Sie fühlten sich als Fremde im eigenen Land. Einige hatten schnell gelernt und rasten protzig mit ihren Geländewagen durch die Landschaft, mit Mobiltelefon am Ohr und Goldkette um den Hals.
Warum sollten es ausgerechnet die Portugiesen anders machen. Der Einzug der technischen Zivilisation führt überall zu den gleichen Verhältnissen und zu einer Beliebigkeit und Gleichförmigkeit der Städte.
Jeder Ort ist austauschbar und verliert seinen typischen Charakter.
So war es jedenfalls in den Tourismuszentren, im Hinterland, in den Bergen, im Alentejo ist die Zeit stehen geblieben.
Am nächsten Morgen war plötzlich der Hund da, trottete gemächlich den Fahrweg herauf. Ohne Scheu und ohne Hast. Es war ein erbärmliches Viech. Abgemagert bis auf die aus dem zottigen Fell stakenden Knochen, mit einem im Verhältnis zum Körper riesigen Kopf. Die Augen waren glasig, der ausgemergelte Körper zitterte, die Schnauze war trocken und heiß. Sie brachten es nicht übers Herz, ihn zu vertreiben. R gab ihm Wasser, dass er gierig schlabberte, das trockene Brot verschmähte er. P hatte den Eindruck, als suche er einen Platz zum Sterben. Trotzdem vertrieb er ihn aus dem Zelt. Der Hund schaute ihn ernst und ruhig an und wich nicht von seiner Seite. Er stand oder lag ständig im Weg herum. Schließlich fraß er etwas von dem Brot. Gegen Abend stiegen P und R den Hügel abwärts auf das kleine Dorf zu. Der Hund folgte ihnen hinkend. Vielleicht konnte man ihn loswerden. Den ganzen steinigen Weg blieb er hinter ihnen, trottete auch zögernd über den Bach. Im Dorf folgte er ihnen bis in die Bar und legte sich zu Ps Füßen nieder. P beachtete ihn nicht, schenkte ihm keine Freundlichkeit. R tat er leid. P auch, aber das wollte er nicht zugeben. Die Barfrau scheuchte den Hund mit Zischlauten. Der Hund ignorierte sie, hob kaum den Kopf. P verleugnete ihn, sah unbeteiligt auf den Fernseher in der Ecke. Plötzlich erschien eine etwa vierzigjährige Frau in der Bar, stürzte auf den Hund zu und liebkoste ihn freudig. Der Hund erhob sich schweif-wedelnd. Zum ersten Mal, dass er eine temperamentvolle Reaktion zeigte. Die Frau brachte den Hund schließlich in ihren Wagen und setzte sich anschließend an den Tisch von P und R. Sie erzählte, dass sie den Hund den ganzen Tag über gesucht hätte. Er sei sehr alt und fast blind und verirrt sich häufig. Er sieht aber sehr mager aus, wir dachten, er würde sterben, sagte P. Oh, sagte die Frau in Schwyzerdütsch, da hätten Sie ihn sehen sollen, als ich ihn fand, dagegen wirkt er jetzt fast fett.
Ich freue mich ja so sehr, dass ich ihn wiederhabe.
Möchten Sie mit mir zusammen essen, ich wohne nicht weit von hier, oder vielleicht etwas trinken? P entschied sich für die Getränke.
R strickt, lässt Maschen fallen, ribbelt wieder auf. P hat sich mit Spaten und Pickhacke bewaffnet. Er schreitet das Gelände ab, bestimmt den Mittelpunkt, schlägt einen Pflock ein und zieht um den Pflock herum einen Kreis von sechs Metern im Durchmesser. Dann beginnt er mit den Schachtarbeiten. Die erste Schicht mit der Grasnarbe lässt sich noch ganz einfach ausheben, doch dann geht es nur noch langsam mit der Pickhacke. Schon bald stößt er auf große Steine.
Der Wall um ihn wächst. Immer schwerer wird die Schaufel. Nach gut zehn Tagen hat der Krater die richtige Tiefe.
Nun entrollt er eine schwarze Kunststofffolie und kleidet den Krater damit aus. Der Wind hilft ihm dabei. Der Boden und der Rand der Folie oben auf dem Wall werden noch mit Steinen beschwert, jetzt fehlt nur noch Wasser, und der Teich ist fertig. Gemeinsam bepflanzen sie den äußeren Wall mit den bunten Blumen Portugals.
Das Wasser wird zum Problem. Der Wasserbeamte lässt sie einen Antrag ausfüllen, erhebt die Gebühren, quittiert. Wochen vergehen, nur der Himmel lässt ein paar flache Pfützen regnen.
Hammerschläge klingen auf Granit. Der Bildhauer ist wieder an der Arbeit. Er schlägt den Tod aus dem harten Stein. Einen weiblichen Tod mit langen hängenden Brüsten. Hohlwangig, mit leeren Augen reißt sie sich den Leib auf, aus dem der
Kopf eines neuen Lebewesens quillt. In dem Steinkreis steht er nach Norden ausgerichtet, verkörpert auch den Winter. Frühling, Sommer und Herbst schlafen noch in einigen der zwölf großen Blöcke. Das Grundstück verwandelt sich langsam in einen Skulpturenpark. In der Mitte der heilige Sebastian, eine über drei Meter große Holzskulptur mit krebsgeschwürartigen Auswüchsen. Für P symbolisiert er den modernen Menschen, einen Gegenentwurf zum David, zerfressen von Gier und Selbstsucht. Neben der Auffahrt zwischen den jungen Palmen erhebt sich der erwachende Titan aus weißem Marmor. Der Künstler, Sohn Sören, lebt mit seiner portugiesischen Freundin in einer einfachen kleinen Hütte, die sie zusammen mit großem Aufwand erbauten. Ziegel und Zement gab es zu kaufen, Sand wurde vom Strand hergeschafft, und Wassern aus den öffentlichen Brunnen in einem alten Ölfass transportiert.
Casa Pequena, das kleine Haus hat jetzt eine Terrasse mit einem Dach aus Palmwedeln als Schutz vor der sommerlichen Glut bekommen, es sieht aus, als hätte es einen Pony.
Unruhe erfasst sie, oder Sehnsucht? Jedenfalls wollen sie los, on the road again. Sie kamen gut voran. Adeus Portugal, Viva Espanha. Sie brettern durch das nächtliche Madrid, verpassen eine Ausfahrt, und sind nun gezwungen in der falschen Richtung weiterzufahren. Kilometer um Kilometer geht es gen Süden, bald sind sie in Toledo, dort wollen sie nicht hin, waren schon einmal dort. Endlich eine Ausfahrt. Zurück, doch sie kommen nicht auf die Zwei. Also wieder zurück bis zum Ausgangspunkt. Und wieder geht es nach Toledo. Verdammt, die Luft wird dick im Camper. Doch jetzt packen sie es. Campingplätze gibt es nicht, also irgendwo runter von der Strecke, es ist bald Mitternacht. Sie schleichen durch die leeren Gassen eines verfallenen Dorfes. Hinter der Kirche gehen sie in Deckung.
Kalter, aber strahlender Morgen. Der Horizont ist weit. In der Ferne verdunsten die blauen Berge. Schneeweiße Obstbäume wie mit Raureif überzogen.
Bei Calatayud hat ein Riesenbaby mit einer Kuchenform lauter Sandkuchen aufgetürmt. Dann geht es durch eine endlose Dünenlandschaft. Bei einer Rast erweisen sich die vermeintlichen Dünen als weißgraues, schmieriges Gestein. Sie zoomen wieder durch eine kahle Ebene, Strommasten flitzen vorbei. Kurz vor Zaragossa faltet sich die Ebene, fällt ab in jähe Schluchten. Und da liegen sie wieder, die Ritter der Landstraße: MAN, Mercedes, Iveco, Pegasus, Volvo. Umgekippt im Graben, alle fünfzig Kilometer ein Schrotthaufen, oder Teile der Ladung, Verpackungsmaterial. Lérida, hektische Großstadt, flache, hässliche Zweckbauten, Werkstätten, Lagerhallen, Reklametafeln. Kurz vor Barcelona, grüne Wiesen, hügelige, gelbe Rapsfelder. Ein bizarrer Gebirgszug füllt den Horizont, gewaltige Skulpturen treten aus dem Fels.
Jetzt schnell auf die Autobahn, Frankreichs Schneeberge grüßen. Am dritten Tag durch Südfrankreich gen Norden, eine Tortur. Dorf an Dorf, Kreisel an Kreisel. Mittagspause, alle Franzosen verstopfen die Straßen. Rauf auf die Autobahn, in Lyon wieder runter. Sie übernachten auf einem idyllisch gelegenen Bauernhof. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sitzen sie in Decken gehüllt bei Käse und Wein und schauen den Hühnern zu. Plötzlich flammt rotes Licht rhythmisch auf, und das schrille Rasseln einer automatischen Signalschrankenanlage gellt in ihren Ohren. Schon hören sie das sich nähernde Donnern des Zuges. Ein Güterzug mit unzähligen Wagen. Als er vorbeirast, ist der Lärm fast unerträglich, und sie spüren das Zittern der Erde. Dann verebbt der Krach in der fernen Finsternis. Doch schon bald ertönt aus der Gegenrichtung das helle Rasseln einer anderen Signalanlage, und kurz darauf rasselt und blinkt es auch wieder bei ihnen.
Der Zug lässt nicht lange auf sich warten. So geht es nun die ganze Nacht hindurch. Kaum sind sie eingedöst, klingelt ihr Wecker, und sie geraten unter die Räder des donnernden Zuges.
Am Morgen wanken sie durch taunasses Gras zu den Duschen. Sie sitzen am Frühstückstisch, als es plötzlich weiß lebendig über die grüne Wiese wogt. Hunderte von kleinen weißen Hühnchen strömen aus dem Stall und stieben flatternd ins Freie, ergießen sich in breitem Strom bis vor ihre Füße. Die Tiere zeigen keine bisschen Scheu und picken vor ihnen im Gras herum. Sie ziehen die Zehen ein.
Nun springt ihnen ein kleiner, brauner, langzotteliger Hund freudig entgegen. Taunass lässt er sich streicheln. R beneidet ihn seiner schönen, langen, braunen Locken wegen. Der Bauer kommt heraus, hebt grüßend die Hand und tränkt die jungen Bäume. Dann lässt er die Kühe und Kälber auf die Weide. In übermütigen Bocksprüngen stiemen sie auf die Koppel. Dunst steigt aus den Niederungen. Sie fahren ab. Der Zug erwischt sie noch ein letztes Mal. Sie brausen dahin auf dem blauen Band des Frühlings. Gelber Löwenzahn auf grünen Wiesen labt das Auge. Rapsgelb ist der Horizont. Der Himmel weit und milchig. Magnolien wehen einen Hauch Erinnerung. Die Hügel wieder laubbewaldet, zartes Grün vor Blütenweiß. Nur die Eichen können warten. In allen Bäumen nisten Misteln.
Sie sind im Land der Gallier. Doch Druiden sieht man nicht in den Bäumen. Lang schon haben sie ihren grauen Umhang gegen den weißen des Apothekers getauscht. Gegen Mittag hatte sie der Zug eingeholt. Sie rasten an einem Bahndamm. Jäh lärmt er über den Gesang der Lerchen. Hell tönt sein höhnisches Tuten. Die Lerchen sind verstummt. Die Air Force beherrscht den Luftraum.
Die Tiroler sind lustig. Ihre Nachbarin, die alte Bäuerin, hatte sich Sorgen um sie gemacht. Sicher, sie wollten nur zwei Monate fortbleiben, und nun sind es drei geworden. Natürlich war auch der Mann vom E-Werk schon zweimal da, wollte den Strom abzwacken. Das Finanzamt wird unangenehm. Die Blutsauger sind schwer abzuschütteln.
Dabei glaubte P schon ihren Fängen entronnen zu sein, damals vor zweieinhalb Jahren, als sie aufbrachen in ein neues Leben.
2. Kapitel
Endlich war es so weit: Die letzten Akten der Firma: HEIZUNG und SANITÄR flogen auf den Container, und mit ihnen landete auch ihre Vergangenheit auf dem Müll. So glaubten sie es. Doch so leicht lässt sich die Vergangenheit nicht abschütteln. Der Jeep war vollbeladen. Ein letzter Abschied, der wievielte?
Die Brücken waren abgebrochen, das Haus verkauft, alle Renten und Versicherungen ausgezahlt.
Sie brausten nach Süden. Es war eine Flucht in die Freiheit. Doch war nichts Befreiendes daran, noch hatten sie es nicht begriffen. Sie waren von den Ereignissen der letzten Monate noch in Bann gezogen. Der Eintritt in neue Lebensumstände war von qualvollen Geburtswehen begleitet.
Erst viel später, auf ihrem Fußmarsch durch die Dolomiten, in der Einsamkeit der Bergwelt, sickerte es langsam in ihr Bewusstsein. Sie hatten es geschafft, sie hatten die große Hauptstraße verlassen, die schnurgerade in eine schon jetzt erkennbare Zukunft führt.
Eine Zukunft, die lediglich eine Fortsetzung der Vergangenheit ist, von einigen Nuancen abgesehen. Sie hatten einen Nebenpfad eingeschlagen, der sich schlängelnd in unbekannte Regionen verlor.
Die schroffen Berge rückten die Dinge auf ihr natürliches Maß zurecht, manches ist geschrumpft, anderes gewachsen.
Als P eines Morgens nach zwölfstündiger Bergtour auf dem Praxer Wildsteig erwachte, durchströmte ihn zum ersten Mal, für Sekunden nur, ein Gefühl unermesslicher Freude. Es gab keine Verpflichtung, keinen Termin, keine ständige Alarmbereitschaft. Dieses ununterbrochene auf der Hut sein, immer hinter dem Geld säumiger Zahler her sein, um jeden Auftrag kämpfen zu müssen, gehörte der Vergangenheit an. Dieses starke Glücksgefühl floss über in eine heitere Gelassenheit. Als sie nach einer Woche abstiegen in die Zivilisation, die Hütten hatten alle schon wegen schlechtem Wetter und Schnee geschlossen, hatte sich eine Wandlung mit ihnen vollzogen. So glaubten sie jedenfalls. Sie waren zwar dem grauen Alltag entflohen, doch vor sich selbst gab es kein Entrinnen, auch nicht vor den immer gleichen Problemen ihrer langen Partnerschaft. Allerdings, diese Problematik wurde überlagert von einer neuen Hoffnung, neuen Zielen.
P war nun achtundvierzig Jahre, R ein Jahr jünger. Siebenundzwanzig Jahre waren sie schon verheiratet. Davor waren sie drei Jahre ein Paar. Ohne Liebe und Vertrauen wäre ihr Auszug ins Unbekannte nicht möglich. In ihrem Bekanntenkreis konnte niemand ihren Entschluss verstehen. Sie hatten doch alles, ein großes Haus, zwei Autos, Pferde, es ging ihnen doch gut. Warum das alles aufgeben? Einige waren neidisch. Ein befreundeter Architekt sagte: Alle möchten ein anderes Leben, ständig reden sie davon, nur P wagt es. Sie hatten eine Chance, Zeit, zum ersten Mal nach siebzehn Jahren Selbständigkeit hatten sie wieder Zeit. Sie schlenderten durch die abgasgeschwängerten Straßen von Florenz, besuchten Museen und Ausstellungen, saßen auf den Plätzen und beobachteten die Menschen. Sie führten das Leben von Nomaden, hausten primitiv in einem winzigen Zelt, richteten sich ein im Provisorium. Nach einer Woche in Florenz hatten sie genug von Museen und Kunst, es stellte sich ein Überdruss ein. Sie fuhren weiter nach Siena. Dann über Genua die Cote d" Azur entlang nach Spanien. In Spanien gerieten sie in ein wochenlanges Unwetter, wie sie es bisher noch nie erlebt hatten. Es war außerhalb der Saison, ihr Zelt stand allein inmitten eines großen Sees. Alles triefte, die Luftmatratzen schwammen auf.
Nach drei Tagen Trostlosigkeit gaben sie auf und bezogen einen Bungalow. Sie warteten auf Post vom Finanzamt. Ps Bruder sollte die Post nachsenden. Dann ging es weiter Richtung Portugal, dem Land ihrer Sehnsucht.
Vom Sturm gepeitscht schabten die Zweige des Oleanders gegen die Holzwand der kleinen, achteckigen Hütte. Regenfluten prasselten gegen die verklemmten Jalousien, drangen durch feinste Ritzen ins Innere und bildeten dunkle Pfützen auf dem grauen Auslegefilz. Der Raum lag im Halbdunkel. P und R lauschten auf das Tosen der Brandungswellen vom Atlantik, das mit rhythmischem Donnergrollen die Luft erfüllte. Der elektrische Strom war seit Stunden ausgefallen, wie bei jedem Unwetter in Portugal, die bläulichen Flammen des Campingkochers verbreiteten zischend einen Hauch von Wärme. Aus der offenen Küche drang der Duft von frisch gebackenem Kuchen und das Aroma von Kaffee überlagerte die feuchte Muffigkeit, die von dem winzigen Bad und dem kleinen Schlafraum, nicht viel größer, als das schmale Doppelbett ausging. An die schäbige Tapete hatten die beiden Fotografien und aus Magazinen ausgeschnittene Kunstdrucke geheftet. Das armselige Mobiliar, das lediglich aus einem wackeligen Tisch, vier Stühlen und einem Notbett bestand, füllte den Raum beinahe aus und ließ kaum Platz für ihre persönlichen Dinge. Auf einem halbhohen Bücherbord türmten sich Bücher, Schreibpapier und Schreibutensilien. Im Schein der flackernden Kerzen tranken sie ihren Kaffee.
Die Kurzwelle meldete Schneesturm und Temperaturen bis zu minus zwanzig Grad in Deutschland.
In das Halbdunkel des Raumes bohrte sich ein einzelner Sonnenstrahl durch die Ritze der Jalousie. Verwundert erhob sich P und zog an dem Griff der Verandatür, um sie zu öffnen. Wie jedes Mal hatte er auch diesmal den Griff in der Hand. Mit dem bereits in Reichweite liegenden Schraubenzieher öffnete er schließlich die klemmende Tür. Der Sturm entriss ihm die Flügel der Jalousie und krachte sie gegen die Wand der Hütte. Schlagartig erfüllte blendende Helligkeit den Raum, der Sturm hatte alle Wolken weggefegt, eine weiße Sonne brannte auf den gelben, schlammigen Lehm, verdampfte die Feuchtigkeit aus den Lachen. Das Klopfen des Oleanders hatte aufgehört, nur der aufgebrachte Atlantik brandete ungebrochen gegen die steilen Klippen. Die Beiden setzten sich mit ihren Kaffeetassen auf die ausgebleichten Plastikstühle auf die schmale Holzterrasse und genossen mit geschlossenen Augen die wärmenden Sonnenstrahlen. Der Kral mit den zehn in zwei engen Reihen angeordneten Holzhütten lag am Ende eines Campingplatzes und grenzte an eine versteppte, steinige Wiese. Am Rande der Wiese lagen ausrangierte und verfallene Wohnwagen. Die Rückseite eines rumpeligen Supermarktes ergänzte den eher trostlosen Ausblick.
Ihre Hütte stand in der Mitte des Krals, umgeben von den Eingeborenen.
Ein kleines, etwa fünf Jahre altes Mädchen hüpfte, eine Melodie summend zwischen den Hütten umher, vorbei an den Fremden mit gesenktem Kopf, pflückte ein paar Blumen vom Rand der Wiese und warf immer wieder scheue, kurze Blicke auf die beiden auf der Terrasse sitzenden Ausländer. Es lief um die Hütte herum, verschwand für kurze Zeit den Blicken der amüsiert lächelnden Deutschen, um an der anderen Seite wieder aufzutauchen. Das Mädchen hatte das Lächeln der Fremden wohl bemerkt und grüßte verlegen, aber mit strahlendem Gesicht mit Bom Dia. Boa Tarde, antworteten die Deutschen, denn es war bereits Nachmittag. Aus der Hütte gegenüber trat eine junge, pausbäckige Frau und rief: Silvia!
Silvia antwortete trotzig, ging aber zu ihrer Mutter in die Hütte. Durch die dünnen Holzwände drang nun das aufgeregte Gezeter der Mutter und die hemmungslosen Schreie des Mädchens. Es wirkte nun gar nicht mehr scheu oder verschüchtert. Es hatte sich in eine wütend schreiende kleine Furie verwandelt. Am nächsten Morgen saßen P und R wieder auf der Terrasse und frühstückten. Silvia kam trippelnd herausgelaufen, grüßte strahlend, drehte dann verlegen mit dem Fuß im Sand herum, äugte aber zwischendurch immer kurz zu den Fremden. Sie trug einen weißen Rock und einen rosa Pullover und hatte lange, weiße Strümpfe und weiße Sandalen an.
Du siehst aber heute schön aus, sagte R auf Portugiesisch. Silvia sah an sich herunter und lächelte. Magst du ein Brötchen mit Honig? Fragte R wieder. Sim.
Silvia kletterte auf die Terrasse und trat an den Tisch. Warte, sagte R, ich hole dir einen Stuhl und eine Tasse, magst du Tee? Sim.
Silvia nahm Platz, schaufelte vier Löffel Zucker in ihren Tee und schmatzte an ihrem Brötchen. Der Honig tropfte zwischen ihre Finger, nun brauchte sie eine Serviette. Aus der Hütte erscholl der Ruf ihrer Mutter: Silvia, komm sofort ins Haus. Silvia reagierte nicht. Deine Mutter ruft dich, sagte P. Die Mutter trat jetzt aus der Hütte und rief etwas, das die Deutschen nicht verstanden.
Nein, schrie Silvia zurück. Die Mutter stürmte aus dem Haus und zerrte Silvia weg von den Fremden und schleifte ihre schreiende, und heftig strampelnde Tochter ins Haus. Völlig außer sich und wütend kreischend ließ Silvia einen Schwall von Worten auf ihre Mutter nieder. Die Mutter versuchte sie ermahnend zu beruhigen, wurde dann aber selber ärgerlich, und bald hörte man nur noch das wütende Geheul Silvias, das von zornig herausgestoßenen Wortschwallen unterbrochen wurde, und in hilflosem Schluchzen endete. P und R fuhren in die nahe Stadt und besuchten einen Portugiesisch Kurs. Unterrichtssprache war englisch. Die beiden waren auch in dieser Sprache nicht wirklich versiert.
Aber sie kamen gut zurecht, zumal sie bereits in Deutschland in Abendschule einen Kurs portugiesisch belegt hatten. Am Nachmittag saßen sie wieder auf ihrer Terrasse, tranken Tee und machten ihre Hausaufgaben.
Im Kral wurde es lebendig, die Einheimischen kehrten von der Arbeit zurück, Autos und knatternde Mopeds fuhren vor, aus den Hütten drang Musik oder die theatralischen Stimmen einer Telenovela aus den Fernsehgeräten. Plötzlich wurde die Geräuschkulisse von der Stimme der jungen, etwas fülligen und pausbäckigen Frau übertönt, die wieder nach ihrer Tochter rief. Aufgeregt rannte sie zwischen den Hütten hin und her, schaute auch auf die Terrasse der Fremden, ja warf sogar ungeniert einen Blick in den Wohnraum.
Nun waren auch die Rufe eines kleinen, schmächtigen Mannes zu hören, und bald darauf Zetern und Schreien, Silvias Geheul und zorniges Protestieren. An der Hand von Vater und Mutter wurde sie aus einer der letzten Hütten gezerrt und nach Hause gebracht. Tags darauf, wieder saßen P und R beim Frühstück, kam Silvia, jetzt nicht mehr schüchtern, an ihren Tisch, wurde freundlich begrüßt, erhielt ihren Tee und versprühte ihren Charme.
Sie war ein lebendiges, charmantes, kokettes, aber auch etwas altkluges kleines Geschöpf. Ihre dunklen Augen blitzten schalkhaft, wenn die Deutschen ihren munteren Redeschwall unterbrachen, weil sie etwas nicht verstanden. In betont ruhigem Tonfall und mit deutlicher Aussprache wiederholte sie das eben Gesagte und untermalte es mit erklärenden Gesten. Am Schluss fügte sie immer hinzu: habt ihr es nun verstanden? Du machst das ganz toll, sagte R, wie eine kleine Lehrerin. Silvia war unheimlich stolz.
Ich höre dich immer so ein lustiges Lied summen, meinte P. Willst du uns nicht etwas vorsingen? Nun war Silvia in ihrem Element. Zuerst zierte sie sich noch etwas, aber dann stellte sie sich vor die Terrasse in Positur, etwas breitbeinig, schaukelte kokett mit den Hüften und sang inbrünstig in ein imaginäres Mikrofon. Das Lied, ein portugiesischer Schlager, handelte von Liebe und Abschiedsschmerz. Die beiden Deutschen applaudierten stürmisch. Silvia war der große Fernsehstar, warf sich in immer neue Posen, hob frivol ihr Röckchen und zeigte ihre weiß bestrumpften Kinderbeine. Kennst du auch Kinderlieder? Fragte P in eine kurze Pause hinein. Silvia sang nun die portugiesische Fassung von “Happy Birthday”.
P holte seine Mundharmonika und begleitete die Sängerin auf dem Instrument. Silvias Mutter stand im Eingang ihrer Hütte und hörte zu. P grüßte winkend. Die junge Frau kam zögernd herüber, grüßte höflich, und meinte, dass es heute ein schöner Tag sei. Sie wendete sich dabei ausschließlich an die deutsche Frau. Man stellte ich vor: R, P, Anna. Die Konversation gestaltete ich holpernd und wurde zudem von dem nicht enden wollenden Gesang Silvias gestört.
Sie wollte weiter die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich gelenkt wissen. Man sprach über Silvia. Sie ist etwas verrückt, sagte Anna, aber ich mag sie sehr gern. Sie ist etwas einsam, meinte P, gibt es keine anderen Kinder hier?
Nein, andere Kinder gibt es nicht in der Siedlung, und auf den Campingplatz durfte Silvia nicht, dort gab zu viele Fremde. Krampfhaft und mit langen Pausen quälte sich die Unterhaltung weiter.
Die Deutschen entschuldigten sich für ihre mangelnden Sprachkenntnisse, aber Anna ließ es nicht gelten, sie verstand die beiden sehr gut. Erstaunlicherweise konnten sie auch Anna ganz gut verstehen, wenn sie jedoch zu ihrer Tochter sprach, verstanden sie kein einziges Wort. Jedenfalls waren sie erst einmal froh, als Anna und Silvia sich verabschiedeten, das Reden in einer fremden Sprache hatte sie geistig völlig erschöpft, und ermattet brachen sie zu einem walk über die Klippen auf.
Ola, kühl heute und sehr windig. Anna schlurfte in Pantoffeln und ihrem grauen Trainingsanzug zu ihnen auf die Terrasse, legte ihre Arme auf die Balustrade, und sah den Fremden beim Frühstück zu. Silvia durchstöberte den Wohnraum und kam mit dem Fernglas heraus. Sie war fasziniert von dem Gerät, hielt es sich mit einer Hand vor die Augen, stapfte durch die Landschaft und tastete mit der anderen Hand vor sich her. Sie war sehr verwundert, dass die Gegenstände noch so weit entfernt waren und stieß erstaunte kleine Schreie aus. P ließ sie durch die andere Seite des Fernglases schauen, und nun war Silvias Verwunderung noch größer, die Welt war in weite Ferne gerückt.
Wie einem die Welt erscheint, kommt immer auf die Perspektive an, dachte P. Können wir überhaupt objektive Aussagen über die Beschaffenheit der Welt treffen? Der einzige Erkenntnisapparat, der uns zur Verfügung steht, sind unsere Sinne. Diese haben sich durch die Evolution entwickelt und dienen einzig unserem Überleben. Mehr als unsere fünf Sinne brauchten wir nicht, die Evolution ist sparsam mit der Entwicklung der Sinne, Überflüssiges wie Ultraviolett, ein Echolot, ein Kompass, wäre reiner Luxus. Dabei wäre ein Kompass, um unseren Weg in der Welt zu finden, ganz nützlich. Auch könnte man heute einen Sinn für Radioaktivität ganz gut gebrauchen, aber dafür haben wir Techniken entwickelt.
Anna ließ kein Auge von den Deutschen, registrierte jede Bewegung, schaute ihnen jeden Bissen in den Mund. Schließlich fragte sie die Beiden, ob sie denn keine Wurst mögen. Wir sind Vegetarier, erklärte P. Er schaute in ein fragendes Gesicht und wiederholte den Satz. Ich verstehe nicht, sagte Anna. P stand auf, suchte das Lexikon, schlug auf:
Vegetariano, Sinn und Aussprache stimmten, also musste Anna der Begriff nicht bekannt sein. Wir essen kein Fleisch, keinen Fisch, keine Wurst, sagte er dann. Doch nun stieß er auf ein noch größeres Unverständnis, obwohl die Aussage offensichtlich verstanden wurde. Anna konnte sich absolut nicht vorstellen, wie man sich ohne diese kulinarischen Köstlichkeiten ernähren konnte. Warum, fragte sie, warum kein Fleisch? Das war nun schwierig zu erklären, selbst auf Deutsch gelang es selten. Doch Anna ließ nicht locker. Dass Fleisch und Fett ungesund sei, wollte sie nicht akzeptieren, dass es dick machen sollte, stimmte sie nachdenklich.
Sie esse gern viel Fleisch und Fisch, und dick sei sie auch, aber das mache nichts, demonstrativ hob sie ihre Trainingsjacke und zeigte den Fremden ihren weißen, dicken Bauch und klatschte lachend darauf.
P unternahm noch einmal einen Versuch, ihre fleischlose Ernährung zu erklären und sagte: ein berühmter Schriftsteller, Bernhard Shaw, hat einmal gesagt: Tiere sind meine Freunde, und meine Freunde esse ich nicht. Warum nicht? Fragte Anna.
P gab es auf.
Anna, ergriff nun R das Wort, ich lade dich und Silvia morgen zum Essen ein, dann kannst du probieren, ob du vegetarische Kost magst. Mutter und Tochter strahlten vor Freude. Es gab Gemüsefrikadellen in pikanter Soße mit grünem Pfeffer, Kartoffeln und Rotkohl. Äußerlich sahen die Frikadellen wie gewöhnliche Frikadellen aus, Anna konnte es nicht fassen. R schrieb ihr das Rezept auf. Nach dem Essen wurde Silvia unruhig und stöberte in den Büchern und Schreibsachen der Deutschen herum. Die Mutter verbot es ihr, aber Silvia wollte nicht hören, wurde trotzig, die beiden schrien sich an, wütend schlug Silvia auf ihre Mutter ein und schrie: Raus, geh auf die Straße. P wurde es zu viel, er wollte beide Schreihälse rauswerfen, als R das vor Wut zitternde Mädchen in die Arme nahm, und es behutsam zum Malen mit bunten Stiften überredete. Silvia ließ sich zwar ablenken, die Wut verrauchte, doch brachte sie nur ein Krickelkrakel zustande.
R sollte malen. Einen Mann, eine Frau, ein Kind und ein großes Haus. Silvias Augen strahlten, sie bestimmte die Farbe der Kleider, Schuhe und Haare. Anna sah lächelnd zu. P hatte sich hinter einer deutschen Zeitung vergraben und studierte die Aktienkurse. Doch plötzlich war etwas nicht richtig. Mit den Größen der Gestalten war etwas nicht in Ordnung. R begriff es nicht, Anna lachte und erklärte: Der Mann muss größer sein, als die Frau, sonst ist es nicht richtig.
Ja, Silvia bestand darauf. Sie verlangte immer mehr Zeichnungen und Bilder, bettelte, legte ihre kleinen Arme um Rs Hals, ließ ihren ganzen Charme spielen. Anna paffte die Bude voll.
Versuch es doch selbst einmal, sagte R und machte sich frei. Nein, ich kann das nicht. Doch, das schaffst du. R schob den Stift in die richtige Position zwischen die Finger des kleinen Händchens, und führte die verkrampfte Faust über das Papier. Siehst du, es geht. Eifrig begann Silvia zu malen, bald war das Blatt voller Strichmännchen. Papier, rief sie und legte das Blatt beiseite. P schaute auf von seiner Zeitung, ging an den Tisch, und drehte das bemalte Blatt um und sagte, auf dieser Seite kannst du auch malen. Nein, das wollte Silvia nicht, sie brauchte ein neues Blatt Papier. Papier, Papier, sim? bettelte sie.
Achselzuckend gab er ihr ein neues Blatt. Er nahm die Lektüre seiner Zeitung wieder auf, da ertönte erneut das fordernde Stimmchen. Papier, Papier. Bitte, sagte Anna, sag bitte. Papier, Papier, bitte, sagte sie nun. Warum bemalst du nicht die andere Seite? Nein, schrie sie sofort. Seufzend reichte er ihr ein neues Blatt.
Da war er nun überfordert, dieser P. Die anerzogene Sparsamkeit aus der Nachkriegszeit wurde einfach ignoriert.
Inzwischen hatte R Tee zubereitet und einen Schokoladeneiskuchen hervorgezaubert. Das war etwas für die portugiesischen Schleckermäuler. R musste das Rezept aufschreiben, Anna wollte gleich morgen die Zutaten besorgen, und R sollte den Kuchen backen. Es sollte eine Überraschung für den Ehemann werden. O marido, der Ehemann, war Fußballer, wie auch viele andere Männer in der Siedlung. Er war Torwart und spielte für den Verein “Hoffnung" Wie alt ist denn
o marido, fragte P. Vierunddreißig.
Er wird nicht ewig Fußball spielen können, was will er später machen, hat er noch einen anderen Beruf?
Nein, das hat er nicht, später, das werden wir dann schon sehen, vielleicht wird er dann Trainer.
P schaute bedenklich.
Anna und Silvia kamen nun jeden Tag. Sobald morgens die Terrassentür geöffnet wurde, liefen sie strahlend und winkend herbei. Nur zum Essenmachen zog Anna sich für eine Stunde zurück. Dann kam sie fröhlich wieder, klopfte kurz an die Scheibe, darf ich, und war auch schon drin, saß paffend am Tisch. Langsam ging den Amigos, ihren deutschen Freunden, der Gesprächsstoff aus. Oft saßen sie sich minutenlang schweigend gegenüber, bis Anna wieder mit dem Wetter anfing. Für sie gab es keine Peinlichkeit, sie brauchte die Geselligkeit wie die Luft zum Atmen. Die beiden Amigos wirkten ermattet, flüchteten sich in lange Wanderungen. Außerdem hatten sie ihren Unterricht und brauchten Zeit für ihre Hausaufgaben. Sie fühlten sich in ihrer Privatsphäre bedrängt. P sagte es schließlich Anna. Wir haben nicht immer Zeit Anna, wir lesen gern, ich muss mich um die Börse kümmern. Anna hatte für alles Verständnis. Nur am nächsten Morgen, die beiden Deutschen waren ausgegangen und erst spät ins Bett gekommen, hörten sie Anna und Silvia schon an der Tür rufen: Ola, alles in Ordnung?
Schlaftrunken öffnete P die Tür, nur mit einer Unterhose bekleidet, und wankte dann ins Bad. Anna setzte sich an den Tisch und schaute zu, wie die Amigos Toilette und Frühstück machten. Silvia malte die Papiere voll. Erschlagen von der naiven Freundlichkeit und Zuneigung ergaben sich die beiden Deutschen ihrem Schicksal. Sie versuchten die Dinge nicht mehr so verbissen zu sehen, sich selbst los, und auf die Menschen in ihren kulturellen Unterschieden einzulassen.
Eigentlich hatten sie es ja gesucht, ein anderes Miteinander, einer der Gründe, weshalb sie Deutschland verlassen hatten. P las zwar auch weiter in Annas und Silvias Gegenwart in der Zeitung, aber wann sollte er das auch sonst tun.
R stand stundenlang mit Anna in der Küche, buk und brutzelte. Am Nachmittag spielten sie Kanaster. Anna war eine leidenschaftliche Spielerin und hatte das Spiel schnell erlernt. Sie war todunglücklich, wenn sie verlor, und außer sich vor Freude, wenn sie gewann.
Sie waren eingeladen zu einer Eurovisionsschlagerschow im TV, um unbedingt den portugiesischen Beitrag zu hören. Dabei lernten sie den marido kennen, und Anna übersetzte ihnen seine Worte vom Portugiesischen ins Portugiesische. Eines Morgens kam Anna wie üblich an ihren Frühstückstisch und hatte Tränen in den Augen. Ich bin sehr traurig, sagte sie. Seit über einem Monat haben wir kein Geld mehr bekommen. Der Verein zahlt die Gehälter nicht aus, weil er kein Geld hat, und die Spieler bekommen auch keine Prämien, weil sie schon lange kein Spiel mehr gewonnen haben. Der Trainer sagt, die Spieler haben selber Schuld, da sie schlecht spielen, aber o marido meint, sie spielen erst schlecht, seitdem sie den neuen Trainer haben.
P, kannst du uns zehntausend Escudos leihen? Meine Mutter kommt nächste Woche, dann bekommst du das Geld zurück. P holte das Geld hervor und gab es Anna.
Es war Karneval. Aus den Fernsehgeräten flöteten, rasselten und stampften Tag und Nacht südamerikanische Rhythmen. Silvia spielte wieder die berühmte Schlagersängerin.
P holte sämtliche Kochtöpfe, Pfannen und Schüssel, Eimer und seine Mundharmonika auf die Terrasse, und nun schlugen sie auf das Blech, Silvia und P, machten einen Höllenlärm, dass die Siedlung erschrocken zusammenlief. Das war ein Spaß, Silvias Augen strahlten, sie konnte kein Ende finden.
Annas Mutter kam und Anna bezahlte ihre Schulden.
Inzwischen hatte auch der Verein die Zahlungen zum Teil wieder aufgenommen, der Trainer wurde gefeuert, alles war wieder gut.
Anfang Februar stand ihr Sohn Sören mit seiner schottischen Freundin plötzlich vor der Tür. Gemeinsam bauten sie ein kleines Haus auf ihrem Grundstück für die Beiden.





























