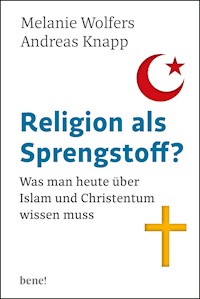Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Immer höher, schneller, weiter soll es gehen. Alles muss optimiert und gesteigert werden, will man uns einreden. In der Folge stellen wir auch an uns selbst meist zu hohe Erwartungen und glauben, dünner, erfolgreicher, cooler oder sonstwie anders sein zu müssen. Das kann nicht gutgehen. Oft sind wir uns selbst der größte Feind. Melanie Wolfers lädt dazu ein, sich endlich von diesem Druck zu befreien und sich stattdessen selbst Wertschätzung entgegenzubringen. Denn erst wenn wir Freundschaft mit uns selbst schließen und pflegen, werden wir heimisch in unserem Leben. Dann können wir unsere Stärken ins Spiel bringen und uns Fehler und Schwächen eingestehen, ohne uns dabei schlecht zu fühlen. Und erst dann können wir auch mit den dunklen Kapiteln unserer Vergangenheit Frieden schließen. Die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, ist eine innere Einstellung, die positive Energien freisetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Melanie Wolfers
Freundefürs Leben
Von der Kunst,mit sich selbstbefreundet zu sein
INHALT
Erstes Kapitel
ZWISCHEN FREUNDSCHAFT UND FEINDSCHAFT
Zweites Kapitel
„SCHÖN, DICH ZU SEHEN!“ VON DER KUNST, SEINEN KÖRPER WAHRZUNEHMEN
Drittes Kapitel
„ICH BIN GANZ OHR!“ DIE KRAFT DER GEFÜHLE
Viertes Kapitel
„DAS IST JA TOLL!“ DEN SPUREN DER LEBENDIGKEIT FOLGEN
Fünftes Kapitel
„TU DIR DOCH SELBST NICHT SO WEH!“ MIT EIGENEN GRENZEN LEBEN
Sechstes Kapitel
„WAS BREMST DICH AUS?“ SICH MIT DER EIGENEN VERGANGENHEIT VERSÖHNEN
Siebtes Kapitel
„WORUM GEHTS DIR?“ DIE WESENTLICHE FRAGE DES LEBENS
EIN LOB DER FREUNDSCHAFT
DANK
LITERATURHINWEISE
Erstes Kapitel
ZWISCHEN FREUNDSCHAFT UND FEINDSCHAFT
1. Ohne Rücksicht auf Verluste
„Ich weiß nicht, was ich tun soll!“, sage ich mit tränenerstickter Stimme zur Therapeutin. Meine Hand drückt bereits die Türklinke nieder, um zu gehen, als meine Not und Ohnmacht sich in diesen Worten Bahn brechen. Die Therapeutin schaut mich schweigend an und antwortet mit ruhiger Stimme: „Ich habe den Eindruck, Sie spüren sehr deutlich, was Sie wollen.“ Die Tür des Sprechzimmers schließt sich leise hinter mir. Ich bin mir selbst überlassen. Und ich bin zu mir selbst entlassen. Denn dieser eine Satz leitet eine Wende ein.
Gemeinsam mit Kolleginnen hatte ich zwei Jahre zuvor mit leidenschaftlicher Überzeugung ein Projekt initiiert. Es entwickelte sich so gut, dass wir unsere berufliche und persönliche Lebensplanung ganz darauf abstimmten. Führende Leute aus verschiedenen Institutionen unterstützten uns und eröffneten ungeahnte Möglichkeiten. Doch in mir breitete sich eine latente Unruhe aus. Weil zu der Zeit alles noch optimal lief, nahm ich mein Unbehagen lange nicht wahr. Und ich wollte die leise warnende Stimme auch gar nicht hören! Dank meiner täglichen Meditationszeit und meiner seelsorgerlichen und therapeutischen Begleitung kam jedoch der Tag, an dem ich der Tatsache ins Auge schauen musste: „Ich habe den Glauben an unser Projekt verloren und sehe keine Zukunft.“ Mit diesem Eingeständnis mir selbst gegenüber begann ein monatelanger innerer Kampf.
„Melanie, du bist die treibende Kraft im Projekt. Da kannst du doch nicht einfach aussteigen! Willst du wirklich deine Kolleginnen im Stich lassen? Und all die wichtigen Leute enttäuschen, die auf dich, auf euch und euer Projekt bauen?“, sprach es in mir. Eine andere Stimme mahnte mich eindringlich, bei den ersten Schwierigkeiten nicht gleich das Handtuch zu werfen, sondern die Krise durchzustehen und Begonnenes zu Ende zu führen. Dann saß mir wieder die Angst im Nacken, dass ich gerade eine riesige Chance vergebe. Wer weiß, ob mir das Leben jemals wieder solche Bälle zuspielt … Und kritisch fragte ich mich: „Lasse ich mich stärker von Angst und Misstrauen leiten statt vom Geist des Vertrauens? Schaue ich zu sehr auf mich und meine begrenzten Möglichkeiten, anstatt mich der unbegrenzten göttlichen Weite zu öffnen?“
Mit solchen inneren Dialogen stellte ich mich monatelang selbst infrage. Oft suchte ich wie getrieben bei anderen nach Antworten. Ich hoffte, durch Gespräche mit meinen Kolleginnen, mit Freunden und in der Beratung zu meiner früheren Klarheit zurückzufinden. Oder zumindest deren verständnisvolle „Erlaubnis“ zu bekommen, aus dem Projekt auszusteigen. Doch nichts dergleichen geschah.
„Ich habe den Eindruck, Sie spüren sehr deutlich, was Sie wollen.“ Dieser Satz öffnete mir die Augen dafür, dass ich tatsächlich wusste, was ich zu tun hatte. Und ich tat es: Ich stieg aus dem Projekt aus.
Mit diesem Tag fiel der Druck von mir ab, der monatelang auf mir gelastet hatte. Ich fühlte mich wie eine nach langer Krankheit Genesende und meine Kräfte kehrten langsam zurück. Und als ich eines Tages hörte, wie ich fröhlich vor mich hin summte, schluckte ich unwillkürlich vor Dankbarkeit: Ich fühlte mich wieder wohl in meiner Haut. Ich war zu mir zurückgekehrt. Ich war in mir daheim.
Wenn ich heute auf diese schweren Jahre zurückschaue, durchzuckt mich immer noch ein Schmerz: Warum habe ich damals nur so hart und rücksichtslos gegen mich selbst gekämpft und mich dabei regelrecht zerfleischt? Zugleich sehe ich dankbar, was mich diese Zeit gelehrt hat und bis heute lehren kann. Vor allem aber begann ich mich aufgrund dieser Geschichte und vieler anderer persönlichen und beruflichen Erfahrungen brennend dafür zu interessieren: Warum sind wir Menschen uns selbst gegenüber so feindselig eingestellt? Wie können wir besser mit uns klarkommen? Ja, wie können wir uns mit uns selbst befreunden? Dies wäre ziemlich sinnvoll, denn schließlich sind wir selbst die Person, mit der wir es ein Leben lang aushalten müssen.
2. Ziemlich beste Feinde
In meiner Tätigkeit als Seelsorgerin und Beraterin geht mir zunehmend auf, wie häufig wir Menschen uns selbst im Weg stehen oder ein Bein stellen. Und es ermutigt nicht gerade zu sehen: Jeder Aspekt des Lebens scheint genügend Zündstoff zu bieten, um mit sich, mit der eigenen Geschichte und den Umständen im Klinsch zu liegen. Es gibt nichts, was wir nicht auch ablehnen und bekämpfen könnten. Einige typische Beispiele:
Viele erleben ihren eigenen Körper als Fremdkörper, als eine Quelle von latentem Missbehagen, von Selbstunsicherheit oder auch von leidvollen Einschränkungen. Und selbst wer im Großen und Ganzen körperlich gut beieinander ist, an dem lässt der innere Kritiker oft kein gutes Haar, sobald es um das eigene Aussehen geht: „Schau dir bloß deine Nase an!“, stichelt er. Oder: „Wie fett du bist. Du ertrinkst ja fast in deinen Rettungsringen!“ Manche ziehen es vor, ihren Körper gleich ganz zu ignorieren – und sabotieren dadurch sich selbst. Etwa wenn sie die Augen vor ihrem ungesunden Lebensstil verschließen und jeden Gesundheitscheck vermeiden, obwohl ihr Körper rebelliert.
Oder der Beruf: Da gehen manche begeistert in ihren Aufgaben auf – und irgendwann gehen sie in ihnen unter. Was als erfüllende Selbstverwirklichung begonnen hat, mündet in quälende Selbstausbeutung.
Auch lassen wir Menschen uns selbst im Stich, wenn wir uns durch die Angst verführen lassen, Erwartungen anderer zu enttäuschen. Mit der coolen Bemerkung „Kein Problem!“ übernehmen manche Männer Dinge, die sie „eigentlich“ nicht übernehmen können oder wollen. Doch eine Stimme im Kopf flüstert: „Steh deinen Mann! Ein echter Kerl würde das verkraften. Ist Mamas Süßer etwa schon schlapp?“ Andere vermeiden zum wiederholten Mal, eine Sache anzusprechen, obwohl sie es sich fest vorgenommen haben. Denn eine Stimme im Innern warnt: „Rede bloß keinen Klartext! Du würdest die Leute total vor den Kopf stoßen. Halt also deinen Mund, lächle freundlich und nicke!“ Ich selbst musste feststellen, wie stark ich mich in dem erwähnten Projekt bisweilen verbogen hatte, um Kritik und Unverständnis zu vermeiden und um Anerkennung und Zuneigung zu erhalten. Das äußerte sich etwa darin, dass ich das Letzte aus mir herauspresste und mich am Ende saft- und kraftlos fühlte. Und dass ich zu lange Zeit nicht umsetzte, wovon ich doch „eigentlich“ überzeugt war.
Auch mit unseren Vorstellungen von uns selbst und wie unser Leben verlaufen soll, können wir Menschen uns unter Druck setzen oder – in Selbsttäuschung gefangen – an uns vorbeileben. So verliefen meine dem Projektausstieg vorangegangenen Monate auch deswegen so qualvoll, weil ich mich in meinen Vorstellungen von mir und meiner Zukunft verheddert hatte. Ich war mit unserer Unternehmung und meinem damit verbundenen Selbstbild verheiratet, und daher erschien mir ein Ausstieg als ein entsetzliches Scheitern. Nur langsam und mühevoll entpuppte sich dieser Schritt als ein Befreiungsschlag und als Treue mir selbst gegenüber.
Im Blick auf Idealbilder erschrecke ich immer wieder, wie stark unsere Kultur von einem Lebensgefühl desMangels infiziert ist. Oft weckt der innere Datenabgleich zwischen Ist und Soll den Eindruck: „Ich bin nicht gut genug. Nicht erfolgreich genug. Nicht hilfsbereit genug. Nicht spirituell genug. Nicht … genug.“ Und wer dann noch beim Zubettgehen seine Liste abspult, was er alles nicht geschafft hat, wird missmutig einschlafen.
Weit verbreitet ist auch das Leben im Konjunktivmodus: „Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich … Es wäre eigentlich schön … Wie wäre es wohl, wenn …“, so seufzen viele sehnsuchtsvoll. Doch eingeschnürt in die Zwangsjacke des Naheliegenden wird das Glück auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. In ruhigen Stunden meldet sich freilich der heimliche Verdacht: „Ich selbst komme in meinem Leben kaum vor. Ich spüre keine Verbundenheit mit dem, was mir wichtig ist, sondern lebe irgendwie nur aus purer Gewohnheit.“
Nicht zuletzt liegen wir Menschen oft mit der eigenen Vergangenheit im Streit. Unsere Geschichte hat sich in unsere Persönlichkeit eingeschrieben. Doch es gibt so manches, was wir vielleicht gerne ein für alle Mal durchstreichen oder ausradieren würden: Fehler, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Klaffende innere Verletzungen, die mir durch Eltern, durch den Partner oder die Partnerin zugefügt worden sind und die mich heute noch beeinträchtigen. Schicksalsschläge, die mir Freude und Leichtigkeit geraubt haben … Wenn wir uns mit unserer Geschichte auf Dauer nicht versöhnen, dann liegen wir mit uns selbst im Streit. Negative Gefühle und belastende Erinnerungen mindern unsere Lebensqualität und das mögliche Glück des Augenblicks geht ungesehen vorüber. Ein ähnlich einengender Tunnelblick stellt sich auch leicht ein, wenn uns im Hier und Jetzt eine Situation stört; wenn wir uns immer wieder über jemanden ärgern oder sich etwas ganz anders entwickelt, als wir erhofft hatten.
Ob Sie das eine oder andere Beispiel aus eigener Erfahrung kennen? Oder fallen Ihnen andere Geschichten zur Beziehungskiste mit sich selbst ein – Geschichten, denen Sie zumindest nicht den Titel „Ziemlich beste Freunde“ geben könnten? In diesem Fall würde es sich lohnen, diese Storys nicht gleich wieder auszublenden, sondern sie genauer anzuschauen. Denn erst dann können Sie Ihre ‚story‘ anders – erfüllender, sinnvoller – weiterschreiben. Vielleicht hat sich Ihr Leben aber auch auf den Kopf gestellt oder Sie stehen in einer Entscheidungssituation und fragen sich: „Worauf kommt es mir an? Will ich einen neuen Kurs einschlagen?“
Welche Motive Sie auch bewegen sollten, ich bin davon überzeugt: Sie tun sich selbst – und auch den Menschen, die mit Ihnen zu tun haben – einen großen Gefallen, wenn Sie Freundschaft mit sich schließen. Denn Sie selbst sind der Mensch, mit dem Sie vom ersten bis zum letzten Atemzug zusammenleben. Sie sind lebenslänglich, auf Gedeih und Verderb an sich selbst gebunden.
Aus diesem Grund läge es nahe anzunehmen, dass Sie und dass wir alle ein großes Interesse daran haben, die Beziehung mit uns selbst zu pflegen – und zwar in einer Art und Weise, dass wir gut mit uns klarkommen und uns in unserer eigenen Gesellschaft wohlfühlen. Doch gegenteilige Beobachtungen drängen sich auf: Oft bringen wir der Beziehung mit uns selbst wenig Aufmerksamkeit entgegen und vernachlässigen sie. Wir wollen möglicherweise gar nicht so genau wissen, wie es uns geht, und haben wenig Interesse, uns näher kennenzulernen. Ein ehrlicher, wohlwollender Selbstumgang hat offenkundig Seltenheitswert. So stimmt es mich nachdenklich, dass unsere Alltagssprache viele abschätzige oder feindselige Redewendungen kennt, etwa: „Ich könnte mir in den Hintern treten“, „mich selbst ohrfeigen“, „mir die Kugel geben“. Positive Redewendungen hingegen tauchen kaum auf. Und kommt doch einmal ein wertschätzender Ausdruck daher wie „Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen“, dann klingt dies für viele befremdlich, denn „Eigenlob stinkt“. Hören wir auf unsere Alltagssprache, in der sich die Erfahrung von zig Millionen Menschen niederschlägt, dann besagt diese: Es liegt uns offenkundig näher, uns selbst harsch oder verächtlich anzufahren, als dass wir uns gegenüber freundlich gesinnt sind und Wohlwollen entgegenbringen.
Was für ein Gebilde ist unser Ich, das hin- und herschwankt zwischen dem Empfinden, mit sich einverstanden zu sein, und das kurz darauf darunter leidet, dass es sich uneins und zerrissen fühlt?
Das Ich und das Selbst sind schlecht fassbar; fast jede und jeder stellt sich etwas anderes darunter vor. Ich will versuchen, Licht ins Dunkel des Begriffsdickichts zu bringen.
3. Das vielgesichtige Ich
Sie sind immer für Überraschungen gut! Oder entdecken Sie nicht manchmal auch ein Gesicht an sich, das Sie noch gar nicht kannten? Werden auf Neues aufmerksam, wenn Sie in den Spiegel der Selbstwahrnehmung schauen: auf Interessen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die Sie überraschen und freuen. Da entdeckt eine Mittfünfzigerin, die seit einer negativen Erfahrung im Schulsport mit dem Dauerlauf auf Kriegsfuß stand, die Freude am Joggen. Oder jemand staunt über seine ungeahnte innere Stärke, wie etwa jener Mann, der nach einer schweren Krise von sich sagte: „Ich bin gar nicht so ein Schwächling, wie ich bislang meinte! So viel Kraft und Willensstärke hätte ich mir nie zugetraut.“ Wer würde sich nicht über solche Überraschungen freuen?!
Wir stolpern aber auch über Befremdliches in uns. Manchmal entdecken wir Züge an uns, die wir lieber nicht unser Eigen nennen würden. Vielleicht haben Sie sich schon einmal nach einem lautstarken Konflikt kopfschüttelnd gefragt: „Was hat mich denn da geritten, dass ich so ausgerastet bin? Ich kenne mich selbst kaum wieder!“ Oder ein Ihnen unsympathischer Kollege blamiert sich vor versammelter Mannschaft. Und Sie stoßen darauf, wie Schadenfreude in Ihnen aufsteigt und sich wohlig in Ihrem ganzen Körper breitmacht. Oder Sie freuen sich beim Aufwachen auf den Urlaubstag mit der Familie, und dann machen Ihnen irgendwelche eigenen Launen einen Strich durch die Rechnung – und wider Willen sind Sie sogar noch drauf und dran, auch den anderen die gute Stimmung zu vermiesen.
In solchen Erfahrungen zeigt sich: Wir haben verschiedeneGesichter. Einige kennen wir, andere nicht. Manche begrüßen wir freudig und manche übersehen wir lieber, verbergen sie vor uns und anderen. In den Überraschungen des Alltags drängen diese uns unbekannten Gesichter unserer selbst nach vorn. Sie bieten uns die Stirn und wollen gesehen werden. Doch damit nicht genug! Vielmehr fühlen wir Menschen uns bisweilen auch zerrissen. Wir wollen dies und wir wollen das genaue Gegenteil. „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ – lässt Goethe den Faust verzweifelt sprechen. Ich finde, da ging es Faust noch ziemlich gut! Wenn ich auf mich schaue, kommt mir manchmal eher der Seufzer in den Sinn: „Zig Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“, etwa wenn Vernunft und unterschiedlichste Gefühle sich in einer Sache so gar nicht einigen können. Oder wenn ich gerne auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen würde.
All dies zeigt: Wir Menschen sind komplex. Verschiedene Stimmen leben in uns – und zwar alle gemeinsam unter einem Dach. Wie kompliziert so etwas sein kann, kennt jede und jeder aus dem Zusammenleben in Familie, Partnerschaft oder Wohngemeinschaft. Auch eine Ordensgemeinschaft – ich lebe in einer solchen – bildet da keine Ausnahme. Ähnliches spielt sich in uns selbst ab: Da schreien verschiedene Stimmen durcheinander, und alle wollen gehört werden. Wie kann jede zu ihrem Recht kommen? Wie kann man vermeiden, dass sich eine einzelne Stimme durchsetzt und die anderen mundtot macht? Wie können sich die verschiedenen Parteien friedlich um einen runden Tisch versammeln?
Vielleicht kann folgendes Bild weiterhelfen: Eine Bundesrepublik setzt sich aus unterschiedlichen Bundesländern zusammen mit ihren jeweiligen Traditionen, Werten und Tabus. Über Jahrhunderte haben einzelne Länder versucht, die anderen zu unterwerfen. Dies führte zu verheerenden Kriegen und verbrannter Erde. Die Gründungsidee einer Bundesrepublik verdankt sich der Vision eines friedlichen Miteinanders, einer Union, die auf demokratischen Spielregeln basiert. In einer parlamentarischen Kultur haben alle Mitglieder eine Daseinsberechtigung und dürfen, ja sollen ihre Stimme abgeben. Natürlich brechen ständig Interessenskonflikte auf. Doch das Entscheidende liegt darin, dass diese nicht durch einseitige Machtausübung „gelöst“ werden, sondern durch Gespräch, Verhandlung, Kompromiss oder – im Idealfall – durch Konsens. Eine Einheit, ein Wir entsteht.
Analog sind auch wir selbst kein einheitliches Gebilde. Entsprechend kann es zu zerstörerischer Feindschaft, zu gleichgültiger Koexistenz oder zu einem kooperativen Miteinander zwischen den verschiedenen „Gebieten“ in uns kommen. Was auf staatlicher Ebene als politischer Fortschritt angesehen und gefeiert wird, gilt auch für das Binnenland in uns: Der Weg vom unverbundenen Flickenteppich verschiedener „Gebiete“ hin zu Einheit und Integration lässt uns freier und friedvoller leben.
Eine demokratische Spielregel im Umgang mit sich selbst zu beachten bedeutet etwa, dass die verschiedenen Kräfte in mir das Recht haben, sich zu Wort zu melden und auch gehört zu werden. Alle haben eine Daseinsberechtigung: die körperlichen Bedürfnisse, die bunte Palette der Emotionen, das hartnäckige Fragen und Verstehenwollen und die Sehnsucht nach Sinn und Geborgenheit. In gleicher Weise kommt dem Fremden und Beängstigenden in uns ein Existenzrecht zu. Im Sinn einer parlamentarischen Kultur gilt es, darauf zu achten, dass sich in diesem Machtspiel keine Stimme dominant durchsetzt. Das passiert etwa, wenn jemand permanent beruflich auf der Überholspur dahinrast und seine Beziehungen und körperlichen Bedürfnisse links liegen lässt. Oder wenn wir uns selbst beherrschen (!) und unsere Gefühle unterdrücken, um nicht negativ aufzufallen.
Ein solcher Selbstumgang wirkt auf Dauer verheerend. Denn wo Unterdrückung ist, wächst immer auch Opposition. Macht korrespondiert mit Ohnmacht – und diese rächt sich irgendwann. Wir werden hingegen zufriedener und erfüllter leben, wenn wir die unterschiedlichen Interessen und widerstreitenden Kräfte in uns immer wieder neu austarieren. Wenn wir versuchen, sie in ein kooperatives oder gar in ein freundliches Verhältnis zueinander zu bringen.
Das sich verändernde Selbst
Das Selbst ist eine Instanz, die das gesamte Ich mit seinen verschiedenen Nuancen und Gesichtern im Blick hat. Mit einem Vergleich aus der Politik ausgedrückt: Wie eine innere Ratspräsidentin lässt das Selbst die diversen Stimmen zu Wort kommen und vermittelt zwischen ihnen. Es schlichtet Streit, versucht auch das Unbewusste mit einzubeziehen und trifft im Zweifelsfall eine Entscheidung.
Hier wird deutlich: Es gibt kein „wahres Selbst“, welches unwandelbar im Menschen liegt und sich herauskristallisieren lässt. Natürlich prägen stabile Charaktereigenschaften uns Menschen. Aber es gibt kein „authentisches Wesen“, das wir jenseits aller Rollen sind. Was uns ausmacht, ist vor allem die Art und Weise, wie wir mit uns und unserer Umwelt im Austausch stehen. Das Selbst bildet sich im Gespräch, das wir mit uns selbst und mit unserer Umwelt führen. Und weil Sie diesen Dialog führen, solange Sie leben, bleibt Ihr Selbst zeitlebens in Bewegung. Es kann weder auf den Begriff gebracht noch festgestellt werden. Sie selbst und das Leben sind immer für Überraschungen gut!
Vielleicht lesen Sie diese Zeilen und sind irritiert. Möglicherweise haben Sie dieses Buch zur Hand genommen in der Hoffnung, dass es Ihnen hilft, Ihr „eigentliches Selbst“ zu entdecken und zu verwirklichen. Und dies aus gutem Grund, denn die Frage: „Wer bin ich denn wirklich?“ bedrängt uns umso mehr, je mehr Möglichkeiten wir haben, ganz unterschiedliche Richtungen einzuschlagen. Was können Sie also von diesem Buch erwarten?
Sie werden zentrale Aspekte Ihres Lebens in den Blick nehmen und sich selbst erkunden. Vor allem aber werden Sie immer wieder Gelegenheit haben, sich zu fragen: „Wie stelle ich mich zu dem, was ich bin? Wer will ich sein, während ich mein Leben lebe?“ Denn wer Sie sind, ist unendlich mehr als all das, was Sie sind; als das, was Sie besitzen und können, was Sie entbehren und erleiden. Wer Sie sind, erwächst daraus, wie Sie mit sich und dem Leben im Dialog stehen. In diesem Gespräch sind Sie einmalig und unvertretbar. Weder steht das Ergebnis im Vorhinein fest, noch gibt es eine Vorlage, die Sie nachsprechen könnten. Sie sind gefragt!
Ich bin davon überzeugt: Sie werden umso tiefer erfahren, wer Sie sind, je mehr Sie sich für eine spirituelle Sichtweiseund Lebenseinstellung öffnen. Jeder Mensch ist spirituell begabt und kann erfahren: Ich lebe nicht allein aus meiner eigenen Kraft, sondern schöpfe aus tieferen Quellen. Ich bin aufgehoben in einem großen Zusammenhang, der mich und alles von innen her trägt. Ein Zusammenhang, der Liebe heißt. Die Bibel drückt dies mit den Worten aus: In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. (vgl. Apostelgeschichte 17,28)
Wer mit dieser Tiefendimension in Berührung kommt, erahnt eine grundlegende Beheimatung. Hier hat alles seinen Platz: der eigene Übermut und die Bedürftigkeit, die glänzenden und die glücklosen Stunden, der Lebenshunger und der Überdruss, wenn wir das Leben satthaben. Auch die Widersprüche, die uns manchmal zu zerreißen drohen und Feindschaft gegenüber uns und anderen säen, haben ihren Raum. In dieser inneren Heimat wird eine tiefe Verbundenheit spürbar mit uns selbst, mit anderen und mit dem göttlichen Geheimnis des Lebens.
4. Wege zu einer gelingenden Freundschaft
Trenduntersuchungen zeigen, dass die Bedeutung von Freundschaften seit den 80er-Jahren in Deutschland stetig zunimmt. Besonders hervorgehoben wird das starke Verantwortungsgefühl, das befreundete Menschen heute füreinander hegen.
Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus betonte der griechische Philosoph Aristoteles, dass wahre Freundschaft – die er von der legitimen Zweckfreundschaft unterscheidet – die tragfähigste und wertvollste Beziehung unter Menschen sei: Echte Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit und auf dem herzlichen, wohlwollenden Wunsch, dass es dem Gegenüber um seiner selbst willen gut geht. Eine solche Beziehung macht das Leben reich und gehört zu den wichtigsten Quellen von menschlichem Glück.
Ich persönlich fände ein Schaubild interessant, das den Entwicklungsstand einer Gesellschaft anhand anderer Kriterien aufzeigt als üblich. Normalerweise wird der Reichtum einer Gesellschaft mittels des Pro-Kopf-Einkommens oder des sogenannten Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhoben. Doch ebenso sinnvoll wäre es, den Entwicklungsstand auch einmal daran zu messen, wie viele Menschen es gibt, die jemanden an ihrer Seite wissen, auf den sie wirklich bauen können. Und wie sähe wohl eine Landkarte aus, die die Verbreitung jenes Reichtums darstellt, mit sich selbst befreundet zu sein?
Mit sich befreundet sein – das klingt ungewohnt und irgendwie fremd.
Bevor Sie weiterlesen, bitte ich Sie, das Buch zur Seite zu legen und sich zu fragen: Was charakterisiert eine gute Freundschaft? Wann würde ich jemanden als einen guten Freund oder als eine echte Freundin bezeichnen? Und was braucht es, dass eine Freundschaft entsteht und sich entwickelt?
Führen Sie sich zur Anschauung einige – möglicherweise auch eingeschlafene oder zerbrochene – Freundschaften vor Augen. Und wenn Sie sich dabei Notizen machen, können Sie diese immer mal wieder zur Hand nehmen, um das Verhältnis zu sich neu zu bedenken und freundschaftlich(er) zu gestalten.
Ins Gespräch kommen
Zu Beginn des Kinofilmes „Ziemlich beste Freunde“ verbindet die beiden Hauptdarsteller – den vermögenden, vom Hals ab gelähmten Philippe und den frisch aus der Haft entlassenen Driss – eine rein zweckmäßige Arbeitsbeziehung: Driss wird von Philippe dafür bezahlt, dass er ihn pflegt. Die Atmosphäre zwischen den beiden verändert sich, als sie sich füreinander zu interessieren beginnen und nach und nach mehr voneinander erfahren. Damit ist der Grundstein ihrer Freundschaft gelegt.
Am Anfang einer Freundschaft steht echtes Interesse aneinander und dies bleibt ihr tragendes Fundament. Mit einem Freund oder einer Freundin will ich gemeinsam Zeit verbringen, will mit ihr im Kontakt sein, erfahren, wie es ihm geht, mich austauschen und miteinander etwas unternehmen. Umgekehrt beginnt eine Freundschaft zu bröckeln, wenn tausend andere Dinge wichtiger erscheinen als ein gemeinsamer Abend. Wenn – wie es die Österreicher unnachahmlich passiv-unschuldig ausdrücken – „es sich einfach nicht ausgeht, dass wir uns treffen“. Fehlendes Engagement und Desinteresse untergraben eine vertrauensvolle Beziehung, bis sie dann irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Untersuchungen zufolge nehmen sich die meisten Menschen zu wenig Zeit für Freundschaften, insbesondere Männer. Mit zwei bis drei Stunden jede Woche, um den Kontakt mit Freunden zu pflegen, wäre schon viel gewonnen …
Was bedeutet dies nun analog für die Beziehung mit sich selbst? Auch hier gilt das Gleiche: Es braucht zuallererst ein waches Interesse an der eigenen Person. Vielleicht denken Sie: „Was soll denn daran besonders sein? Jeder und jede ist sich selbst die Nächste und schaut auf sich.“ Doch sich selbst mehr kennenlernen zu wollen, ist alles andere als selbstverständlich! Natürlich laufen wir uns des Öfteren – mehr oder weniger beglückt – selbst über den Weg. Doch den umtriebigen Alltag so zu gestalten, dass wir immer wieder neu den Kontakt mit uns suchen, ist eine dauerhafte und nicht immer leichte Aufgabe. Dazu braucht es eine bewusste Lebenskultur. Zwar seufzen viele sehnsüchtig: „Hätte ich doch mehr Zeit für mich!“, doch häufig setzen sie ihren Wunsch nicht in die Tat um. Ihre Absichtserklärung ähnelt dem frommen Wunsch, der Umwelt zuliebe in Zukunft aufs Fahrrad umzusteigen. Doch dann ist man knapp dran oder es regnet – und schon fällt der gute Vorsatz ins Wasser.
Wie entschlossen jemand mit sich selbst in Tuchfühlung kommen will, erweist sich darin, ob er oder sie sich tatsächlich Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Ein kleiner Realitäts-Check: Pflegen Sie eine Kultur des Rückzugs, der Stille und der Selbstreflexion? Bemühen Sie sich um eine achtsame Haltung sich selbst gegenüber? Schenken Sie den verschiedenen Stimmen in sich Gehör: der Sprache des Körpers und der Gefühle, der Träume und Ängste? Lauschen Sie der Stimme Ihres Herzens und den substanziellen Fragen, die auftauchen, wenn Sie mit sich allein sind – Fragen, in denen es um die eigene Person geht und die auch ein beunruhigendes Potenzial in sich tragen?
Wenn Sie das Gespräch mit sich selbst suchen, sind Sie auf dem besten Weg zur Freundschaft mit sich selbst.
Doch es gibt Stolpersteine auf diesem Weg. Auf drei häufige Hindernisse möchte ich hinweisen.
Stolperstein 1: Angst vorm Alleinsein
Eine Freundschaft mit anderen braucht Zweisamkeit. Eine Freundschaft mit sich selbst braucht Einsamkeit. Sie lebt (auch) von der Verabredung mit sich selbst fern von Trubel und Geschäftigkeit. Und hier liegt ein Problem: Will ich überhaupt zu mir zurück? Was finde ich dort? Und wer ist dort? – Karl Valentin bringt es launig auf den Punkt: „Morgen gehe ich mich besuchen. Hoffentlich bin ich zu Hause!“
Viele finden Alleinsein fürchterlich und halten Stille kaum aus. Beobachten Sie etwa Leute, die in der Schlange an einer Kinokasse stehen oder auf den Bus warten. Die meisten holen sofort ihre Kopfhörer heraus oder wischen auf ihrem Smartphone herum. Dazu eine Zahl: Ein Teenager in den USA erhält im Durchschnitt 3417 Textnachrichten monatlich, das sind sieben bis acht Mitteilungen pro Stunde, wenn man den Tag mit sechzehn Stunden ansetzt. Und einem Bonner Forscherteam zufolge nutzen die Menschen ihr Smartphone drei Stunden täglich und nehmen es alle fünfzehn Minuten zur Hand, um zu kontrollieren, ob es etwas Neues gibt.
Worin gründet diese Angst vor Stille und Alleinsein? Warum muss immer etwas gesagt oder getan, gehört oder gepfiffen werden, sobald es um einen ruhig wird? Warum beschäftigen Menschen sich lieber wie besessen mit etwas, als dass sie sich mit sich selbst beschäftigen? Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung schreibt in einem seiner Briefe, dass der Lärm vor „peinlichem Nachdenken“ schützen soll. Unterhaltung und Aktivismus sollen einem vom Hals halten, was in der Stille aus dem eigenen Innern aufsteigen könnte. Und in der Tat: Das Hören auf die inneren Stimmen kann bisweilen schmerzlich sein. Denn in uns wohnen auch Angst und Wut, schmerzhafte Erinnerungen an Kränkungen und eigene Schuld oder das quälende Empfinden, die Orientierung verloren zu haben. Wir stoßen auf unsere Endlichkeit und spüren doch zugleich unseren unendlichen Hunger. Wenn wir uns dem Innerseelischen aussetzen, werden wir in unserem Tatendrang nicht befriedigt, sondern müssen lernen, auch Leere auszuhalten.
Wie halten Sie es mit dem Alleinsein und der Stille? Verabreden Sie sich mit sich selbst? Und wann und wie oft ergreifen Sie diese Gelegenheit: Zum Jahreswechsel oder runden Geburtstag oder gibt es regelmäßige Treffpunkte in Ihrem Alltag?
Vielleicht entdecken Sie beim genaueren Hinschauen manche Ausweichmanöver, durch die Sie Schweigen und Alleinsein vermeiden wollen. Falls dies der Fall sein sollte, machen Sie sich deswegen bitte nicht nieder! Denn wie angedeutet kann es nachvollziehbare Gründe geben, die Sie zu einem solchen Verhalten motivieren. Zugleich können Sie sich fragen, ob eine solche Vogel-Strauß-Politik Sie wirklich Ihrem Ziel näher bringt. Denn wenn Sie nicht auf sich selbst hören, so hören Sie bald nur noch auf andere oder anderes. Je weniger Sie einen Zugang zu dem haben, was Sie empfinden und wollen, umso leichter werden Sie ein Spielball Ihrer Launen oder der Interessen anderer. Umgekehrt verhilft Ihnen der Rückzug in die Stille, dass Sie Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden und Ihr eigenes Leben führen können.
Wenn Sie Ihre Motivation stärken wollen, Stille und Selbstreflexion zu kultivieren, kann es hilfreich sein, sich an Stunden erfüllten Schweigens zu erinnern. Vielleicht als Sie allein durch die Natur spazieren gegangen sind. Oder als Sie in einer menschenleeren Kirche saßen und die Zeit stillzustehen schien.
Stille hat eine beruhigende und heilende Kraft. Die Stimmen, die etwas von einem wollen und immer weitertreiben, verstummen: die Stimme des Ehrgeizes, die Angst, zu kurz zu kommen oder nicht zu genügen. In der Stille lässt sich erleben, dass ich einfach da sein darf, ohne etwas leisten oder machen zu müssen. Nichts und niemand will etwas von mir – nicht einmal ich selbst.
In dem Maß, in dem wir – immer wieder neu – den inneren „Raum der Stille“ aufsuchen, werden wir bei uns selbst ankommen. Ich persönlich erfahre dies auch als ein spirituelles Geschehen. Denn wenn ich näher zu mir selbst finde, erahne ich zugleich einen umfassenderen Grund, der mich und alles von innen her trägt. Und umgekehrt: Je mehr ich in Berührung komme mit dem göttlichen Geheimnis, umso mehr komme ich in Kontakt mit mir und der Welt. In diesem inneren Zusammenhang liegt aus christlicher Sicht der entscheidende Lackmustest! Wenn auf meinem inneren Marktplatz mal wieder die verschiedenen Parteien durcheinanderschreien, halte ich daher inne und versuche herauszuhören: Führt mich eine innere Stimme mehr zu mir selbst? Öffnet sie mich gegenüber meinen Mitmenschen und stärkt die Verbundenheit mit ihnen? Oder bringt sie mich dazu, mich von mir selbst zu entfremden? Treibt sie mich in eine größere Enge und Vereinzelung hinein? Die christliche Spiritualität lädt ein, jenen Stimmen Gehör zu schenken, die uns innerlich weit machen. Die uns mehr zu uns selbst und zu anderen zugleich führen und die unser Vertrauen in die leise Gegenwart Gottes stärken. Schenken wir diesen Stimmen Glauben, dann geben wir dem göttlichen Geist Raum.
Stolperstein 2: Selbstmitleid
„Wenn nur die Leute nicht wären! Immer und überall stören die Leute. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann sähe die Sache schon anders aus“, klagt Hans Magnus Enzensberger ironisch. Mit spitzer Feder karikiert er die Lamentierhaltung, mit der man sich so vortrefflich aus der eigenen Verantwortung stehlen kann.
Wenn die Unzufriedenheit im Beruf wächst oder sich der Urlaub trist dahinzieht, liegt als erste Reaktion nahe, anderen dafür die Schuld zuzuweisen: Die unfähige Chefin oder die mobbenden Kollegen, der schlechte Hotelservice oder das miese Wetter haben es einem vermasselt. Oder auch der eigene Charakter – „Ich kann nichts dafür. Ich bin halt so“ –, das Elternhaus, die Gene und die Gesellschaft müssen oft für die eigene Misere herhalten.
Natürlich sind wir Situationen und Menschen ausgesetzt und werden ungewollt und auch unbewusst durch vieles geprägt. Ja, bereits mit der Geburt sind wir kein unbeschriebenes Blatt mehr. Genetische Veranlagungen, vorgeburtliche Erfahrungen und die Kultur, in die wir hineingeboren werden, haben sich in unsere Persönlichkeit eingeschrieben.
Und doch haben wir einen Gestaltungsspielraum. Wir sind Mitautorinnen und Mitautoren unserer Geschichte. Aber dies anzuerkennen fällt manchmal schwer. Wenn etwas schiefgeht, schreiben wir lieber anderen die Verantwortung zu, als darin die eigene Handschrift wiederzuerkennen. Es entlastet, lauthals über die frechen Schüler oder undankbaren Patientinnen zu schimpfen, anstatt sich einzugestehen: „Ich habe den falschen Beruf ergriffen.“ Es ist angenehmer, anderen die Schuld an der schlechten Urlaubsstimmung in die Schuhe zu schieben, als anzuerkennen, wo bei mir der Schuh drückt. Dass ich vielleicht mit mir selbst nichts anzufangen weiß. Denn wenn ich mich langweile, bedeutet das letztlich nichts anderes, als dass mich meine eigene Gesellschaft anödet. – Keine erfreuliche Selbsteinsicht!
Sich in der Rolle des leidenden Opfers einzurichten, bringt also Vorteile mit sich: Ich muss mir selbst nicht begegnen und meinem Unbehagen an mir selbst nicht ins Auge blicken. Wenn ich leide, werde ich vielleicht von anderen bemitleidet und unterstützt. Und ich brauche in meinem Leben nichts zu ändern, denn es sind ja die anderen, denen ich mein Elend verdanke. Doch für eine solche Lebenseinstellung bezahlen wir einen hohen Preis! Denn wenn wir daran festhalten, dass andere für unser Glück oder Unglück zuständig sind, geben wir die Zügel aus der Hand. Wir lassen uns auf dem Beifahrersitz durch unser Leben kutschieren. Wir bleiben in der Zuschauerrolle – vielleicht, weil wir zu mutlos oder zu bequem sind. Was wir als Schicksal beweinen, lässt sich oft auch als ein Mangel an Selbstverantwortung beklagen. Mit dieser Lebenseinstellung verbauen wir uns den Weg zu einer Freundschaft mit uns selbst. Wir halten uns selbst davon ab, dass wir unsere tiefsten Wünsche und Schwierigkeiten wahrnehmen und angemessen mit ihnen umgehen.
Hat sich erst einmal eine wehleidige Lamentierhaltung in einem eingenistet, fällt es gar nicht leicht, sich von ihr zu befreien. In diesem Fall kann es helfen, nüchtern damit zu rechnen, dass eigene blinde Flecken einem die Sicht verstellen. Denn im Normalfall sind wir mit passiven und aktiven Anteilen in spannungsreiche Situationen hineinverwoben. Wenn uns durch einen realistischen Blick unsere Mitverantwortung aufgeht, dann entdecken wir zugleich, dass wir auch jetzt tätig und aktiv werden können. Dass wir es in der Hand haben, an der misslichen Lage etwas zu verändern.
Stolperstein 3: Selbstoptimierung
Bertolt Brecht erzählt in einer bekannten Kalendergeschichte davon, was ein Mensch unter Liebe versteht. Er macht einen Entwurf von einem geliebten Menschen und bemüht sich um Angleichung. Allerdings: Nicht der Entwurf soll dem Menschen ähnlich werden, sondern der Mensch dem Entwurf!
Diese bekannte Kurzgeschichte über die Liebe lässt sich auch auf eine Freundschaft übertragen. Sie macht darauf aufmerksam, was das Fundament einer Freundschaft unterhöhlt: der Versuch, dass ein Mensch dem Bild angeglichen werden soll, das man von ihm hat. Doch Freundschaft lebt von einer grundlegenden wechselseitigen Akzeptanz. Da weiß jemand um unsere Stärken und Schwächen, um unsere Erfolge und Niederlagen – und mag uns so, wie wir sind. Wir müssen nicht erst jemand anders werden oder uns einem bestimmten Bild anpassen. Auch wenn der Freund oder die Freundin nicht alles gutheißt, was wir getan haben. In der Gegenwart eines solchen Menschen lässt sich aufatmen. Es fühlt sich an wie ein Zu-Hause-Ankommen.
Sich mit sich selbst befreunden funktioniert ganz ähnlich. Und hier stoßen wir auf ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Selbstfreundschaft: auf die weitverbreitete Kultur der Selbstoptimierung. Die gesellschaftliche Tendenz, ständig an sich zu arbeiten und sich zu verbessern, torpediert einen freundschaftlichen Umgang mit sich selbst.