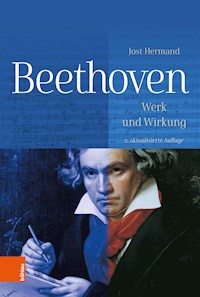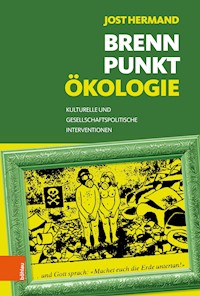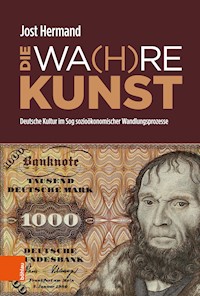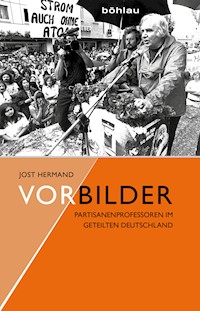Jost Hermand
Freunde, Promis, Kontrahenten
Politbiographische Momentaufnahmen
2013
BÖHLAU VERLAG KÖLN · WEIMAR · WIEN
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Graduate School der University of Wisconsin-Madison
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.
Umschlagabbildungen:
Von links nach rechts, mit oberer Zeile beginnend: Walter Ulbricht, Wolfgang Schäuble, Johannes Rau, Bill Bradley; darunter: Heiner Müller, Hans Mayer, Richard Hamann, George L. Mosse. Bildnachweise: Walter Ulbricht: Foto © akg-images; Wolfgang Schäuble: INTERFOTO / Jurino Reetz; Johannes Rau: Meldungsarchiv NRWSPD; Bill Bradley: Archiv des Verfassers (Copyright 85photo.com); Heiner Müller, Hans Mayer: Fotos: Roger Melis © Roger Melis / Nachlass Mathias Bertram; Richard Hamann, George L. Mosse: Archiv des Verfassers.
© 2013 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien Ursulaplatz 1, D–50668 Köln, www.boehlau-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Lektorat und Korrektorat: Volker Manz
Satz: WBD Wissenschaftlicher Bücherdienst, Köln
Druck und Bindung: Finidr s.r.o., Český Těšín
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-412-22158-4 (Print)
Datenkonvertierung: Beltz, Bad Langensalza
ISBN dieses eBooks: 978-3-412-21638-2
Inhalt
VorbemerkungÜber Sinn und Unsinn autobiographischen Schreibens7
Unterm Faschismus (1942–1945)11
Die Nachkriegszeit (1946–1949)21
In Marburg und Ostberlin (1950–1957)27
Die ersten Jahre in Wisconsin (1958–1967)43
Politische Umbrüche (1968–1980)59
Gegen den Strom (1980–1989)113
Die Nachwendezeit (1990–2011)181
Anmerkungen239
Namenregister249
Vorbemerkung:Über Sinn und Unsinn autobiographischen Schreibens
Bei der Darstellung gesamtgesellschaftlicher Prozesse oder auch politischer Einzelvorgänge das eigene Ich in den Vordergrund zu rücken, hat stets etwas Peinliches.1 Jeder, der es dennoch versucht, setzt sich zwangsläufig der Gefahr aus, sich selber allzu wichtig zu nehmen oder gar den Eindruck des Angeberischen zu erwecken. Besonders dann, wenn es sich dabei um Begegnungen mit irgendwelchen allbekannten Promis oder bedeutsamen Kontrahenten handelt, mit denen man sich auseinander setzen mußte, ist es oft schwierig, den jeweils richtigen Ton zu treffen. Derartige Versuche werden deshalb von strengen Wissenschaftlern meist von vornherein als unziemliche Eitelkeit ausgelegt. Und viele der damit verbundenen Vorwürfe sind sicher berechtigt. Worauf solche Wissenschaftler bestehen, ist eine überpersönliche Objektivität, die sich keinerlei Ausflüge ins vermeintlich Privatistische erlaubt und sich an eine getreue Wiedergabe der vorgegebenen Fakten hält. So weit, so einleuchtend.
Dennoch scheint mir auch im Bereich des Wissenschaftlichen – vor allem wenn es um politische, soziale oder kulturelle Erlebnisse des eigenen Lebens geht – eine vom persönlichen Erfahrungsbereich ausgehende Sehweise nicht unberechtigt. Allerdings müßte man hierbei stets folgenden Versuchungen aus dem Wege gehen. So wäre nichts unangebrachter, als sich bei der Darstellung solcher Ereignisse in längeren theoretischen Ausführungen zu ergehen, statt sich vornehmlich auf Tagebuchnotizen, Briefe oder Kalendereintragungen, das heißt lebensgeschichtlich überlieferte Dokumente zu stützen. Deshalb sollten alle in derartigen Schriften aufgezeichneten Gespräche, Begegnungen, Angriffe [<< 7 Seitenzahl der gedruckten Ausgabe] oder Freundschaftserklärungen so authentisch wie möglich wiedergegeben werden, das heißt für sich selber sprechen, statt den Lesern von vornherein eine bestimmte Interpretation aufzunötigen. Es versteht sich, daß ein solches Bemühen – besonders wenn es sich um Jahrzehnte zurückliegende Ereignisse handelt – nicht in allen Fällen auf eigene Dokumente zurückgreifen kann. Bei Notaten dieser Art dürfte man sich darum nicht nur auf sein eigenes Gedächtnis verlassen, sondern müßte so viele historische Quellen wie nur möglich heranziehen.
Eine andere Schwierigkeit bei der Niederschrift derartiger Erinnerungen besteht darin, daß es leichter ist, Begegnungen mit Kritikern als mit Freunden oder Schülern aufzuzeichnen. Äußerungen von Kritikern – ob nun auf Tagungen oder in Rezensionen – eignen sich meist besser, eigene Standpunkte klar hervortreten zu lassen, als irgendwelche Gespräche mit gleichgesinnten Freunden sowie Reaktionen auf wohlwollende Besprechungen oder Leserzuschriften. Ebenso schwierig ist es, das Zusammentreffen mit irgendwelchen Promis – sei es nun unter positiver oder negativer Perspektive – zu beschreiben, ohne sich dabei den Anschein der Wichtigtuerei zu geben. In solchen Fällen ist deshalb eine möglichst nüchterne Zurückhaltung geboten, um nicht mit jenen Memoirenschreibern in einen Topf geworfen zu werden, denen es in ihren Lebenserinnerungen vor allem darum geht, ihre subjektiven Erfolgserlebnisse oder ihren persönlichem Umgang mit bestimmten Stars oder Divas herauszustreichen.
Kurzum: was mich bei der Niederschrift dieses Buchs – trotz aller Ichbezogenheit – motivierte, war nicht das Autobiographische, sondern das Dokumentarische. In den folgenden Kurztexten oder Momentaufnahmen geht es darum weniger um irgendwelche persönlichkeitsbildenden oder gar allzu privaten Episoden aus den ins Auge gefaßten Jahrzehnten zwischen 1942 und 2011, sondern vielmehr um Erlebnisse oder Eindrücke, in denen sich, wie ich hoffe, zugleich das zeitgeschichtlich Bedeutsame widerspiegelt. Das können, je nachdem, entweder Gespräche, Begegnungen, Briefkontakte, Lektüreerlebnisse, [<< 8] Reiseeindrücke und Vortragsreaktionen oder selbst Gemälde und Musikwerke sein. Mögen daher manche der in diesem Buch dargestellten Einzelerlebnisse auch noch so privat klingen, worum es mir letztlich ging, war stets die politische Pointe, welche sich daraus ergibt. Was in all diesen Texten angestrebt wird, ist daher weniger eine forciert bekennerische Note, die nur allzu leicht ins Predigerhafte auszuarten droht, als das Bemühen, lediglich das aufzuzeichnen, was mir in meinen Werdejahren und in meinem späteren Berufsleben als gesellschaftsrelevant erschien. So gesehen, sollen die in diesem Buch wiedergegebenen Momentaufnahmen nicht nur meine Altersgenossen ansprechen, sondern zugleich Dokumente für spätere Geschichtsbetrachtungen sein, bei denen trotz aller notwendigen Verallgemeinerungen auch der subjektive Erlebnischarakter bestimmter historischer Großvorgänge nicht völlig unterschlagen wird.
Die politbiographischen Voraussetzungen einer solchen Sehweise bildeten dabei – nach den Jugendjahren unterm Faschismus und der Studienzeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit – vor allem meine wechselnden Eindrücke in der frühen BRD, der DDR, den USA und dann der Berliner Republik. Diese Erfahrungen werden zwar weitgehend aus der Perspektive eines in viele Gebiete ausgreifenden Kulturhistorikers dargestellt, ohne jedoch dabei – trotz aller den Gesetzen der Arbeitsteilung unterliegenden Berufsbezogenheit – das größere Ganze aus dem Auge zu verlieren. So betrachtet, versteht sich dieses Buch als Dokument eines jener vielberufenen Zeitzeugen, dem zwar irgendwelche in den Gang der Geschichte „eingreifenden“ Möglichkeiten versagt geblieben sind, der sich aber trotz alledem bemühte, wenigstens durch seine Lehrtätigkeit, seine Vortragsreisen und seine Bücher einen Beitrag zur Erbschaft dieser Zeit zu leisten.
Madison/Berlin im März 2013 [<< 9][<< 10]
Unterm Faschismus (1942–1945)
1942
[<< 11 Seitenzahl der gedruckten Ausgabe][<< 12] Der erste Promi, dem ich die Hand gegeben habe, hieß Adolf Hitler. Wie es dazu kam, ist schnell erzählt. Nachdem mich im Winter 1941 auf 1942 die anderen Jungen im Hitlerjugend-Fähnlein „Totenwölfe“ blau und dämlich geschlagen hatten, wie man damals in Berlin sagte, flehte ich meine Mutter an, mich aus dieser Horde zu befreien. Und das gelang ihr auch. Drei Wochen später wurde ich dem Musikchor Steglitz zugeteilt und bekam eine Fanfare in die Hand gedrückt. Die anderen 40 Jungen wußten schon recht gut, wie man aus einem solchen Naturhorn, das keinerlei Ventile besaß, allein durch einen starken Atem bestimmte Tonfolgen hervorbringt – ich nicht. Wenn wir in Reih und Glied standen, täuschte ich demnach mit anschwellenden Backen lediglich vor, ebenfalls blasen zu können, hütete mich aber, irgendwelche Töne aus diesem „Ding“ herauszubringen. So weit, so gut. Ernst wurde es erst, als wir im Frühjahr 1942 zwei- oder dreimal mit unseren Fanfaren vor dem Anhalter Bahnhof aufmarschieren mußten, um bei irgendwelchen Staatsempfängen eine Art Ehrenkompanie zu bilden und den HohenfriedbergerMarsch zu blasen, was den anderen Jungen schon recht gut gelang, während ich weiterhin nur so tat, als wäre ich ebenfalls ein guter Fanfarenbläser.2
Einmal standen wir da, als am 24. März 1942 König Boris III. von Bulgarien dort ankam und von Hitler persönlich begrüßt wurde. Wir hatten uns schon drei Stunden zuvor die Beine in den Bauch gestanden – die Blonden wie immer im ersten Glied und die Dunkelhaarigen dahinter –, als der Zug endlich einlief und dann der Führer und König Boris auf uns zukamen, um jedem von uns lächelnden Gesichts die [<< 13] Hand zu drücken. Da ich zu den Blonden gehörte und in der ersten Reihe stand, sah ich, wie Hitler allmählich näher kam. Weil ich immer noch nicht blasen konnte, schwitzte ich Blut und Wasser, dieser Mann würde mich auffordern, aus dem Glied zu treten und ein Solo zu blasen. Doch er schüttelte mir nur die Hand und wandte sich dann den weiter rechts von mir stehenden Jungen zu. Als zwölfjähriger Junge konnte ich ja noch nicht wissen, daß Hitler bei einer solchen Zeremonie – angesichts der vielen Pressefotografen – nichts dem Zufall überlassen hätte. Schließlich war er ein genau kalkulierender Realpolitiker und kein spontan handelnder Gemütsmensch. Ich war daher heilfroh, als diese Zeremonie vorüber war – und die anderen Jungen sich bemühten, den Badenweiler, Hitlers Lieblingsmarsch, zu blasen, bevor er mit König Boris in eine der bereit stehenden Limousinen stieg.
1942
Bei uns zu Hause wurde selten oder nie über „die Nazis“ gesprochen. Ich entsinne mich nur an eine Szene, wo dieses Thema in höchst dramatischer Weise aufs Tapet kam. Es war im April 1942. Meine Eltern hatten meinen antifaschistisch eingestellten Biologielehrer sowie einen höheren Beamten aus dem NS-Landwirtschaftsministerium zum Abendessen eingeladen, den sie aus dem Verein der Kurhessen in Berlin kannten. Der Lehrer, ein moralisch äußerst integrer Mann, war höchst empört, weil er gehört hatte, daß man Abiturientinnen nahegelegt habe, sich ruhig mit Fronturlaubern „einzulassen“ und selbst eine Schwangerschaft in Kauf zu nehmen, da Deutschland so viele Kinder wie nur möglich brauche. Darauf konterte der auf die Rechtsstaatlichkeit des bestehenden Systems vertrauende Landwirtschaftsbeamte mit erregter Stimme: „Das kann unser Führer nicht gewollt haben. Das ist übelste Feindpropaganda. Für eine solche Äußerung gehören Sie ins Gefängnis!“ Doch meiner Mutter, die ein Faible für diesen Lehrer hatte, gelang es erst einmal, das Schlimmste zu verhüten. Am nächsten Abend kam der Landwirtschaftsbeamte wieder bei [<< 14] uns vorbei und erklärte stolz: „Ich habe mit meinem Ortsgruppenleiter gesprochen. Solche unmoralischen Anordnungen sind nie ausgegeben worden. Dieser Lehrer gehört wirklich ins Gefängnis.“ Aber meine Mutter vermochte erneut, diesen Mann zu beruhigen, so daß es nicht zu einer Anzeige kam.
1942
Meine Eltern waren beide Atheisten und hatten daher weder meinen älteren Bruder noch mich taufen lassen. Im Frühjahr 1942 bestand jedoch mein Bruder plötzlich darauf, sich wie die anderen Jungen in seiner Klasse protestantisch konfirmieren zu lassen. Und er setzte diesen Wunsch auch durch. Demzufolge gingen wir alle an dem betreffenden Sonntagmorgen in die Marienkirche nahe dem Rüdesheimer Platz in Berlin-Wilmersdorf. Auf Anforderung des dortigen Pfarrers hatte mein Bruder, wie alle anderen Konfirmanden, die Sommeruniform der Hitlerjugend an. Die Zeremonie vor dem Altar verlief recht „zackig“ und unterschied sich kaum von anderen NS-Veranstaltungen. Ja, am Schluß erklärte der Pfarrer sogar, daß die von ihm eingesegneten Jungen sicher in den bevorstehenden kriegerischen Auseinandersetzungen selbst den Tod nicht fürchten würden. Ich entsinne mich nicht, daß meine Eltern danach je wieder eine Kirche betreten hätten.
1942
Um die Schweinefütterung zu verbessern, verfügten die Berliner NS-Behörden im Sommer 1942, daß alle Lebensmittelreste nicht mehr in den allgemeinen Müll, sondern in gesonderte Tonnen kommen müßten. Zugleich bestimmten sie, daß der jeweilige Block- oder Zellenwart einen zwölf- bis vierzehnjährigen Jungen beauftragen solle, diese Tonnen zu einer besonderen Sammelstelle zu bringen. In dem Haus, in dem wir in der Bingerstraße in Berlin-Wilmersdorf wohnten, war ich der einzige Junge in dem entsprechenden Alter. Also [<< 15] befahl mir die dortige Blockwärterin, eine ältere Frau mit dem ominösen Namen „Krautwurst“, daß ich diese Aufgabe übernehmen müsse. Da von dieser Tonne ein ekliger Gestank ausging und die betreffende Sammelstelle relativ weit entfernt war, sagte ich naiv, wenn auch kurzentschlossen: „Nein, das tue ich für die Nazischweine nicht!“ Darauf begab sich diese Frau sofort zur NS-Ortsgruppe und bezichtigte meine jugendlich-attraktiv aussehende Mutter, auf die sie – aus altersbedingten Gründen – schon lange einen „Kieker“ hatte, mich gegen das Regime aufzuhetzen. Meine Mutter konnte jedoch den Ortsgruppenleiter von der „Kindlichkeit“ meiner Äußerung überzeugen. Und so verlief dieser Streit im Sande, zumal wir Jungen kurze Zeit später – wegen verstärkter Bombenangriffe auf Berlin – in ein sogenanntes Kinderlandverschickungslager abtransportiert wurden, das im Reichsland Warthegau lag.
1942
Noch heute erinnere ich mich an die Anfangszeilen von etwa dreißig Hitlerjugend-Liedern, welche uns ideologisch „aufmöbeln“ sollten und die wir zwischen 1942 und 1945 in zwei aufeinanderfolgenden Warthegau-Lagern tagaus, tagein zu singen oder genauer gesagt „herauszubrüllen“ hatten. Besonders eines dieser Lieder kommt mir dabei nicht aus dem Sinn. Fast jeden Morgen, wenn wir uns um 7 Uhr 30 in den jeweiligen Sommer- oder Winterdienstuniformen vor dem Flaggenmast aufstellen mußten und sahen, wie unser „Lamafü“ (Lagermannschaftsführer) die Hakenkreuzfahne aufzog, sangen wir das Lied „Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod“. Was wir uns als Zwölf- bis Fünfzehnjährige eigentlich dabei gedacht haben oder ob wir uns überhaupt bewußt waren, was wir da sangen, ist mir bis heute ein Rätsel. [<< 16]
1943
Einen der schrecklichsten Vorfälle, durch den wir Jungen aufs Grausamste mit der im damaligen Warthegau herrschenden Germanisierungspolitik konfrontiert wurden, erlebte ich im KLV-Lager Groß-Ottingen (heute Opoczki). Es muß im November oder Dezember 1943 gewesen sein. Jedenfalls war es schon reichlich kalt, als wir eines Nachmittags einen SS-Mann auf seinem Fahrrad von Standau (heute Straszewo) herüberkommen sahen. Wegen der wenigen Abwechslungen, die es in unserem öden Tagesablauf gab, liefen einige von uns hinter ihm her und sahen, wie er plötzlich anhielt und seinem ihn begleitenden Schäferhund den Befehl gab, eine hochschwangere Polin auf der Dorfstraße anzuspringen. Und das tat der Hund auch, wodurch die beleibte, schon etwas unbeholfene Frau auf den Rücken fiel und voller Angst den knurrenden Schäferhund anstarrte. Darauf stieg der SS-Mann von seinem Fahrrad ab und trampelte mit seinen Stiefeln so lange auf dem Bauch der Frau herum, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab.3
Was ich bei dieser Szene empfunden habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war es eine grausige Mischung aus Angst, Schrecken, Mitleid, Neugier und vielleicht sogar Lüsternheit, da dieser Frau beim Niederfallen der Rock nach oben gerutscht war und ihre nackten Beine zum Vorschein kamen. Warum all das geschah, fragten wir uns nicht. Wir wußten nur, daß diese Frau unverheiratet war, also eine „Sünde“ begangen hatte. Daß sie höchstwahrscheinlich zu jenen Polinnen gehörte, die sich nach den SS-Bestimmungen nicht mehr vermehren durften, war uns sicher noch unbekannt. Daher empfanden wir diese Szene nicht als etwas Politisches, sondern als etwas uns dumpf Bedrückendes, das wir schicksalshaft akzeptierten. Ich weiß nur, daß wir danach äußerst betreten ins Lager zurückliefen und über diesen Vorfall nie wieder geredet haben. Denn daß hier etwas Fürchterliches passiert war, war uns allen bewußt. Wir hatten jedoch als Dreizehnjährige noch nicht die Fähigkeit, das eben Erlebte in unser recht mangelhaft ausgebildetes Weltbild einzuordnen. [<< 17]
1944
Die einzige Freizeitbeschäftigung, die man uns während dieser Jahre in Groß-Ottingen erlaubte, war der Bau von Segelflugmodellen. Als wir 14 Jahre alt wurden und die NS-Jugendweihe hinter uns hatten, stiegen wir daher aus dem Jungvolk automatisch in die Flieger-HJ auf. Kurze Zeit später tauchten in unserem Lager zwei SS-Offiziere auf, die uns ausforderten, irgendwelche von ihnen mitgebrachten Formulare auszufüllen. Bei genauerem Zusehen erwiesen sich diese Papiere als Fragebögen, auf denen wir erklären sollten, in welcher Waffengattung wir später am liebsten dienen würden. Als Mitglied der Flieger-HJ machte ich mein Kreuzlein zwangsläufig hinter dem Wort „Luftwaffe“. Da mir jedoch – als einem schwächlichen und unsportlichen Kind – der Einsatz bei den Kampfflugzeugen zu waghalsig erschien, schrieb ich dahinter: „Als Sanitäter beim Bodenpersonal“. Ich weiß noch heute genau, wie sehr diese vier Worte die beiden SS-Offiziere belustigten. Doch nicht nur das – sie lasen meinen Eintrag sogar den anderen Jungen vor, worauf mich diese unbarmherzig hänselten.
1945
Obwohl uns gegen Ende Januar 1945 im KLV-Lager Sulmierschütz (heute Sulmirczice) ein NS-Fanatiker während des Abendessens versichert hatte, Deutschland werde durch den Einsatz der V III, einer sogenannten Wunderwaffe, doch noch den Krieg gewinnen, mußten wir am nächsten Morgen – aufgrund der anrückenden Roten Armee – das Lager Hals über Kopf räumen und uns durch Eis und Schnee nach Krotoschin durchschlagen, wo sich der letzte Flüchtlingszug befand, der alle in diesem Umkreis lebenden Deutschen „heim ins Reich“ bringen sollte. Wir erreichten diesen Zug mit Müh und Not und fuhren dann fast zwei Tage im Schneckentempo nach Berlin. Als wir dort gegen Mitternacht am Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, ankamen, standen auf dem Bahnsteig mehrere SS-Männer, die uns [<< 18] in ein neues HJ-Lager nach Vorpommern bringen sollten. Aber wir durchbrachen einfach die Sperre und rannten in die Nacht hinaus. Nach einem langen Fußmarsch quer durch Berlin erreichte ich endlich die Bingerstraße in Wilmersdorf. Doch das Haus, in dem meine Mutter gewohnt hatte, war inzwischen bei einem Bombenangriff total zerstört worden. Weil ich mich erinnerte, daß sie mit einer am Rüdesheimer Platz wohnenden Familie befreundet war, ging ich dorthin. Dieses Haus stand noch, und nachdem ich – es war gegen 2 Uhr früh – geklingelt hatte, öffnete sich nach einigen Minuten die Tür und eine Frau im Morgenrock blickte mich ausgehungerten und zerlumpten Jungen fassungslos an und fragte: „Wer bist denn du?“ Erst nachdem ich einige unzusammenhängende Worte gestammelt hatte, sagte sie: „Jost!“ und drückte mich an sich. Aber bevor wir weitersprechen konnten, ertönten plötzlich die Fliegeralarmsirenen, und wir gingen schleunigst in den Luftschutzkeller, wo sich meine Mutter, wenn wir eine niedersausende Bombe hörten, kurzentschlossen über mich warf. Reden konnten wir erst wieder, als wir eine halbe Stunde später die Entwarnungssirene hörten. [<< 19][<< 20]
Die Nachkriegszeit (1946–1949)
1947
[<< 21 Seitenzahl der gedruckten Ausgabe][<< 22] Nachdem ich seit Kriegsende ein Jahr lang auf einem Dorf in der Nähe Marburgs als Pferdeknecht gearbeitet hatte und am liebsten Bauer geworden wäre, holten mich meine Eltern nach Kassel, wo mein Vater eine neue Anstellung gefunden hatte. Dort hörte ich 1947 – noch nicht wissend, wer Goethe oder Beethoven waren – mein erstes Symphoniekonzert. Es handelte sich dabei um Hans Pfitzners nationalbetonte Kantate VondeutscherSeele nach Texten von Joseph von Eichendorff. Da ich noch nie eine derartige Musik gehört hatte, fand ich selbst ein solches relativ „dröges“ Werk höchst eindrucksvoll, zumal ich mir keine Gedanken machte, wer denn dieser „Pfitzner“ sei. Daß die Deutschheit dieses Werks durchaus politisch gemeint war, kam mir nicht in den Sinn. Eine Komposition dieser Art war für mich etwas „Klassisches“ – und damit eine nicht zu bezweifelnde Größe. Und es klärte mich auch niemand über den Trugschluß einer solchen Einstellung auf.
1947
Über die Nazivergangenheit sprach während dieser Jahre in meinem Umkreis fast niemand. Auch die von den Kulturoffizieren der US-amerikanischen Besatzungsstreitkräfte im Rahmen ihres Democratic Re-Education Program verkündeten Parolen verhallten weitgehend im Leeren. Was die meisten Menschen in einer zu 80 Prozent zerstörten Stadt wie Kassel beschäftigte, waren erst einmal rein existentielle Sorgen: ob nun neue Berufsmöglichkeiten, die Trümmerbeseitigung, die Lebensmittelknappheit, der Kohlenman [<< 23] gel, die Wohnraumnot oder der Erwerb jener Güter, die es nur auf dem Schwarzen Markt zu erstehen gab.
Selbst in den Schulstunden, die wir zwischen 1947 und 1949 als Sekundaner und Primaner absolvierten, hörten wir nichts von den Verbrechen der Nazizeit oder den ihnen vorangegangenen ideologischen Propagandamanövern. Die meisten Lehrer, die uns unterrichteten, hatten sich im Dritten Reich sicher systemkonform verhalten, waren aber als „Mitläufer“, da man sie nicht ersetzen konnte, nach 1945 sofort wieder eingestellt worden. Um sich nicht bloßzustellen, wichen sie daher von vornherein allen „heiklen Themen“ aus und hielten sich lieber an das Altbewährte. Im Deutschunterricht hörten wir nur von den Klassikern, im Fach Geschichte ging es lediglich bis Bismarck und im Musikunterricht wurden uns Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach als die zwei bedeutendsten deutschen Komponisten angepriesen. Und wir nahmen das alles als bare Münze hin – froh darüber, uns nach den kulturlosen Kriegs- und Nachkriegsjahren überhaupt „bilden“ zu können.
Daß zu diesem Zeitpunkt in Kassel eine reformwillige SPD am Ruder war, die alle wilhelminisch klingenden Straßen in Bebel-, Scheidemann-, Breitscheid-, ja sogar Marx- und Engelsstraßen umbenannte, blieb völlig außerhalb unseres Gesichtskreises. Wir gehörten zu jenen 4 oder 5 Prozent junger Menschen, die damals die Oberschulen besuchten, und kamen uns daher wie eine Clique von Außenseitern vor, die sich nur für die hohe Kunst interessierte, während wir für die politische oder sozioökonomische Realität überhaupt kein Auge hatten.
1949
Als wir Oberprimaner im August 1949 im Blauen Saal der Kasseler Stadthalle das relativ unbekannte Stück DesEpimenidesErwachen von Goethe aufführten, in dem sich ein weiser Philosoph während kriegerischer Auseinandersetzungen in eine Höhle zurückzieht und dort einen Heil [<< 24] schlaf hält, regte das keinen von uns zum Nachdenken über die jüngste Vergangenheit an.4 Wir sahen in dem weisen Epimenides und seinen Genien lediglich Gestalten, deren Verse, wie etwa „Allen Gewalten / Zum Trutz erhalten“, uns zwar etwas gestelzt, aber zugleich hochpoetisch vorkamen. Offenbar wurde dieses Drama damals auch von anderen Schülergruppen oder Theatern aufgeführt. Schließlich eignete es sich ausgezeichnet, die Zeit des Nazifaschismus als eine Ära dämonischer Wirren hinzustellen, in der alle „besseren Menschen“ in den Höhlen der Inneren Emigration lediglich darauf gewartet hätten, daß der Spuk des Terrors und des Krieges endlich aufhören würde. Jedenfalls werden das sicher die Gedanken unseres Regisseurs gewesen sein, der als Liberaler der Weimarer Republik, wie ich heute annehme, höchstwahrscheinlich kein aktiver Nazi gewesen war, sondern im Dritten Reich – analog zu Goethes Epimenides – in irgendeiner Nische des gesellschaftlichen Lebens überwintert hatte.
1949
Um der Kasseler Staatskapelle wieder ihren altbewährten Glanz zu verleihen, wurde 1948 als neuer Generaldirektor Karl Elmendorff berufen. Der von Hitler in die „Gottbegnadeten“-Liste aufgenommene Elmendorff war nach Karl Böhm seit 1942 bis zum Kriegsende Chefdirigent der Dresdner Staatsoper gewesen5 und hatte 1945 die Sowjetische Besatzungszone fluchtartig in Richtung Westen verlassen. Die von ihm dirigierten Kasseler Symphoniekonzerte waren von kaum zu überbietender Qualität. An eins erinnere ich mich noch sehr genau. Es war Mitte September 1949, als Elmendorff das dortige Konzertpublikum bat, sich zum Andenken an Richard Strauss, der am 8. desselben Monats verstorben war, für eine Minute schweigend zu erheben. Danach dirigierte er jene Metamorphosenfür23Solostreicher von Strauss, deren Hauptmotiv auf dem Trauermarsch im zweiten Satz von Beethovens Eroica beruht. Da niemand die genaueren Umstände der Entstehungszeit dieses Werks kannte, waren [<< 25] alle von der bedeutsamen Schönheit dieser Musik zutiefst beeindruckt. So auch ich, der ich noch lange Zeit gerade diese Metamorphosen nicht aus dem Ohr verlor. Erst später, als ich mehr über sie wußte, trat in diesem Fall eine gewisse Ernüchterung ein. Schließlich erfuhr ich, daß Strauss dieses Werk im April/Mai 1945 komponiert hatte, es also auch ein Trauermarsch auf den Untergang des Dritten Reichs sein konnte. Und plötzlich nahm ich an, daß vielleicht auch Elmendorff bei seinen Hörern die gleiche Assoziation hervorrufen wollte. [<< 26]
In Marburg und Ostberlin (1950–1957)
1951
[<< 27 Seitenzahl der gedruckten Ausgabe][<< 28] Im Herbst 1951 sahen wir Marburger Studenten am Schwarzen Brett der Neuen Universität einen Anschlag, der uns zu einem Vortrag über „Probleme der Lyrik“ eines uns unbekannten Autors namens Gottfried Benn einlud. Da wir fast alle selber Gedichte schrieben, wurden wir neugierig und setzten uns am 21. August bereits eine halbe Stunde vorher auf die Sitze in der ersten Reihe des Auditorium maximum. Und dann kam dieser Benn herein: untersetzt, etwas korpulent, mit einem kalten Lächeln auf den Lippen und einer geschäftsmäßigen Redeweise, die uns erst einmal abstieß, zumal er bereits zu Anfang erklärte, etwas „Rauhreif in unsere lyrischen Frühlingsnächte“ streuen zu wollen. Darauf nahm er sein Manuskript, hielt es sich vors Gesicht und murmelte etwas, von dem wir nur die Hälfte verstanden. Was wir hörten, waren lediglich besonders hervorgehobene Sprachfetzen wie „monologische Lyrik“, „an niemanden gerichtet“ oder „nur zu sich selbst gesprochen“.6 Da diese Haltung durchaus unserer eigenen Vereinzelung und ideologischen Orientierungslosigkeit entsprach, lasen wir anschließend einige seiner schmalen Gedichtbändchen, die damals unter Titeln wie Aprèslude oder Fragmente beim Wiesbadener Limes-Verlag erschienen. Was uns vor allem faszinierte, war die unsentimentale Kälte, sprachliche Schnoddrigkeit und zugleich artistische Raffinesse seiner Lyrik – nicht ahnend, was dieser Mann im Dritten Reich getrieben hatte oder daß er inzwischen ein Kalter Krieger in der „Frontstadt“ Westberlin geworden war. Politik war uns zu diesem Zeitraum völlig „Hekuba“. Wir schworen einzig und allein auf eine apolitische Ästhetik, auf das Beste vom Besten. Was scherte uns der Nazifaschismus oder der Kalte Krieg? Wir [<< 29] wollten wie Benn als weltverlorene Schöngeister in der „Mitte des Taifuns“ leben.
1952
Das einzige, was wir Marburger Germanistikstudenten in den frühen fünfziger Jahren als „politisch“ empfanden, war die Tatsache, daß die „Gewichsten“ aus den Verbindungshäusern der Teutonia und Germania fast jeden Sonntagmorgen vor der Elisabethkirche aufmarschierten, um dem Hohenzollernkönig Friedrich II. und dem preußischen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg ihren Respekt zu erweisen, deren Gebeine damals in einer der Seitenkapellen dieser Kirche untergebracht waren. Doch warum diese Studenten das taten und welche Traditionen dahinter standen, interessierte uns nicht. Wir fanden das lediglich „affig“, ohne uns weitere Gedanken über ein solches Verhalten zu machen.
1952
Wie stark die materiellen Voraussetzungen auch die politischen Anschauungen beeinflussen können, erlebte ich unter anderem am Beispiel meines Vaters. Vor 1933 hatte er sich in Kassel vorübergehend aus lokalpatriotischen Gründen dem Mahraunschen Jungdeutschen Orden angeschlossen. Den Nazis brachte er dagegen keine Sympathien entgegen, sondern zog sich in den dreißiger Jahren in eine Schwejk-Haltung zurück. Und das gab ihm eine gewisse Bonhomie. Er spielte in Berliner Bars jahrelang den Klavierunterhalter, tanzte gern, trank auch mal einen über den Durst, kurzum: war – trotz seines geringen Einkommens – auf eine liebenswürdige Weise umgänglich. Das änderte sich erst Anfang der fünfziger Jahre. Indem er plötzlich zum Direktor einer größeren Brauerei aufstieg, verwandelte er sich in einen typischen „Boß“, das heißt, er wurde nicht nur in seinen Umgangsformen, sondern auch in seinen Ansichten herrschaftsbetont. So sah er [<< 30] nach diesem Zeitpunkt in den Vertretern der SPD nur noch „Industriefeinde“, schwor auf den Wirtschaftswunderminister Ludwig Erhard und war froh, als die CDU/CSU 1957 bei den Wahlen zum Bundestag die absolute Mehrheit erhielt. Ja, später wurden Helmut Kohl und Ronald Reagan seine politischen Idole, in denen er die Garanten einer angeblichen Leistungsethik sah. Und er liebte es, sich dabei weiterhin auf Erhard zu berufen, der einmal gesagt habe, daß die Bundesrepublik keine Ideologie brauche, sondern die einzige Funktion dieses Staats darin bestehe, „dem Bereicherungsdrang des einzelnen so wenige Schranken wie nur möglich entgegenzustellen“.
1952
Als Martin Heidegger 1952 in Freiburg seine Venia legendi zurückerhielt, unterbrach der Marburger Neukantianer Julius Ebbinghaus mittendrin seine Vorlesung zur Philosophie des 18. Jahrhunderts und warf Heidegger vor, nicht erst in seiner bekannten Rektoratsrede von 1933 als „Nazi“ aufgetreten zu sein, wie noch heute vielfach behauptet wird, sondern bereits seit 1928 mit der NSDAP sympathisiert zu haben. Dies wisse er aus eigener Erfahrung, da er mit Heidegger in den frühen 20er Jahren einmal gut befreundet gewesen sei. Uns Studenten waren jedoch derartige Tiraden weitgehend fremd. Wir hatten noch nie von Heidegger gehört und wußten ebensowenig, daß Ebbinghaus ein bewährter Antifaschist war, den die Amerikaner – wegen seiner politisch „unbescholtenen“ Vergangenheit – im Herbst 1945 als ersten Nachkriegsrektor der Marburger Universität eingesetzt hatten. Uns interessierten lediglich die ins Subjektivistische drängenden Aspekte der Aufklärung und nicht irgendwelche Universitätsquerelen. Und so ließen wir diese Angelegenheit auf sich beruhen. [<< 31]
In Marburg gab es in diesen Jahren nur einmal ein Theaterstück zu sehen. Und das war Georg Büchners DantonsTod. Da es als wildes, expressionistisches Drama aufgeführt wurde, bei dem 20 im Publikum verteilte Komparsen die zum Theaterraum hergerichteten Stadtsäle in den französischen Nationalkonvent verwandelten, konnte ich mit dieser Form der Dramaturgie sowie der politischen Botschaft des Ganzen wenig anfangen. Jahre später fiel mir der Programmzettel dieser Aufführung in die Hände, und ich sah zu meinem Erstaunen, daß bei ihr kein Geringerer als Erwin Piscator die Regie geführt hatte, der in den fünfziger Jahren – als älterer, aus dem Exil zurückgekehrter „Linker“ – offenbar im Klima des Kalten Krieges in der frühen Bundesrepublik fast nur in Provinzstädten wie Marburg Theater machen durfte. Ein solcher Name sagte mir um 1953 noch gar nichts. Selbst wenn auf dem Programmzettel „Regie: Bertolt Brecht“ gestanden hätte, hätte mir das nichts bedeutet.
1953
Nach fünf Semestern an der Marburger Universität wollte ich mit idealistischem Elan endlich promovieren. Doch bei wem? Da es dort seit dem Tod von Werner Milch keinen germanistischen Ordinarius gab, wandte ich mich an den etwas salbungsvollen APL-Professor Johannes Klein, bei dem ich eine Vorlesung zum Thema „Rilke in seiner und unserer Zeit“ gehört hatte. Er ging sogar auf mein Ersuchen ein und fragte mich, über welches Thema ich denn meine Dissertation schreiben wolle. Als ich ihm sagte, daß ich am liebsten über die Rolle der mich an Gottfried Benns artistische Kälte erinnernden Musik Adrian Leverkühns in Thomas Manns DoktorFaustus promovieren würde, verfinsterte sich sein Gesicht, und er erwiderte: „Das können Sie bei mir nicht. Mit einem Ironiker wie Thomas Mann kann man nicht leben.“ Als ich ihm daraufhin zu erklären versuchte, daß für mich Literatur kein „Lebensersatz“ sei, wurde er noch abweisender und [<< 32] sagte: „Wenn überhaupt, könnten Sie bei mir nur über Stefan George promovieren. Aber dann müßten Sie sich allerdings dazu durchringen, an den von George im ‚Siebten Ring‘ zum Halbgott erhobenen Heilsbringer Maximin zu glauben.“7
Wenige Wochen nach diesem Gespräch schwang ich mich in den Sommerferien aufs Fahrrad und fuhr nach Göttingen, um dort mit naiver Unbekümmertheit den damals hochberühmten Neugermanisten Wolfgang Kayser aufzusuchen und ihn für mein Dissertationsthema zu gewinnen. Als ich ihm mein Anliegen vortrug, lächelte er zwar liebenswürdig, konnte sich aber mit einem solchen Thema ebensowenig anfreunden wie Johannes Klein. Für seine ablehnende Haltung gab er keinerlei Gründe an. Vielleicht sah er in Thomas Mann noch immer einen „Vaterlandsverräter“, wie ihn manche der systemkonformen BRD-Gazetten in den frühen fünfziger Jahren nannten. Kurzum: er riet mir, lieber in Marburg zu bleiben und mich mit meinen Wünschen an den gerade nach dort berufenen Neugermanisten Friedrich Sengle zu wenden. Doch auch der wollte von Thomas Mann nichts wissen und überredete mich, über „Die literarische Formenwelt des Biedermeiers“ zu promovieren – was ich dann auch notgedrungen tat. Allerdings durchschaute ich damals noch nicht, daß er seine Schüler mit solchen Themen bewußt von jedem Engagement für irgendwelche systemkritischen Tendenzen ablenken wollte.
1955
Im Sommer 1955 wurde in Kassel im immer noch halbwegs zerstörten Museum Fridericianum die 1. Documenta eröffnet. Viel ist mir davon nicht im Gedächtnis geblieben. Nur an den Einleitungsvortrag des damals weithin bekannten Kunsthistorikers Werner Haftmann erinnere ich mich noch relativ genau. Nach den erforderlichen Danksagungen wies er auf ein rechts von ihm hängendes Gemälde hin, das lediglich aus einem schwarzen Quadrat bestand, durch das ein grüner Strich verlief, und [<< 33] charakterisierte dieses Bild als Ausdruck jener „westlichen Freiheit“, die in ihrem individuellen Phantasiereichtum auf jede realistische Abbildlichkeit verzichten könne. Anschließend lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf ein zwar kubistisch-verzerrtes, aber immerhin noch klar erkennbares Frauenporträt von Pablo Picasso, das zu seiner Linken hing, und erklärte unmißverständlich, daß sich ein derartiger Realismus heute nur noch bei Kommunisten finde.8 Und niemand widersprach ihm.
Auch ich war damals noch nicht fähig, in dieser westlichen Moderne-Begeisterung eine hochideologisierte Proklamation jener Stimmung des Kalten Kriegs zu erkennen, die – im Gefolge der früheren CIA-Bemühungen – vor allem vom Kunstkreis im Bundesverband der westdeutschen Industrie sowie von der Gesellschaft für Abendländische Kunst des 20. Jahrhunderts lanciert wurde. Schließlich hatten derartige Organisationen als Standort für die Documenta eine Stadt wie Kassel vor allem darum gewählt, weil sie nahe an der „Zonengrenze“ lag und sich somit das Ganze als ein „lautloser Aufstand gegen den Sozialistischen Realismus“ ausgeben ließ. Und auch ich dachte – nach fünf Jahren einer angeblich unpolitischen Beschäftigung mit Kunst – im Sommer 1955 noch, daß die nichtgegenständliche Malerei ein Ausdruck westlicher Freiheit und die realistische Malerei eine dirigistisch gelenkte Manifestation totalitär ausgerichteter Regime sei, wie es Haftmann kurz zuvor in seinem Buch Malereiim20.Jahrhundert formuliert hatte.9
1955
An einem besonders heißen Tag im Juli 1955, als ich mit einem kurzärmeligen Hemd im Untergeschoß der Bibliothek der Ostberliner Alten Nationalgalerie saß, um für drei bis vier Wochen an einer Bibliographie für Richard Hamanns GeschichtederdeutschenMalereides19.Jahrhunderts zu arbeiten, kam plötzlich der alte Hamann, der damals als sogenannter Grenzgänger in Marburg und an [<< 34] der Humboldt-Universität unterrichtete, herein und bat mich, ihm wegen seiner klapprigen Beine die steile Treppe hinaufzuhelfen. Oben würden nämlich in einem Staatsakt eine Reihe „zurückgekehrter“ Bilder wieder feierlich ausgestellt. Als wir in den betreffenden Saal kamen, standen dort – zwischen sorgfältig gestutzten Lorbeerbäumchen – einige bedeutsam blickende Herren in schwarzen Anzügen herum. Ich wollte gleich wieder gehen, aber Hamann hielt mich am Ellbogen fest und stellte mich dem alten Ludwig Justi, dem in Westberlin wohnenden Generaldirektor der Ostberliner Nationalgalerie, vor. Und dann geschah etwas, was ich nicht erwartet hatte. Walter Ulbricht, der Erste Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, kam herein, ging sofort auf Justi zu, klappte die Hacken zusammen, machte einen kleinen Diener und sagte mit gedämpfter Stimme: „Guten Morgen, Herr Geheimrat.“
Heute weiß ich, wie ich diese Szene politisch einzuordnen habe, nämlich als Pflichtverbeugung vor den wenigen Größen des alten, antifaschistischen Bürgertums, ohne welche die frühe DDR in ihrem Versuch, sich als die legitime Erbin aller progressiv-humanistischen Traditionen der deutschen Kultur hinzustellen, nicht auszukommen glaubte. Doch damals fand ich eine solche Szene – ohne jeden Sinn für die hinter ihr stehende Symbolik – einfach grotesk. Darauf zwang mich Hamann, neben Ulbricht, Justi und ihm in der ersten Reihe Platz zu nehmen, was mir in meinem kurzärmeligen Hemd so peinlich war, daß ich froh war, als das Ganze zu Ende ging und ich wieder an meine Arbeit gehen konnte.
1956
Als ich 1955 gegen Ende des Sommersemesters das Rigorosum bestanden hatte, empfahl mir Friedrich Sengle, noch ein Semester dranzuhängen und das Staatsexamen zu machen, um mich für die höhere Bibliothekslaufbahn zu qualifizieren, da ich wegen meines Sprachfehlers für den Lehrberuf [<< 35] oder gar eine akademische Laufbahn nicht in Frage käme. Also fuhr ich im folgenden August nach Köln, wo es an der dortigen Universität ein Institut für Bibliothekswissenschaft gab, in dem die Referendare für die höhere Bibliothekslaufbahn ausgebildet wurden. Sengle hatte mich dem dortigen Direktor naiverweise zwar als einen besonders begabten Junggermanisten, aber zugleich als leicht neurotischen Typ vorgestellt, der wegen seines Sprachfehlers am besten in einer Bibliothek aufgehoben wäre, wo er wenig zu sprechen brauche. Als ich das Amtszimmer dieses Mannes betrat, hatte dieser gerade Sengles Gutachten in der Hand und sagte empört: „Was stellt sich denn Ihr Doktorvater eigentlich unter einer Universitätsbibliothek vor? Er preist Sie zwar als jungen Wissenschaftler über den grünen Klee und schreibt, daß Sie eine ‚außerordentliche Fähigkeit besäßen, große Stoffmassen zu durchdringen‘ und sich ‚daher sicher schnell auch in andere Fächer der Geisteswissenschaften einarbeiten könnten‘, betont aber dann, daß Sie wegen Ihres Sprachfehlers am besten in stillen, abgelegenen Büchermagazinen aufgehoben wären und ihren Oberen wegen Ihrer neurotisch-scheuen Veranlagung sicher ‚treu und hingebend dienen würden‘. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Wir brauchen auch im Bibliothekswesen Vollmenschen und keine seelischen Krüppel.“ Da ich diesem Argument nichts entgegenzusetzen vermochte, drückte er mir Sengles Gutachten in die Hand und warf mich nach zwei bis drei Minuten einfach hinaus. Damals [<< 36] sagte mir der Begriff „Vollmenschen“ noch nichts. Erst später wurde mir der nazifaschistische Bedeutungshintergrund dieses „Unworts“ bewußt, das – wie so viele dieser Wörter – in den fünfziger Jahren noch überall verwendet wurde.
1956
In einer Situation höchster Verwirrung, als ich trotz meines Sprachfehlers fürchtete, am Wetzlarer Gymnasium eine Stelle als Studienreferendar annehmen zu müssen, erhielt ich plötzlich am 4. März 1956 im Haus meiner Eltern in Kassel ein Telegramm, das [<< 37] mein gesamtes Leben ändern sollte. In ihm stand lediglich: „Bitte umgehend nach Marburg zurückkommen. Schreiben zusammen Bücher. Hamann.“ Ich nahm sofort den nächsten Zug und traf kurz nach 10 Uhr 30 bei Hamann ein. Er erklärte mir, daß er inzwischen in meiner Dissertation über die Literatur und Malerei der Biedermeierzeit geblättert habe.10 „Sprechen können Sie ja nicht“, sagte er, „aber schreiben können Sie gut.“ Darauf entwickelte er mir das Konzept einer fünfbändigen Deutschen Kulturgeschichte von der Gründerzeit bis zum Expressionismus, das ihm schon seit zehn Jahren vorschwebe. Den ersten Band zur Kunst der Gründerzeit habe er bereits zur Hälfte fertig, er sei aber zu alt, um an dem Ganzen weiterzuarbeiten. Und dann fragte er mich, ob ich Lust habe, ihm dabei zur Hand zu gehen. Ich sagte unverzüglich: „Ja.“ „Das habe ich mir gedacht“, erwiderte er, „deshalb habe ich bereits in Ostberlin für Sie und Ihre Frau telegraphisch die nötigen Aufenthaltsgenehmigungen und ein Zimmer mit Küchenbenutzung bestellt. Anders geht es nicht“, fügte er hinzu, „schließlich kann ich Sie nur in Ostgeld bezahlen. Von meiner Westpension leben hier in Marburg meine Frau und meine Tochter. Doch nach einigen Monaten wird Ihnen dann der Akademie-Verlag, bei dem diese Bände herauskommen werden, monatlich ein Fixum überweisen. Kommen Sie also in drei Tagen nach Marburg zurück, wo mich mein DDR-Chauffeur abholen wird, und wir fahren alle zusammen nach Ostberlin.“
1956
Im Herbst 1956 fand in Ostberlin eine Verkaufsausstellung einiger Porträts von Otto Dix statt, die dieser während seiner neusachlichen Periode in der Mitte der zwanziger Jahre gemalt hatte. Offenbar ließen sich diese Werke – angesichts des rasanten Siegeszugs der abstrakten oder nichtgegenständlichen Malerei im Westen – zu diesem Zeitpunkt in der BRD nur schwer absetzen. Die Preise waren lächerlich niedrig. So hätte ich etwa seine SilviavonHarden für 5.000 [<< 38] Westmark erstehen können. Doch ich tat es nicht. Zum einen hatte ich nicht das nötige Kleingeld, zum anderen schreckte mich – trotz aller malerischen Qualität – die groteske Häßlichkeit der dargestellten Frau ab. Solche Bilder, dachte ich schon damals, gehören als historische Zeugnisse in ein Museum und nicht in Privatbesitz. Und ich bereute diese Entscheidung auch später nicht. Heute hängt dieses Bild – als eines der Zentralbilder der deutschen Abteilung – im Musée Pompidou in Paris. Dort hat man später beim Ankauf dieses Gemäldes sicher das Tausendfache dafür ausgeben müssen.
1956
Einer seiner jüngeren Kollegen an der Humboldt-Universität, den der alte Hamann besonders schätzte, war der Philosoph Wolfgang Heise. Als ich daher mit der Niederschrift des mich politisch aufwühlenden Naturalismus-Bandes gegen Ende des Jahres 1956 fertig war, bat er ihn, das Gesamtmanuskript durchzulesen und es darauf mit mir zu besprechen. Das tat Heise auch umgehend und lud mich anschließend zu einer Aussprache in sein Haus im Hessenwinkel in Ostberlin ein. Nach einem zweistündigen Gespräch, bei dem es vor allem um das Verhältnis der Naturalisten zur SPD während der achtziger und neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts ging, lockerte sich die Stimmung etwas auf, und es stellte sich fast – trotz des Altersunterschieds – so etwas wie eine vertrauensvolle Kameraderie ein. Das ermutigte mich sogar zu der Frage, warum er denn vor einem seiner Bücherregale einen Vorhang habe, vor den anderen aber nicht. „Ja“, sagte Heise, „dahinter steht der gesamte Expressionismus. Das müssen manche meiner Genossen nicht unbedingt sehen. Wenn Sie mit dieser Reihe einmal bis zum Expressionismus vorstoßen sollten, werden Sie selbst sehen, warum.“11[<< 39]
Als ich das erste Mal Helene Weigel außerhalb ihrer Bühnenauftritte sah, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Es war im Frühjahr 1957. Ich hatte die Erlaubnis bekommen, an einer Probe zu DerguteMenschvonSezuan