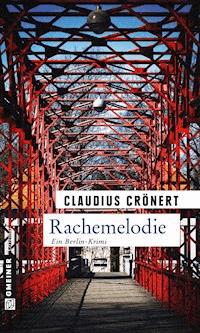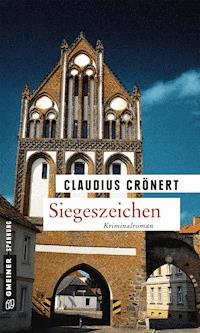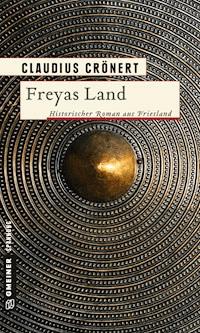
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Herzog Radbod
- Sprache: Deutsch
715 n.Chr.: Die friesischen Stämme rüsten zum Feldzug gegen die christlichen Franken, um ihre Handelsstadt Dorestad von deren Besatzung zu befreien. Auf einem Festbankett verlangt einer der friesischen Fürsten von Herzog Radbod, er möge ihm seine Tochter zur Frau geben. Das Mädchen ist aber erst 15 Jahre alt und der Herzog will sich um keinen Preis von ihr trennen. Es droht ein Streit zur Unzeit, denn nur wenn die Friesen zusammenhalten, haben sie eine Chance gegen den übermächtigen Gegner. Und Radbod hat viele Gefahren auf sich genommen, um die Stämme seines Landes zu einen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudius Crönert
Freyas Land
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von:
© Henrik Winther Ander – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4570-5
Vorwort
Radbod ist derbekannteste Herzog des frühmittelalterlichen friesischen Reiches. Er lebte – nach christlicher Zeitrechnung – von 675 (oder 678) bis 719. In manchen Sagen wird er sogar als König bezeichnet. Insgesamt befinden wir uns in einer Zeit, aus der es nur spärliche Überlieferungen gibt. Die Friesen haben ihre Geschichte erzählt, nicht aufgeschrieben; sie kannten keine Schrift in unserem Sinne. Wahrscheinlich wäre ihnen die Vorstellung, der Nachwelt Berichte zu hinterlassen, seltsam vorgekommen, weil sie ihre Toten – und die noch nicht Geborenen – um sich glaubten. Die wenigen Daten, die es gibt, stammen aus christlicher Überlieferung und sind entsprechend gefärbt. Radbod wird meistens als Wilder dargestellt.
Der fränkische Hausmeier Pippin der Mittlere starb Ende des Jahres 714. Pippin war ein fähiger Politiker, geschickt darin, entscheidende Posten in beiden Teilen des fränkischen Reiches mit Vertrauten zu besetzen. Zum Höhepunkt seines Einflusses war er der mächtigste Mann im Reich, klug genug, einen schwachen König über sich zu dulden. Doch am Ende gelang es ihm nicht, einen Nachfolger zu bestimmen und geordnete Verhältnisse zu übergeben. Nach seinen Tod brachen Kämpfe aus. In dieser Zeit spielt der Roman, im Jahr 715, als sich die Nachricht vom Tod Pippins herumgesprochen hat.
Teil 1
1. Kapitel
Von der See blies ein kräftiger Wind herüber, als der Zug der Kämpfer aus dem Norden endlich eintraf. Am Waldrand bogen sich Birkenstämme, Tannenzweige schlugen wie die Flügel einer Ente auf und nieder. Ein Heulen fuhr durch die Luft, ein Göttergruß. Das war ein gutes Zeichen. Forsete, der Gott des Windes, unterstützte sie.
Herzog Radbod hatte mit ein paar Getreuen und mit seinen Söhnen auf einer Anhöhe Posten bezogen, er stand in hohem Gras und hielt seinen Schwertknauf umschlossen. Die Krieger, die unter ihm vorbeizogen, stellten zusammen mit denen, die bereits auf den Wiesen am Herrenhaus lagerten, das größte friesische Heer seit Menschengedenken dar. Verwegen sahen die Männer aus, ihre Bärte waren wild, die Haare filzig, sie hatten Narben am ganzen Körper, ihnen fehlten Zähne, Augen, Finger, Hände. Oh ja, sie verbreiteten Angst. Aber ein fränkischer Hauptmann würde auf einen Blick erkennen, wie schlecht gerüstet sie waren.
Zu Pferd waren nur die Fürsten und Truppenführer, sie allein hatten Langschwerter und trugen Schilde, die nicht beim ersten Stoß gleich zerbrachen. Die anderen gingen zu Fuß, viele ohne Schuhe, oder sie hockten auf Ochsenkarren. Ihre Bewaffnung bestand aus Wurfgeschossen, aus Steinen, manche hatten rostige Kurzschwerter. Da sie alle nach friesischer Tradition mit nacktem Oberkörper in die Schlacht ziehen würden, hatte keiner von ihnen ein gepanzertes Hemd und nicht einmal ein Lederwams.
Radbod hielt sich nicht lange mit der Frage auf, ob dieses Heer dem übermächtigen Nachbarn zusetzen konnte und ob es gelang, die Franken endgültig aus dem Friesenland zu vertreiben. Man musste es darauf ankommen lassen, und er war bereit dazu, seit vielen Jahren schon. Nun, endlich, waren es die friesischen Stämme auch. An einem Donnerstag, dem Tag des Kriegsgottes Thor, hatte er Boten in ihre Gebiete ausgesandt und die Fürsten aufgefordert, jeden waffenfähigen Mann zu schicken.
Diesmal, endlich, waren sie seiner Order nachgekommen.
Die Streitigkeiten im Frankenland hatten nach Pippins Tod überhand genommen. Es ging um die Macht im Ostreich, die mehrere Männer für sich beanspruchten, und keiner von ihnen kannte Gnade mit dem Gegner. Sie mordeten, verjagten, verbannten. Schlitzten schlafenden Knaben die Kehle auf, setzten Stiefsöhne in Gefangenschaft und eigene Kinder als Nachfahren ein. Auf diese Weise schwächte sich das Riesenreich selbst. Zusätzlich waren die Franken in Scharmützel an ihren südlichen und westlichen Grenzen verwickelt, und nur ein Rest von ihnen stand noch in Friesland. Es war also eine günstige Zeit, um sie anzugreifen und auf alle Zeit zu verjagen aus dem Land an jenem Meer, das die Römer bereits voller Respekt Mare Frisicum, das Friesische, genannt hatten.
Wie ein Hund, der Witterung aufgenommen hatte, hob Radbod den Kopf in den Wind. Sein langes Haar begann zu flattern. Er ließ den Blick schweifen. Nirgendwo war der Himmel so weit wie hier, die Erde so fruchtbar, die Luft ähnlich würzig. Friesland war es wert, sein Leben zu lassen.
Über das Ansinnen der vielen Krieger, die nach wie vor an ihm vorbeizogen, brauchte man sich keine Illusionen zu machen, für die zählte Patriotismus nicht viel, sie waren gekommen, weil man nur auf einem Feldzug in kurzer Zeit reich werden konnte, da ließen sich in einem einzigen Sommer mehr Waffen und Pferde, mehr Schmuck und Hausrat erbeuten, als man in einem ganzen friedlichen Leben erarbeiten konnte. Radbod war egal, was die Männer trieb, sollten sie mit Schätzen nach Hause gehen, ihre Frauen beglücken und sich von ihnen belohnen lassen. Die Hauptsache war, dass sie gut kämpften.
Wachleute geleiteten den Zug zu den Lagerplätzen am Herrenhaus. Jeder der Männer trug einen Ledersack bei sich und hatte darin Verpflegung für mehrere Wochen – so war es angeordnet. Die Säcke ließen sie nicht aus der Hand, weder bei der Begrüßung mit denen, die vor ihnen eingetroffen waren, noch beim Aufschlagen der Zelte. Mancher machte sich nicht so viel Mühe, sondern suchte sich gleich einen Schlafplatz unter einem Baum. Warm genug war es allemal.
Bald loderten neue Feuer auf, und die Männer packten Brot und harten Käse, Zwiebeln und Würste aus und aßen und tranken Bier. Zwei oder drei Tage, so war Radbods Plan, sollten sich Mensch und Tier in Stavoren ausruhen, bevor es weiterging. Er selbst wollte in dieser Zeit mit den Anführern das Vorgehen besprechen. Zwar hatte in Kriegsfragen niemand anders als er das Sagen, doch um der Einigkeit willen würde er ihnen das Gefühl geben, mitreden zu dürfen.
Bevor es aber ins Gespräch ging, erwarteten die fremden Fürsten und ihre Edlen, anständig bewirtet zu werden. Er, der sich aus Essen noch nie viel gemacht hatte, verabscheute die Völlerei und den Suff, zumal er dafür aufzukommen hatte, was die Gäste umso ungehemmter zuschlagen ließ. Dagegen war nichts machen. Er hatte in der Halle des Herrenhauses einen langen Tisch decken lassen. Am Essen arbeiteten sie in der Küche seit drei Tagen. Das Dienstpersonal hatte eine Menge Kerzen verteilt, und an den Wänden hingen Fackeln in Eisenringen. Als der Abend anbrach und das Feuer die Halle erleuchtete, stellte er sich mit seiner Familie an den Eingang.
Der Erste, der eintrat, war Hayo, ausgerechnet Hayo, das Eulengesicht, der Fürst aus dem Ostergouw. Der schmale Mann hatte sich fein gemacht, trug einen neuen Umhang mit goldener Fibel, und die Haare waren gekämmt. Radbod verachtete ihn. Hayo war sein Nachbar, aber ein Mäkler und Stänkerer, der sich immer gegen ihn gestellt hatte, aus Prinzip, wie Radbod meinte. Nach ihm kam Diemo, der neue Fürst aus Groningen, sein Schwager, auch er ein Gegner. Radbod würde aufpassen müssen, wer auf dem Feldzug hinter ihm ritt. Es folgten die drei Emsgaer Anführer, einfache Bauern eines Stammes, der keinen Fürsten hatte. Sie hatten sich mit Wasser die Haare und Bärte geglättet, um einen guten Eindruck zu machen. Ihnen allen und ihrem Gefolge gab Radbod die Hand, ohne Überschwang, aber er sah ihnen in die Augen und sagte ein paar Worte, sodass sie sich persönlich angesprochen fühlen durften.
Als Letztes erschien Reemer, der Fürst der Hriustrer. Sein Stamm war der wildeste in Friesland. Gerüchte besagten, dass Schiffe der Hriustrer bis ans Ende der Welt segelten, wo es angeblich wieder Land gab. Reemer selbst sah, alleine schon wegen der Narbe auf seiner Wange, wie ein echter Krieger aus, furchtlos und kampfbereit. Er war ein älterer Mann, sein Bart war weiß, aber er hatte muskulöse Arme und ein breites Kreuz. Seine Augen waren winzig, fast wie die einer Maus. Er hatte Radbods Größe, einen kräftigen Händedruck und wartete nicht auf die Worte des Gastgebers, sondern redete selbst.
»Nun, Herzog, wie es aussieht, werden die Friesen in den Krieg ziehen.«
»Wir beanspruchen unser Land für uns, mehr nicht. Das werden wir den Franken zeigen.«
»Wenn es gut geht«, erwiderte Reemer, »sollten wir einen Abstecher in ihr christliches Land machen. Meine Männer brennen darauf. Es heißt, das Frankenland sei reich.«
Radbod neigte den Kopf, ohne ihm aber zuzustimmen. Vor dem zweiten musste der erste Schritt gesetzt werden, und nur wenn der gelang, konnte man über weitere nachdenken. Reemer nickte ihm zu und setzte sich mit seinen Leuten an den Tisch, der sich unter dem Gewicht der Schüsseln und Platten bereits bog, unter den Mengen von Dorsch und Makrele, Flunder und Rotbarsch, von Wildbraten und gekochtem Getreide und den vielen Krügen voller Bier. Reemers Platz war am schmalen Ende, von Radbod aus gesehen auf der anderen Seite der Halle.
Radbod überblickte die Tafel. Die Stämme saßen bei einander. Kein Mann, der nicht schon einen Krug Bier vor sich hatte. Die Stimmen waren noch gedämpft, aber das würde sich bald ändern. Essensdüfte füllten die Luft, wobei der von Fisch alle anderen übertönte. Die Tafel war eines Herzogs würdig, und am Ende passte sie auch zum Anlass. Keiner der Männer wusste schließlich, ob er lebend zurückkehren würde.
Es gab nur zwei Frauen am Tisch. Eine von ihnen war die Herzogin, seine Gemahlin. Sie sah blass aus und war in sich gekehrt. Er rechnete ihr an, dass sie sich schön gemacht hatte, sie trug ein langes Kleid in einem kräftigen Ton, das zu ihrem grauen Haar passte. Und sie hatte die Aufsicht über das Festessen an sich genommen. Dass der Tisch bereitet war, hatte er ihr zu danken.
Die andere Frau war Eila, seine Tochter, 13-jährig, fast noch ein Mädchen. Bei Eila blieb sein Blick hängen, sein Schritt wurde langsamer. Sie saß neben ihrem Halbbruder Poppo, der ihr etwas ins Ohr geflüstert hatte, und sie lachte auf. Ihr Gesicht war wie das Strahlen der Sonne. Nach seiner Überzeugung war das Mädchen ein Göttergeschenk, ein Wesen aus einer anderen Welt, eine Lichtelfe, die sich zu ihnen verirrt hatte. Sie hatte weder mit ihm noch mit ihrer Mutter viel Ähnlichkeit. Auf ihre eigene Weise war Eila schön, und den Männern am Tisch war sie bereits aufgefallen, sie glotzten und stierten, und wer das Glück hatte, in ihrer Nähe zu sitzen, bemühte sich darum, ihr aufzufallen und das Wort an sie zu richten. Radbod passte das überhaupt nicht, aber er konnte Eila schlecht fortschicken, deshalb tröstete er sich damit, dass Poppo auf sie aufpassen würde wie ein Wachhund.
Als er sich setzte und sich auftat, gab Radbod das Signal, dass sich die Männer bedienen durften. Er nahm wenig, im Gegensatz zu den anderen, die nach den Fischen packten und den Wildkeulen, die mit den Händen, als wären es Schaufeln, in die Getreideschüsseln griffen und sich hinterher die Finger ableckten. Auch seine Söhne Alfbad und Onno langten ordentlich zu.
Mit dem Bier, das Sklaven immer wieder nachzufüllen hatten, begannen bald die Geschichten. Zu Radbod drangen nur Fetzen davon, denn die Männer redeten alle gleichzeitig und lachten und rülpsten dazu, ihre tiefen Stimmen vermischten sich zu einem einzigen Gebrumme. Er hörte von sächsischen Einheiten, die von Groningern in den Hinterhalt gelockt, überfallen und getötet worden waren, und von Fahrten auf die offene See, an Forsetesland und Britannien vorbei, immer weiter, immer weiter, gegen Wind und Wellen, höher als das Herrenhaus von Stavoren. Auch Anekdoten über die Missionare bekam er zugetragen. Wie diese Geschichten erzählt wurden, waren die Christen dumm und schwerfällig und leicht zu narren. Manches davon konnte nicht stimmen, sonst stünde es besser um Friesland. Sein Blick traf den von Tade, der sein engster Berater war, und als der andere nickte, wusste er, dass er den gleichen Gedanken gehabt hatte.
Radbod korrigierte niemanden, er mischte sich nicht ein. Er hatte sich fest vorgenommen, ein höflicher Gastgeber zu sein, und daran hielt er sich, hörte zu, fragte nach und redete nur dann, wenn Gesprächspausen zu lang zu werden drohten.
Bald wurde es lauter in der Halle. So, wie das Bier floss, beschränkte man sich nicht mehr auf Unterhaltungen mit den Nebenleuten, sondern man rief quer über den Tisch und prostete einander zu. Auch die Götter wurden immer lauter angerufen, und die hohe Decke, die all die Stimmen wiedergab, trug ihren Teil zur Lautstärke bei.
Radbod verlegte sich aufs Beobachten. Hayo, der Ostergouwer, untersuchte mit dem Messer die Fische, die er sich auf den Teller geladen hatte, er schnitt sie in kleinste Stücke, war gründlich, zog immer wieder Gräten heraus. Selbst nach seiner Vorarbeit biss er noch wie ein Vöglein zu und kaute die Stückchen gründlich. Es war alles andere als ein Vergnügen, ihm zuzusehen.
Am ruhigsten war es auf der Seite der Groninger. Auch sie hatten volle Teller und Becher, hielten sich aber, von Ausnahmen abgesehen, im Gespräch zurück, als gehörten sie nicht dazu. Was zwischen ihnen und dem Herzog stand, war nicht mehr zu überbrücken. Sicherlich waren sie nicht gekommen, weil Radbod sie gerufen hatte, sondern weil sie eingesehen hatten, dass sie in einer Lage wie dieser nicht außen stehen konnten, wollten sie ihren Stamm nicht in die Bedeutungslosigkeit führen. Diemo, ihr junger Fürst, ignorierte Radbod nach Möglichkeit.
Die Emsgaer Bauern hingegen hatten ihre Scheu abgelegt. Mit jedem Becher Bier waren ihre Köpfe roter geworden, sie genossen eine Festmahlzeit, für die sie nicht hatten arbeiten müssen. Wie weit ihre Leute Erfahrung im Kampf hatten, konnte Radbod nicht einschätzen. Im Schildwall würden sie schon mitziehen.
Reemer, der Hriustrer, hatte die Ärmel aufgekrempelt, als gelte es, schwere Feldarbeit zu verrichten. Er schaufelte. Griff lieber zu Fleisch als zu Fisch, schwenkte Keulen in der Luft, um seine Rede zu untermalen, lachte lauter als alle anderen und nahm Bier in sich auf wie ein Regenfass nach langer Trockenheit. Radbod war sich darüber klar, dass er sich auf diesen Mann am ehesten verlassen konnte. Allerdings waren die Hriustrer noch schlechter bewaffnet als die Krieger der anderen Stämme.
Als Reemer sich von seinem Platz erhob – dabei leicht schwankte und die Hand brauchte, mit der er sich auf der Schulter eines Nachbarn stützen musste –, dachte Radbod, er werde nach draußen gehen, um sich zu erleichtern. Doch der Hriustrer schlug einen anderen Weg ein, er hielt auf die Mitte der Tafel zu. Dort blieb er stehen und schaute hinüber zu Eila, die auf der anderen Seite des Tisches saß. Er musterte sie regelrecht. Das Mädchen spürte den Blick, erwiderte ihn erst, wich ihm dann aber aus und beschäftigte sich mit ihrem Essen.
Radbod gefiel das nicht. Seine Tochter war kein Ding, das man anglotzen durfte.
Bevor ihm einfiel, auf welche Weise er den Hriustrer zur Ordnung rufen konnte, hatte Reemer bereits kehrt gemacht. Schwerfällig setzte er seine Schritte, es war offensichtlich, dass er darauf achten musste, Kurs zu halten. Zu Radbods Überraschung ging der Hriustrer an seinem Platz vorbei weiter um die Tafel herum. Die Stimmen am Tisch waren unverändert laut, die Reden, Lachen und Rufe füllten die Luft. Reemer setzte seinen Weg unbeirrt fort. Wie alle anderen hatte er seine Waffen abgelegt und trug nur ein Messer. Ein breiter Gürtel hielt seinen Kittel. Sein blondes und gleichzeitig graues Haar reichte ihm bis an die Schulter. Er war ein Kerl, musste Radbod einräumen, trotz seines Alters. Ein Baum.
Hinter Eila blieb er stehen und tippte ihr mit den Fingerspitzen auf die Schulter. »Du, steh einmal auf.«
Das war der Satz, der die Aufmerksamkeit am Tisch weckte. Poppo war der Erste, der sich umdrehte, noch vor seiner Schwester, und auf seinen Lippen hatte er eine Frage. Bevor er sie noch gestellt hatte, erhob sich Eila. Grazie – Damenhaftigkeit – lag nicht in ihrer Bewegung, die war eher burschikos. Doch sie besaß dieses Strahlen. Das Licht, das immer brannte.
»Wie heißt du?«, fragte der Hriustrer.
»Eila.«
»Des Herzogs Tochter?«
»Ja.«
Reemer verstummte, ließ aber die kleinen Augen nicht von ihr. Inzwischen interessierten sich fast alle Männer für das Schauspiel, sie wollten wissen, was der Hriustrer-Fürst vorhatte, und wahrscheinlich auch, wie weit Radbod zuließ, dass jemand auf Kosten seiner Kinder Scherze machte. Poppo hatte seine Beine über die Bank geschlagen. Er war bereit, einzugreifen, sobald es einen Anlass dafür gab.
»Du gefällst mir, Eila.«
Sie lachte.
Das war ein Lachen, das rein und unschuldig klang, auch stolz. Eine gute Antwort des 13-jährigen Mädchens für den fremden Mann. Beide boten ein seltsames Bild. Sie war wesentlich kleiner als der Hüne ihr gegenüber, viel gepflegter als der wilde Mann und deutlich jünger. Zwar hatte ihr Körper weibliche Formen ausgebildet, sie war bereits eine Frau. Der Mann vor ihr aber war älter als ihr Vater.
»Ich bin im vergangenen Sommer Witwer geworden und werde den Herzog bitten, dich mir zur Frau zu geben. Du gefällst mir wirklich, Eila.«
Die Worte trafen Radbod wie ein Schwertstreich. Ohne Ton rief er ihr zu, den Fremden abzuweisen, sofort und eindeutig. Sie aber war rot geworden und wendete sich ab. Poppo hielt ihr den Arm, damit sie sich leichter hinsetzen konnte. Beide wandten sich der Tischmitte zu, sodass sie Reemer den Rücken zeigten. Eila flüsterte ihrem Bruder etwas ins Ohr.
Der Hriustrier zog weiter. Er kam auf Radbod zu.
Es war eindeutig – er kam auf ihn zu.
Jedem einzelnen seiner Schritte sah man das Bier an, das er im Bauch hatte. Er wankte, während sein Auftritt den ganzen Saal bannte. Es war still. Allein Radbod hatte angefangen, mit seinem Bruder Finn zu sprechen, denn er wollte dem Fremden nicht die Bühne überlassen, und als Reemer hinter ihm stand, tat er so, als habe er ihn nicht bemerkt.
»Hast du gehört, was ich zu deiner Tochter gesagt habe, Herzog?«
Radbod hatte seine Hand um einen Bierkrug geschlungen und hielt sein Ohr in Finns Richtung, als müsste er sich Mühe geben, um des Bruders Antwort verstehen zu können. Inzwischen wartete alle Welt darauf, was er dem Hriustrer erwidern würde. Er spürte die vielen Blicke auf sich, während er sich an der kindlichen Hoffnung festhielt, Reemer würde weiterziehen, wenn er ihm keine Beachtung schenkte.
»Herzog?«, wiederholte der Hriustrer und legte Radbod seine Pranke auf die Schulter.
Radbod blieb nichts übrig, als sich umzudrehen. »Was sagst du?«
»Ob du gehört hast, was ich zu deiner Tochter gesagt habe?«
»Zu meiner Tochter?« Radbod schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Dann wiederhole ich es.«
Bevor Reemer in seinem schweren Kopf die Worte angeordnet hatte, stand Radbod auf. Er fischte sich einen zweiten Becher vom Tisch, den er seinem Gegenüber reichte. »Lass uns auf unseren Feldzug trinken, Hriustrer. Auf unseren Sieg.«
Er hielt seinen Becher in die Höhe. Reemer stieß mit dem anderen dagegen. Dann tranken sie. Tranken ausgiebig. Beiden tropfte Bier aus dem Bart.
»Na, siehst du«, erklärte Radbod, nachdem er gerülpst hatte. Er war dabei, sich wieder zu setzen.
»Herzog.«
Radbod blieb stehen.
»Ich möchte dich bitten, mir …«
»Reemer«, fiel Radbod ihm ins Wort, »wir ziehen in den Krieg. Gegen die Franken und gegen dieses Christenpack. Es geht um unsere Freiheit. Nichts anderes zählt.«
Er stieß erneut mit seinem Becher gegen den des Gastes.
»Trotzdem ist es mir erlaubt, an die Zukunft zu denken. Ich bitte dich, mir deine Tochter zur Frau zu geben. Nenne mir den Brautpreis.«
Der Saal hielt den Atem an, zumindest jener Teil der Gäste tat das, denen klar war, wie sehr der Herzog an Eila hing, die, all die, die wussten, dass seine Tochter die Freude seines Lebens war. Dabei war es ihm nicht unmöglich, sie herzugeben. Nur eintauschen gegen irgendeinen Vorteil würde er sie nicht.
Er lachte. Lachte als Einziger in der Halle.
»Wenn das Bier einem den Verstand vernebelt, sagt man Dinge, die man am nächsten Tag lieber nicht gesagt hätte.«
Auch von diesen Worten ließ sich Reemer nicht abschütteln. Er hielt seine Mäuseaugen auf Radbod, der ihm in diesem Moment am liebsten den Rest seines Biers ins Gesicht gekippt hätte.
»Ich meine, was ich sage.«
»Du bist 50 oder noch älter, was weiß ich. Eila dagegen ist jung.«
»Bei mir ist noch alles tüchtig, das kannst du mir glauben. Gib sie mir, und innerhalb eines Jahres mache ich dich zum Großvater.«
Radbod fehlten die Worte. Sein Vorhaben, den Gästen gegenüber höflich zu sein, hatte er vergessen. Mit einem Kopfschütteln setzte er sich wieder hin und ließ den Hriustrer stehen wie einen abgewiesenen Bittsteller. Im Saal war es unverändert still, bestenfalls rülpste hier und da ein Mann oder stieß sein Messer in das Holz. Der Tisch war wie ein Schlachtfeld, überall Knochen, Fischreste, Bierseen. Immerhin hatte sich, im Saal zumindest, noch keiner übergeben. Sie warteten. Viele grinsten, und als er es sah, wurde Radbod wütend. Was für die Leute am Tisch ein Schauspiel war – eine Einlage zu ihrer Unterhaltung –, war in Wahrheit bitterer Ernst.
Nach wie vor spürte Radbod den Hriustrer in seinem Rücken, während er sich, als wäre der kurze Austausch zu Ende, seinem Essen zuwandte. Warum ließ Reemer nicht ab? Mit jedem Moment verschlimmerte er die Situation, machte sie zu einem Kampf um die Ehre, und das zwischen zwei Männern, die einander noch brauchen würden, wollten sie doch gemeinsam in den Kampf ziehen.
War dem Hriustrer denn nicht klar, wie brüchig die Einigkeit der Friesen war?
Radbod war kurz davor, ihm das deutlich zu machen, hoffte aber noch, dass sich die Situation von alleine löste, während er in seinem kalten Essen stocherte und von seinem Bier trank. Immer noch war Stille im Saal. Alle Blicke richteten sich auf ihn.
Reemer verschwand nicht. Radbod hörte schweren Atem in seinem Rücken, ein Schnaufen, als habe der andere eine große Anstrengung hinter sich. Eila drückte Poppos Hand und hatte sich an dessen Arm gelehnt, als könnte ihr Bruder ihr Schutz gegen jede Unbill des Lebens bieten. Kein Zweifel, dass das Mädchen im heiratsfähigen Alter war, und es wunderte ihn nicht, dass sie dem Hriustrer gefiel. Wäre Radbod nicht ihr Vater gewesen – hätte er sie nicht vom ersten Tag ihres Lebens gekannt –, sie hätte auch ihm gefallen. Jedem Mann musste ein so strahlendes Wesen ins Auge stechen.
Der Hriustrer schien immer noch nicht begriffen zu haben, dass seine Demütigung immer schlimmer wurde, je länger er auf seinem Platz stehen blieb. Er roch nach Schweiß und Bier und sonderte seltsame Geräusche ab, ein Ächzen und Schnarchen, als schlafe er bereits.
Doch das war nicht der Fall.
»Herzog«, sagte er und zwang Radbod, sich ihm erneut zuzuwenden.
Radbod kam ein zweites Mal auf die Füße. Er war weniger als eine Armlänge von seinem Gegenüber entfernt. Der Mann war wirklich wie ein Baumstamm, mit breiten Armen, Händen größer als Teller, mit Brusthaar, das sich vom Kittel nicht verstecken ließ, und mit dieser Narbe, die vom Mundwinkel bis zum Ohr reichte und von einem fremden Schwert stammen musste. Angst schien er nicht zu kennen.
Warum aber hatte er sich in diese Lage gebracht? Nur ein Dummkopf bat öffentlich um etwas, das auch abgelehnt werden konnte, alle anderen fühlten vor, schickten Vertraute, ließen sich beraten.
»Herzog!« Die Stimme des Hriustrers war lauter geworden, noch der Letzte im Saal konnte sie vernehmen. »Mir scheint, ich bin dir nur als Waffenbruder gut genug.«
»Das stimmt doch nicht.«
»Ich habe aus meinem Land jeden Mann mitgebracht, der ein Schwert halten kann. Unsere Nachbarn, die Wanger und Astergaer, sind meinem Ruf gefolgt, sonst wären sie nicht hier. Selbst die Männer von der Ems sind mit mir gekommen.« Er fuhr den Arm aus, der schwankte, und zeigte ungefähr in die Richtung, in der die Emsgaer saßen.
Radbod verstand, was sein Gegenüber ihm wirklich sagte: Wenn Reemer wollte, gingen alle diese Leute mit ihm wieder nach Hause, und er konnte seinen Feldzug alleine führen. Dort, wo die Stämme des Ostens lebten, jenseits des großen Moores, dort kamen keine Franken und keine Christen jemals hin. Deshalb war der Feldzug für sie keine Notwendigkeit.
Radbod zwang sich, die Ruhe zu bewahren, er rief sich auch sein Vorhaben ins Gedächtnis, höflich und zuvorkommend zu sein. »Du weißt sehr wohl, dass ich dich nicht nur als Waffenbruder, sondern als Fürsten und als Friesen schätze. Deshalb bitte ich dich, dich einfach wieder hinzusetzen. Sieh, meine Frau, sie hat dieses Festmahl vorbereitet. Ihr zu Ehren und für alle Männer in diesem Saal soll es nun weitergehen. Trink mit mir, Reemer, trink mit mir auf unseren Sieg.«
Er riss seinen Becher erneut in die Höhe, musste aber erkennen, dass der andere nicht bereit war, auf das Angebot einzugehen. Reemer war nicht auf Versöhnung aus, er wollte eine Antwort, und die hatte Radbod ihm aus gutem Grund verweigert. Welcher Heeresführer stieß am Vorabend der Schlacht seinen wichtigsten Bundesgenossen vor den Kopf?
Zum Glück wurde es im Saal wieder lauter, die Männer lachten über einen Ostergouwer Edlen, der von der Bank gefallen war, auf dem Boden lag und schnarchte. Auch das Reden hatte wieder eingesetzt. Radbod glaubte, dass seine Gäste kommentierten, was vor ihrer Nase aufgeführt wurde.
Er selbst blickte den Hriustrer unverwandt an. Seinen Becher hielt er vor sich, das Angebot zur Versöhnung bestand fort. Er war schmaler, aber nicht kleiner als sein Gegenüber. Und er war der Herzog. Es gab keinen Grund für Demutsgesten.
Endlich stieß Reemer mit ihm an. Aber bevor er trank, sagte er, wenn auch leiser: »Du wirst sehen, das Bier vernebelt mir meinen Kopf nicht. Morgen bin ich der gleichen Ansicht wie heute. Bei Tageslicht stelle ich meine Frage erneut. Dann erwarte ich eine Antwort von dir.«
Er stürzte hinunter, was noch in seinem Becher war, dann drehte er sich um und ging zurück. Seine Schritte waren schwer, die Arme ruderten durch die Luft, der massige Körper schwankte. Viele Augenpaare begleiteten ihn auf seinem Weg. Als er an Eila vorbeiging, hielt er nicht an und blickte nicht zu ihr. Erst vor seinem Platz machte er Halt, stützte sich auf seine Nebenleute, stieg über die Bank und setzte sich. Aber im nächsten Augenblick kam er wieder hoch. Radbod war dabei, einen neuen Trinkspruch auszubringen. Was hatte der besoffene Hriustrer vor? Er kletterte schon wieder über die Bank. Wollte er sein Anliegen noch einmal vorbringen?
Beide Männer standen jeweils am Kopfende der Tafel, mit einem Abstand von vielen Schritten, und es mochte aussehen, als wollten sie einen Fechtkampf beginnen. Reemer hielt sich an Kitteln und Schultern seiner Leute fest. Als er sich wieder in Bewegung setzte, hielt Radbod den Atem an.
Aber dann zog der Hriustrer nach draußen. Musste sich nun offenbar erleichtern.
»Lasst uns trinken«, brüllte Radbod in die neuerliche Stille hinein. »Auf unseren Sieg. Auf Friesland.«
Im nächsten Augenblick setzte ein Grölen ein, als hätte Thor einen Donner geschickt. Die Männer sprangen auf, rissen ihr Bier in die Höhe und stießen an. Man hörte, wie mancher Becher zerschlug. Die Rufe wurden immer lauter.
Reemer stand an der Tür. Da er nichts zu trinken in der Hand hatte, warf er die Arme in die Höhe.
»Hoch«, rief er, »hoch!«
Wenig später ging Eila davon. Sie hatte Poppo gebeten, sie zu begleiten. Radbods andere Söhne saßen noch am Tisch, Alfbad neben seiner Mutter, die er zu unterhalten versuchte, Onno bei Finn, mit dem er scherzte. Bier floss weiterhin in einer solchen Menge, dass mehrere Sklaven mit dem Nachfüllen beschäftigt waren. Radbod stach das Lallen der vielen Stimmen ins Ohr. Immer häufiger verschwanden die Männer, wahrscheinlich hatten sie draußen inzwischen einen künstlichen See erschaffen. Ihm selbst war alle Lust vergangen. Er aß nicht mehr und trank nicht mehr, wandte sich weder an Finn noch an Tade. Stattdessen spielte er mit seinem Messer und kratzte sich alte Erde unter den Fingernägeln hervor.
Ganz anders Reemer, der nüchterner geworden zu sein schien und ein großes Wort führte. Dort, wo die Hriustrer saßen, ging es am lautesten zu. Reemer lachte aus vollem Hals und schlug dazu mit der Faust auf den Tisch. Der Mann schien ein unbeschwertes Gemüt zu haben. Seine Unterarme waren vom Essen fettig, der Bart genauso. Dass er in wenigen Tagen durch ein Frankenschwert sterben konnte, schien ihn nicht zu kümmern.
Radbod war bei Reemer im Hriustrerland, jenseits des großen Moores, gewesen. Dort war die Erde saftig und schwarz, der Himmel hing tief wie die Decke eines Hauses. Wie ein Zauber lag an windstillen Tagen ein steter Nebel über dem Land. Was war das Geheimnis der Leute, die dort lebten? Sicherlich waren sie mutig und sie schienen sich nicht allzu viele Gedanken zu machen. Aber da war noch mehr. Ob sie den Tod liebten?
Er ging hinaus und gesellte sich zu den Männern, die einen großen Baum umkreist hatten und pinkelten. Von Ferne sah man die Feuer der Krieger, die auf den Wiesen lagerten. Auch dort wurde sicher viel Bier getrunken.
Als er seine Hose zuband, entschied er sich, nicht wieder zurückzukehren. Finn war noch im Saal, also war die Herzogsfamilie vertreten. Er schlenderte um das Herrenhaus herum. Es war ein milder Abend, der Wind hatte sich abgeschwächt, Feuchtigkeit lag in der Luft. Auf dem Boden waren bunte Blütenblätter verstreut.
Er würde Eila nicht an den Hriustrer geben, so viel war sicher, nicht einmal um des Landes willen oder wegen des Krieges. Andererseits war es sein Anliegen, dass die friesischen Stämme nicht erneut im Streit auseinandergingen und jahrelang kein Wort miteinander wechselten. Die Herausforderung für ihn hieß, einen Weg zu finden, der weder Ablehnung noch Zusage war. Reemer – sollte er sich überhaupt noch an sein Begehr erinnern, wenn er wieder nüchtern war – durfte er nicht verprellen. Er musste freundlich bleiben, und das hieß, zu lavieren.
Nur war er für solche Dinge ganz und gar nicht geschaffen.
2. Kapitel
Radbod sah eineschlaflose Nacht vor sich liegen. Er öffnete sein Fenster, zog sich einen Stuhl heran, setzte sich und legte die Füße hoch. Himmel und Sterne konnte er von seinem Platz aus nicht sehen, dazu war der Ausguck zu klein, vor ihm war nur schwarze Nacht. Schon früher hatte es Momente gegeben, da hatten Friesland und das Amt des Herzogs mehr von ihm verlangt, als er zu geben bereit war, und dort lag, glaubte er, eine Verbindung in seine Vergangenheit. Er wurde herausgefordert, daran hatte sich nichts geändert, auch wenn ihm der Junge, dem es vor vielen Jahren genauso ergangen war, wie ein Fremder erschien, wie ein anderer Mensch. Erst mit Onno war er zu dem geworden, der er jetzt war. Und mit Paak. Onno, der beinahe stumme Fischersohn von der Insel Vlylan. Paak, sein Vater.
Damals war er 17 und kämpfte jeden Tag gegen die Angst, die seine ständige Begleiterin war. Zu Hause zeigten sie ihm immer wieder, dass er kein vollwertiger Mensch war, weil er nicht richtig sprechen konnte. Sobald er den Mund aufmachte, fürchtete er, sich zu blamieren.
Vater und Mutter wussten das ganz genau. Sie hatten ihren Spaß daran, Radbod Fragen zu stellen und auf eine Antwort zu bestehen. Wenn er dann hängen blieb, worauf sie nur warteten, machten sie ihn nach und lachten. Und er schämte sich.
Wenn die Möglichkeit bestand, stahl er sich davon, denn dann war er sicher, nicht reden zu müssen. Oft wanderte er hinunter nach Stavoren. An einem dieser Tage war es auf halbem Weg zwischen Markplatz und Fischerhafen, dort, wo die Thoreiche stand, ungewöhnlich voll, mehrere Reihen von Menschen drängten sich zu einem Kreis. Radbod war neugierig, trat näher und schob sich, um etwas zu sehen, durch die Leute hindurch. Vorne angelangt, entdeckte er Rixa. Sie war nicht weit von ihm. Eine ältere Frau an einem Krückstock hatte sich bei ihr eingehakt, ihre Großmutter, wie er bald erfuhr. Was Rixa und die anderen Schaulustigen fesselte, das waren die christlichen Missionare. Sie hatten ihre Planwagen auf dem Platz abgestellt und luden etwas aus. Ein Kreuz. Ein Holzkreuz, hoch wie zwei Männer und entsprechend schwer.
Die Gruppe führte der Missionar Willibrord an, ein hagerer, hochgewachsener Mann, der aus Northumbria, von der britannischen Insel, stammte. Wer ihn anschaute, dem fielen die Augen auf, die seltsam unbeweglich waren. Die Lider gingen nicht auf und zu, sondern standen immer offen. Der Mann starrte. Er blickte nicht, er starrte.
Willibrords Aufmerksamkeit war bei einem Zimmermann mit langem, feuerrotem Haar. Dieser Mann kommandierte ein paar Lehrlinge und Sklaven, die das Kreuz geschultert hatten. Sie sollten es mit dem angespitzten Ende in ein vorbereitetes Erdloch setzen, was wegen seines Gewichts und der Größe nicht einfach war. Der Zimmermann schnauzte seine Leute unentwegt an.
Während sie arbeiteten, begann Willibrord, zu den Zuschauern zu reden. Er hatte eine Stimme, die so durchdringend war, dass man meinte, sie irgendwo im Bauch spüren zu können. Die Sprache seiner Heimat war dem Friesischen nahe, deshalb redete er fast ohne Fehler, auch wenn man ihm den Ausländer anhörte. Sein Auftritt schien die Leute zu beeindrucken, auch deshalb, weil sich nur wenige Fremde nach Stavoren verirrten.
»Seht ihr das Kreuz, ihr Friesen? Seht ihr es? Gleich wird es aufgestellt. Das ist das Kreuz, an dem unser Herr gestorben ist. Er ist für euch gestorben.«
Willibrord machte ein paar Schritte auf sein Publikum zu und zeigte auf einzelne Leute. »Für dich ist er gestorben und auch für dich. Für jeden einzelnen von euch.«
Radbod bezweifelte, was der Fremde sagte. Er hatte seinen Lehrer Tade von diesem angeblichen Gottessohn sprechen gehört. Wieso sollte dieser Jesus, der ihn gar nicht kannte, für ihn gestorben sein? Der Mann hatte vor ewigen Zeiten gelebt, als die Römer stark waren und sich sogar bis nach Friesland getraut hatten. Zu ihm, zu Radbod, gab es da keine Verbindung.
Wenn er gekonnt hätte, hätte er widersprochen. Inzwischen redete dieser Willibrord immer weiter.
»Mit seinem Tod hat er eure Sünden auf sich genommen«, behauptete der Missionar, »da ist es das Mindeste, was ihr tun könnt, dass ihr euch zu ihm bekennt. Denn er hat sein Leben für euch gegeben.«
Der Northumbrier war ein geschickter Redner. Er setzte Pausen, in denen seine Worte nachklangen. In Radbod aber wuchs die Unruhe. Er verstand nicht alles – was war Sünde? – und glaubte, dass es den anderen Zuhörern genauso ging. Trotz alledem drängte es ihn, sich einzumischen.
Wenn er nur hätte sprechen können.
»Meine Leute werden nun dieses Kreuz aufstellen, und ihr alle seid aufgefordert, niederzuknien und mit uns zu beten. Wer es wünscht, den taufe ich, hier an Ort und Stelle, dann ist er aufgenommen in die heilige Kirche, und nach dem Dasein auf der Erde erwartet ihn ein Platz im Himmel.« Der Northumbrier zeigte nach oben, wo helle Wolken standen und die Sonne zwischen ihnen hindurchblinkte. »Dort herrscht Frieden. Alle Mühsal ist vergessen.«
Er machte dem Zimmermann ein Zeichen, und der Rothaarige wies seine Leute an, die spitze Seite des Kreuzes in die Mitte des Lochs zu versenken. Der Missionar sah ihnen mit seinen unbewegten Augen zu, hatte dabei die Hände in einander gelegt und die Finger verschränkt. Er trug einen braunen Wollkittel, der von einer hellen Kordel gehalten wurde. Es war windig. Der Mann hatte kaum Haar, nur einen dürren Kranz um den Hinterkopf, aber der Wind kam auch dahin und ließ die Härchen wehen.
»Ich will euch erklären, warum das Christentum die richtige Religion für euch ist, ihr Friesen. Seinerzeit hat Gott seine Engel geschickt, um die frohe Botschaft von der Geburt seines Sohnes zu verbreiten. Und wisst ihr, wem er sie geschickt hat? Nicht den Königen und Fürsten oder anderem hohen Volk. Nein, denen nicht, sondern zu Schäfern, die bei ihren Herden wachten.«
Einige Leute kicherten.
»Ja, zu Schäfern. Zu den Ärmsten der Armen. Sie als Erste sollten von dem Wunder hören. Und noch etwas will ich euch berichten. Als Jesus Christus Männer suchte, die ihn auf seinem Weg begleiten sollten, wen hat er da wohl ausgewählt? Etwa Adelige und reiche Kaufleute? Oh nein, ganz und gar nicht. Er hat Fischer genommen, Fischer wie euch, Männer, die einer ehrlichen Arbeit nachgingen. Das ist der Grund, warum unsere Religion eine für das einfache Volk ist, für mich – und für euch. Lasst euch taufen, ihr Friesen, es wird euch vielfach belohnt werden. Christus hat gesagt: ›Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.‹ Bedenkt diesen Satz. Bedenkt ihn gut.«
Radbod musste sich bremsen, um nicht hinauszutreten aus dem Kreis der Schaulustigen. Wieder sagte er sich, dass es nicht ging. Dass er nicht konnte. Nicht durfte.
Der Missionar schritt auf einzelne Leute zu, die er aufforderte, niederzuknien. Er legte ihnen die Hand auf die Schulter und redete auf sie ein, und als der Erste seiner Aufforderung nachkam, folgten ihm schnell andere, Männer wie Frauen, Junge und Alte, und ließen sich auf die Knie fallen. Rixa widerstand, aber ihre Großmutter – der der Missionar versprach, sie werde von ihren Schmerzen erlöst und könne wieder ohne Krückstock gehen – war bereit, ihm zu folgen.
Nun konnte Radbod sich nicht mehr halten. Seine Warnungen an sich selbst hatte er vergessen.
Er machte ein paar Schritte auf Rixas Großmutter zu, gerade als sie im Begriff war, unter der Schulterberührung des Missionars auf die Knie zu sinken. Sie war eine alte Frau, hatte aber ein weiches Gesicht und volle Lippen und war schön, wie man nur im Alter schön sein kann. So würde auch Rixa einmal aussehen.
Radbods Bewegungen waren unsicher, tief in seinem Inneren zitterte er. Die Angst war mit ihm, doch er riss sich zusammen und schüttelte sie ab. Als er die alte Frau erreicht hatte, hielt er ihr seine Hand hin. So, wie sie ihn anblickte, schien sie nicht zu verstehen, was er wollte.
Aber sie griff zu.
»S-steh wieder auf«, presste er hervor.
Die Augen aller Leute waren auf ihm – und auf der Großmutter, die schwankte, als sie mit Radbods Hilfe wieder auf die Füße kam. Er reichte auch den Nebenstehenden die Hände, und die standen ebenfalls wieder auf.
»Du lädst Sünde auf dich. Schwere Sünde«, rief die tiefe Stimme neben ihm. Anders als seine schallte sie über den ganzen Platz.
»S-steht alle wieder auf. F-Friesland hat seine eigenen Götter. Ihnen w-wollen wir die Treue halten. Sch-schlechte Friesen wären wir sonst.«
Radbod zog weiter in der Runde und reichte den Leuten ohne weitere Worte seine Hände. Für einen Moment sah er sich von außen zu: ein schmaler, zitternder Junge, der zunichte machte, wozu der Mann in der Kutte die Leute überredet hatte. So, wie sie vor dem einen niedergesunken waren, standen sie mit Hilfe des anderen wieder auf.
Radbod fühlte sich bestärkt und begann nun doch zu reden, während der Missionar schräg hinter ihm nur zusehen konnte.
»D-denkt an Thor, Wotans Sohn, den Wettergott, den Beschützer der Menschen und der Welt. Und w-was ist mit dem weisen W-wotan selbst, dem ihr bei der Ernte Getreide auf dem Feld stehen lasst? Ihr wollt ihm doch nicht ab-abschwören.«
Auch wenn es nur Gemurmel war, Radbod bekam Unterstützung, und dem Missionar half es nicht, dass er seinen Satz von der Sünde wiederholte. Radbod scherte sich nicht mehr um die Warnungen des Northumbriers und die Leute auch nicht. Einer wie der andere standen sie auf, als Radbod seinen Weg den Zuschauerkreis entlang fortsetzte.
Der Missionar schien kaum zu glauben, was sich da abspielte. Ohne Worte suchte er Rat bei seinen Leuten, die ihrerseits auf eine Reaktion von ihm warteten.
Als Willibrord schließlich seine Sprache wiederfand, hatte er Zorn in der Stimme, mehr als das, eine Wut, die eiskalt war. »Ich werde euch zeigen, welcher Gott der stärkere ist«, rief er. »Cedric, ein Beil, schnell. Ein scharfes.«
Er hatte sich an den rothaarigen Zimmermann gewandt, der nicht gleich verstand, was der Missionar wollte. Aber dann eilte er zu seinem Planwagen und brachte ein Beil, und der Missionar schritt aus zur Thoreiche und begann, auf den Stamm einzuschlagen.
Der knorrige, niedrige Baum hatte ausgeschlagen, hellgrüne Blätter standen an seinen Zweigen. Er sah aus wie ein alter Mann, der, obwohl gebeugt, über seinen Jahren die Lebensfreude nicht vergessen hatte.
Bereits unter den ersten Schlägen des Beils barst das Holz. Die Leute schrien auf.
»Ich fälle diesen Baum«, rief der Northumbrier, »der angeblich Thor geweiht ist. Und dann warte ich auf die Strafe eures Donnergottes. Ich bin bereit, zu ertragen, was immer er mir auferlegt.«
Während der Missionar auf den Baum einschlug, mit kräftigen Schlägen und in einer Höhe, dass nur ein Stumpf stehen bleiben würde, setzte ein allgemeines Getuschel ein. Die Leute starrten zum Himmel. Alle warteten auf Thors Antwort, auf den Donner.
Der Missionar hieb auf den Baum ein.
Er kam ins Schwitzen. In seiner Wucht ließ er nicht nach, sein Arm schien nicht zu ermüden. Er hieb und hieb, und frische Holzspäne stoben durch die Luft.
Bald gab es einen ersten Riss. Der Baum ächzte. Er war verwachsen, sah hutzelig aus, und der ständige Wind hatte ihn schief werden lassen. Unter dem Beil des Missionars begann er, sich stärker zu neigen, als der Wind je verlangt hätte. Der Northumbrier hatte bereits eine kräftige Kerbe in den Stamm geschlagen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Baum fiel. Radbod hörte darauf, ob sich ein Donner ankündigte. Ein einfacher Missionar – ein starker Friesengott, was sollte da zweifelhaft sein? Das allgemeine Gemurmel war lauter geworden, man hörte das Entsetzen der Umstehenden und nach einem harten Hieb wurden Schreie laut. Viele Leute hatten die Hand vor den Mund geschlagen.
Dann knickte der Baum ein und kippte auf die Seite.
Dem Missionar war es noch nicht genug, er trennte auch die letzten Holzfasern durch und gab keine Ruhe, bis die alte Eiche gänzlich in den Dreck fiel. Zum Zeichen seines Triumphes schlug er das Beil ins Holz. Dann wandte er sich den Leuten zu und breitete die Arme aus.
»Nun, Thor, ich warte. Wo ist deine Strafe? Schickst du deinen berüchtigten Donner? Ich sage dir etwas: Ich habe keine Angst vor dir. Warum sollte ich auch? Es gibt keinen Thor. Es gibt nur einen Gott.«
»V-vielleicht da, wo du herkommst«, entgegnete Radbod.
Aber die Verhältnisse hatten sich gewandelt. Willibrords Rede war durchdringender denn je, und sein Streich hatte die Leute beeindruckt. Radbod kam sich verlassen vor. Thor half nicht, Thor ließ ihn allein.
»Nein, das gilt auf der ganzen Welt. Gott hat sie geschaffen. So fängt das heilige Buch an – am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.«
»Aber nicht F-friesland.«
»Oh doch, auch Friesland. Die ganze Welt. Alles. Menschen und Tiere, das Meer und das Land. Einfach alles. Selbst den Tag und die Nacht.«
Radbod tat so, als ließe er den Kopf sinken. Thor war sehr wohl anwesend – er hatte eine Antwort geschickt, einen Einfall. Der Junge gab vor, mehr als alle anderen über das Ausbleiben des Donners enttäuscht zu sein. Er trat auf den Missionar zu, der nach der Anstrengung immer noch keuchte, dem aber die Siegesgewissheit ins Gesicht geschrieben stand.
»Nun, Junge? Erkennst du deinen Irrtum?«
»Vielleicht.«
»Vielleicht?« Der Missionar hob mit einer ausholenden Bewegung die Hände. »Wo es um Gott geht, da gibt es kein Vielleicht. Kniet nieder, Leute. Erkennt euren Irrtum.«
Willibrord schritt wieder auf die Reihe der Männer und Frauen zu, denen Radbod auf die Füße geholfen hatte. Es war Rixas Großmutter, der er als Erste die Hand auf die Schulter legte. Radbod sprang, schneller als einer der Christen reagieren konnte, auf den gefallenen Baum zu und zog mit der linken Hand das Beil heraus. Mit ein paar weiteren Sätzen erreichte er das gerade aufgestellte Kreuz. Bevor er zuschlug, schaute er in die Runde, als wollte er sich der Aufmerksamkeit des Publikums versichern.
Rixas Großmutter stand noch. Sie schaute zu ihm, genauso wie ihre Enkeltochter.
Radbod setzte den ersten Hieb. Er klang anders als die Schläge gegen die Thoreiche, heller, und das Beil federte mehr. Radbod ließ weitere folgen.
Im nächsten Moment wies der Missionar seine Leute an, dem Jungen Einhalt zu gebieten. Sie waren ein ganzer Trupp, jüngere Mönche, Handwerker, Sklaven. Und alle eilten auf Radbod zu.
Noch bevor sie ihn erreicht hatten, trat ein Mann aus dem Kreis des Publikums. »Überlege dir gut, was du tust, Northumbrier«, rief er. »Wir sind viele, und wir haben Waffen.« Zum Beweis reckte er ein Eisenwerkzeug in die Höhe. »Wir lassen es sicher nicht zu, dass ihr euch an einem Friesen vergreift.«
Willibrord bedachte die Worte und schaute auf die Leute im Publikum, von denen einige mit dem Kopf nickten. Schließlich hob er die Hand und hielt seine Leute zurück.
Radbod setzte ein paar neue Schläge gegen das Kreuz.
»Ich w-will ja nur wissen, ob dein Gott reagiert«, rief er, und man hörte seine Anstrengung.
»Er hat es nicht nötig …«
»Dann hat es Thor auch nicht nötig.«
»Wie kannst du einen so dummen Vergleich anstellen!«
Aber die Friesen waren nun auf Radbods Seite. Sie feuerten ihn an. Erst wenige, dann immer mehr begleiteten sie jeden seiner Schläge mit rhythmischen Rufen. Bald klang ein einziges »Hep, hep« über den Platz.
Das Kreuz hielt dem scharfen Beil genauso wenig stand wie die Thoreiche. Radbod hatte bereits einen Keil hineingeschlagen, und wieder wirbelten die Holzsplitter durch die Luft. Von den Fremden schien es nicht so sehr der Missionar Willibrord zu sein, der litt, sondern der rothaarige Zimmermann. Der blickte drein, als würde er selbst vom Beil getroffen. Es war sein Werkstück, das zerstört wurde.
Das Kreuz ächzte, als das Holz einriss, dann neigte es sich auf die Seite. Radbod richtete sich auf. Lässig schnitt er die letzten Fasern durch. Der Stamm fiel.
Wie Willibrord blickte Radbod gen Himmel. »N-nun?«
Der Missionar kam auf ihn zu. »Sag mir, Junge: Du schlägst mit der linken Hand?«
»Wie du siehst.«
»Hast du in ihr mehr Kraft?«
»Ja. Warum fragst du das?«
Radbod erhielt keine Antwort. Der Northumbrier neigte den Kopf zur Seite, dann suchte er Hilfe beim Himmel.
»Die Linke ist des Teufels«, rief er schließlich. »Und niemand anders als der Teufel schlägt ein Kreuz um.« Zu Radbod sagte er: »Du wirst seiner Strafe nicht entgehen, selbst wenn sie nicht sofort kommt.«
»T-Thor wird dich ebenfalls strafen. S-sein Donner ist stark.«
»Ach was, Thor. Es ist nicht Thor, der den Donner macht, sondern Gott. Er allein. Gott lässt das Getreide wachsen und sorgt dafür, dass die Ernte gut wird, niemand sonst.«
»D-du r-redest doch nur.«
Die Stimme des Northumbriers wurde noch lauter. »Ja, ich rede. Und warum? Weil Gott mir die Worte gibt und die Kraft, sie auszusprechen. Aber was ist mit dir? Warum darfst du nur stottern? Hast du dich das mal gefragt?«
Er hatte die Stelle getroffen, an der sich Radbod nicht wehren konnte. Wie ein guter alter Bekannter war der Spott an seiner Seite. Seine Arme hingen ihm am Körper herab, das Gesicht wurde rot. Zusammen mit dem Missionar hatte er die Aufmerksamkeit aller Leute auf sich gezogen, sie beide waren die Darsteller gewesen, die anderen das Publikum. Aber nun war der Zweikampf entschieden. Sein Gegenüber hatte seine Sicherheit zurückgewonnen. Es war, als hätte er sie Radbod gestohlen.
»D-das ist kein B-beweis«, versuchte er es noch.
»Ach nein? D-das soll kein B-beweis sein?«
Die Leute lachten.
Die Friesen bestärkten Willibrord.
»Ich sage euch etwas: Von Gott gibt es viele Beweise, und der wichtigste ist die Bibel. Das Wort bedeutet ganz einfach: das Buch. Die Bibel ist viele hundert Jahre alt. Gott selbst hat den Männern, die Seine Geschichte und die Seines Sohnes aufgeschrieben haben, die Feder geführt.« Wieder hob er seine Arme und sah selbst fast wie ein Kreuz aus. »Aber was gibt es über eure Götter. Hat jemand ein Buch über Wotan geschrieben? Oder über Thor?«
Radbod rang mit sich und mit seinem Stottern. Ihm war klar, dass es nun mit jedem Wort schlimmer wurde. So war es immer gewesen.
Trotzdem unternahm er einen weiteren Anlauf. »W-warum s-soll ein B-b-buch ein B-beweis sein?«
»Weil die Wahrheit darin geschrieben steht! Und auch hier, auf diesem Platz, mitten im heidnischen Stavoren, wird die Wahrheit verkündet. Entscheidet selbst, Leute, durch wen Gott spricht. Durch mich, der aus Northumbrien zu euch gesandt wurde, um euch die Wahrheit zu bringen? Oder durch einen – Stotterer? Es ist doch offensichtlich.«
Radbod wurde es heiß, im Gesicht wie am Körper, es war Zorn, der ihn schwitzen ließ, aber vor allem Scham. Rixa war im Publikum, ausgerechnet Rixa. Vorsichtig schüttelte sie den Kopf. Was sollte das heißen? Dass sie sich ebenfalls schämte?
»Ich sage dir etwas«, fuhr der Missionar fort. »Du bist jung, und Gott ist milde und gerecht. Du hast das Kreuz umgeschlagen, an dem böse Menschen seinen Sohn haben sterben lassen, trotzdem nimmt er dich und verzeiht dir. Auch mit deiner linken Hand. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, da hat Gott die Widerspenstigen am Ende besonders geliebt. Deshalb: Knie nieder, wir holen Taufwasser, und ich nehme dich auf in unsere Kirche.«
In Radbods Ohren klangen all die falschen Töne des Fremden nach, aber die anderen Leute erreichte Willibrord mit seiner plötzlichen Güte. Sie waren bereit, die Überlegenheit des Christen anzuerkennen und warteten nur noch darauf, wie der Junge reagieren würde.
Willibrord ließ nicht nach. »Na Junge, was ist? Bist du einverstanden?« Er wies einen seiner jungen Missionare an, einen Eimer Wasser zu bringen.
Radbods Mund war trocken, im Gesicht glühte er. Er machte zwei, drei Schritte auf den Missionar zu, die Fäuste geballt.
Der Northumbrier schien keine Angst zu haben – und das war der Unterschied zwischen ihnen. Er ließ sein Gegenüber nicht vom Haken, so wie ein geschickter Angler einen Fisch nicht entkommen lässt. »Was sagst du? Sprich laut und deutlich.«
Seine Augen lachten, in seinem ganzen Gesicht war Heiterkeit, und er musste an sich halten, damit sich sein Körper nicht vor Freude schüttelte.
Radbod rang mit sich. Die Sprache hatte ihn verlassen, als hätte der Wind sie aus seinem Kopf geblasen. »I-ich …«
»D-Du? Was ist mit dir? R-rede doch.«
Während die Menge kicherte und wartete, schloss Radbod die Augen und holte tief Luft. Seinen nächsten Satz stieß er hervor: »I-ich bin F-friese. Und b-bleibe es.«
Willibrord wandte sich dem Publikum zu, dabei klatschte er in die Hände. »Habt ihr gehört? Er ist F-friese. Das nimmt ihm doch keiner weg. Und euch auch nicht. Leute, ihr dürft Friesen bleiben.«
Radbod wollte nur noch fort. Er drängte an die Seite. Die Leute machten ihm Platz, sie bildeten eine Gasse, durch die er sich drücken konnte, und wo es ihm nicht schnell genug ging, schob er sie auseinander.
Sobald es möglich war, rannte er.
Der Missionar aber hatte noch nicht genug, und seine Stimme war nicht zu überhören. »Nun, da ihr Gottes Macht gesehen habt, zögert nicht. Lasst euch taufen. Dass ihr alle Friesen bleiben könnt, auch wenn ihr Christen seid, das verspreche ich euch, so wahr ich Bruder Willibrord bin. Und noch etwas: Das Kreuz stellen wir wieder auf. Gottes Macht lässt sich nicht umstürzen.«
3. Kapitel
Radbod rannte denganzen Weg zurück, als sei ein Geist hinter ihm her. Er stürmte durch die Gassen von Stavoren, vorbei an den bunten, strohgedeckten Häusern, jagte am Kanal entlang und schwenkte in vollem Lauf auf den Pfad, der zum Herrenhaus hinauf führte. Im Wald spendeten die Bäume Schatten, aber ihm half das nicht, er schwitzte. Es war ihm egal, er achtete nicht einmal darauf. Auch als vor ihm die roten Steine und das Eichengebälk seines Elternhauses auftauchten, wurde er nicht langsamer. Zwei Sklaven, die an den Beeten arbeiteten, starrten ihn an.
Kurz vor ihnen bremste er ab und fragte sie nach Tade.
Im Stall vielleicht, erwiderten sie. Oder im Haus.
Eine Antwort, die keine war. Er versuchte es bei den Pferden, wo er keinen Menschen traf, nur seine Stute Baja, die schnaubte und mit den Hufen scharrte, sobald sie ihn hörte. Er legte ihr die Hand auf den Hals und streichelte mit der anderen ihre Blässe. Doch auch bei ihr ließ die Demütigung nicht von ihm ab, sie umhüllte ihn wie ein Mantel, sie war eine Schande, die er nie würde vergessen können. Das Lachen des Missionars und das der Leute klang ihm im Ohr. Keinem von ihnen konnte er jemals wieder unter die Augen treten.
Als er den Stall verließ, trottete er so langsam, wie er vorher schnell gelaufen war. Der Kopf hing ihm herunter. Er stieß die schwere Tür zum Haus auf, sodass sie gegen die Wand schlug. Nahm den Gang zum Gesindetrakt, wo er in Tades Zimmer platzte.
»M-mach, dass das weggeht«, sagte er anstelle eines Grußes.
»Was meinst du?« Der Ältere brauchte einen Moment, dann begriff er. »Das Stottern? Das kann ich nicht.«
Die Wut, die sich über Radbods Scham gelegt hatte, war kalt und böse. Er hätte diesen Mann, der sein Lehrer war, treten und schlagen können. Stattdessen kniff er die Augen zusammen. »D-dann sage mir, was ich tun soll!«
Tade stand von seinem Hocker auf. Er wollte Radbods Hände nehmen, doch der stieß ihn so heftig zurück, dass er erst an der Wand wieder Halt fand.
Er strich sich mit einer Hand über den blonden Bart. »Üben. Du kannst nur üben.«
»Ich habe geübt! Es ist nicht weggegangen. Und jetzt soll ich damit weitermachen? Ist das dein Rat?«
»Eine andere Antwort kann ich dir nicht geben, Radbod. Wann fällst du ins Stottern? In ungewöhnlichen Situationen. Oder wenn dein Vater dich anspricht oder die Herzogin. Was passiert dann? Du bist aufgeregt. Ich glaube, dann arbeitet dein Verstand schneller als deine Zunge es vermag. Sie kommt nicht hinterher. Dann stotterst du.«
Radbod verabscheute diese Worte, er wollte keine Erklärungen, was er brauchte, war, dass ihm jemand diesen Fluch nahm. Und zwar sofort.
»Ich glaube«, fuhr Tade fort, »du wirst lernen müssen, beide, Verstand und Zunge, in der gleichen Geschwindigkeit arbeiten zu lassen. Sie sollten zusammengehen, wie ein guter Reiter mit seinem Pferd zusammengeht.«
Der Junge schloss die Augen. Aus der Ferne rief ihm eine fremde Stimme zu, dass sein Lehrer recht hatte. Es gab keine Abkürzungen auf diesem Weg. Dennoch klang er weiterhin barsch, als er fragte, wie er das umsetzen solle.
»Es gibt nur einen Weg – zu reden. Ja, du musst reden, Radbod, so oft wie möglich reden. Achte gleichzeitig darauf, was in dir vorgeht. Ob du aufgeregt bist oder ärgerlich. Nutze die Gelegenheiten, die sich bieten. In ein paar Tagen kommen die Groninger zu Besuch. Überall wird schon vorbereitet, die Gästezimmer werden hergerichtet, und in der Küche arbeiten sie auch. Was ist mit dir? Bereite dich auch vor. Nimm dir vor, zu sprechen, gerade vor Fremden. Langsam – aber sprich. Auch dann, wenn viele zuhören. Ergreife das Wort, selbst wenn du am Anfang stotterst.«
Tade legte ihm die Hand an den Arm, was Radbod nun zuließ. »Einen besseren Vorschlag habe ich nicht.«
Radbod stellte sich das Zusammentreffen mit den Groningern vor, und das machte ihm wenig Hoffnung. Die Fürstenfamilie kam in der Regel mit Kindern und Dienstleuten, dann war das Haus voll und der Tisch ebenso, die Leute plapperten alle durcheinander und sprachen schnell und viel. Da überhaupt zu Wort zu kommen, war bereits eine Herausforderung. Bislang hatte er diese Essen stumm hinter sich gebracht.
»Du brauchst Mut, Radbod,« sagte Tade, »viel Mut. Aber am Ende kannst du dir nur selbst helfen.«
Noch vor den Groningern kamen die Missionare ans Herrenhaus, nicht die ganze Truppe mit Handwerkern und Sklaven, sondern nur eine Delegation, von Willibrord angeführt. Er war der Älteste von ihnen. Die anderen, mit niedergeschlagenem Blick, unreiner Haut und gefalteten Händen, trugen den gleichen braunen Wollkittel und hatten die Haare geschoren wie ihr Mitbruder.
Radbod wurde, wie auch Finn, in den Empfangssaal gerufen. Als sie eintraten, nahm er wahr, dass die fremden Männer auf ihn reagierten. Willibrord verstummte, obwohl er mitten im Satz war, er hob den Kopf und riss die Augen auf. Dem Christen war offenbar nicht klar gewesen, wen er da auf dem Marktplatz vorgeführt hatte.
Finn und er nahmen auf niedrigen Sitzen an den Seiten der Eltern Platz, während Vater und Mutter, Herzog und Herzogin, die Stühle mit den hohen Lehnen vorbehalten waren. Die Besucher mussten stehen. Sie hatten einen Halbkreis gebildet, und die Jüngeren hatten die Hände gefaltet und die Köpfe gesenkt und wirkten schüchtern. Sie waren stumm – wie er selbst.
Willibrord setzte seine Rede fort. Er war noch bei den üblichen Höflichkeitsfloskeln, und erst als Aedgil ungeduldig abwinkte, sagte er: »Wir bitten dich, Herzog, uns die Erlaubnis zu erneuern, die dein Vater unserem Amtsvorgänger, dem tapferen Wilfried, und unserem Orden gegeben hat. Dass wir im Land der Friesen von unserer Religion künden dürfen.«
»Wozu sollte das nötig sein?«, knurrte Aedgil. Allen war bekannt, dass er kein Christenfreund war.
»Nun, wir werden behindert. Vielfach behindert.«
»Ach? Und wo soll das sein?«
Aedgil begann damit, sich den Bauch zu reiben. Radbod kannte diese Geste, sie drückte Wohlgefühl aus. Dem Herzog gefiel es, wenn die Missionare es schwer hatten.
Willibrord, der noch am Vortag gesagt hatte, dass Gott ihm die Worte gebe, geriet ins Stocken. Radbod blickte den Fremden an, mehr, er starrte ihm ins Gesicht und ließ nicht locker. Der Missionar, glaubte er, würde die Geschichte vom Vortag nicht erzählen, sonst müsste er berichten, dass er die Thoreiche gefällt hatte. Tatsächlich begann Willibrord, von allgemeinen Vorfällen zu berichten, von Leuten, die widersprachen, die andere davon abhielten, sich taufen zu lassen, selbst von Drohungen.
Aedgil lachte. Finn grinste.
Willibrord stockte. »Es gibt widerspenstige Menschen unter deinen Leuten, Herzog«, brachte er hervor.
»Das will ich meinen, Angelsachse. Dafür sind wir Friesen, wir trotzen der See und dem Wind, und das kann nur ein starkes Volk.« Zur Betonung seiner Rede hielt er den entblößten Unterarm in die Höhe und bildete eine Faust.
Radbods Mutter Helrun, die Herzogin, regte sich kaum. Wie immer trug sie ein Kleid, das bis zum Hals geschlossen war, darüber eine silberne Kette und eine helle Haube. Was mochte in ihr vorgehen?
Radbod vermutete, dass sie anderer Ansicht war als ihr Mann.
»Seit Menschengedenken leben wir in diesem Land, und das hat uns hart gemacht. So wie die Friesen gegen die wilde Natur stehen, so stehen sie gegen alles, was sie nicht kennen. Daran lässt sich nichts ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der alte Herzog je etwas anderes zugesagt hätte.«
»Das nicht«, entgegnete Willibrord. »Wir schätzen die Stärke der Friesen. Gott selbst hat sie ihnen verliehen, und das mit gutem Grund. Er lässt diejenigen Menschen an den gefährlichen Stellen seiner Welt siedeln, die die Kraft dazu haben. Die den Elementen trotzen können.«
»Jaja. So ähnlich hält es Wotan auch. Was genau ist deine Sorge, Angelsachse?«
Willibrord hatte bemerkt, dass er angestarrt wurde. Mit seinen bewegungslosen Augen begegnete er Radbods Blick, und das brachte ihn aus dem Tritt.
»Äh …«
Aedgil feixte. »Was sagst du?«
»Meine Sorge ist, dass man uns in deinem Land behindert, und zwar mit voller Absicht.«
»Ach so?«
»Leider, ja.«
Diesmal schielte der Missionar nur zu Radbod herüber und wandte sich sofort wieder ab. Er schien tatsächlich Scheu davor zu haben, dass dem Herzog die Geschichte von Eiche und Kreuz bekannt wurde. Radbod empfand die eigene Überlegenheit und freute sich an ihr. Wenn er nur verlässlich hätte sprechen können.
»V-vielleicht liegt es an euch«, stieß er hervor.
Willibrord stutzte, überging aber den Einwurf. »Wir wurden sogar überfallen«, sagte er zu Aedgil.
»Da kann ich doch nichts dafür. Gibt es keine Räuber, wo ihr sonst hinkommt?«
»Doch, sicher. Sogar bei den Franken.«
»Na, siehst du.« Aedgil lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander, ein Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet war.
Radbod drängte es, den Missionar in Verlegenheit zu bringen, auch wenn das die Demütigung an der Eiche nicht ausgleichen würde. Er suchte einen Satz, mit dem er den Mann ein wenig aus der Fassung bringen konnte. Aber ihm fiel nichts Passendes ein.
Bislang war Willibrord nicht in die Verteidigung geraten. »Nur«, sagte er mit seiner durchdringenden Stimme, »ist das nicht das Einzige.«
»Was denn noch?«
»Selbst in deiner Residenz Stavoren begegnet uns Gewalt, und das ist gegen alle Abmachungen.«
»Gewalt?«
Wollte sich der Missionar also doch beschweren? Radbod würde dagegenhalten. Der Britannier hatte das Beil als Erster in der Hand gehabt. Die Thoreiche war ein alter Baum gewesen, und sie war heilig.
Er öffnete den Mund. Seine Lippen waren trocken. Schon bei dem Gedanken an ein Wort war die Angst da und ließ ihn stocken.
»Jawohl, Gewalt«, sagte der Missionar.
Aedgil warf die Hände in die Höhe, was ungehalten wirken sollte, aber ein wenig übertrieben aussah. »Die Leute sagen, das Schlimmste an eurem Glauben ist, dass immerzu gejammert wird. Warum tut ihr das? Wollt ihr nur die Weiber bekehren?«
»Herzog!« Willibrord hatte aufgeschrien, fand aber sofort zurück in die angemessene Tonlage. »Jesus Christus war ein Mann, seine Jünger waren Männer, genauso wie die, die sein Wort in der Welt verbreiten.«
»Dann benehmt euch auch wie Männer.«