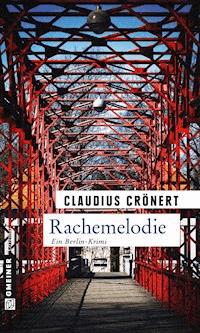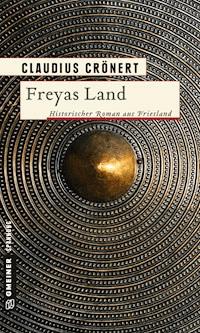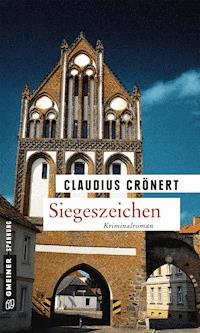Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
»Sie hing nun einmal an diesem Mann, sie liebte ihn so sehr. Und dennoch hinterging sie ihn. Halblaut rief sie sich eine bittere Wahrheit in Erinnerung. Dass ihr Geliebter einer der engsten Mitarbeiter des Führers war. Sie versuchte, ihre Gedanken zu Ende zu führen und musste sich der Frage stellen, wie es wirklich zwischen ihnen stand. Es war denkbar, dass er ihr doppeltes Spiel längst durchschaut hatte. Aber solange sie die Nazis bekämpfen wollte, brauchte sie ihn …« Ein Leben zwischen Liebe und Widerstand. Die Journalistin Felicitas von Reznicek schloss sich dem Widerstand gegen das NS-Regime an - und verliebte sich in Fritz Wiedemann, einen Adjutanten Hitlers. Doch ihre Überzeugungen gab sie für ihn nicht auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudius Crönert
Die Aufrechte
Roman aus dem Widerstand
Impressum
Einige Figuren des Romans und auch Teile der Handlung sind frei erfunden. Hier sind Ähnlichkeiten rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Felicitas von Reznicek aus dem Nachlass der Familie
ISBN 978-3-8392-7306-7
Prolog
Auf diesen Brief hatte Fee fast zwei Wochen gewartet und am Ende kaum noch mit ihm gerechnet, doch nun war er da, ein hellblauer Umschlag aus rauem Papier, die Adresse mit der Maschine geschrieben. Man konnte sie kaum lesen, so blass war das Farbband: »Frl. Felicitas v. Reznicek, Wilmersdorfer Straße 94, Berlin-Charlottenburg«. Absender war die Entnazifizierungskommission für Kunstschaffende, ebenfalls in Charlottenburg, Schlüterstraße 45. Eine der Typen, das L, war am Hebel verrutscht, sodass der Buchstabe höher anschlug als die anderen, was den Eindruck des Selbstgestrickten im Schriftbild verstärkte. Vor fünf Jahren, mitten im Krieg, hätten Beamte einer deutschen Behörde schnurstracks den Mechaniker kommen lassen, damit er den kleinen Fehler behebe. Aber es war nichts mehr wie vor fünf Jahren.
Mit dem Brief in der Hand stellte sie sich an ihr Wohnzimmerfenster, drehte den Messinggriff in die Waagerechte und zog es auf. Die Sonne schien herein, es war leidlich warm, ein paar Wolken wanderten gemächlich über den Himmel. Auf beiden Seiten des Hofes gab es keine Häuser mehr, kaum noch Mauern, links war überhaupt nichts stehengeblieben, rechts ein Steinskelett mit einem Berg aus Schutt zu seinen Füßen, auf dem drei Jungen in kurzen Hosen herumkletterten und dabei Staub aufwirbelten. Es hieß, die Eigentümer wollten ihr Haus neu aufbauen, wenn es wieder Banken und Kredite gab und man Handwerker fand. Kein Mensch wusste, wann das sein würde.
Der Rest der Nachbarschaft bis hinunter zum Kurfürstendamm war kahl, eine Wüstenlandschaft, die Steine waren abtransportiert, den Platz auf den Grundstücken hatten sich Löwenzahn und Brennnesseln erobert. Ihr Haus war als einziges stehengeblieben. Wie durch ein Wunder, pflegten die Leute zu sagen, aber das stimmte natürlich nicht, es war kein Wunder gewesen, sondern ein guter Einfall und dessen beharrliche Umsetzung. Fees Einfall. Auch ihre Sturheit. Gegen den Willen der Nachbarn, die ihr einen Vogel gezeigt hatten, hatte sie in der Zeit der Fliegerangriffe Holzfässer aufs Dach schleppen lassen und dafür gesorgt, dass sie stets voll waren. Als die Bomben dann einschlugen und es brannte, waren sie die Einzigen gewesen, die löschen konnten, wenn auch nur mit einem langen Gartenschlauch. Fee hatte damals erkannt, dass das größte Problem bei Treffern der Wassermangel war. Die Feuerwehr vermochte nichts auszurichten, weil alles Wasser schnell verbraucht war, und die Bewohner standen wie erstarrt vor ihren Häusern und mussten zusehen, wie sie niederbrannten. Also hatte sie vorgesorgt. Zum Dank hatte eine Nachbarin sie später bei den Russen angeschwärzt. Sie sei mit verschiedenen Parteigrößen wie etwa dem SS-Gruppenführer Artur Nebe gut bekannt gewesen. Eine Nazifreundin.
Sie legte den Umschlag auf das Tischchen am Eingang, wo ihr Telefon stand, und setzte Teewasser auf. Tee war eine Kostbarkeit in diesen Tagen, nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, deshalb geizte sie mit den Blättern, die sie ins Sieb füllte. Lieber ließ sie ihn etwas länger ziehen, damit er nicht nur wie dunkles Wasser aussah. Zucker gab es nicht dazu, Milch auch nicht.
Vor einigen Monaten hatte sie, wenn auch mit Widerwillen, den amerikanischen Fragebogen ausgefüllt, hatte alle 131 Fragen mit einiger Sorgfalt beantwortet. Ihre Parteimitgliedschaft – Frage 40. In der folgenden Liste ist anzuführen, ob Sie Mitglied einer der angeführten Organisationen waren und welche Ämter Sie dabei bekleideten – hatte sie angegeben, denn sie war davon ausgegangen, dass die entsprechenden Karteikarten in irgendwelche Keller oder Höhlen ausgelagert worden waren und die Bombenangriffe überstanden hatten. Inzwischen hatte sie gehört, dass mancher Kollege nicht so ehrlich gewesen war, seine Zugehörigkeit zu Partei und Organisationen verschwiegen hatte und inzwischen wieder arbeitete. Möglicherweise war sie zu naiv gewesen. Wie sollten die alliierten Beamten Millionen von Fragebögen überprüfen, bei denen jede einzelne Antwort mit deutschen Akten abgeglichen werden musste? Dafür hätte man ein ganzes Heer von Mitarbeitern gebraucht, und die Engländer zumindest, die inzwischen gemeinsam mit den Amerikanern die Bizone verwalteten, hatten andere Sorgen, zu Hause und in ihrem Empire.
Im Fragenbogen war kein Platz gewesen, um auf die speziellen Umstände ihrer Mitgliedschaft einzugehen. Wegen ihrer Auslandsreisen – Frage 125. Zählen Sie alle Reisen oder Wohnsitze außerhalb Deutschlands auf (Feldzüge inbegriffen). Frage 126. Haben Sie die Reisen auf eigene Kosten unternommen? Frage 127. Falls nein, auf wessen Kosten? – hatte sie bereits mehrere Extraseiten beigelegt, das war ihr wichtig gewesen, denn wer während des Krieges hatte reisen dürfen, der war verdächtig. Kein alliierter Beamter, hatte sie unterstellt, würde lesen wollen, auf welch seltsame Weise sie Parteigenossin geworden war. Außerdem hätte die Erklärung wie eine billige Entschuldigung geklungen. Und natürlich war sie Mitglied der Reichsschrifttumskammer gewesen. Jeder, der veröffentlichte, war das. Man konnte nur hoffen, dass die Alliierten das wussten.
Bei ihr hatte die Behörde von Anfang an stur nach den Regeln entschieden: Parteizugehörigkeit gleich Veröffentlichungsverbot. Trotzdem hatte sie eine Arbeit, sie schrieb für die Agentur Reuters, was sie einem alten Bekannten aus San Francisco zu verdanken hatte, Webster K. Nolan. Er habe viele Freunde und werde sehen, was er für sie tun könne, hatte er ihr geschrieben, als sie ihn vor etwa einem Jahr um Hilfe gebeten hatte; Informationen aus Berlin seien doch begehrt. Ein paar Tage später hatte sich Reuters telefonisch gemeldet, die im amerikanischen Sektor ein Büro betrieben. Voller Hoffnung war Fee dorthin gefahren. Inzwischen war sie ernüchtert. Sie hatte festgestellt, dass die amerikanischen Reporter den größten Teil der Arbeit selbst erledigten. Für sie, die deutsche Kollegin, fielen nur ein paar Krümel ab, bedeutungslose Termine, Randnotizen, für die sich die Amis zu fein waren. Das Honorar reichte hinten und vorne nicht. Obwohl sie kaum etwas ausgab, war das Geld immerzu knapp, deshalb musste sie endlich wieder Regelmäßigkeit in ihre Tätigkeit bringen, und das ging nur, wenn sie für deutsche Zeitungen schrieb. Zudem hatte sie ein Großprojekt im Kopf, eine mehrteilige Reportage über den Widerstand, die vielleicht dazu beitragen konnte, dass das allgemeine Bild von Deutschland ein wenig zurechtgerückt würde. Sie war erst Anfang 40. Kein Alter, um aufzugeben.
Im Gerichtsverfahren würde sie deutschen Bürgern Rechenschaft über ihr Leben in diesen zwölf Jahren ablegen müssen. Die Richter waren anerkannte Opfer des Faschismus, entweder ehemalige Inhaftierte oder Emigranten. Sie hatte Respekt vor ihrem Schicksal, aber die Frage war, was diese Leute von den Zugeständnissen wussten, die man für ein Überleben diesseits von Flucht oder Gefangenschaft hatte machen müssen. Kannten sie das Gefühl, das sich einstellte, wenn man immer weitermachte, während andere abgeholt wurden und man wusste, dass sie nie wiederkommen würden?
Der Tee zog noch, sie deckte eine Tasse mit der Untertasse ab. Ihr Porzellan hatte seltsamerweise alle Fliegerangriffe überstanden. Die Wohnungstür war eines Nachts durch den Druck einer Bombenexplosion herausgeflogen, die Fensterscheiben waren zu Bruch gegangen, aber das Porzellan im Schrank hatte nur ein wenig gewackelt. Sie begriff nicht, wie das möglich war. Hätte es gerne verstanden.
Die Vorstellung belastete sie, dass sie sich ein zweites Mal vor fremden Leuten für ihr Leben rechtfertigen sollte. Als sie über dem amerikanischen Fragenbogen gesessen hatte, war ihr der Gedanke im Kopf umhergegangen, dass auch die Sieger die eine oder andere Frage beantworten müssten. Sie hätte einige davon gerne dazugeschrieben, zum Beispiel: »Haben Sie je verfolgten Juden die Aufnahme in Ihr Land verweigert?« Oder: »Haben Sie oder Sportler Ihres Landes bei den Spielen 1936 den rechten Arm zum Hitlergruß gegen die Haupttribüne gereckt?« Oder als drittes: »Was hat Ihre Regierung unternommen, als Hitler im gleichen Jahr, 1936, Truppen der Wehrmacht widerrechtlich ins Rheinland marschieren ließ und Sie von deutschen Spionen wussten, dass er sich bei der geringsten militärischen Gegenwehr sofort zurückgezogen hätte? (Übrigens haben wir unser Leben riskiert, um Sie mit dieser Information zu versorgen.) Hätten Sie nicht den Anfängen wehren müssen, als wir es nicht mehr konnten?«
Sie hatte diese Fragen nicht gestellt und würde sie nie stellen. Die Stimmung war eine andere, wer auch nur einen Teil der Verantwortung anderswo suchte, galt als uneinsichtig, als ewiger Nazi. In diese Nähe wollte sie nicht gerückt werden. Also würde sie darüber Rechenschaft ablegen, ob sie als Autorin zu viele Zugeständnisse gemacht hatte. Das war das, was anstand. Ein Anflug von Bitterkeit stieg in ihr auf. Sie kämpfte das Gefühl nieder. Es sollte nicht ihr Leben bestimmen.
Der Brief auf dem Flurtischchen hatte lange genug gewartet. Sie holte ihn in die Küche und schenkte sich Tee ein. Er enthielt die Aufforderung, 1.206 Reichsmark an Gebühr zu entrichten. Wenn sie gezahlt hatte, hieß es in dem Schreiben, würde die Verhandlung vor der Schwurkammer am 28. Mai 1947 stattfinden. Sie hatte dieses Geld nicht. Natürlich konnte sie versuchen, sich welches zu leihen, und stellte sich vor, einen Bekannten um Hilfe zu fragen. Spielte es noch eine Rolle, so oft, wie man sich schon gedemütigt hatte für ein Stückchen Butter oder eine Scheibe Schinken, weil man nicht schon wieder Steckrüben ohne jedes Fett essen wollte? Doch, es spielte eine Rolle, und wenn sie diesen Weg nicht erneut gehen wollte, musste sie sich von dem letzten Wert trennen, den sie noch besaß: der Schmetterlingssammlung ihres Vaters.
*
Ihr Vater war im Sommer 45 gestorben, kurz nach Kriegsende und wenige Monate, nachdem er in das zerbombte Berlin zurückgekehrt war. Selbst in seinem dämmrigen Zustand hatte er damals erkannt, wie sehr die Stadt in Schutt und Asche lag, und die Hände vors Gesicht geschlagen. Sie hatten ihn in Stahnsdorf beerdigt, wo die Russen waren. Es war eine groteske Beisetzung gewesen, der letzte Akt im Leben eines Künstlers, eines Musikers. Den Leichenwagen hatten sie mit Benzin betrieben, das ihr Curt Riess, ein früherer Kollege, geschenkt hatte, der emigriert und als amerikanischer Leutnant nach Berlin zurückgekehrt war.
An der Zonengrenze hatte der zuständige sowjetische Offizier ihnen mitgeteilt, er habe neue Soldaten einer anderen Kompanie bekommen, für die er nicht garantieren könne, deshalb sei es besser, wenn die Frauen allesamt auf amerikanischem Gebiet blieben. Den Sargträgern riet er, alles auszuziehen, was man ihnen abnehmen könne. So wurde Emil Nikolaus von Reznicek von Männern in Unterhosen zu Grabe getragen. An der Seite gafften feixende Rotarmisten, während Fee nur von Weitem zuschauen konnte. Ihr Halbbruder Burghard war gar nicht erst erschienen. Er lebte mittlerweile in Köln, die Reise, so hatte er ihr am Telefon erklärt, sei nicht möglich, er bekomme keine Genehmigung dafür.
Die elterliche Wohnung musste sie alleine auflösen, acht Zimmer, vollgestellt mit Erinnerungen und altem Mobiliar. Bücher brachten auf dem Schwarzmarkt nichts, Orientteppiche kaum mehr. Für das Klavier hatte sie Lebensmittel für ein paar Tage erhalten. Russische Soldaten hatten zwei Kleider und den Wintermantel ihrer Mutter gegen Butter, Speck, zwei Kilo Buchweizen und eine Flasche Wodka eingetauscht. Den größten Wert hatten Briefe gehabt, die Komponistenkollegen wie Hindemith, Alban Berg oder Richard Strauss an ihren Vater geschrieben hatten. Eine Zeit lang hatte sie davon gelebt, immer mal wieder einige dieser Briefe zu versilbern. Jetzt gab es nur noch die Schmetterlinge, beinahe 10.000 Stück in Schaukästen und Pappschachteln.
Sie sah ihren Vater vor sich, wie er sich in seine Sammlung vertieft hatte, während die Welt um ihn in Trümmer fiel. Stundenlang hatte er die Präparate mit der Lupe betrachtet. Jedes der Tiere hatte er selber gefangen, in jüngeren Jahren war er auf der Jagd nach seltenen Exemplaren mit dem Netz durch die Alpen gelaufen, über Wiesen und Felsen und Schneefelder. Von ihm hatte Fee die Leidenschaft für die Berge geerbt. Ihr Vater kannte jede Schmetterlingsart, eine, die bis dato unbekannt war, hatte sogar seinen Namen erhalten. Seine Sammlung besaß einen Ruf unter Fachleuten und hatte Wissenschaftler interessiert. Doch nun war es vorbei. Ihr Vater war tot, und sie wollte weiterleben.
Es gab ein praktisches Problem: Der nächste Schwarzmarkt war zwar in der Nähe, am Bahnhof Charlottenburg, dennoch konnte sie die Schaukästen nicht dorthin transportieren, dazu waren es viel zu viele und sie waren zu sperrig und zu schwer. Ein Auto hatte sie nicht. Schließlich nahm sie nur die Registraturhefte mit, abgegriffene Büchlein mit schwarzem Ledereinband, in denen ihr Vater mit seiner feinen Frakturschrift jedes Stück seiner Sammlung festgehalten hatte. Nach einigen Stunden des Wartens und Anbietens fand sie einen Interessenten, einen etwas schmierigen Herrn mit gezwirbeltem Bart und einem Päckchen Camel in der Brusttasche, der am Ende nicht einmal selber zum Abholen kam, sondern zwei junge Burschen schickte, die die Schaukästen heraustrugen und auf einem Pferdewagen festzurrten. 1.800 Reichsmark gaben sie ihr dafür, wie verabredet.
Am nächsten Tag zahlte sie die verlangte Gebühr ein. Ihre Zeugen hatte sie angeschrieben und der Kammer benannt, Doktor Pechel war zweifelsohne der wichtigste von ihnen. Pechel war ein Freund gewesen, er wusste viel über sie aus dieser Zeit und würde für sie sprechen. Seine Persönlichkeit und seine Aussage hatten wahrscheinlich so großes Gewicht bei den Richtern, dass sie das Urteil günstig beeinflussen würden. Inzwischen wurde ihr aber immer bewusster, dass es nicht um das Publikationsverbot ging, jedenfalls nicht nur. Es stand eine andere, viel gewichtigere Frage im Raum, und die hieß, ob sie zu sehr beteiligt gewesen war. Sie hatte lange auf die Verhandlung gewartet, jetzt grauste ihr davor. Fast noch schlimmer drohten die Wochen bis zu ihrem Beginn zu werden. Die alte Zeit war nicht vorbei, im Gegenteil, sie begann gerade wieder. Alles von vorn.
1. Kapitel
1.
Der 30. Januar 1933 war ein Montag, und Fee verbrachte ihn im Hotel Adlon. Genauso wie das gesamte Wochenende zuvor spielte sie Bridge. Ihre Mutter hatte ihr das Spiel bereits als Kind beigebracht, Fee hatte es im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert, hatte sogar ein englisches Lehrbuch übersetzt, 1.000 Seiten, mit vielen Beispielen. Sie betreute die Bridgeecke in der Vossischen Zeitung, schrieb über Bietsysteme und Spieltechniken und gewann hin und wieder renommierte Spieler als Autoren. In der Redaktion war ihr, als sie von ähnlichen Vorhaben in Österreich und Amerika gelesen hatte, auch die Idee gekommen, einen internationalen Verband zu gründen. Sie hatte Adressen von Klubs aus England, Frankreich und Holland gefunden und sie angeschrieben, und ein Jahr später waren sie alle in Amsterdam zu einem Gründungswochenende zusammengekommen. Selbstverständlich gehörte ein jährliches Turnier dazu, es war geradezu der Clou an der Sache, an wechselnden Orten, in diesem Jahr in Berlin.
Sie ließ sich gegen die plüschige Lehne ihres Sessels sinken und betrachtete anhand einer Liste, was sie da organisiert hatte. Je vier Spieler aus den verschiedenen Ländern, dazu vier aus ihrem Berliner Klub. Eine Menge Planung war vorausgegangen, unzählige Briefe, die sie alle selbst hatte tippen müssen, denn ihre Sekretärin konnte kein Englisch und erst recht kein Französisch. Fee aber war in ihrem Element gewesen. Sie hatte jedem Mitspieler den gleichen Brief geschrieben, selbstverständlich mit eigener Anrede. Formuliert in einer kameradschaftlichen Sprache, mit einem Wir-Gefühl.
Den Termin hatte sie an das Amsterdamer Turnier angelehnt und genau geplant, nicht zu nah an Weihnachten und Neujahr, aber weit genug von Ostern entfernt. Seit einem halben Jahr, seit dem Juli 1932, stand er fest und hatte damals so fern in der Zukunft gelegen, dass alle zugesagt hatten. Trotzdem war Fee bis zum Schluss einen Rest von Zweifel nicht losgeworden und hatte in stillen Momenten befürchtet, dass alles ausfallen würde. Gegen ihre Unruhe hatte sie sich ein Kleid nähen lassen, der Jahreszeit entsprechend aus Wolle, hatte sich sorgfältig angezogen und geschminkt und war reichlich früh ins Hotel gefahren. Dort trank sie in der Halle mehrere Kännchen Kaffee, bis schließlich eine Mannschaft nach der anderen eintrudelte, allesamt in Mäntel und Schals gepackt und trotzdem frierend. Die Westeuropäer hatte keine Vorstellung davon, was ein Berliner Winter war.
Ein eisiger Ostwind pfiff durch die Stadt, die Temperaturen lagen zwischen minus zehn und minus 15 Grad, auf der Spree trieben dicke weiße Eisschollen, aller Schiffsverkehr war eingestellt, die Seen zugefroren, und an den Straßenlaternen hingen Eiszapfen. Wer konnte, blieb zu Hause, alle anderen stapften steifbeinig durch die Straßen. Das Hotel war gut geheizt, und mit ein wenig Whisky für die Engländer und Holländer und dem einen oder anderen Cognac für die Franzosen wurde den Gästen auch innerlich wieder warm. Sie saßen auf den Sofas, redeten in verschiedenen Sprachen durcheinander und erzählten Geschichten von ihrem ersten Zusammentreffen in den Niederlanden. Die Engländer, deren Team erneut von Colonel Beasley, einem Hauptmann aus dem Weltkrieg, angeführt wurde, hatten eine unnachahmliche Art zu scherzen. Ihr Geheimnis war, dass sie sich nicht nur die anderen Leute oder widrige Umstände vorknöpften, sondern vor sich selbst nicht haltmachten. Unübertroffen dabei war ein Mann namens Domville, ein bärtiger Pfeifenraucher, vom König geadelt, sodass man ihn mit Sir Guy anzusprechen hatte. Bei solchen Temperaturen, erklärte er knochentrocken, würden britische Motoren definitiv nicht funktionieren. »Und deshalb gebe ich Ihnen das Versprechen, dass Großbritannien, falls es jemals wieder das Deutsche Reich angreift, das im Sommer tun wird. Der König ist strikt dagegen, dass seine Soldaten erfrieren.«
Die Mitspieler brüllten vor Lachen. Sir Guy schmunzelte und zog genüsslich an seiner Pfeife.
Als die Gruppe später in den Saal umzog, den Fee gemietet hatte, waren die Tische mit grünen Filzdecken belegt. Turnierleiter war ein Franzose, Monsieur Laplace. Sein Akzent war unüberhörbar, als er auf Englisch den Ablauf bekanntgab. Das Los wollte es, dass sie für die erste Runde mit den beiden Engländern an einen Tisch kam. Sie hatte besonders Sir Guy beobachtet. Wie beim letzten Turnier war sein Whiskyglas stets voller gewesen als das der anderen, und er hatte es schneller geleert und sich nachschenken lassen, und wie der Mann dasaß, in seinem Tweedsakko und mit gehäkelter Krawatte, die Pfeife in der einen, einen neuen Drink in der anderen Hand, stellte sie ihn sich in einem Herrenhaus irgendwo in Hampshire oder Wessex vor, mit Butler, Gärtner und Köchin, dazu zwei schwarze Jagdhunde und eine Frau mit näselnder Aussprache. Die halbwüchsigen Kinder besuchten wahrscheinlich ein altes Internat, auf das er selbst genauso wie sein Vater bereits gegangen war. Eines Tages würden sie in die elterlichen Fußstapfen treten, so wie er seinen Ahnen nachgefolgt war.
Angesichts des Trinkverhaltens der Engländer ging sie davon aus, dass sie zusammen mit Krämer, ihrem Partner aus dem Berliner Klub, leichtes Spiel mit Sir Guy und dem Colonel haben würde. Selbstverständlich ließ sie sich nichts anmerken, im Gegenteil, während sie reizten, lächelte sie die Gäste freundlich an und machte höfliche Bemerkungen. Auch als sie ihren Irrtum erkannte, zeigte sie keine Regung. Sir Guy wirkte zwar entspannt, wenn er seine Karten aufnahm, aber er war hochkonzentriert. Und Colonel Beasley war nicht einen Deut schlechter.
Fee und Krämer verloren die erste Halbzeit. Die beiden Engländer schienen sich blind zu verstehen. Sie reizten ihre Kontrakte jedes Mal voll aus. Gleichwohl erklärte Sir Guy, Beasley und er hätten einfach Glück gehabt.
»Fortune favours fools. Im Laufe eines Turners schleift sich das erfahrungsgemäß ab. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir am Ende nicht Letzte werden.«
Fee hielt diese Aussage für blanke Koketterie. Auch Krämer winkte ab und entgegnete in seinem unbeholfenen Englisch, damit rechne er gewiss nicht. Er war ein Preuße durch und durch, in mittleren Jahren, mit Kurzhaarschnitt und Nickelbrille, ein Ministerialbeamter. Fee kannte ihn seit Langem und mochte ihn, weil sich hinter seiner Beamtensteifheit ein Moment von Großzügigkeit verbarg. Sie gewannen das dritte und vierte Spiel. Die Engländer verloren lächelnd. Sie reichten sich die Hände und sprachen Gratulationen aus.
Fee hatte sich vorgenommen, im Laufe des langen Wochenendes mit jedem der Mitspieler ins Gespräch zu kommen, und suchte sich zu den Mahlzeiten stets einen anderen Tischherrn. Es gab nur zwei Frauen bei dem Turnier, neben ihr eine Holländerin, deswegen musste sie sich um Kontakt nicht bemühen, die Männer kamen zu ihr, die Franzosen mit Handküssen und Komplimenten, die Holländer mit ihrer seltsamen Sprache und die Engländer mit ihrer ewigen Ironie. »Darf ich Sie für ein paar Minuten mit meiner Anwesenheit langweilen?«
Am Montagnachmittag beendeten sie die Spiele. Ein französisches Team hatte gewonnen, die Sieger nahmen den Applaus und die vielsprachigen Gratulationen entgegen. Nach und nach verabschiedeten sich die Gäste, holten ihre Koffer aus den Zimmern, knöpften die Wintermäntel zu, zurrten ihre Schals fest und machten sich auf den Weg zum Bahnhof. Vorher gaben sie sich alle das Versprechen, dass sie sich im kommenden Jahr in London wiedersehen würden. Fee hatte sich diesen Montag freigenommen. Als Gastgeberin blieb sie bis zum Schluss, und als ihr Blick im Hotel auf die Schlagzeile einer Abendzeitung fiel, las sie zwar, dass der Reichspräsident am Vormittag einen neuen Kanzler ernannt hatte, doch jetzt wollte sie davon nichts wissen. Für derlei Dinge war morgen Zeit. Diesen Tag sollten sie nicht verderben.
Die letzten Spieler, die aufbrachen, waren Sir Guy und Colonel Beasley, die sich einen Nachtzug nach Calais gebucht hatten, wo sie am nächsten Morgen die Fähre über den Ärmelkanal nehmen wollten. Zusammen traten sie durch das Portal des Hotels auf die abendliche Straße. Dort aber kamen sie nicht weiter. Vor ihnen stand eine dichtgedrängte Menschenmenge, allesamt mit dem Rücken zu ihnen, die Gesichter der Straße zugewandt.
»What’s going on?«, fragte Sir Guy.
Er hatte seinen Mantelkragen aufgestellt, trug einen karierten Schal und dazu eine Tweedkappe, wie sie Arbeiter im Wedding aufzogen, nur dass sie bei ihm die Ausstrahlung eines britischen Adeligen noch betonte.
Fee schob sich durch die Menge. Die Engländer, beide ihre Koffer in der Hand, folgten ihr, wobei sie andauernd »Excuse me« oder »Sorry« sagten und oft beides zusammen. Obwohl der Abend längst angebrochen war, war es sehr hell, deshalb ahnte sie, was sie sehen würde, und als sie schließlich die erste Reihe erreicht hatte, war sie nicht überrascht. Ein Fackelzug, endlos lang. Braune Uniformen und Marschschritte. Publikum auf beiden Seiten der Straße, Gedränge, soweit man sehen konnte, ausgestreckte Arme. Das passte zu der Schlagzeile der Abendzeitung.
»Was bedeutet das?«, fragte Sir Guy.
Colonel Beasley schaute auf seine Uhr. Sie mussten zum Bahnhof Friedrichstraße und dazu die Linden überqueren. Doch das war schlicht unmöglich. Im Fackelzug gab es keine Lücke. Es war nicht zu erwarten, dass jemand für sie anhalten würde.
Fee stellte sich auf die Zehenspitzen. Der Aufmarsch reichte weiter, als sie blicken konnte, auf der einen Seite bis zum Brandenburger Tor, auf der anderen die Linden hinauf, und überall dichte Reihen von Gaffern. Die Berliner glaubten wahrscheinlich, dass es etwas umsonst gab, und dass sie, wenn sie den rechten Arm nur weit genug reckten, schneller drankämen. Die Tritte der schwarzen Stiefel knallten auf das Pflaster. All die brennenden Pechfackeln, die braunen Uniformen und Fahnen, dazu die schweigenden Marschierer, ihr kindlicher Ernst – die gesamte Veranstaltung hatte etwas Jungenhaftes. Eine Pfadfindertruppe in einem Ferienlager.
Als Sir Guy erneut fragte, was das zu bedeuten habe, erwiderte Fee auf Englisch: »Wenn diese Leute an der Regierung bleiben, dann bedeutet das früher oder später Krieg.«
»Werden sie an der Regierung bleiben?«
»Natürlich nicht.«
2.
Sie fuhr mit der Elektrischen nach Hause und fand die elterliche Wohnung hell erleuchtet. Im Flur, im Wohnzimmer, in der Küche, überall brannten die Gaslampen. Mehrere Öfen waren geheizt, es war warm. Sie hörte Stimmen, und als sie ins Esszimmer trat, saß die gesamte Familie dort, auch ihre Brüder Burghard und Emil. Beide hatten eigene Hausstände, aber Burghard war seit einigen Monaten zum zweiten Mal geschieden, und um Emils Ehe schien es auch nicht zum Besten zu stehen, weshalb sie sich regelmäßig bei den Eltern aufhielten.
»Gut, dass du kommst, Fee«, sagte ihr Vater. Seine Stimme, weich und liebevoll, hatte sie als Kind immer an einen Mantel denken lassen, der sie umhüllte. Die Familie, genauso wie alle Bekannten und die Musikwelt, nannten ihn nach den Initialen seiner beiden Vornamen, Emil und Nikolaus, EN. Fee hielt es ein wenig anders. Wenn sie über ihn sprach, sagte sie ebenfalls EN, aber wenn sie ihn anredete, blieb sie bei dem alten Wort Papa. Er trug einen Winteranzug und Krawatte. Sein Kopf sah im Licht der Lampe gerötet aus, als hätte er sich aufgeregt. Neben ihm saß Fees Mutter in einem dunklen Kleid und mit einem Seidentuch um den Hals. Sie starrte auf die Tischplatte und auf ihre Hände, die dort lagen.
»Ja, gut, dass du da bist«, erklärte Burghard. »Heute ist der Abend der Geständnisse. Hast du überhaupt gehört, was passiert ist?«
Er war der Sohn der Mutter aus erster Ehe, EN hatte ihn adoptiert. Selbst im Sitzen überragte er, ein Kerl von einem Meter 95, alle anderen. Auch mit Ende 30 hatte er sich sein sonniges Gemüt bewahrt, wozu die Tatsache beitrug, dass er durch seinen Vater eigenes Vermögen besaß und deshalb keine Geldsorgen kannte. Was er meinte, war ihr klar, die neue Regierung mit Hitler an der Spitze, eine Koalition aus Nationalsozialisten, Deutschnationalen und den alten Frontkämpfern vom Stahlhelm. Die Parteien der Mitte waren in die Opposition verbannt.
»Das war nicht zu übersehen. Trotz der Kälte schaut halb Berlin den braunen Pfadfindern zu. Fackeln haben sie jedenfalls genug.« Sie stellte ihre Tasche ab. »Was für Geständnisse?«
»Setz’ dich erst mal«, forderte EN sie auf. »Wir halten hier eine Art Familienrat ab.«
Für gewöhnlich überspielte er konfliktträchtige Situationen mit einem Scherz, aber diesmal war das anders. Ihr erster Eindruck stimmte, er wirkte erregt, also hatten sie sich bereits auseinandergesetzt. Keiner widersprach ihm, überhaupt wollte offenbar niemand reden. Auf dem Tisch stand ein Krug mit Wasser. Fee nahm sich das Glas von Emil, neben den sie sich gesetzt hatte, schenkte es voll und trank es in einem Zug aus. Nach dem vielen Alkohol mit den Engländern tat das Wasser gut. Sie goss das Glas wieder voll und leerte es ein zweites Mal.
»Jetzt bin ich soweit.«
Sie rechnete mit irgendeiner zum Drama aufgeblasenen Kleinigkeit. Dazu passte die Szenerie – die Familie an dem ovalen Tisch, das gelbliche Licht der Gaslampe, das sah irgendwie nach Theater aus, nach Oper, kurz bevor jemand mit seiner Arie ansetzt und das ausweglose Schicksal beklagt. Ihre Mutter schaute weiterhin ihre Finger an. Auf Fee wirkte sie traurig und auch dünner als sonst. Dabei hatte sie in der letzten Zeit ganz normal gegessen. Trotzdem waren ihre Wangen eingefallen. EN starrte die Wand an, als stünde dort ein Geheimnis, das er ergründen wollte. Selbst Burghard, der sonst immerzu plapperte, hielt den Mund. Emil hatte die Lippen zusammengekniffen.
»Was ist nun?« Fee war ungeduldig. »Höre ich die Geständnisse? Oder wollen wir schweigen?«
»Berta?«, sagte EN und legte seine Finger sanft auf ihre Hand.
Fees Mutter streckte den Rücken, und mit einem Schlag war ihr seltsamer Gemütszustand verflogen. Nach guter alter Reznicek’scher Maxime riss sie sich am Riemen.
»Ich habe unserer Familie mitgeteilt, dass meine Mutter, also eure Großmutter, Jüdin war. Volljüdin, wie man heute sagt.«
»Oh Gott, wie furchtbar.« Fees Satz klang so ironisch, wie er hatte klingen sollen.
Burghard lachte auf. Fee wartete darauf, dass einer ihrer Brüder zu einem Kurzvortrag über das Thema Nazis und Juden ansetzte, aber das geschah zum Glück nicht. Jeder kannte diesen Hass, seit Jahren brüllten ihn die Naziführer in ihren Reden in die Welt, in ihren Zeitungen wiederholten sie mit nervtötender Penetranz, dass die Juden an allem Elend in der Republik schuld seien, und das braune Fußvolk setzte dazu die Fäuste ein.
»Wer glaubt denn, dass sich Hitler lange halten wird?«
»Ich glaube das«, sagte Emil. Seine erste Regung, seit sie da war, und der Satz klang so barsch, dass jeder Widerspruch zu Streit führen würde.
»Ich nicht«, sagte sie trotzdem. »Aber selbst wenn, haben diese Leute angesichts von Massenarbeitslosigkeit und sonstigem Elend nichts Besseres zu tun, als sich um eine tote jüdische Großmutter zu scheren? Sie werden nicht einmal von ihr erfahren.«
Keiner antwortete. Fee bekam den Eindruck, die anderen seien vor ihrem Eintreffen schon an dieser Stelle gewesen. Sie wandte sich an ihre Mutter. »Du hast doch immer gesagt, deine Eltern seien Calvinisten gewesen.«
»Das waren sie auch. Die Familie meiner Mutter ist konvertiert, als sie ein kleines Kind war.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Nazis irgendeine Bedeutung hat.«
»Emil«, sagte EN, »du bist dran.« Das war ein Befehl, recht streng und deshalb untypisch für ihren Vater. Er hatte Emil nicht einmal angeschaut.
»Ich bin Mitglied der NSDAP.«
»Wie bitte?«
»Ja. Und deshalb muss sich niemand von euch Sorgen machen. Ich schütze euch, wann immer es notwendig sein sollte.«
Ihr Mund stand offen. »Seit wann?«
»Knapp zwei Jahre. 1931 bin ich eingetreten. Ich bin auch in der SS.«
Emil war dunkelhaarig, er hatte einen gedrungenen, muskulösen Körperbau. Er war fast einen Kopf kleiner als Burghard, gleichwohl war er der härtere, männlichere ihrer Brüder. Burghard war der, mit dem man über alles reden konnte, Emil dagegen der Schweigsame, manchmal Verstockte. Trotzdem hatte sie Emil immer mehr geliebt. Als Kind hatte sie ihn »Putz« genannt, weil er sich gerne schick angezogen hatte. Ihr kam der Gedanke, dass er der SS beigetreten war, weil er sich gerne in der schwarzen Uniform zeigen wollte. Aber das stimmte natürlich nicht. Er war nicht mehr der liebenswerte Junge von früher. Beinahe wirkte er fremd auf sie.
»Ich kann’s nicht glauben. Du bist doch ein intelligenter Mensch. Hochintelligent sogar, haben sie das nicht immer in der Schule gesagt? Wie kannst du dich einer solchen Bande von Rüpeln anschließen? Das ist nicht wahr, oder?«
Mit einer knappen Bewegung klappte er das Revers seines Jacketts um. Eine Nadel kam zum Vorschein, ein Emailleabzeichen, das ein schwarzes Hakenkreuz auf rotem Untergrund zeigte.
In den letzten Jahren hatten sie nur selten über Politik gesprochen, es gab auch wenig zu debattieren, denn die Dinge hatten sich nicht verändert, der Reichspräsident war ein Greis, die bürgerlichen Abgeordneten bekämpften sich gegenseitig, die Nazis und Kommunisten prügelten sich auf der Straße. Angesichts der Wirtschaftskrise hatten die Rezniceks, genauso wie die meisten ihrer Bekannten, andere Sorgen. Fee ging wählen – manchmal widerwillig, weil es so häufig war – und machte meistens ihr Kreuzchen beim Zentrum oder bei der DVP, der Deutschen Volkspartei. Sie war davon ausgegangen, dass ihre Familie es genauso hielt. Das war offenbar ein Irrtum gewesen.
»Was sagst du denn dazu?«, fragte Fee ihren Vater.
»Ich habe meine Meinung bereits geäußert«, erwiderte er.
»Und zwar ziemlich lautstark«, ergänzte Burghard.
Ihr Vater nickte. Offenbar hatte Fee eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn verpasst. Es tat ihr nicht leid darum, EN war kein Mensch, mit dem man streiten mochte, dazu war er zu weich, zu verletzbar, was dazu führte, dass man meistens klein beigab. Nicht nur ihr ging das so, sondern auch den Brüdern. Aber an diesem Abend war es offenbar anders gelaufen.
Fee ärgerte sich über Emil, darüber, dass er seine Parteimitgliedschaft so lange verschwiegen hatte, und auch über die Kälte, mit der er sie jetzt preisgegeben hatte. Wut machte sich in ihr breit. Ihr wurde warm, wahrscheinlich war sie auch rot im Gesicht. Aber sie würde sich nicht die Blöße geben und ihren Gefühlszustand zeigen. »Na gut«, sagte sie, »dann können wir ja jetzt ins Bett gehen. Ich bin müde.«
Keiner regte sich. Alle starrten wieder in die Luft, was Fee glauben ließ, sie habe noch mehr verpasst, und auch das sollte ein weiteres Mal zur Sprache kommen.
»Gibt’s noch etwas?«
»Ja«, antwortete ihre Mutter.
»Und was ist das?«
»Emil benötigt einen … wie heißt das Ding?«
»Ariernachweis«, sagte er.
»Ariernachweis?« Fee wiederholte das Wort und zog es dabei in die Länge, weil es so absurd klang. Obwohl sie wusste, was gemeint war, ließ sie es sich erklären, in der vagen Hoffnung, es wäre Emil peinlich, und er würde die Lächerlichkeit selbst empfinden. Immerhin war er so feinfühlig, dass er die Mutter nicht anschaute, als er ausführte, dass seine Partei dokumentiert haben wollte, dass es keine Juden in der Familie gab.
»Tolle Freunde hast du«, sagte sie. »Gratuliere.«
»Finde ich auch«, sagte Burghard. »Putz braucht seinen Nachweis übrigens nicht nur für eine oder zwei Generationen, sondern bis zur Zeit von Napoleon. Das ist der Standard bei der SS.«
»Ich heiße Emil. Nenn mich gefälligst auch so.«
»Oh, entschuldige.« Burghard lächelte fein. Fee sah voraus, dass er sich diesen Spaß nicht verderben ließ. »Also: Nicht Putz, sondern Emil braucht diesen Nachweis. Aber die Jahreszahl stimmt, nicht wahr? 1800. Oder ist es noch länger?«
»Spar dir deine bürgerliche Ironie.«
»Kinder, bitte«, mischte sich EN ein, »nicht schon wieder Streit. Dazu ist die Lage zu ernst.«
»Ich weiß auch nicht, was es da zu streiten gibt«, sagte Fee. »Die Fakten sind eindeutig. Du hast mütterlicherseits eine jüdische Großmutter. Und wer weiß, was auf deiner Seite war, Papa. Österreich-Ungarn, ich bitte euch. Böhmen, Galizien, Moldau – da haben doch immer Juden gelebt. Und sich fortgepflanzt. Einige werden sich auch gemischt haben.«
»Ah, geh«, sagte EN in breitem Wienerisch. »Bei uns gab es ja nicht einmal Geburtsscheine.«
»Wie auch immer, es wird auf jeden Fall verdammt schwer, dass du 130 Jahre Ariertum nachweist.« Fee blieb in dem ironischen Tonfall ihres Vaters. »Das gilt für deine beiden Seiten.«
»Ich brauche das aber!« Emil schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und stand auf. »Also helft mir dabei. Vergesst nicht, es ist auch zu eurem Schutz.«
Ohne ein weiteres Wort verließ er das Zimmer. Sie hörten die Wohnungstür schlagen. Eine seltsame Leere blieb zurück.
»Was machen wir nun?«, fragte ihr Vater.
»Er soll sich selber kümmern«, entgegnete Burkhard. »Ist schließlich seine Partei.«
»Ich fürchte, da machst du es dir zu einfach«, sagte ihre Mutter.
»Meinst du?«, fragte Fee. »Der Spuk ist doch bald wieder vorbei. Und wenn Putz nicht von selber austritt, schmeißen sie ihn eben raus. Das ist doch klasse.«
Niemand erwiderte etwas, das Gespräch erstarb wie ein Motor ohne Benzin. Es folgten noch ein paar Floskeln und ein paar höfliche Fragen nach ihrem Bridgeturnier, von dem Fee einen kurzen Bericht gab. Bald verabschiedeten sich die Eltern, erst die Mutter, die ins Bett wollte, nach ihr auch EN. Fee blieb mit Burghard zurück, der seit seiner Scheidung viel Zeit hatte.
Fees saß die Müdigkeit in den Beinen genauso wie im Verstand. Das Wochenende im Adlon war anstrengend gewesen. Sie gähnte, dabei fielen ihr die vielen Koffer der abreisenden Bridgespieler ein. »Vielleicht wäre es das Beste, wir würden allesamt für ein paar Wochen aus Deutschland verschwinden. Wenn wir eine neue Regierung haben, kehren wir zurück. Das ist nicht mehr als ein langer Urlaub.«
»Und wo sollen wir deiner Meinung nach hin?«
»In die Schweiz. Es ist Mamas Land. Remarque lebt auch dort.«
»Dein Freund Remarque. Jemand, dessen Buch in 30 Sprachen übersetzt wurde. Wer kann sich mit dem vergleichen?«
3.
Am nächsten Morgen diktierte sie ihrer Sekretärin eine Glosse für die Bridgeecke der Vossischen, ließ in ihren Text ein paar Scherze über Missverständnisse und Sprachverwirrung einfließen, erzählte von Eigenarten der Spieler aus anderen Ländern, beschrieb den einen oder anderen Trick, mit denen die Franzosen und Engländer ihre Gegner überrascht hatten. Als Alice das Blatt Papier aus der Maschine zog und Fee den Text Korrektur las, fand sie ihn gelungen. Nur zwei Mal stellte sie per Hand ein paar Wörter um. Ein neuerliches Abtippen war nicht nötig.
Seit drei Jahren war Alice mittlerweile bei ihr. Fee hatte sie eingestellt, als sie begonnen hatte, zusätzlich zum Journalismus die Geschäfte ihres Vaters zu führen. Dort fiel eine Menge Korrespondenz an, jeden Tag gab es Post zu bearbeiten, stets mussten neue Konzerte festgelegt, die Vereinbarungen bestätigt und vertraglich fixiert werden, außerdem hatte sie die Abrechnungen zu prüfen. EN hatte sich nie um diese Dinge geschert, ihm war im Zweifelsfall eine neue Melodie im Kopf wichtiger als eine ausstehende Gage. Zu zweit hatten sie Ordnung in seine Dinge gebracht, wobei sich Alice ausgesprochen patent angestellt hatte. Sie ging ihre Aufgaben mit viel Schwung an. Sie war Anfang 20 und hatte dichtes schwarzes Haar, das ihr auf die Schultern fiel und ihr rundes Gesicht umrahmte.
Über Politik sprachen sie nie, auch an diesem Morgen nicht, obwohl er anders war als die anderen. Marie, die Haushälterin, klopfte und brachte Tee. Fee diktierte noch zwei Briefe für EN, die er unterschreiben musste. Er schlief um diese Zeit noch. Alice musste auf ihn warten, bevor sie die Briefe zur Post bringen konnte, während Fee ins Ullsteinhaus in der Kochstraße fuhr, den Artikel für die Vossische in der Tasche. Sie hätte ihn per Telefon durchgeben können, doch da sie für mehrere Blätter des Verlages arbeitete, bemühte sie sich, an den Redaktionskonferenzen teilzunehmen. Dort wurden die Aufträge vergeben, ein Bericht über eine Modenschau am Kudamm oder über einen Empfang beim Tennisklub Rot-Weiß, vielleicht auch mal nur die Vorankündigung eines Konzerts oder 30 Zeilen über eine defekte Oberleitung, die die Elektrische zum Stehen gebracht hatte.
Im Ullsteinhaus hatte sich etwas verändert, das empfand sie, sobald sie eingetreten war. Es herrschte eine seltsame Stille. Die übliche Geschäftigkeit war verflogen, die Leute gingen stumm aneinander vorbei, niemand blieb auf ein Schwätzchen stehen oder rief eine Neuigkeit über den Flur. Viele Mitarbeiter trugen plötzlich Nadeln am Revers, die gleichen wie Emil, mit schwarzem Hakenkreuz auf rotem Emaillegrund. Wie ihr Bruder hatten auch die Ullsteinleute sie bis dahin offenbar auf der Rückseite ihrer Jackenkrägen versteckt gehalten.
Fee hatte sich seit Langem gefragt, wo die vielen NSDAP-Wähler herkamen, 35, fast 40 Prozent bei der letzten Reichstagswahl. Mehr als jeder Dritte war für die Braunen, aber sie kannte keinen Einzigen davon. Zumindest hatte sie das geglaubt und war davon ausgegangen, dass die Nazis ihre Anhänger vor allem in der Provinz hatten, irgendwo im tiefsten Schlesien oder bei ostpreußischem und bayerischem Landvolk. An diesem Morgen erkannte sie ihren Irrtum. Sie hatten sich im Verborgenen gehalten, hatten ihre Meinung nicht geäußert, waren nie aufgefallen. Ein Geheimbund. Was diese Leute wohl machen würden, wenn ihre Zeit vorüber sein würde? In welches Loch würden sie sich verkriechen?
Im Treppenhaus begegnete sie einem Betriebsrat des Verlages, einem Mann namens Lissen, der einen buschigen Schnauzbart trug und nie einen Hehl daraus gemacht hatte, dass er SPD-Mitglied war. Er blieb stehen.
»Fräulein von Reznicek, auf ein Wort.«
»Bitte.«
Er hatte dunkle Augen und schaute ihr ins Gesicht. »Lassen Sie mich ganz direkt fragen: Gehören Sie auch dazu?«
»Zu den Braunen?«
»Ja.«
»Sicher nicht.« Sie überlegte, wie vielen Leute er seine Frage an diesem Morgen schon gestellt haben mochte. Fast wirkte es, als machte er innerhalb des Verlages eine private Erhebung.
»Dann bin ich beruhigt«, erwiderte er und schmunzelte. »Ich gebe der neuen Regierung ein paar Wochen, bestenfalls drei Monate. Die Vorgänger haben auch nicht länger gehalten. Und wissen Sie, was hier dazukommt? Die Partner passen überhaupt nicht zusammen. Ein Großkapitalist wie Hugenberg und ein Pinscher wie Hitler, wie soll das gehen?«
Fee ging davon aus, sein Parteivorstand hatte diese Sichtweise ausgegeben, und sie stand bereits im Vorwärts. Fee fand es beruhigend, dass die SPD so klar Position bezog.
»Es wird sich schnell zeigen«, fuhr Lissen fort, »dass man mit SA-Schlägern und Judenhetze zwar Wählerstimmen gewinnen, aber keine Probleme lösen kann. Dafür braucht es andere Kompetenzen. Wir haben übrigens immer gesagt, dass man das Reich auf Dauer nicht gegen die Arbeiterklasse regieren kann. Das ist ausgeschlossen.«
»Wahrscheinlich, ja.«
»Ganz bestimmt sogar. Denken Sie an meine Worte, Fräulein von Reznicek, drei Monate, dann ist diese Regierung Geschichte. Höchstens drei Monate.« Zum Gruß tippte er sich an die Schläfe.
Anders als in den Fluren und im Treppenhaus wurde hinter den verschlossenen Türen der Redaktionsbüros durchaus über die Neuigkeiten gesprochen. Wohin sie auch kam, zur Vossischen, zur Morgenpost, zur BZ am Mittag, überall gab es zwei Meinungen. Wesentlich lauter war die, die wie Lissen und wie Fee von einer kurzen Zeit der neuen Regierung ausging. Sie hatten gute Argumente – die letzten Kabinette hatten so schnell gewechselt, dass sich kaum noch jemand an die Namen der früheren Reichskanzler erinnerte. Außerdem hatten die neuen Minister keinerlei Erfahrung, genauso wenig wie Hitler, und ohne Erfahrung ging es nun mal nicht.
Man werde ja sehen, erwiderten die anderen.
Ihr Widerspruch klang wie kindlicher Trotz.
Zwei Stunden später, sie hatte ihren Artikel abgegeben und abnehmen lassen, an zwei Redaktionskonferenzen teilgenommen und wollte das Haus gerade wieder verlassen, sah und hörte sie eine Gruppe von etwa 30 Mitarbeitern, die wie ein Demonstrationszug durchs Treppenhaus marschierten. »Juden raus, Juden raus«, skandierten sie.
Fee stand an einem Geländer. Ihr Mund stand offen, sie war sprachlos. Einige Redakteure kamen aus ihren Büros, die meisten hemdsärmelig, die Krawattenknoten gelockert. Arthur Lohmann stellte sich neben sie, der stellvertretende Chefredakteur der Morgenpost, ein Mann mit einem rotbraunen Vollbart. Sie war noch nie mit ihm warm geworden, warum auch immer, sie fand keinen Draht zu ihm und fragte sich auch jetzt, wie sie ihn ansprechen sollte. Dazu müsste man wissen, welche Ansicht er vertrat. Wie die meisten Kollegen schaute er schweigend zu und reagierte auch nicht, als jemand rief: »Hört auf!« Ein anderer setzte hinzu: »Schämt euch!«
Der Theaterkritiker Curt Riess bezog den Platz auf ihrer anderen Seite. Mit ihm war es ganz anders als mit Lohmann, sie redete gern mit ihm. Er war schwarzhaarig, hatte einen kräftigen Schädel und eine tiefe Stimme. Obwohl in Fees Alter, erst Anfang 30, hatte er bereits einen Ruf als Kritiker.
»Wie die Ratten, die plötzlich aus ihren Löchern kommen. Ich hoffe, Sie sind keine von denen, Fräulein von Reznicek.«
Sie wandte sich ihm zu, wodurch sie Lohmann im Rücken hatte. »Gott bewahre. Die Leute, die da brüllen, bekommen ihr Geld von jüdischen Verlegern. Die schreien sich gerade um ihre Existenz.«
»Zumal Ullstein besser zahlt als die anderen Häuser im Zeitungsviertel. Aber von den kleinen Widersprüchen des Alltags lassen sich die Hasen nicht stören. Denen geht’s ums Große.«
»Die Hasen?«
»Die Braunen. Die braunen Hasen.«
»Das gefällt mir«, erwiderte sie. »Scheue Tiere. Wenn wir laut klatschen, verschwinden sie in ihren Höhlen.«
»Wir sollten nicht zu lange damit warten.«
»Sie haben recht. Verjagen wir sie wieder.«
4.
Am 1. April, dem Tag des Judenboykotts, stieß Fee überall auf SA-Männer mit ihren Schildern: »Deutsche, kauft nicht bei Juden«. Niemand traute sich in die bewachten Geschäfte, die Passanten machten einen weiten Bogen darum, und Fee hielt es nicht anders. Sie fand ein wenig Trost in dem Gedanken, dass nicht nur Sonnabend, sondern auch Sabbat war, was die Nazis offenbar nicht bedacht hatten. So hatten sie Posten vor geschlossenen Läden bezogen. Wo es anders war, zeigten sie sich umso härter. Einem Mann, offenbar Inhaber einer Münzhandlung, hatten sie ihr Schild um den Hals gehängt. Zudem hatten sie ihn gezwungen, Schuhe und Strümpfe auszuziehen, er musste barfuß auf den kalten Pflastersteinen neben seinem Laden stehen, dieses dämliche Plakat um den Hals.
Am Abend kam Emil zu ihnen in die Knesebeckstraße. Sie waren beim Essen. Emil trug Zivil, nicht seine schwarze Uniform, trotzdem konnte Fee ihn kaum anschauen. Es zog sie fort, in ihr Zimmer, sie ertrug seine Gegenwart nicht. Nur der Gedanke, dass sie sich von ihm nicht vertreiben lassen wollte, hielt sie.
»Was soll nun werden?«, fragte ihre Mutter.
»Was meinst du, meine Liebe?«, fragte EN.
»Ich meine das, was passiert. Den Judenboykott.« Sie wirkte ausgesprochen sachlich, als gelte es, ein technisches Problem zu lösen. Dass es um sie ging, hätte ein Fremder kaum bemerkt.
EN legte seine Hand auf ihre. »Ich beschütze dich, Berta, das ist doch selbstverständlich.«
Er war ein alter Mann, im nächsten Monat würde er seinen 73. Geburtstag begehen. Fee ging davon aus, dass er keine Vorstellung von dem hatte, was er da versprach. Obwohl er jeden Tag seine Runde durch Charlottenburg und den Tiergarten drehte, ahnte er nicht, wie sehr die Gewalt um sich gegriffen hatte.
Fee zwang sich, Emil anzusehen. Es gelang ihr nur für einen Moment. Ihre Mutter zog ihre Hand unter der ihres Mannes fort. Sie schenkte ihm keine noch so kleine Zärtlichkeit, dankte ihm auch nicht für sein Schutzangebot. Offenbar hatte sie nicht viel Vertrauen in seine Zusage.
»Ich passe auf. Auf euch alle«, sagte Emil.
»Das hast du neulich schon behauptet«, platzte es aus Fee heraus. »Passt du auch auf die jüdischen Geschäfte am Kudamm auf?«
»Natürlich nicht. Wie sollte ich das tun?«
»Und auf Freunde von dir, die zufällig Juden sind?«
»Wenn ich kann.«
»Wenn du kannst! Dann solltest du es Mama auch so sagen: Ich passe auf, wenn ich kann. Wahrscheinlich kannst du nicht.«
Er warf ihr einen bösen Blick zu. Seine Augenfarbe war ein stumpfes Blau. Sein Gesicht wirkte schmal und hart.
»Allemal besser als du.«
»Kinder, hört auf«, verlangte EN. »Wir essen.«
»Ich mache jedenfalls nicht mit bei diesem Mist.«
»Spar dir deine Ausdrücke. Wir sind die Bewegung, die Deutschland retten wird.«
Ihre Mutter schaute ihn mit großen Augen an. Fee erinnerte sich gut daran, wie sie im Weltkrieg die deutschen Siege bejubelt und bei den Niederlagen gelitten hatte. »Das heilige Deutschland muss leben«, war einer ihrer oft wiederholten Sätze gewesen. Mittlerweile allerdings hatte dieses Deutschland Berta von Reznicek, geborene Juillerat, mütterlicherseits aus der Familie Haas und Tochter einer Jüdin, zu seiner Feindin erklärt.
»Retten?«, wiederholte Fee mit gepresster Stimme. »Ich würde mir diesen Satz am liebsten aufschreiben und ihn dir in ein paar Jahren vorlegen.«
»Gerne.« Emil klang kalt. »In vier Jahren werden wir alle dieses Land nicht wiedererkennen.«
»Geschwätz von eurem Führer. Dumm, wer darauf hereinfällt. Mit dem Ermächtigungsgesetz habt ihr bereits alles kaputt gemacht. Nach zwei Monaten Hitler haben wir eine Diktatur. Wo wir in vier Jahren stehen, will ich gar nicht wissen.«
»Kinder, jetzt hört auf«, sagte ihr Vater erneut.
Emil schenkte ihm keinerlei Beachtung. »Dumm ist allein der, der nicht an die Bewegung glaubt. Wir werden Deutschland erneuern. Dafür braucht man nun einmal Macht. Ein Quasselparlament kann so etwas nicht. Das hat die Vergangenheit ja hinreichend gezeigt.«
»Ich hätte nie gedacht, dass du so blind bist. Und so naiv.«
»Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört«, erklärte EN, »dann stehe ich auf und gehe, und ihr könnt eure Mahlzeit alleine fortsetzen.«
Der entschiedene Tonfall klang fremd aus seinem Mund, aber er half. Sowohl Emil als auch Fee verstummten, und EN nutzte das Schweigen und erzählte von Richard Strauss, mit dem er befreundet war und der früher ebenfalls in der Knesebeckstraße gewohnt hatte. Er hatte den alten Freund auf seinem Spaziergang von Ferne gesehen und beschrieb ausführlich, wie Strauss in einem Horch mit Chauffeur über die Charlottenburger Chaussee gefahren worden war. Die Leute seien stehengeblieben und hätten gegafft. Wahrscheinlich hatten sie ihn für einen der neuen Machthaber gehalten. EN kicherte, er freute sich bereits auf seine Pointe. Ein Machthaber? Oh nein, nur ein Dirigent, der wahrscheinlich aus seinem Hotel kam und zur Orchesterprobe unterwegs war.
Fee dachte über Emil nach und kam zu dem Schluss, dass er klare Strukturen schätzte, Befehl und Gehorsam, aber Zeiten von Unentschiedenheit und Debatte nicht ertrug. Wahrscheinlich war er um dieser Klarheit willen beigetreten. Eins und eins macht zwei. Anweisung und Ausführung bedeutet Handlung. Reibungsverluste fielen weg. Offenbar war es das, was ihn an den Nazis faszinierte.
Nach dem Essen ergriff er wieder das Wort. »Ich meine es ernst, Fee. Ich werde auf Mama aufpassen. Aber ich brauche deine Hilfe.«
»Meine Hilfe?« Sie hörte selbst, dass sie immer noch entrüstet klang, und bemühte sich um einen verbindlicheren Tonfall. »Und was soll ich für dich tun?«
»Mir den Ariernachweis besorgen.«
»Du bist kein Arier. Begreifst du das nicht?«
»Fee …«
»Was? Es ist doch wahr.«
»Fahr für mich in die Schweiz und sprich mit dem Pfarrer an dem Ort, wo die Großeltern gelebt haben. Wo sie geheiratet haben. Der wird nicht so streng sein. Ich brauche eine Bescheinigung. Irgendwas Amtliches. Hier werden sie am Ende schon nicht so genau hinschauen.«
»Kommt nicht infrage. Fahr doch selber.«
»Ich kann nicht weg. Meine Arbeit im Ministerium ist … nein, das ist geheim.«
Er sah sie an, eindringlich, wie sie fand, vielleicht sogar flehend. Schon immer war es ihre Aufgabe in der Familie gewesen, anstehende Probleme zu lösen. Sie hatte stets die offiziellen Briefe schreiben müssen, mit dem Finanzamt verhandelt oder mit dem Hausverwalter gesprochen. Aber diesmal nicht, auch wenn da etwas an ihm war, das ihr leidtat. Er hatte sich verrannt, glaubte sie, und fand den Ausgang nicht mehr.
Sie erkannte, dass seine Bitte an sie der Grund gewesen war, warum er an diesem Abend überhaupt gekommen war. An den Judenboykott hatte er wahrscheinlich überhaupt nicht gedacht. Offenbar stand er bei der SS unter Druck. Trotzdem konnte sie sich nicht vorstellen, seinen Nachweis für ihn zu besorgen.
»Es tut mir leid, ich habe auch keine Zeit«, sagte sie.
Damit war die Debatte beendet.
Später am Abend kam ihr Vater in ihr Zimmer, was ungewöhnlich war. Er klopfte an und trat ein. Sie war noch angezogen. Er setzte sich auf ihren Sessel, sie sich aufs Bett.
»Fee …«, begann er.
Sie hatte keine Ahnung, was er wollte. »Was ist?«
»Ich habe eine Bitte.«
»Und welche?«
»Überleg’ dir noch mal, ob du Emil nicht doch helfen kannst.«
»Warum fährt er nicht selber?«
»Er kann wirklich nicht. Soweit ich weiß, soll er in ein Ministerium wechseln, das ganz neu aufgebaut wird. Die haben ihn angefordert.«
»Göring?«
»Ich glaube, ja. Du musst mir jetzt keine Antwort geben. Nur, dass du’s dir noch mal überlegst.«
»Papa …«
»In einem hat er recht – er könnte uns alle beschützen. Berta besonders. Aber dafür braucht er diesen blödsinnigen Nachweis. Wenn er aus seinem Verein fliegt, dann kann es für uns alle ungemütlich werden.«
Sie drehte sich weg. Es war ihr zuwider, sich an diesem Mist zu beteiligen. Andererseits hatte er recht. Für den Fall, dass die Nazis wirklich einige Jahre an der Macht blieben, musste man vorsorgen.
Er streckte ihr seine Hand entgegen, sie ergriff sie.
»Wenn du das möchtest, dann fahre ich.«
Er blickte auf und lächelte. »Ich habe dich lieb, mein Kind.«
Am nächsten Morgen, als sie frühstücken wollte, hing ein Schild an der Lampe über dem Esstisch, eine weiße Pappe mit einem Satz in ENs altdeutscher Handschrift: »Gespräche über Politik verboten«.
Ein paar Tage später bestieg sie den Zug Richtung Schweiz.
5.
Ihre Großmutter stammte aus Stuttgart, hatte aber mit ihrem Mann in dessen Heimat in der Westschweiz gelebt, wo Fees Mutter aufgewachsen war. Fee fuhr zunächst nach Zürich, wo Hans Bodmer sie vom Bahnhof abholte. Bodmer war ein alter Freund der Familie, der vor über 20 Jahren, noch vor dem Weltkrieg, in Berlin bei ihrem Vater Kompositionsunterricht genommen hatte. Deshalb hatte Fee ihn schon als Kind gekannt. Er war einer der feinsten Menschen, der ihr je begegnet war, zurückhaltend, nachdenklich, verlässlich. Seine Familie pflegte ihr altes Erbe und gehörte zu den reichsten des Landes. Er selbst hatte in mittleren Jahren noch ein Medizinstudium aufgenommen. Außerdem unterstützte er ihren Vater jeden Monat, was sie wusste, seit sie für ihn die Buchführung machte.
Fee streckte ihm zur Begrüßung die Hand entgegen.
»Ich freue mich sehr, Fräulein von Reznicek«, sagte er in seinem Schweizer Tonfall. »Wie geht es Ihrem Herrn Vater?«
»Gut. Solange die Melodien in seinem Kopf nicht versiegen, geht’s ihm gut.«
Er lachte, nahm ihren Koffer und führte sie zu seinem Auto.
Es war Frühling in Zürich, die Temperatur milde, Obstbäume blühten, in Beeten wuchsen Tulpen und Stiefmütterchen, die Sonne schien. Auf dem See kreuzten Segelboote. Das Wasser funkelte. Fee kurbelte die Scheibe herunter, hielt ihr Gesicht in die Sonne und meinte, sie dehne sich aus.
Zusammen mit seiner Frau und drei Kindern lebte Bodmer in einer Villa mit Blick auf den See. Fees Gästezimmer hatte eine gestreifte Tapete und einen kleinen Sekretär am Fenster. Sie wusch sich und zog sich um. Beim Abendessen kamen sie bald auf Deutschland zu sprechen. Bodmer vertrat die Ansicht, dass die neue Regierung schnell wieder abgelöst werde, Hitler sagte er ein kurzes politisches Dasein voraus, er werde in der Versenkung verschwinden. Von der Hetze gegen Juden, von Verhafteten und Verschwundenen wussten weder er noch seine Frau etwas. Auch die Gerüchte über Gefangenenlager, die im Reich angeblich entstanden, kannten sie nicht. Da die Kinder mit am Tisch saßen, hielt sich Fee zurück.
Am nächsten Tag machte sie einen Spaziergang am Seeufer und fuhr mit der Straßenbahn in die Innenstadt. Sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie zusammen mit ihrer Familie hier leben würde, in dieser friedlichen Normalität. Bereits im Winter hatte sie zu Burghard von einer Übersiedlung gesprochen, aber damals war es nur ein spontaner Einfall gewesen, jetzt malte sie sich ein solches Leben in Einzelheiten aus, eine Wohnung in Zürich, sie alle zusammen, jeder trug zum Lebensunterhalt bei, was er konnte, und eine jüdische Mutter oder Großmutter interessierte keinen Menschen. Die Zeit in der Schweiz würde nur solange dauern, bis die Hasenpartei wieder verschwunden war, und ob das nun etwas früher oder etwas später passierte, brauchte sie nicht mehr zu scheren. In Zürich wären sie in Sicherheit.
Sie erkannte, was neben dem milden Wetter der größte Unterschied zu Berlin und Stuttgart war. Die Leute in der Straßenbahn und im Café redeten in normaler Lautstärke. Weder senkten sie ihre Stimmen noch schauten sie sich um, weil sie Sorge hatten, wer ihnen zuhören könnte. Und die Kinder lachten laut. Fee hatte das Gefühl, ihr ginge das Herz auf. Wie angenehm war eine Stadt ohne SA-Gegröle. Die NSDAP versuchte zwar, auch in der Schweiz Fuß zu fassen, war damit aber nicht weit gekommen. Ihr lokaler Führer hieß Wilhelm Gustloff, ein Deutscher, der in Davos lebte. Fee sah sein Konterfei auf einem Plakat. Er kam ihr harmlos vor, ein Kahlkopf in einer entschlossenen Pose. Seine Organisation tauchte nirgendwo im Straßenbild auf. Hakenkreuzfahnen gab es auch nicht.
Beim Abendessen schlug Bodmer ihr vor, sie am Wochenende zu Remarque zu fahren, der im Tessin eine neue Heimat gefunden hatte. Er wusste, dass Fee mit ihm befreundet war, seit der ihr einst das journalistische Handwerkszeug beigebracht hatte. Allerdings lebte Remarque mit einer überaus eifersüchtigen Frau zusammen, die kaum erfreut wäre, eine alte Berliner Bekannte ihres Mannes zu sehen, selbst wenn es keinerlei Grund zur irgendwelchen Spekulationen gab. Auf dem Weg wollte Bodmer zudem Hermann Hesse besuchen, den Fee flüchtig kannte. Die Hesses bewohnten ein Haus, das Bodmer gebaut hatte. Beide, Remarque wie Hesse, seien sicher begierig auf Einzelheiten aus Deutschland. Fee vertröstete ihn. Ihr Plan war, Emils Angelegenheit zu klären und dann ihrer Familie möglichst schnell ihren Vorschlag zu unterbreiten. Ihr Onkel, der Bruder ihrer Mutter, lebte in Lausanne und arbeitete bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Sie telefonierte mit ihm und kündigte ihren Besuch an.
»Die Tessinfahrt holen wir nach«, sagte sie zu Bodmer. »Wer weiß, vielleicht übersiedelt die Familie Reznicek demnächst in die Schweiz. Dann hätten wir genug Zeit.«
»Das würde mich sehr freuen. In dem Fall würde ich Ihren Herrn Vater bitten, den Unterricht mit mir fortzusetzen.«
»Was er sicher gerne tun wird.«
Ihren Onkel Loulou Juillerat hatte sie so lange nicht mehr gesehen, dass sie ihn sich in Erinnerung rufen musste. Er war der einzige einzelne Mann auf dem Bahnsteig, ein Herr mit einem schmalen Gesicht unter dem Hut und ein wenig gebeugten Schultern. Sie ging auf ihn zu und begrüßte ihn. Auch er hätte sie wohl nicht erkannt.
Er sprach nur wenig Deutsch, Fees Schulfranzösisch war besser, sodass er sich nicht bemühte. Sie nahmen die Straßenbahn. Er wohnte zusammen mit seiner Frau mitten in der Stadt. Die Wohnung war ein wenig dunkel und wirkte eng, erst recht nach dem Eindruck von Bodmers großem Haus. Beim Essen brachte Fee die Rede auf ihr Vorhaben einer Übersiedlung. Sie hielt sich im Vagen, denn noch ahnte keiner der Rezniceks etwas von ihrem Vorhaben. Onkel Loulou sagte zu, dass er Erkundigungen einholen werde.
Gleich am nächsten Morgen reiste sie weiter in den Ort Rolle im Kanton Waadt, am Nordufer des Genfer Sees, wo ihre Großeltern einst geheiratet hatten. Die Hügellandschaft fiel zum See hin ab, die Wiesen waren grün, Kühe grasten. Im Ort selber gab es Patrizierhäuser und zwei Kirchen, eine katholische und an der Grand Rue eine reformierte. Fee machte den Pfarrer ausfindig, einen misstrauisch wirkenden Mann mit runder Brille. Er begrüßte Fee auf Französisch und ließ sie ihr Anliegen vortragen.
Nach einer Weile antwortete er auf Deutsch. »Einen Ariernachweis benötigen Sie? Ich bezweifle, dass sich Jesus Christus für solche Dinge interessiert hat. Seine Mutter war übrigens Jüdin. Wussten Sie das nicht?«
»Doch, natürlich. Unsere Regierung hat nicht viel mit Jesus Christus gemeinsam.«
»Das ist wohl die traurige Wahrheit. Ich muss Einsicht in die alten Kirchenbücher nehmen. Wenn Sie in der Wartezeit beten möchten, lasse ich Sie in die Kirche. Andernfalls müssten Sie noch einmal wiederkommen.«
Sie nahm auf einer der Gebetsbänke Platz. Nach calvinistischer Tradition gab es kein Bild an der Wand, keinerlei Skulptur oder Schnitzerei, nichts, was ablenkte, nicht einmal ein Kreuz. Die Kanzel war leicht erhöht, eine Art Pult. Außer Fee war niemand da. Es roch süßlich nach dem Holz der Bänke.
Sie war christlich erzogen worden und gehörte zu Hause der lutherischen Kirche an, doch sie hatte seit Langem keinen Gottesdienst mehr besucht. Jetzt, allein in diesem schmucklosen Raum, wusste sie nicht recht, was sie tun sollte. Sie hatte Wünsche, ja. Einer davon war, dass die Hitlerregierung wieder verschwinden möge, allerdings war das wohl eine zu allgemeine Bitte, um sich damit an Gott zu wenden. Deshalb bat sie, dass ihre Familie und ihre Freunde diese Zeit unbeschadet überstehen würden. Dass die Rezniceks vorübergehend in die Schweiz zögen und sich dort alles zum Guten fügte. Einmal in Fahrt, stellte sie sich vor, dass sie in Zürich einen Mann fände, heiratete, für immer blieb. Warum sollte das nicht möglich sein? Sie war 29 Jahre alt, manche Bekannte hatten ihr gesagt, dass ihre schwarzen Haare und die dunklen Augen attraktiv seien, außerdem war sie wach und interessiert, jemand, der von anderen ins Vertrauen gezogen wurde. Allerdings war sie keine Frau, die ein Leben als Hausfrau zufriedenstellen würde. Ein Mann müsste akzeptieren, dass sie weiterhin ihrem Beruf nachging.
Sie faltete die Hände und schloss die Augen. Die Stille in der Kirche war beinahe überwältigend. Vor ihrem inneren Auge tauchten Landschaftsbilder auf, wie sie sie auf der Zugfahrt von Zürich gesehen hatte, schneebedeckte Berge, herabfallende Gletscherbäche, Wiesen und Seen im Sonnenlicht. Die Schweiz war ein friedliches Land, möglicherweise zu friedlich für Journalisten. Wenn sie hier lebte, sagte sie sich, würde sie ein neues Kinderbuch schreiben.
Am Ende äußerte sie einen ganz konkreten Wunsch: dass ihre Familie hier Sicherheit fände.
Der Pfarrer kam nach einer Stunde zu ihr. Er hatte mit der Maschine eine zweisprachige Bescheinigung geschrieben, französisch und deutsch, nach der ihre Großeltern, Amelie Haas und Arthur Juillerat-Chasseur, 1872 beide als Christen in dieser Kirche getraut worden seien. Dafür gebe es im Archiv einen Beleg, der auf Wunsch einsehbar sei.
Es war nicht alles, was Emil brauchte, aber immerhin ein Anfang. Fee bedankte sich.
»Ich habe nicht einmal gelogen«, sagte er, »obwohl es moralisch gerechtfertigt wäre, eine Regierung anzulügen, die von ihren Bürgern solche Erklärungen verlangt.«
Sie kehrte nach Lausanne zurück. Ihr Onkel hatte weniger gute Nachrichten für sie. Er hatte mit Kollegen gesprochen, mit Schweizer Ämtern telefoniert und Gesetzestexte gelesen. Beim Abendessen eröffnete er ihr, dass sie zwar, genauso wie ihre Familie, in der Schweiz bleiben dürfe, hier aber keine Arbeitsgenehmigung erhalten werde.
Fee tupfte sich mit der Serviette über den Mund. »Onkel, ich habe ein Kinderbuch verfasst und ein englisches Bridgebuch ins Deutsche übersetzt. Sobald ich das Reich verlassen habe, gelte ich als Emigrantin, dann wird dort nichts mehr von mir veröffentlicht.«
»Ich weiß.«
»Das bedeutet, dass ich keine Einnahmen mehr habe.«
»So ist es.«
»Das ist den Schweizer Behörden egal?«
»Sie sorgen sich um die Beschäftigung ihrer eigenen Staatsbürger. Wir haben Arbeitslosigkeit in unserem Land.«
»Und was ist mit meinem Vater?«
»Nach dem habe ich mich auch erkundigt. Es ist denkbar, dass die Behörden für ihn eine Ausnahme machen, weil er ein bekannter Künstler ist. Immerhin würde es unser Land ehren, wenn er hier lebte.«
»Es ist denkbar?«
Onkel Loulou nahm den Spott in ihrer Frage nicht wahr. »Ach, ich halte es für wahrscheinlich«, sagte er.
Das würde bedeuten, dass EN die alleinige Verantwortung für die fünfköpfige Familie tragen müsste, Fee könnte bestenfalls seine Buchführung und Korrespondenz erledigen. Eine solche Aufteilung war ausgeschlossen. Sie dachte an Bodmer. Er war ein Mann aus einflussreicher Familie. Vielleicht konnte er etwas tun.
»Die Schweiz gibt euch eine Aufenthaltserlaubnis«, sagte Onkel Loulou, »weil Berta Schweizerin war. Aber sobald du oder einer deiner Brüder eine Arbeit annehmt oder ein Wort veröffentlicht, schicken sie euch zurück nach Deutschland. Es tut mir leid, so sind unsere Gesetze.«
Fee bezweifelte die Auskunft. Bodmer würde etwas für sie erreichen.
6.
Kaum war sie wieder in der Villa am Zürichsee eingetroffen – Bodmer selber war an der Universität, seine Frau hatte sie eingelassen –, erhielt sie einen Anruf aus Berlin. Ihr Vater war dran.
»Fee, bitte, komm nach Berlin. Wir brauchen dich hier.«