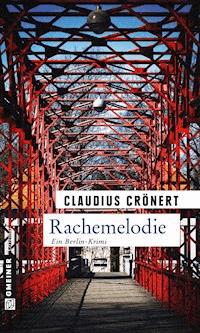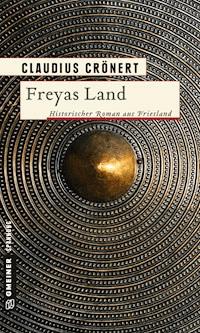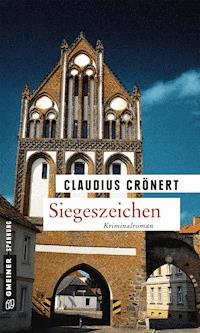
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nathan Fleming
- Sprache: Deutsch
Für eine teure Behandlung seiner schwerkranken Tochter benötigt der ehemalige Bereitschaftspolizist Nathan Fleming viel Geld. Nach tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen heuert Nathan, selbst seelisch angeschlagen, als Personenschützer bei einem rechtspopulistischen Politiker an. Bald erkennt er, wie skrupellos dieser Mann handelt, um mit seiner Partei in die Schlagzeilen zu kommen. Nathan trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihn in höchste Gefahr bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudius Crönert
Siegeszeichen
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © shorty25 – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4800-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Dunkel erinnerte sich Nathan an eine Menge Zustimmung und Aufmunterung. Wo er hinkam, traf er auf warme Worte, sah erhobene Daumen, musste sich auf die Schulter klopfen lassen. Die Kollegen, nicht nur in der Kaserne, sondern auch bei der Mordkommission, lächelten ihm zu, nickten merklich, und er hörte immer wieder diese beiden Worte: Gut gemacht.
Gut gemacht? Soweit er überhaupt einen Gedanken fassen konnte, sprach er diesen Männern das Urteilsvermögen ab. Im Einsatz hatten sie den Schlagstock geschwungen, manchmal Tränengas versprüht, aber die Pistole kannten sie bestenfalls aus dem Übungsraum. Keiner von denen hatte jemals einen Menschen erschossen, allein deshalb konnten sie sich nicht vorstellen, wie es in Nathan aussah, schwarz nämlich. Böse Träume, das Gefühl totaler Sinnlosigkeit.
Es war Nacht in ihm. Er hatte es nicht gut gemacht, ganz und gar nicht.
Auf der anderen Seite, den freundlichen Kollegen gegenüber, stand eine lange Riege von Schlaubergern, all die Kommentatoren und Talkshowquatscher und sonstigen selbsternannten Experten. Auch wenn er kaum die Glotze anschaltete und Zeitungen mied, blieben ihm ihre Vorwürfe nicht verborgen. Man hätte Verstärkung anfordern können. Den Bewaffneten unschädlich machen müssen, anstatt nach Wildwestmanier sofort zu schießen. Vor allem hätte man sehen müssen, dass der Angreifer ein Junge war, erst 15, der sich mit dem Kajalstift der Mutter Bartstoppeln aufgemalt hatte. Ein Kind.
Wahrscheinlich hätte man das sehen müssen. An jenem Abend hatte Nathan eine 14-Stunden-Schicht hinter sich, Wecken um vier, schnelles Frühstück in der Kaserne, dann in den Bus, um sechs waren sie vor Ort, für den Fall, dass es Frühaufsteher unter den Demonstranten gab, die sich Pflastersteine an der Strecke deponierten. Aber da war niemand, deshalb hieß es, zu warten. Um diese Zeit kam die Sonne hervor, es wurde schwül. Die Kollegen dösten, manche quatschten, man hörte leises Gelächter. Andere hatten ihre Stöpsel in den Ohren und das Smartphone in der Hand.
Als es am Vormittag endlich losging, mussten sie auf 100 Neonazis achtgeben, auf Lederjackentypen mit geschorenen Haaren und Reichsfahnen, die gekommen waren, um ein englisches Bombardement im Zweiten Weltkrieg anzuprangern. Die Gegendemonstranten waren zehn Mal so viele, nicht nur ältere Herrschaften mit Kerzen in der Hand und Protestliedern, sondern auch der Schwarze Block. Eine Großlage; und Nathans Hundertschaft hatte die Aufgabe, beide Parteien auseinanderzuhalten.
Die Pöbeleien von beiden Seiten hörte man unter dem Helm nicht mehr, auch die Pfeifkonzerte nicht, aber das Gedränge wurde immer stärker. Beide Lager wollten Action. Es wurde anstrengend für die Bereitschaftspolizei, sie auseinanderzuhalten. Er sah, wie seine Männer unter ihren Kampfanzügen ins Schwitzen kamen, wie sie die Visiere aufklappten, um frische Luft zu bekommen. Seine Aufgabe war es, sie bei der Stange zu halten. Lücken im Zug zu stopfen, übertriebene Gewalt zu verhindern.
Verschärft wurde ihre Situation dadurch, dass es keinen Nachschub gab, warum auch immer, kein Mittagessen, und die Schokolade, die sie für Notfälle immer bei sich hatten, war geschmolzen. Irgendwann ging sogar das Wasser aus. Die Sonne brannte.
Am Ende, als ein paar Schaufenster zerbarsten, bekamen sie die Anweisung, die Demonstration aufzulösen. Gingen mit Schlagstöcken gegen die Randalierer vor. Schützten sich mit Schilden gegen fliegende Steine.
Bis alle Protestierer verschwunden waren und sie endlich abziehen konnten, war es Abend. Die Kollegen warfen ihre Jacken in den Bus. Die T-Shirts hatten Salzflecke, Staub klebte einem in Augenwinkeln und Haaren, der Mund war knochentrocken. Auch im Bus gab es kein Wasser, das war der Grund, warum sich der Fahrer überreden ließ, am Einkaufszentrum zu halten, anstatt wie üblich in die Kaserne zurückzufahren. Die meisten Kollegen stiegen aus; ein, zwei kalte Bier, um runterzukommen, dazu ein paar Pommes anstelle des verpassten Mittagessens.
Es war Feierabendzeit. Die Passanten hatten pralle Tüten in der einen und Eis in der anderen Hand und drehten sich durch die Türen. Max und er waren den anderen gefolgt, hatten sich aber bald verdrückt, zwischen ihnen herrschte Einigkeit darüber, dass sie nach einem solchen Einsatz keine Heldengeschichten hören wollten, überhaupt keine Unterhaltung brauchten, nur ihre Ruhe und ein kühles Bier.
Wie zwei alte Männer schlurften sie durch die Gänge, in denen die Luft abgestanden und stickig war. Aus den Geschäften drang leise Musik. Alte Leute saßen auf Bänken und warteten, dass die Zeit verging. Max hob beim Gehen kaum seine Füße und hielt den Kopf gesenkt, Nathan machte es nicht viel anders. Der Durst war übel. Sie waren erschöpft.
Und dann sprang ein Junge aus einer dunklen Ecke, als hätte er auf sie gewartet. In der Hand eine Pistole, die er auf Max richtete, direkt auf den Kopf: »Wenn du dich rührst, puste ich dich um.«
Amerikanische Sätze, aus irgendeinem Film geklaut. Die Amerikaner hatten auch einen Begriff für das, was der Junge gewollt und am Ende auch bekommen hatte: Suicide by Cop. Das hieß: Der Bulle drückt ab, wenn du zu feige dafür bist. Musst ihn nur dazu bringen.
Was danach geschah, war nur eine verschwommene Erinnerung, Bilder, die in dichtem Nebel lagen, und Nathan fragte sich später Hunderte Male, ob er es wirklich erlebt hatte. Der Junge, der wie ein siegreicher Sportler die Arme in die Höhe warf, während er in sich zusammensackte. Seine Augen waren aufgerissen, er hatte ein verrücktes Grinsen auf dem Mund. Die Spucke färbte sich hellrot. Im nächsten Moment kam eine Frau angestürzt, ließ ihre Einkaufstüte fallen, sodass Obst herauskullerte, warf sich auf ihn und schrie, während sie ihn schüttelte: »Nein! Uwe, komm, wach auf! Uweeee!«
Die Mutter. Die den Leichnam aufhob und umklammerte, um ihn nie wieder herzugeben, während sie Nathan ansah, als wäre er Satan persönlich. Oder als wollte sie Rache nehmen.
Wie lange hatte Nathan mit der Pistole in der Hand bei ihnen gestanden? Und Max? Hatte der sich wirklich hingesetzt, die Schultern an eine Wand gelehnt und die Hände vors Gesicht geschlagen?
Nathans Erinnerungen waren flüchtig wie ein Traum, und wenn er sie greifen und festhalten wollte, verzogen sie sich. Er hatte ein vages Bild von mehreren Streifenbeamten, die ihm die Pistole abnahmen, auf ihn einredeten, ihn unterhakten und wegführten, während andere Kollegen versuchten, die Mutter von dem toten Jungen wegzuziehen. Nathan wurde in einen Bus gesetzt und durch die abendliche Stadt zur Wache gefahren, wo er seine Aussage machen sollte. Aber es hatte ihm die Sprache verschlagen. Er war nicht anwesend.
Kam dann wirklich ein Arzt, der ihm eine Spritze setzte? Wo hatte er geschlafen? In einer Zelle? Möglich. Vielleicht auch nicht.
Tage später hatte er im Bericht der Mordkommission gelesen, dass in der Leiche drei Kugeln gefunden worden waren, eine im Unterleib, zwei in Brusthöhe. Hatte er also dreimal geschossen? Er hätte schwören können, dass es nur ein einziger Schuss war, den er abgegeben hatte. Wo kamen die anderen beiden her? Warum fehlten in seiner Waffe drei Patronen?
Die nachfolgenden Ermittlungen dauerten eine Ewigkeit, in der er sein Zimmer in der Kaserne selten verließ. Selbst mit Andrea telefonierte er kaum, und als sie zu ihm wollte, wimmelte er sie ab. Auch an diese Zeit hatte er nur verschwommene Erinnerungen. Die Mordkommission befragte Zeugen und wertete Kameraaufzeichnungen aus, der Staatsanwalt sichtete die Ergebnisse und musste über eine Anklage entscheiden, kam aber wegen einer Krankheit und wegen anderer Fälle nicht dazu. Am Ende wurde keine Anklage erhoben. Er habe in Notwehr gehandelt, bescheinigten sie Nathan.
Er hörte es, aber es interessierte ihn kaum noch. Während er die vielen Aufmunterungen von den Kollegen bekam und gleichzeitig vom Dienst mit der Waffe suspendiert war, wuchs in ihm die Gewissheit: Seine Zeit bei der Bereitschaftspolizei war abgelaufen. Er nahm seinen Abschied.
EINS
In langen Wochen tropfte das Fass voll, jeden Tag ein bisschen, sodass es am Ende nur einer Kleinigkeit, einer umgestoßenen Bierflasche bedurfte, um es zum Überlaufen zu bringen. Nathan hob sie schnell wieder auf und besah sich den Schaden. Er war alles andere als groß, zwei Taschentücher reichten ihm, um die Pfütze aufzuwischen. Doch für Andrea war diese Lache auf ihrem Fußboden zuviel. In Windeseile legte sich eine glühende Röte auf ihre schmalen Wangen. Im Gegenlicht wurden ihre Konturen scharf. Ihre Stimme zitterte und war voller Bitterkeit, als sie ihre Vorwürfe herausbrachte, nicht laut, sondern mit unterdrückter Wut.
»Du tust nichts, und ich, ich ertrage dich nicht länger. Dein Geschlurfe nicht und deine stinkende Trainingshose nicht.«
Angeekelt drehte sie sich weg, schnappte nach Luft, dann ging es weiter: »Da – das ist ein Urinfleck.«
Sie fuhr den Arm so schnell aus, als wollte sie ihn schlagen, und zeigte mit dem Zeigefinger auf einen Punkt im Schritt. »Seit Tagen schon. Du hast eingepinkelt, Nathan Fleming, eingepinkelt wie ein kleiner Junge. Scheint dich nicht zu stören. Mich aber. Mich stört er gewaltig. Ich find’s ekelhaft.«
Ihre Sätze ließen Nathan an Gewehrsalven denken, an Schüsse aus einem Sturmgewehr. Er machte keine Anstalten, sich zu wehren, erst recht wollte er nichts zurückgeben, was das Feuer nur weiter anheizen würde. In vielen Dienstjahren darauf trainiert, seine Gefühle zu beherrschen, ließ er den Ausbruch über sich ergehen, als wäre Andrea eine Vorgesetzte, nicht seine Frau.
»Deine einzige Sorge ist,«, rief sie und kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, »ob wir genug Bier im Kühlschrank haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehst du raus. Aber auch nur dann. Schleppst dich zum Supermarkt. Fünf Minuten Fußweg. Große Leistung, Mann. Du kommst nicht mal auf die Idee, zu fragen, ob du etwas mitbringen sollst für den Haushalt.«
Draußen ging ein sanfter Regen nieder. Es war warm, die Terrassentür stand offen, und über ihren kleinen Garten legte sich die Dämmerung, ein Zwielicht, im dem sich Katis Spielgeräte, die Schaukel und der Roller, langsam verloren. Nathan überlegte, die Tür zu schließen, aber schon die Vorstellung, aus seinem Sessel aufzustehen, erschien ihm mühsam. Und ob die Nachbarn sie hörten – was sie denken würden –, war ihm völlig egal.
Sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich in ihm aussah. Ihre Fragen waren ihm oberflächlich vorgekommen, deshalb hatte er genauso geantwortet. Auch ihr Vorwurf stimmte nur zum Teil. Er brauchte das Bier keineswegs, zumindest nicht jeden Tag, sondern nur dann, wenn die Dämonen kamen. Dann gab es kein Mittel, das ihn in gleicher Weise entspannte. Für diesen Notfall Bier im Kühlschrank zu wissen, beruhigte ihn ungemein.
Er machte weiterhin keine Anstalten, sich zu verteidigen. »Andrea, bitte«, brachte er nur hervor. Seine Stimme klang schwach.
Sie nahm keine Rücksicht und schien ganz und gar nicht zum Einlenken bereit. Mit dem ausgestreckten Arm winkte sie ab, eine reichlich dramatische Geste. »Hör bloß auf! Sieh in den Spiegel, dann weißt du, was ich meine. Du rasierst dich nicht und wäschst dich nicht. Deine Haare sind fettig, und schneiden lässt du sie auch nicht mehr. Seit du zurück bist, hast du bestimmt fünf Kilo zugenommen. Eine richtige Wampe hast du dir angefressen.«
Er faltete die Hände über seinem Bauch, als müsse er ihn schützen. Ihr Vorwurf stimmte. Na und? Auch sie war dicker geworden, in den letzten Jahren schon, seit Kati auf der Welt war. Nur tat er einen Teufel, ihr den Vorwurf zurückzugeben, er wusste doch, sie war bis an die Grenze belastet, nicht durch die Arbeit mit ihrer kranken Tochter – Kati –, sondern vor allem wegen der steten Sorge um sie. Wer konnte da ans Abnehmen denken?
»Ich …«, begann er, ohne zu wissen, wie er seinen Satz weiterführen sollte. Ein jämmerlicher Versuch.
Auf dem Boden, neben seinem Ledersessel, stand sein Bier. Er tastete unauffällig danach. Andrea hatte sich ihm gegenüber aufgebaut, die Fäuste in die Hüften gestemmt.
Unauffällig? Natürlich sah sie, was seine Hände machten.
Er ließ die Flasche an ihrem Platz und schluckte.
»Ich funktioniere im Moment einfach nicht wie früher. Das habe ich bereits versucht, dir zu erklären. Schon mehrfach. Ich habe etwas Furchtbares erlebt. Und getan. Furchtbarer, als viele sich das vorstellen können.«
»Falls du mich damit meinst – ja okay, ich habe noch nie jemanden erschossen. Ich bin kein Polizist. Na und? Das heißt nicht, dass ich nicht zu kämpfen hätte. Mein Tag …«
»… ja, ich weiß …«
»… ist voll, von morgens bis abends. Ich bringe Kati in die Schule, gehe arbeiten, dabei immer ein Auge aufs Handy, falls irgendetwas ist. Dann hole ich sie ab, muss einkaufen, den Haushalt machen und unsere Tochter pflegen.«
»Ich weiß.«
»Du nimmst mir nichts ab. Nullkommanull.«
»Andrea …«
Sie fuhr ihn an, als reize es sie zusätzlich, dass er nicht gegenhielt, nicht einmal die Stimme hob. Jetzt winkte sie ab. »Mann, hör auf. Ich scheiße auf dein Verständnis. Es kotzt mich an.«
Offenbar selber überrascht von der Schärfe ihres Angriffs, machte sie ein paar Schritte auf die Schrankwand zu, wo der Fernseher stand und ein paar Bücher, ordentlich aneinander gereiht wie eine Kompanie. Sie stützte sich an einem Regalbrett ab, ihr Kopf fiel nach vorne, die Haare wie Vorhänge, sie sah ihn nicht an. Die Wut hatte sie erschöpft.
Er fand sie immer noch schön, nach all den Jahren, liebte ihre dunklen Augen und das schmale Gesicht mit der kräftigen Nase, verletzlich und zäh zugleich. Wäre es besser, ihr von seinen Albträumen zu erzählen? Von der Mutter des toten Uwe, die mit erhobener Faust an seinem Bett stand. Von dem Obst, das aus ihrer Tüte rollte, und dann waren es Steine, mit denen sie ihn bewarf.
»Ich habe keine Lust auf Mitleid mir dir. Mitleid mit seinem Mann haben zu müssen, das ist ja wohl das Letzte.« Sie sprach leiser, aber nicht einen Deut weniger scharf. »Wenn du in Schwierigkeiten bist, Nathan, dann suche dir gefälligst Hilfe. Vielleicht hast du so eine posttraumatische Dingsda-Störung.«
Sie drehte sich zu ihm. Er erwartete Tränen in ihren Augen, aber da waren keine. Ihr Mund stand offen, sie selbst war irgendwo in der Mitte zwischen Wut und Verzweiflung.
»Oder glaubst du, man könnte das wegsaufen?«
Ihre Wangen glühten, um ihre Mundwinkel war ein Zittern, als stünde ein neuerlicher Ausbruch bevor. Sie schüttelte den Kopf, dass ihr Haar durch die Luft wirbelte. »Soll die Polizei dir eben eine Therapie bezahlen. Aber krieg endlich, endlich deinen Arsch hoch!«
»Ich habe bereits mit einem Psychiater gesprochen. Noch in der Kaserne.«
»Scheint nicht viel genützt zu haben.«
Es war wenige Tage nach den tödlichen Schüssen gewesen. Der Psychiater, ein Mann in mittleren Jahren mit grauem Bürstenschnitt und eckiger Brille war genau das, was Nathan von der Truppe kannte, ein nüchterner Kerl, der seine Botschaft vermittelte, ohne den Mund dafür weit aufzumachen: Nur nicht zu viel Wehleid.
Der Mann hatte sich eingelesen, er kannte den Vorfall, wie Nathan und die verschiedenen Zeugen ihn berichtet hatten. Sie sprachen in einem kahlen Büroraum der Bereitschaftspolizei miteinander. Draußen regnete es. Wie es Nathan ginge, wollte er wissen.
»Ich kriege die Bilder nicht aus dem Kopf. Der Junge, der die Arme hochreißt, als hätte er ein Siegtor geschossen. Und dann die Mutter …«
»Das verstehe ich. Aber so etwas gibt sich mit der Zeit. Belastungsstörungen bekommen in der Regel Opfer, nicht …«
Nathan hörte das Wort, auch wenn sein Gegenüber es taktvollerweise ausgespart hatte: Täter.
»Versuchen Sie, andere Bilder dagegenzusetzen«, riet der Psychiater. »Und machen Sie sich vor allem immer wieder klar, dass Ihr Kollege hätte sterben können, wenn Sie nicht gehandelt hätten. Sie haben ein Leben gerettet – so müssen Sie das sehen. Für die Männer hier in der Kaserne sind Sie ein Held. Und das sind immer noch Ihre Leute, Ihr Zug. Die wollen Sie doch nicht enttäuschen.«
Max hätte zwar möglicherweise sterben können, aber er hatte sicher ein Leben vernichtet. Ein Riesenunterschied, und das war die Wahrheit. Warum erwähnte der Mann das nicht einmal?
Nathan nickte und verzichtete darauf, zu schildern, dass der tote Junge immer um ihn war, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Ihn fragte, warum er das getan habe. Es sei doch alles nur ein Spiel gewesen, ein Scherz.
»Und wenn ich Ihre Akte richtig gelesen habe, ist dies nicht der erste Mensch, den Sie erschossen haben.«
Der dritte. Vor ihm waren ein Geiselnehmer, auf der Flucht wild um sich schießend, und ein Rocker, der dabei war, einen Kollegen mit einem Wagenheber totzuschlagen.
»Was wollen Sie damit sagen? Dass ich langsam Routine haben müsste?«
»Natürlich nicht. Ich möchte Ihnen nur helfen, das Ereignis ein wenig zu relativieren.«
Beide Tote hatten ihn nicht lange beschäftigt. Vielleicht, weil er jünger gewesen war oder die Täter älter. Oder weil sie ihre Waffen wirklich eingesetzt hatten. In beiden Fällen war es zweifelsfrei Notwehr gewesen.
Der Psychiater drückte ihm drei Päckchen mit Tabletten in die Hand. »Die braunen lassen Sie zur Ruhe kommen, die gelben sorgen dafür, dass Sie wieder lachen können. Und die weißen helfen Ihnen, dass Ihr Magen das alles gut verträgt. Nehmen Sie sie, Fleming. Wenn sie alle sind, verschreibe ich Ihnen neue.«
Seit er nach Hause zurückgekehrt war, lagen die Medikamente im Badezimmerschrank, die Packungen nicht einmal angebrochen. Er wollte das nicht. Pillen konnten nichts ungeschehen machen.
»Andrea«, sagte er jetzt und bemühte sich, Wärme in seine Stimme zu legen, »gib mir etwas Zeit, das ist alles, worum ich dich bitte. Ich muss mich neu finden, außerhalb der Bereitschaftspolizei. Dann verdiene ich wieder Geld, wir fahren mit Kati nach Hongkong, sie bekommt ihre Therapie und wird gesund. Das haben wir doch immer gewollt.«
Andrea schnaubte, während sie einen abschätzigen Blick auf die Bierflasche zu seinen Füßen warf. Er meinte, die Skepsis in ihrem Gesicht mit Händen greifen zu können. Sie setzte sich wieder in Bewegung, schritt an ihm vorbei zum Esstisch, an dem die Stühle ordentlich unter die Tischplatte geschoben waren. Sie waren lederbezogen und hatten hohe Holzlehnen, in der Mitte heller eingefärbt als an den Rändern. Andrea zitterte, als sie einen von ihnen herauszog und sich darauf fallen ließ. Die Erschöpfung machte sich in ihrem Körper breit, die Kraft wich aus ihren Gliedmaßen, die Schultern sackten zusammen. Sie musste den Ellenbogen aufstützen und ihren Kopf halten.
Ihre Stimme war nur noch ein Flüstern. »Ich glaube nicht mehr daran.«
»An was?«
»An das alles. Weder daran, dass du jemals so viel Geld auftreibst, wie wir brauchen würden – 80 000 Euro alles in allem.« Sie machte eine Pause. Dann sagte sie: »Und auch nicht mehr daran, dass Kati gesund wird. Jedenfalls nicht durch ein Wunder.«
Als hätte sie ihm einen elektrischen Schlag versetzt, fuhr er aus seinem Sessel auf. Mit einem Mal hatte er seine Beherrschtheit verloren. Seine Stimme wurde laut: »Wie kannst du sowas sagen? Natürlich wird sie gesund!«
»Du machst dir etwas vor, Nathan.«
»Quatsch. Ich muss mich nur neu sammeln. Dann geht es wieder los.«
Sie schüttelte den Kopf, lächelte wie ein trauriger Clown und wischte sich mit zwei Fingern über die Augenwinkel. »Mein Ziel ist mittlerweile anders. Ich will lernen, mit Katis Krankheit zu leben. Vielleicht kann man die Chemo in kleinen Schritten höher dosieren, sodass sie doch damit klar kommt. Aber die Hoffnung auf eine chinesische Wunderheilung, die will ich nicht mehr.«
»Das haben wir doch immer …«
»Mag sein, dann bin ich eben ausgestiegen. Ich glaube einfach nicht mehr daran. Man zahlt viel Geld und hängt all sein Bangen an ein paar Kräuter und Nadeln? An Ärzte, deren Denken man überhaupt nicht kapiert? Nee, Mann, nicht mit mir.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Das war doch deine Idee gewesen, als du damals die kleine Miriam gesehen hast, die wie die gesunden Kinder im Garten gespielt hat. Weißt du das nicht mehr?«
»Doch. Aber das war damals.«
»Nein, Andrea, das ist heute! Was für Miriam möglich war, wird Kati auch helfen.«
»Und wer bezahlt uns das? Wie? Miriams Vater ist Bankier, die Leute haben jede Menge Geld. Ein halbes Jahr in Hongkong mit Behandlungen, während zu Hause die Kosten weiterlaufen, das ist denen vollkommen egal.«
»Für uns auch. Ich schaffe das. Vertrau’ mir.«
Sie erhob sich wieder, wozu sie die Hilfe ihrer Arme brauchte. »Ich will nicht mehr. In ihrem Zustand könnte Kati eine solch weite Reise gar nicht durchstehen. Also bekommt sie vorher eine neue Chemo, oder was? Die sie wahrscheinlich nicht verträgt. Nathan, ich habe für all das keine Kraft. Lass mich in Ruhe.«
»Was dann?«
»Leben mit dem, was ist.«
»Leben?«, gab er zurück. »Ohne Behandlung stirbt sie.«
Endlich fühlte er sich frei, nach seiner Bierflasche zu greifen, und machte einen langen Zug. Sein Mund füllte sich, er schluckte, dann rülpste er. Dass es aggressiv klang, gefiel ihm.
Sie wandte sich ab und sprach leise weiter: »Das darfst du nicht sagen. Niemand weiß, wann sie stirbt und mit welcher Behandlung sie überleben wird. Das ist die Wahrheit, und das müssen wir akzeptieren.«
»Ein Quatsch ist das! Totaler Quatsch!«
Er knallte die Bierflasche auf den Boden. Wäre sie ein Mann gewesen, hätte er sich auf sie gestürzt und eine Prügelei begonnen. So aber hockte er sich auf die Sessellehne, zwang sich zur Ruhe und machte sich klar, was passiert war. Was auf dem Fußboden stand, war sein drittes Bier, er war leicht angetrunken, sie hatte ihn provoziert, und er hatte sich reizen lassen. Sie hatte ihn an der einzigen Stelle erwischt, wo sie ihn treffen konnte – bei ihrer Hoffnung, ihrem Vorhaben. Bei ihrer Gemeinsamkeit. Wenn sie dort ausstieg …
Er konnte diesen Gedanken nicht einmal zu Ende denken.
»Mama«, hörte er im nächsten Moment.
Andrea reagierte sofort, sie war aus dem Zimmer, noch ehe Nathan auf die Füße gekommen war, um selber zu seiner Tochter zu gehen. Kati stand auf der Treppe, eine Hand am Geländer, in der anderen ein abgegriffenes Stofftier. Ihre Haare, dunkel und lang wie die ihrer Mutter, fielen wirr und zeigten, dass sie aus dem Bett kam. Auf ihrem Schlafanzug waren kleine Bären.
»Was ist denn, meine Liebe?«, hörte er Andrea. »Bist du wach geworden?«
»Ich hatte einen bösen Traum.«
»Komm, ich bringe dich wieder hoch.«
Als Andrea mit der Kleinen nach oben ging, trat er ans Fenster und sog die feuchte Luft ein. Sie roch nach Erde. Dann schloss er die Terrassentür, schaute aber weiter ins Dunkel und trank sein Bier aus. Seine Schultern spannten sich, während der Gedanke ihn ausfüllte, dass seine Frau unrecht hatte. Man musste alles versuchen – für Kati, aber auch für sie selber, für die Eltern der Kranken. Für sie als Familie. Er würde das tun.
Das Problem war nur, dass er so kraftlos war, so müde. Er hatte das ewige Kämpfen satt. Im Spiegelbild an der Terrassentür schien ihm sogar sein Oberkörper weniger breit als früher.
Andrea kam nicht wieder herunter, im Gegenteil, sie löschte im oberen Stockwerk die Lichter, als wollte sie ihm signalisieren, dass aller Kontakt zwischen ihnen abgerissen sei. Das aber passte ihm nicht, er hatte den Wunsch, sich auszusprechen und zu versöhnen, die gemeinsame Hoffnung wieder aufleben zu lassen. Er warf seine Trainingshose in den Wäschekorb, wusch sich das Gesicht und reinigte sich gründlich die Zähne, bevor er zu ihr unter die Bettdecke kroch.
Er tastete nach ihrem Arm. Sie schlief nicht, dessen war er sich sicher. Er strich mit dem Finger über ihre Nase, über Wangen und Mund, dann legte er seine Hand auf ihren Bauch.
»Andrea«, sagte er leise, »komm schon.«
Sie reagierte nicht.
Er hörte ihren Atem, auch ihr Schnauben durch die Nase. Nein, sie schlief nicht.
Ihr Nachthemd war so dünn, dass er ihre nackte Haut zu fühlen glaubte. Die Erregung schoss in ihn ein, und er ließ seine Finger langsam zu ihrer Brust wandern und den Busen streicheln. Sie blieb auf dem Rücken liegen, drehte sich nicht weg, gab aber auch kein Zeichen von Zustimmung. Er rückte näher und küsste sie aufs Ohr. Sein Glied war steif und presste gegen ihren nackten Schenkel. Sein Hintern kam in Bewegung.
Die Augen hatte er geschlossen, während seine Hand nach ihrer Hüfte tastete. Durch den dünnen Stoff fuhr er über den Beckenknochen und glitt schließlich mit den Fingerspitzen zwischen ihre Beine.
Im nächsten Moment zog sie ihr Nachthemd hoch und stemmte die Füße auf die Matratze. Ohne etwas sehen zu können, wusste er, dass sie breitbeinig dalag, mit angewinkelten Knien.
»Dann mach schnell«, sagte sie, »ich bin müde und brauche meinen Schlaf.«
Ein Satz wie ein Eimer kaltes Wasser. Seine Erregung verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Er zog seine Hand zurück.
»Andrea«, sagte er wieder und klang eher erstaunt als vorwurfsvoll.
»Gute Nacht.«
Mit einem Ruck rollte sie sich auf die andere Seite.
Obwohl er sich fest vorgenommen hatte, wach zu werden, wenn sie aufstand, weckten ihn erst ihre Schritte auf der knarrenden Treppe. Kati folgte ihr, beide waren bereits in einer leisen morgendlichen Unterhaltung. Er schwang sich aus dem Bett, zog sich etwas über, dann folgte er ihnen und setzte sich neben sie an den Küchentisch. Während er sich Kaffee einschenkte, sah er zu, wie Andrea mit routinierten Handgriffen Katis Brotdose füllte, selber ihr Toastbrot aß, dem Kind schließlich eine Jacke anzog. Dabei sprachen beide über die Schule.
Ihm dagegen schenkte Andrea kaum einen Blick und kein einziges Wort.
Er fasste Kati an den Händen und gab ihr einen Abschiedskuss. Hand in Hand ging sie mit Andrea hinaus, ließ sich von ihrer Mutter ins Auto setzen und anschnallen.
Aber Andrea stieg nicht ein, sondern kam mit eiligem Schritt zurück, offenbar hatte sie etwas vergessen. Als sie erneut in der Küche stand, hatte sie wieder diesen herausfordernden Blick und die scharfen Gesichtszüge. Gleichzeitig sah sie müde und blass aus. Ihre Augen waren rot.
Sie blieb an der Tür. Senkte den Blick. Schluckte. »Nathan, ich möchte, dass du gehst.«
»Gehen? Wohin?«
»Fort. Weg von hier.«
»Aber nein.«
»Doch, Nathan, bitte geh. Ich kann nicht mehr. Zwei Behinderte, das übersteigt meine Kräfte. Dann breche ich zusammen.«
»Ich bin nicht behindert! Und Kati übrigens auch nicht. Unser Kind hat Krebs.«
»Nenn es, wie du willst. Die Verantwortung für zwei kranke Menschen kann ich nicht tragen. Ich habe nichts mehr zuzusetzen. Null, glaub mir.«
»Gib mir doch nur etwas Zeit.«
»Nicht hier. Von mir aus komm zurück, wenn du dich wieder gefunden hast, und dann schauen wir, ob wir uns noch wollen. Aber so nicht.«
»Andrea …«
»Tu mir den Gefallen.« Ihre Stimme war brüchig, ihr Blick wich ihm weiter aus. »Sonst klappe ich zusammen.«
Er hatte nichts, was er ihr entgegnen konnte.
Sie zeigte mit dem Daumen nach draußen, in Richtung auf das Auto. »Ich muss los. Mach’s gut, Nathan. Leb wohl.«
Kein Abschiedsblick, keine letzte Berührung. Sie machte auf dem Absatz kehrt, zog die Haustür hinter sich zu, war verschwunden. Er sah ihr nach, wie sie ins Auto stieg und fortfuhr.
Sein Kaffee war mittlerweile kalt geworden, er hatte keine Lust mehr darauf, ihn verlangte nach Bier, obwohl die bösen Erinnerungen ihn nicht heimsuchten. Aber als er am Kühlschrank stand, die Hand bereits an der kühlen Flasche, bremste er sich. Kein Bier mehr. Schluss damit.
Er duschte und rasierte sich. Es war sein Haus genauso wie ihres, sie hatten es gemeinsam gekauft, Andrea konnte ihn nicht vor die Tür setzen. Außerdem brauchte er sie, zum ersten Mal in seinem Leben, ihn verlangte nach ihrer Zuwendung, nach ihrer Hilfe, um die böse Vergangenheit hinter sich zu lassen. In einer solchen Situation warf sie ihn hinaus?
Während er seinen Vorwürfen nachhing, wurde ihm klar, dass er diese Zuwendung nicht bekommen würde, nicht einmal, wenn er darum bettelte. Sie war so erschöpft, dass sie nichts mehr zu geben hatte. Und er würde sie nicht weiter reizen. Wenn sie verlangte, dass er verschwand, würde er ihr diesen Dienst erweisen. Einen Liebesdienst.
Mit wenigen Handgriffen stopfte er Klamotten in seinen Seesack. Viel hatte er nie gebraucht, auch damals nicht, wenn es wieder in die Kaserne ging, ein paar Turnschuhe, etwas Unterwäsche, einen Pulli, die Waschsachen. Für Andrea ließ er einen Zettel auf dem Küchentisch, dass er gegangen sei, wie sie verlangt habe, und dass er zurückkommen werde. Mit dem Geld.
ZWEI
3 Monate später
Schulte-Loh redete und redete.
Antwort schien der Mann nicht zu erwarten, nie, selbst der Aufmerksamkeit seiner beiden Zuhörer versicherte er sich höchstens beiläufig, dann fragte er: »Habe ich recht, Herr Fleming?« oder: »Ist es nicht so?« Ansonsten machte er den Eindruck, als sei er sich selbst genug.
Auf dem Tisch stand eine Flasche Rotwein, die zweite an diesem Abend. Der Alkohol hatte ihm die Zunge weiter gelöst. Seine Rede war ein einziger Vortrag. Er hatte offensichtliche Freude daran. Glaubte zutiefst an seine Thesen.
Am Anfang hatte Nathan zugehört, mittlerweile aber hatte seine Konzentation nachgelassen, an sein Ohr drangen nur noch einzelne Sätze, Aussagen wie: »Es muss endlich Schluss sein mit dem Ausverkauf deutscher Interessen.« Oder: »Wir können doch nicht immer weiter zahlen. Sollen die, die nicht mithalten können, eben austreten. Sonst führen wir die D-Mark wieder ein, das wäre auch nicht das Schlechteste. Der Euro ist sowieso eine Missgeburt.«
Seltsam gedämpft waberten die Worte zu Nathan herüber. Obwohl er nicht getrunken hatte, kam es ihm vor, als stünde zwischen ihm und Schulte-Loh eine Nebelwand, wie der Alkohol sie hervorruft. Er dachte an Andrea und Kati, an die Unmöglichkeit seiner Rückkehr. 4000 Euro hatte er, weil er sehr sparsam war, bisher zur Seite legen können, fünf Prozent von dem, was er benötigte. Wenn sein Guthaben in diesem Tempo weiterwuchs, würde er viele Jahre brauchen.
»Am schlimmsten finde ich, dass wir für unsere Hilfe nicht einmal geschätzt werden. Wir retten die Nachbarn, und was bekommen wir dafür? Nichts. Keine Anerkennung, kein Dankeschön, im Gegenteil, wir werden beleidigt, wir sind immer noch die Arschlöcher, die Nazis. Da muss unsere Politik endlich gegenhalten. Ganz entschieden gegenhalten. Wir lassen uns doch nicht in den Dreck ziehen.«
Der Abend war milde, sie saßen vor dem Haus auf einer weitläufigen Terrasse. Sterne und ein Halbmond standen am Himmel. Ein paar Kiefern begrenzten das Grundstück, vor ihnen lag der Fleesensee, eines der vielen Mecklenburger Gewässer.
Nathan hörte ein Geräusch. Ein Knacken. Er schreckte auf, beruhigte sich aber wieder. Nur ein Tier.
Anders als bei Martin Schulte-Loh, zu dessen Schutz er hier war, hatte der Rotwein die Zunge seiner Freundin schwer gemacht. Sie hieß Yvonne, war mindestens 15 Jahre jünger als er und beschäftigte sich hauptsächlich mit ihren Fingernägeln und ihrer Figur oder blätterte in irgendwelchen Zeitschriften.
Mecklenburg gefiel ihr nicht. Sobald ein paar Tropfen Regen fielen, sagte sie: »Lass uns nach Italien fahren, Schatz. Oder nach Mallorca. Da sind alle anderen auch.«
»Wir machen Urlaub in Deutschland.«
»Warum denn?«
»Weil es schön ist. Der See liegt vorm Haus, wir können Golf spielen und die herrliche Natur genießen. Außerdem ist es wichtig, der Heimat verbunden zu sein. Dort zu sein, wo die Wähler sind.«
»Das können wir doch den Rest des Jahres machen. Nur den Sommer verbringen wir am Mittelmeer, ja? Bitte, Martin.«
»Nein, sage ich. Den Menschen hier bedeutet es viel, mich zu sehen. Ich bin wie sie, trage eine Badehose, gehe im See baden.«
»Von einem privaten Steg aus.«
»Ein paar Unterschiede muss es geben, das ist wichtig.«
Sie quengelte: »Ach Martin, sei doch nicht so stur.«
Nun aber hatte der Wein sie stumm gemacht. Schläfrig offenbar auch, ihre Lider waren halb geschlossen, sie gähnte.
Wieder gab es ein Knacken. Nathan hob den Kopf und sah sich um. War das wirklich ein Tier? Was sonst?
Über die Terrasse zog ein leichter Wind. Der Abend hätte auf Mallorca oder in Italien nicht schöner sein können. Allerdings war es spät. Auf dem Tisch stand eine Kerze hinter einem Glasschutz. Sie war fast heruntergebrannt, und Nathan beschloss, nur noch auf ihr Ende zu waren, dann würde er leere Flaschen und Gläser hineintragen und auf diese Weise signalisieren, dass es Zeit fürs Bett war.
Er hörte ein Rascheln. Nahe. Jetzt reichte es ihm. Er stand auf – Schulte-Loh dozierte gerade über deutsche Schuldkomplexe – und trat an eine Ecke, von wo aus er ums Haus herumsehen konnte. Nichts. Da war nichts. Zumindest nichts, was er in der Dunkelheit hätte erkennen können.
Aber das Rascheln hatte er sich nicht eingebildet. Was für ein Tier sollte das sein – so nahe am Haus? Und mitten im Sommer? Für einen Igel war es zu laut. Ein Reh oder Fuchs kam nicht so dicht.
Er war versucht, das Windlicht zu holen. Aber dann säßen Schulte-Loh und Yvonne im Dunkeln. Er nahm es trotzdem. »Einen Moment nur.«
Schulte-Loh trank einen letzten Schluck aus seinem Glas. Yvonne gähnte tief.
Wie ein Nachtwächter früherer Zeiten trug Nathan das Licht vor sich her. Stapfte an der Seite des Hauses entlang. Scherte sich nicht um den Krach, den er machte. Außerhalb seines Lichtkegels war es vollkommen finster, er sah nichts und nun hörte er auch das Rascheln nicht mehr, sondern nur das Quaken von Fröschen, das vom See herüberdrang. Offenbar hatte er das Tier vertrieben. Der warme Wind trug ihm süßliche Sommmergerüche in die Nase.
Er hatte sich geirrt und war dabei, umzukehren. Ein Igel, wahrscheinlich eine ganze Igelfamilie, die inzwischen ihr Nachtlager erreicht hatte. Etwas übervorsichtig, der Herr Personenschützer.
Doch bevor er noch umgekehrt war, sah er im Schein seiner Kerze etwas aufblitzen. Es glitzerte, für einen Augenblick nur. Ein Stück Metall.
Hallo, wollte er rufen.
Er kam nicht dazu. Ehe er den Mund geöffnet hatte, traf ihn ein Schlag am Hinterkopf. Glas splitterte. Er ging in die Knie. Aus weiter Ferne nahm er einen unterdrückten Ruf wahr.
Im Haus wurde er wieder wach. Helles Deckenlicht stach ihm in die Augen. Mit Plastikbändern war er an Händen und Füßen gefesselt, im Mund steckte ihm ein Knebel. Sein Kopf schmerzte an der Stelle, wo er den Schlag bekommen hatte.
Da er auf dem Rücken lag, musste er den Hals recken, um nach Schulte-Loh und Yvonne zu sehen. Beide waren ebenfalls gefesselt und geknebelt. Während Schulte-Loh wie ein Schlafender auf seinem Bauch lag und den Kopf zur Seite gedreht hatte, war Yvonne unruhig. Sie zuckte, bewegte sich hin und her, versuchte, den Hals zu recken, stöhnte auch. Wollte sich befreien, was unmöglich war.
Die Angreifer sprachen kein Wort. Keine Stimme, die man hätte wiedererkennen können. Was wollten sie, weshalb waren sie hier? Schulte-Loh töten, den Vorsitzenden einer neuen und weit rechts stehenden Partei? Das hätten sie leichter haben können, ohne die Fesseln und Knebel.
Den Mann entführen, samt Partnerin und Personenschützer? Zu welchem Zweck? Oder ihn nur einschüchtern? Als politisches Statement einer radikalen Gruppe?
Er hörte ein Geräusch, ein Zischen, das Sprühen aus einer Farbdose, und zwischendurch das Klappern der Kugel, wenn die Dose geschüttelt wurde. Die Angreifer waren, glaubte er, zu dritt. Sie trugen Motorradmasken, die nichts als die Augen freiließen, unmöglich, ihre Gesichter zu erkennen, zumal er nicht mit Bewegungen auffallen wollte. Wenn er befreit würde, würde er einen schlechten Zeugen abgeben.
Das Sprühgeräusch hörte auf. Die Kugel, die in der Dose war, schlug lange gegen die Metallwand, dann gab es ein neuerliches kurzes Zischen, wie einen Abschied. Dann nichts mehr, nur noch Schritte. Fußgetrappel. Alles wortlos. Die Angreifer schienen sich mit Handzeichen und Blicken zu verstehen.
Die Terrassentür wurde aufgezogen. Wenn er sich nicht irrte, verschwanden die Typen. Nein, da war noch etwas, eine Erschütterung, ein kleines Beben, das man nicht nur hörte, sondern auch auf dem Boden spürte. Als wenn einer von ihnen gegen eine Scheibe gelaufen wäre. Dann aber Ruhe.
Mit einem Schwung drehte sich Nathan auf den Rücken. Der Knebel schmeckte nach trockenem Tuch, er hatte einzelne Baumwollfasern im Mund. Schulte-Loh lag immer noch schicksalsergeben da, den Kopf auf der Seite, die Augen geschlossen. Yvonne dagegen schien Panik zu haben. Sie versuchte, sich aufzubäumen, was ihr aber nicht gelang. Sie schlug mit den Füßen auf den Boden. Ihr Gesicht war knallrot. Sie sah aus, als bekäme sie kaum Luft. Er musste etwas unternehmen.
Er bewegte sich vorwärts, robbte auf Unterarmen und Hinterteil und Füßen. Die Fesseln waren aus hartem Plastik, trotzdem durchtrennbar. Dafür brauchte es ein Messer – oder Glas.
Er entschied sich gegen die Terrassentür, in der er eine Verbundscheibe vermutete, mit den Füßen kaum einschlagbar. Besser war der Fernseher. Der stand allerdings zu hoch, als dass er hätte hinlangen können. Deshalb trat er mit Wucht gegen die Kommode, auf der er platziert war. Erst knackte sie, beim zweiten Versuch wackelte sie, dann gab sie nach. Bretter kamen in Bewegung, das ganze Ding krachte laut und brach in sich zusammen. Der Fernseher stürzte zu Boden. Allerdings war die Mattscheibe nicht gesprungen.
Nathan robbte in Position und trat wieder zu. Die Sohlen seiner Turnschuhe waren zu weich, und doch, es musste gelingen, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Er trat und trat.
Das Einzige, was er erreichte, war, dass der Fernseher nach hinten geschoben wurde, immer weiter, bis er endlich gegen die Wand stieß. Nathan robbte ihm nach, nahm Schwung, trat zu. Einmal. Noch einmal. Ein drittes Mal.
Er hörte ein Knacken. Ein Reißen. Und er hörte Yvonne stöhnen. Sie wurde leiser, sie wimmerte nur noch. Nicht aufgeben, Yvonne. Nicht aufgeben.
Er trat schneller, trat und trat, ein wütendes Trommelfeuer, wieder und wieder, bis Bauch und Beine gegen die ungewohnte Anstrengung rebellierten. Es hatte keinen Sinn, und er konnte nicht mehr. Sein Atem ging schnell, als hätte er einen üblen Spurt hinter sich gebracht. Aus Verzweiflung gab er der Mattscheibe einen letzten Tritt.
Sie ächzte. Klang wie ein alter Mensch, der sich überanstrengte. Gab sie endlich nach?
Er nahm seine Kraft zusammen und setzte einen neuen Wirbel aus Tritten an. Die Schmerzen in seinem Körper ignorierte er, wie er es gelernt hatte. Ja, das Glas gab nach! Es war eingerissen, auch wenn er davon noch nichts sehen konnte. Er wünschte sich einen Hammer.
Schließlich barst die Scheibe unter der Vielzahl seiner Tritte. Der größte Teil des Glases versank in dem schwarzen Kasten. Nur an den Rändern waren Scherben stehen geblieben, die wie Zähne eines Hais herausstanden.
Nathan brachte seine Fußgelenke in das Gehäuse. Die Fessel hielt er gegen eine der Scherben und begann zu reiben. Das Plastik war stabiler als das Glas. Ehe es auch nur ein kleines Stück eingerissen war, brach das Stückchen Scheibe und sackte nach hinten in den Kasten.
Er fluchte. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Die gefesselten Hände auf dem Rücken, auf denen sein gesamtes Gewicht lag, pochten unter dem Druck, und die Muskeln der Unterarme verkrampften sich schmerzhaft.
Er hielt seine Knöchel an eine andere Scherbe, die höher war. Dazu musste er sich strecken, wobei er die überzähligen Kilos auf seinen Hüften spürte. Diese Stellung, mit erhobenen, ausgestreckten Beinen, kostete viel Kraft, und er war schon besser in Form gewesen. Wesentlich besser.
Die zweite Scherbe stand fester in ihrer Halterung. Er rieb. Rieb und rieb. Dabei drückte er die Knöchel auseinander – die Fessel war gespannt, allerdings unversehrt und damit weiterhin zu stabil, als dass er sie mit seiner Kraft hätte zerreißen können. Es blieb nur der Schnitt mit der Scheibe.
Schulte-Loh hatte den Kopf gehoben und schaute ihm zu, mit einem väterlichen Lächeln in dem vom Knebel verzerrten Mund. Der Mann war braun gebrannt, die Frisur hielt ihre Form, der Überfall schien ihm nicht viel auszumachen. Yvonne dagegen hatte offenbar aufgegeben. Sie bewegte sich nicht mehr, ihr Röcheln war nicht mehr zu hören.
Nathan schloss die Augen. Er fürchtete das Schlimmste. Kaum hatte er die Anstrengung unterbrochen und seine Beine abgelegt, überkam ihn Panik, die ihn wie ein Stromschlag traf. Sie breitete sich augenblicklich in seinem gesamten Körper aus und ließ ihn schwitzen. Im Ohr hatte er ein Piepen, einen hohen Ton, eine Schadensmeldung. Er hob seine Beine wieder an und setzte die Befreiung fort, rieb schneller, rieb wie ein Getriebener, alle Konzentration auf die Scherbe und seine Knöchel gerichtet, damit er nur nicht abrutschte, denn es hatte keinen Sinn, immer wieder neu anzusetzen, er musste dort weitermachen, wo er das Plastikband schon eingeschnitten hatte. Hoffentlich schon eingeschnitten hatte.
Das Deckenlicht blendete ihn, er kniff die Augen zusammen, wodurch ihm auf der Netzhaut seltsame Bilder erschienen, Wassertropfen, die sich verzogen, Wolken bei leichtem Regen. Künstliches Licht in einem Einkaufszentrum.
Er rieb. Immer weiter. Auf seinem T-Shirt machte sich in Bauchhöhe ein Schweißfleck breit. Auch im Gesicht stand das salzige Wasser und tropfte hinunter zu Ohren und Schultern. In den Augen brannte es. Das Piepen im Ohr hielt an.
Er rieb und war sich inzwischen sicher, das Plastikband eingekerbt zu haben. Mit neuer Kraft zerrte er daran. Es gab nicht nach.
Trotzdem blieb nur das Reiben, eine Abkürzung gab es nicht. Er zog die Knie und streckte sie, vor und zurück, immer wieder. Alle Schmerzen, an Händen, an Rücken und Hals und an den Oberschenkeln drückte er nieder. Nicht aufgeben.
Auf der Brust saß ihm ein Schrei, der aber nicht aus dem geknebelten Mund herauskam, er blieb ein Druck, ein schwerer Stein, der auf ihm lastete.
Dann, endlich, riss die Fessel. Sie riss so plötzlich, dass seine Beine auseinander stoben und jeweils gegen den Rahmen des kaputten Fernsehers stießen. Und neue Schmerzen verursachten.
Er ließ sich zur Seite fallen, kam auf die Knie, dann mit einem Fuß hoch, schließlich mit dem anderen. Seine ersten Schritte waren ein Torkeln, er musste sich an der Wand abstützen, bevor er sich in die Küche aufmachen konnte.
Schulte-Loh hatte eine Luxuswohnung angemietet, mit Sauna und Whirlpool, mit verchromter Espressomaschine und teurem Geschirr. Und mit einer Brotschneidemaschine. Gegen dieses Gerät stellte er sich mit seinem Rücken, schob den metallenen Schutz auf und fing das gleiche Spiel wieder an, das gleiche Reiben, auf und nieder.
Diesmal ging es schneller – die Maschine stand fest, sie war an der Küchenplatte verschraubt, und er musste sich nicht verrenken. Als die Fessel gerissen war, zog er sich den Knebel aus dem Mund, griff nach einem Küchenmesser und rannte zurück ins Zimmer. Schulte-Loh lag inzwischen wie ein Sack auf dem Boden, kraftlos und schwer. Erst als er Nathan hörte, blickte er auf.
Yvonne dagegen rührte sich nicht. Nathan war hektisch, seine Hand zitterte, als er ihr den Knebel aus dem Mund zog. Um ihr die Fessel zu zerschnieden, musste er drei Mal ansetzen. Sie reagierte nicht. Ihren Puls konnte er nicht tasten, beim Herzschlag war er sich nicht sicher. Er schloss die Augen, als wollte er beten. Dann öffnete er unter den Augen ihres Partners ihren Mund und beugte sich zu ihr, holte Luft und blies sie ihr in den Hals. Holte wieder Luft und blies. Und noch einmal.
Sie bewegte sich nicht. Er ließ von ihr ab, um Schulte Loh, der schon gekrächzt hatte, frei zu schneiden, sodass der Mann sich von seinem Knebel befreien konnte.
»Schnell, einen Notarzt«, rief er ihm zu. »Eins-eins-zwo.«
Schulte-Loh nahm sein Smartphone und wählte. Yvonne war kreidebleich. Leblos, dachte Nathan und hatte Mühe, seine Panik im Griff zu halten. Er beugte sich wieder über sie und versuchte erneut, sie zu beatmen.
DREI
Wenig später traf die Rettung ein. Drei rote Autos parkten vorm Haus, Funkgeräte rauschten, Notarzt und Sanitäter knieten sich neben Yvonne, während sich draußen die Blaulichter drehten und ihr Widerschein in rhythmischen Abständen in den Wohnraum blinkte. Vorm Fenster drängten sich Nachbarn in Shorts und Badelatschen und glotzten durch die Scheibe.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!