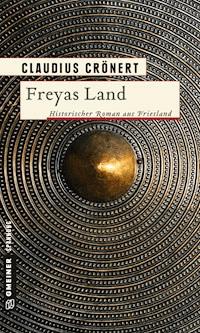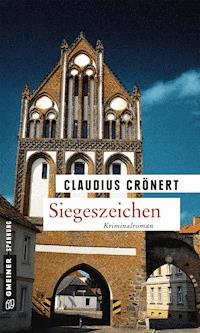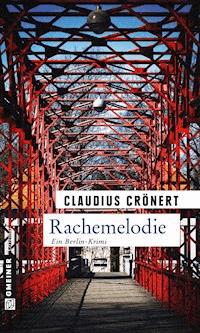
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Ostrowski
- Sprache: Deutsch
Kaum ist Bastian Siewert aus dem Gefängnis entlassen worden, wird wieder eine junge Frau ermordet. Der Berliner Kommissar Thomas Ostrowski, mittlerweile in Pension, muss noch einmal ran. Im Laufe der Ermittlung überfallen ihn jedoch Zweifel: Hat er damals den falschen Mann hinter Gitter gebracht? Ihm 15 Jahre seines Lebens geraubt? Jetzt wird die Tochter des Kommissars bedroht. Aus Rache? Ein vielschichtiges Rennen beginnt, bei dem es um alles geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudius Crönert
Rachemelodie
Ein Berlin-Krimi
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © spuno – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4470-8
Widmung
Für Valeria und Marcello
Und ganz besonders für Cristiano
Zitat
I see a bad moon rising
I see troubles on the way
I see earthquakes and lightning
I see bad times today.
John Fogerty
»Die Vergeltung ist mein«
Auf die Melodie von »Die Gedanken sind frei«
Von Bastian Siewert
I
Die Vergeltung ist mein, wer will sie verhindern?
Sei der Weg auch nicht fein, und mag man mich schinden
Kein Mensch kann sie wissen, kein Kripo erschießen,
Es bleibet nicht klein: Die Vergeltung ist mein.
II
Ich räche was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still’ und wie es sich schicket.
Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren,
Es bleibet nicht klein: Die Vergeltung ist mein.
III
Ich liebe die Tat, die Rache vor allem,
denn diese zwei wolln mir trefflich gefallen.
Bin ich auch allein, mein Weg ist stets rein.
Es bleibt nicht beim Schein: Die Vergeltung ist mein.
IV
Und sperrt man mich ein in finstere Kerker,
das alles sind nur vergebliche Werke,
denn meine Gedanken zerreißen die Schranken
und Mauern aus Stein. Die Vergeltung ist mein.
V
Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen
Und will auch nimmer mit Menschen mehr plagen
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen
Und denken: Wie fein, die Vergeltung ist mein.
1. Kapitel
Die segensreiche Finsternis.
Der Abend hatte eingesetzt, die Autos schoben, eins wie das andere, gelbe Lichtkegel vor sich her. Die Scheiben der Busse waren beschlagen. Nasser Schnee tropfte vom Himmel. Auf Straßen und Bürgersteigen wurde er zu Matsch.
Der Mann stand und schaute.
Er sah zu, wie Wasser durch die Luft spritzte. Wie Passanten auswichen. Und wie sich die Nacht tiefer und tiefer über die Häuser senkte.
Der Mann zog seinen Handschuh aus und ließ die Finger in die Hosentasche gleiten, wo sie auf das Messer trafen. Es war zusammengeklappt. Mit dem Zeigefinger fuhr er über die stumpfe Seite.
Ein Schauer strich ihm über den Rücken.
Als er seinen Weg aufnahm, führte er vorbei an Hügeln von Schnee, die mit der Zeit schwarz geworden waren, kotbraun und gelb. Die Nässe fiel ihm auf den Kopf, aber da er einen Hut trug, spürte er sie nicht. Den Mantelkragen hatte er aufgestellt. An einer Ampel kreuzte er die vierspurige Fahrbahn, in der Sicherheit, dass er nur ein Passant unter vielen war, unauffällig wie sie, unbeachtet.
Sein Ziel lag einige Hundert Meter weiter. Es war kurz nach sechs, er hatte keine Eile, dennoch überholte ihn niemand, denn sein Viertel war eines der Alten geworden. Nicht dass sie alle Gehhilfen oder Rollatoren gebraucht hätten, manche verbanden weiße Haare mit sportlicher Kleidung und großen Plänen, trotzdem kamen sie nicht hinterher. Das Geräusch der Autoreifen auf der nassen Fahrbahn drang in sein Ohr, ein Zischen, ein Surren.
Der Mann trat an die Seite, um nicht nass gespritzt zu werden.
Am gegenüberliegenden Rand des Tegler Hafenbeckens tauchte der Kiosk auf. Die Zeitungsstände waren wegen der Nässe hineingeräumt worden. Durch die Scheiben drang fahles Licht. Der Mann kannte die Auslage, sie war ihm am Vortag ins Auge gefallen, die Werbung für Lotto, die Spiele und Schreibwaren, die Hinweise auf Zigaretten und Schnaps. Ohne hineinzusehen, schritt er daran vorbei.
Dabei empfand er ein Glücksgefühl, das grenzenlos war. Niemand würde ihn aufhalten.
Die rückwärtige Tür war aus Eisen und rostig. Er drückte den Griff herunter – verschlossen. Mit dem Rücken zur Tür wartete er. Sollte ihn, den Mann im schwarzen Mantel, mit Handschuhen und Kopfbedeckung, überhaupt einer wahrnehmen, würde er wie jemand wirken, der unter einem Vordach Schutz vor dem Mistwetter gesucht hatte. Unauffälliger, fand er, ging es kaum. Mit der Aktentasche in der Hand war er jemand, der von der Arbeit kam. Die Tarnung war perfekt.
Als niemand zu sehen war, öffnete er den Riemen der Tasche, griff hinein, tastete nach seinem Werkzeug. Er hatte einen Kuhfuß dabei, entschied sich aber, es mit dem Dietrich zu versuchen. Das Öffnen von Schlössern – eines der wenigen Dinge, die er in seiner Jugend gelernt hatte. Erst eine Lehre, hatte sein alter Herr gesagt, dann kannst du machen, was du willst.
Er tat, was er wollte.
Bevor er sich dem Schloss zuwandte, hielt der Mann erneut inne. Nun brauchte keiner mehr zuzuschauen. Es war beruhigend, viel Zeit zu haben. Er hatte den Dietrich in der Hand und die Aktentasche wieder verschlossen. Den Weg konnte er zu beiden Seiten einsehen. Als er sich überzeugt hatte, dass er vollkommen menschenleer war, begann er mit seiner Arbeit.
Das Schloss war widerspenstig, und er hatte lautlos zu werken. Der Dietrich griff nicht. Er setzte ihn ab, rieb sich die Augen, schöpfte Atem. Auf der gegenüberliegenden Seite des Weges kam jemand vorbei, der Montur nach ein Handwerker, sein Feierabendbier in der Hand. Seine patschenden Schritte hatten ihn schon von Weitem angekündigt. Der Handwerker ging schnell, während der nasse Schnee ihm auf Jacke und Haar fiel. Im Mundwinkel hatte er eine Zigarette. Kein Blick zu irgendeiner Seite.
Der Mann nahm seine Arbeit wieder auf und stellte fest, dass die Pause ihm gutgetan hatte. Der Dietrich fasste beim ersten Versuch, das Schloss gab nach, die Tür sprang auf. Als er sie weiter aufschob, machte sie ein knarrendes Geräusch. Er erschrak und griff nach ihr. Noch einmal sah er sich um. Stellte fest, dass er unbeobachtet war. Trat ein.
Das Hinterzimmer lag im Halbdunkel.
Ein muffiger Raum, voller aufgerissener Pappkartons und eingestaubter Regale. Aus einem Bretterverschlag, hinter dem eine Kloschüssel verborgen sein mochte, stank es nach Abflussrohr. Leichter Ekel stieg in dem Mann auf. Er hielt die Luft an und drückte den Ekel fort. Von Gestank und Durcheinander würde er sich die Laune nicht verderben lassen, und auch nicht davon, dass sein Mantel roch. Die Wärme des Zimmers hatte die Feuchtigkeit auf der Wolle trocknen lassen.
Zum Verkaufsraum führte eine Falttür aus Pappe. Sie war zu drei Vierteln zugezogen. Nicht nur Licht, auch Stimmen drangen zu ihm. Bevor er auf sie achten konnte, brauchte er einen sicheren Platz. Ein Versteck.
Er suchte die Wände ab. Ausgerechnet neben der Toilette fand er, was er benötigte.
Der Mann hielt ein weiteres Mal die Luft an und fahndete nach einem anderen Platz. Vielleicht in der Ecke neben der Schiebetür. Aber dort sähe man ihn, sobald jemand den Raum betrat. Zwischen den Kistenstapeln? Waren keine Lücken. Er hätte sie verschieben müssen.
Blieb allein der Vorsprung am Verschlag. An der Kloschüssel.
Auf Zehenspitzen machte er die wenigen Schritte. Er wollte nirgendwo gegen stoßen und nichts berühren. Der Fußboden knarrte. Er wurde noch langsamer, noch vorsichtiger. Tastete sich vorwärts, verlagerte wie ein Dressurpferd das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Atmete durch den Mund und versuchte, die Nase auszuschalten. Und erreichte endlich den Platz, zu dem er gewollt hatte.
Seine Uhr zeigte 20 nach sechs. Das Messer war in der Hosentasche, er spürte es am Oberschenkel.
Und er wurde auch wieder ruhiger.
»Was wollen wir heute Abend machen?«, kam es von nebenan. Eine Frauenstimme.
»Erst mal zu dir«, erwiderte ein Mann. Beiden hörte er ihre Jugend an.
»Geht schlecht. Meine Oma ist da.«
»Na und? Die schicken wir für ’ne halbe Stunde weg. Muss doch auch mal frische Luft schnappen, die gute Alte.«
Er hörte sie quieken, dann ein Schmatzen, ein Kuss wahrscheinlich, den er irgendwo in ihrem Gesicht gelandet haben mochte. Die Geräusche fuhren tief in ihn hinein.
Das Quieken wurde lauter.
»Hör auf«, sagte sie, kicherte aber dabei. »Doch nicht hier im Laden.«
»Schließ einfach ab.« Eine anzügliche Stimme, feuchte Lust. »Dann brauchen wir auch nicht zu dir.«
»Nein. Es ist noch nicht halb sieben.«
»Aber kurz davor. Komm, gib den Schlüssel, ich mach. Und dann zeigst du mir mal das Hinterzimmer. Das sieht schön dunkel aus.«
Er hörte eine Schublade, die zugeschoben wurde. Dann das Geräusch einer Kühlschranktür.
Das Ziffernblatt seiner Uhr leuchtete. Fünf Minuten noch bis Ladenschluss.
Er hoffte, dass sie ihn fortschickte. Aber nicht zu schnell.
»Ich nehme mir ein Bier, ja?«
»Musst du bezahlen. Sonst stimmt meine Kasse nicht.«
Münzen wurden auf einen Tisch geworfen und kullerten dort weiter. Eine Flasche wurde geöffnet.
»So, Baby, es ist halb. Komm, lass absperren.«
Der Junge trank und rülpste laut, das Geräusch drang bis in sein Versteck. Er grinste und drückte seine Hand auf den Reißverschluss der Hose.
»Dann muss ich die Kasse machen.«
»Mensch, Süße, das hat doch Zeit.«
Wieder ihr Quieken. Wahrscheinlich hatte er sie in den Hintern gekniffen. In das weiche Fleisch.
»Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. So heißt es doch.« Der Junge lachte.
Eine Glocke erklang, und die Tür ging auf. Er spürte den Luftzug, der durch den Spalt in der Schiebetür bis zu ihm gedrungen war. Frische Luft.
Sie tat gut.
»Wir haben eigentlich schon geschlossen«, hörte er die Frau.
»Komm, hab dich nicht so. Bitte.« Die Stimme eines Trinkers, zittrig, dabei fordernd, als hätte alle Welt die Pflicht, ihm in seiner Not zu helfen. Er stellte sich einen mittelalten Kerl vor, mit roter Nase, steifen Knien und ungepflegtem Bart. Wie viele von diesen Typen hatte er schon gesehen. »Ich brauche nur paar Zigaretten und ein Bier oder zwei. Sonst komme ich nicht über den scheiß Abend.«
Ein weiteres Mal wurde die Kühlschranktür aufgezogen. Glas schlug aneinander. Bierflaschen.
»Anschreiben kann ich nicht, wa?«
»Leider nicht.«
»Dann keine Zigaretten. Ein Päckchen Tabak. Und Blättchen.«
»Welchen Tabak?«
»Den billigsten.«
Diesmal war es eine andere Art zu bezahlen, die Münzen wurden nicht auf den Tresen geworfen, sondern Stück für Stück dorthin gelegt. Ein Mensch, der sein letztes Geld ausgab.
»Kann ich nicht wenigstens einen Flachmann anschreiben? Morgen bekomme ich Geld. Ganz sicher.«
Anstelle der Frau antwortete ihr Freund: »Nun ist gut, ja?«
Der Trinker brauchte lange, ehe er herauspresste: »Was mischst du dich denn ein?«
Spannung kam auf wie im Kino und fand den Weg bis in sein Versteck. Unmissverständliche Geräusche waren zu hören, Absätze, die auf dem Fußboden kratzten, Knochen, die knackten.
Gewalt lag in der Luft. Die Hand an seinem Reißverschluss drückte zu.
»Ich darf nicht anschreiben lassen«, hörte er die Frauenstimme. »Steht auch auf einem Schild an der Tür. Und außerdem möchte ich abschließen. Es ist Feierabend.«
Von den beiden Streithähnen schien sich keiner zu rühren, auch sprachen sie kein weiteres Wort.
Die Spannung ließ nicht nach.
»Bitte«, flehte die Frau, »bitte, alle beide. Das bringt doch nichts.«
Der Mann in seinem Hinterzimmer hörte ein lautes Ausatmen. Wieder schlug Glas aneinander, Sohlen stießen gegen den Fußboden. Der Trinker hatte sich mitsamt seiner Bierflaschen in Bewegung gesetzt.
»Wir sehen uns wieder«, sagte er, bevor er die Tür aufzog.
»Ganz sicher«, rief der andere hinter ihm her. Und sagte dann: »Los, Bine, schließ endlich ab, dass nicht noch einer von diesen Pennern reinkommt.«
Ein Schlüsselbund klapperte. Sie schien an ihm vorbei zu gehen, denn es gab ein Klatschen und danach einen Aufschrei, halb im Spaß, halb im Ernst. Die Tür wurde abgeschlossen. Dann ein Grunzen. Ein Geräusch wie von einem Tier. Ein Tier in der Brunftzeit.
Seine Erregung wurde stärker. Er schloss die Augen, während sich der Mund wie von selbst öffnete. Er malte sich aus, dass der Junge seine Arme um sie geschlungen hatte. Mit seinen Pfoten unter ihrem Pullover herumfuhrwerkte. Ihren Busen betatschte. Mit seiner Zunge über ihr Gesicht fuhr. Spucke darauf zurückließ.
Köstlich.
»Zeigst du mir nun endlich das Hinterzimmer?«
»Das geht doch nicht.«
»Bine!«
»Manchmal kommt abends der Chef. Und außerdem muss ich die Kasse machen.«
»Ist doch nicht eilig.«
»Torsten, bitte. Nicht jetzt.«
»Und was, wenn ich will? Jetzt?« Sein Ton war plötzlich laut geworden. »Jetzt sofort?«
Der Mann in seinem Versteck musste sich bei aller Lust der Frage stellen, was er tun würde, wenn der brunftige Kerl sich durchsetzte. Unsichtbar zu bleiben, war unmöglich. Und zwei Leute waren zu viel für ein einziges Messer. Also wieder verschwinden? Jetzt, wo er so weit gegangen war? Unvorstellbar. Er musste das Risiko eingehen. Spürte, wie es ihn fesselte, ihn anspannte. Ein scheußliches und gleichzeitig erregendes – ein wundervolles Gefühl.
»Torsten, lass mich los. Bitte.«
Ein Lachen. Schmutzig und brutal. Er zeigte ihr, wo es langging. »Nein. Ich lass dich nicht.«
Der Mann gab sich Mühe damit, sich möglichst genau vorzustellen, was im anderen Raum vor sich ging. Die Geräusche halfen seiner Fantasie: Kleidung rieb aufeinander, Gürtelschnallen, die aneinander stießen. Ein Gerangel. Eine Situation, die umzukippen drohte. Einzelne Worte, die schärfer wurden.
Vielleicht brauchte der Kerl Gewalt? Ein wenig nur, um sie umzustimmen.
Dann ihr Gejammer. »Torsten, bitte. Wenn der Chef kommt, bin ich meinen Job los.«
»Der lässt sich fast nie sehen.«
»Eben doch. Und er kommt meistens dann, wenn man überhaupt nicht mit ihm rechnet.«
»So ein Quatsch.«
Er hörte kein Wort mehr, und nichts passierte. Die Spannung war kaum auszuhalten. Er schlug die Zähne auf die Lippen, bis der Schmerz kam. Eine Urgewalt wollte ihn aus seinem Versteck ziehen, damit er durch die Falttür spähte, auf nackte Haut und festes Fleisch. Er musste mit aller Macht dagegenhalten. Kein unnötiges Risiko eingehen, sich nur nicht verraten. Die andere Möglichkeit, abzubrechen, gab es längst nicht mehr. Er war viel zu tief drin.
Dann meldete sich ein Handy. Musik als Klingelton: Für Elise. Der Mann atmete durch. Seine Anspannung ließ nach.
»Ja?«, meldete sich der Kerl im anderen Raum.
Schweigen.
»Und wann?«
Wieder Schweigen.
»Ist gut. Bis gleich.«
»Wer war das? Wohin gehst du?«, fragte sie.
»Treff’ mich mit den anderen. Die haben eine Kiste Bier.« Er lachte.
»Und wir? Sehen wir uns heute Abend noch?«
Keine Antwort.
Die Sprachlosigkeit drang bis zu ihm in die Kammer. Diesmal war es nicht Gewalt, die in der Luft lag, sondern Enttäuschung. Mit einem Mal hatten sich die Verhältnisse gedreht. Nun war sie es, die etwas von ihm wollte. Und er spielte mit seiner Macht.
»Mal sehen.«
»Eine halbe Stunde noch, dann habe ich frei.« Sie klang auf einmal wie die Liebe selbst. »Ich muss nur abrechnen. Geht schnell.«
»Ruf mich halt an.«
Schritte.
»Torsten?«
Der Schlüssel wurde gedreht, die Tür geöffnet.
In seinem Hinterzimmer hörte er die Glocke. Er entspannte sich. Alles würde gut. Sie war allein.
Der Mann schlich, nachdem sie die Ladentür abgeschlossen hatte, zum Lichtschalter, knipste ihn an und sofort wieder aus.
»Hallo«, kam im nächsten Moment ihre Stimme aus dem Verkaufsraum. »Ist da jemand?«
Sie schob die Papptür auf, die sich verhakte und mit Kraft weitergedrückt werden musste. Licht drang aus dem Verkaufsraum herein. Da stand sie und schaute sich um, ihre Haut war mehr als blass, sie war weiß und stach gegen das schwarz gefärbte Haar. Schwarz waren auch ihre Schminke und ihr Pullover. Ein Mensch mit Sehnsucht nach dem Tod. Durch den Nasenflügel war ein Ring gestochen.
Sie war bereits auf dem Weg. Er würde ihr helfen.
Der Mann drückte sich hinter den Verschlag und stellte das Atmen ein.
Erst als sie auch im Hinterzimmer das Licht anknipste, stieß er sich heraus und sprang auf sie zu. Bevor ihr Schrei laut wurde, presste er ihr eine Hand auf den Mund und die andere an den Hinterkopf.
Ihr Blick war starr. Wasserfarbene Augen. Weit aufgerissen. Und das Gesicht so weiß wie ein Blatt Papier.
»Hör auf«, flüsterte der Mann ihr ins Ohr, »dann lasse ich los.«
Er trug seine Handschuhe. Trotzdem hätte sie zubeißen, hätte sich wehren können. Ihn in einen Kampf verwickeln.
Hätte alles versuchen können. Das hätte ihm Spaß gemacht.
Stattdessen nickte sie. Ängstlich wie ein Reh. Wie ein dummes Mädchen. Bettelnd. Flehend.
Sie hatte Angst vor der letzten Reise.
Langsam lockerte er die Hand vor ihrem Mund, bereit, wieder zuzudrücken, sollte sie erneut schreien.
Aber sie blieb leise. Schluchzte nur.
»Was … was wollen Sie?«
Das Messer in der Hose war bereit. Das Tuch, das zuoberst in seiner Tasche lag. Wer wollte da Eile haben? Der Moment war zu wundervoll, jener Augenblick vor der Erfüllung, in ihm lag Genuss, und der Mann war erfahren genug, um sich ihm vollständig hinzugeben. Er schaute das Mädchen an. Bine, hatte der Junge sie genannt. Sabine. Aus der Nähe war sie ein wenig hübscher. Da gab es Anzeichen von Charakter in ihrem Gesicht, ein Kinn, das den Namen verdiente, und Wangenknochen, die sich abzeichneten. Vor allem anderen aber stand die Blässe. Die Sehnsucht nach dem Tod.
Wegen der Tränen verlief ihre Schminke, sie zog eine dunkle Spur Richtung Wangen, und das gefiel ihm. Bine litt. Gefühle waren selten eindeutig, die Angst mischte immer mit. Er war sich sicher, dass sie sich in die Hose gemacht hatte. Stellte es sich vor. Und konnte nicht anders, als darin zu schwelgen.
Er stand vor ihr, die Augen halb geschlossen, war ganz Geruch und Erregung. Von Ferne drang ihr Schluchzen und Schniefen an sein Ohr. Das weckte ihn schließlich.
Er öffnete die Augen, sah sie ein letztes Mal an und drehte das willenlose Mädchen mit Schwung um ihre Achse.
Thomas Ostrowski öffnete die Wohnungstür, ließ seinen Schlüssel auf den kleinen Tisch unter dem Spiegel fallen und rief: »Hilde!«
Keine Antwort.
Er hatte keine erwartet.
Sie saß im Wohnzimmer auf ihrem Sessel und regte sich kaum. Im Fernsehen lief eine Show mit dramatischer Musik und künstlichem Applaus. Eine kleine Lampe am Regal brannte, sonst gab es kein Licht.
Ostrowski beugte sich zu ihr herunter und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich bin da.«
Er blieb zwischen ihr und der Glotze stehen, verdeckte das Bild mit der ganzen Masse seiner 103 Kilo und der Größe von 1,96 Meter und setzte hinzu: »Es ist geschafft.«
Sie bemühte sich um ein Lächeln. Verzog die Lippen, blickte ihn sogar an. Trotzdem war sein Eindruck, dass sie besonders blass aussah und schmal. Die Wangen waren eingefallen, die Knochen traten hervor, das graue Haar war strähnig, und die Augen waren stumpf, als wären sie erloschen.
Was hatten diese Augen früher geleuchtet.
»Es ist wirklich geschafft, Hildelein. Seit heute bin ich ein freier Mann. Pensioniert. Das heißt, ein wenig Resturlaub habe ich noch. Aber arbeiten muss ich nun nicht mehr. Was sagst du?«
Sie sagte nichts. Ihr Blick kehrte zum Fernseher zurück. Den Kopf neigte sie auf die Seite. Wortlos bedeutete sie ihm, dass er ihm Weg stand.
Er dagegen wollte erzählen und die vielen Eindrücke loswerden. »Sie haben sich Mühe gegeben mit mir. Jedenfalls soweit ihnen das möglich ist. Es gab Kaffee und sogar Sekt. Aus Pappbechern natürlich. Wir haben angestoßen. Und diese ganzen warmen Worte. Du wirst staunen, was für eine hohe Meinung sie von mir haben. Zumindest, wenn sie nicht fürchten müssen, dass ich wiederkomme.« Er lachte bis in den Bauch hinein. Als sie in keiner Weise einstimmte, bremste er sich. »Ich mache dir erst mal Abendbrot. Hast du Hunger? Übrigens …«
Sie kniff die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Wie eine Puppe sah sie aus, wie eine Marionette im Kindertheater, die ihren Willen kundtat.
»Übrigens«, wiederholte er, »macht das Auto seltsame Geräusche. Könnte der Auspuff sein. Ich ruf gleich morgen früh die Werkstatt an.«
Seine Knochen knackten, als er sich neben sie hockte. Er legte seine Hand auf ihre. Seine warme Pranke auf ihre kalten Altfrauenfinger.
»Irgendwas musst du doch essen, Hildelein. Fällst mir noch vom Fleisch.« Er strich über ihren schmalen Handrücken. »Ich deck Brot, dazu Gurke und Tomate. Wurst und Käse. Und einen Tee. Einverstanden?«
In ihrem Gesicht gab es weder Ablehnung noch Zustimmung. Da Werbepause war, schaltete er den Fernseher aus und ließ, während er sich in der Küche zu schaffen machte, die Tür offen stehen, damit sie ihn hören konnte.
»Rahlke hat mir die Hand gegeben. Eine feuchte Hand, das kann ich dir flüstern. Er hat sich sogar zu ein paar Abschiedsworten durchgerungen. Wurde richtig rot im Gesicht. Ein großer Schritt, aufzuhören, wenn man sein ganzes Leben gearbeitet hat. Blablabla. Er wünscht mir, dass ich das Beste aus meinem neuen Lebensabschnitt mache. Warme Worte, das klang wie auswendig gelernt. – Kommst du?«
Sie kam nicht. Stand nicht auf, rührte sich nicht. Er ging zu ihr, fasste ihr unter den Arm, zog sie vorsichtig auf die Füße und führte sie in die Küche, wo er ihr den Stuhl zurecht schob.
»Ja, und dann Paula Wahlis. Du erinnerst dich an sie? Ich habe dir oft von ihr erzählt. Die Rothaarige, weißt du? Unsere Musterschülerin. Die Streberin. Hat mir auch die Hand gegeben und gesagt, es wär für sie immer interessant gewesen, mit mir zu arbeiten. Und was sie angeblich alles von mir gelernt hat – Schmeichlerin. Hätte noch ein kleines Tänzchen vor mir aufführen können. Und einen Knicks machen.«
Da Hilde keine Anstalten machte, etwas zu nehmen, bestrich er ihr eine Scheibe Brot mit Butter und Käse, schnitt sie in Häppchen und dekorierte den Teller mit Gurke und Tomate. Dazu schenkte er ihr Tee ein.
»Unser junger Kriminalkommissar, Edgar Becker, – der mit dem Ohrring, weißt du? – hat mir zugeprostet. Was waren die alle freundlich. Alle außer Kemal. Der gute alte Kemal, dem ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen. Hat keinen Sekt angerührt, sondern Tee getrunken, wie immer. Und praktisch nicht mit mir gesprochen. Ich habe den Eindruck, er ist der Einzige, dem es leidtut, dass ich weg bin. Der findet das echt schade. Natürlich verliert er kein Wort darüber, dazu ist er zu stolz. Was er sonst hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja sauer, dass er nicht Dienststellenleiter geworden ist, keine Ahnung. Wer sich das mit diesem Rahlke wohl ausgedacht hat? Das mag ja ein netter Mensch sein. Aber als Kommissar hat der noch nichts gerissen. Anders als Kemal. Was denkst du?«
»Kemal«, sagte sie und nickte. »Ja.«
Er kaute langsam. Der Sekt des Nachmittags, das ungewohnte Getränk, setzte seinem Körper zu. Er war aufgekratzt. Ihn verlangte nach Bier. Er nahm sich eine Flasche aus dem Kühlschrank.
»Später ist sogar noch Kriminalrat Sommerfeld erschienen«, fuhr er fort, als er wieder saß. »Stell dir vor. Er meinte, das wär doch noch nicht alles, ich hätte ja Urlaub. Ein Witz, den er machen wollte. Ich habe nicht gelacht. Warum auch?«
Er trank Bier – besser als jeder Sekt der Welt.
»Sommerfeld stand da und wusste nicht weiter. Hatte zwei Finger in seiner Weste wie Napoleon und trat von einem Fuß auf den anderen. War ihm wohl peinlich, die ganze Angelegenheit. Ich glaube, das hat er zu überspielen versucht. Getrunken hat er nicht einen Schluck. Überhaupt hatte sein Auftritt etwas von Pflicht. Das war ein Anstands-Viertelstündchen.«
Hilde hatte zwei Häppchen verspeist, zwei winzige Häppchen. Er schob ihr das nächste an den Tellerrand, direkt vor sie.
»Er meinte noch, ich hätte ja jetzt Zeit, mit meinem Ruderboot den Tegeler See unsicher zu machen. Am Ende wurde er richtig pathetisch, da sagte er, er will sich in aller Form bei mir für die gute Zusammenarbeit bedanken, ich hätte dafür gesorgt, dass es in unserer Stadt für manchen Verbrecher ungemütlicher geworden wäre. Und so weiter. Überhaupt wäre das ein schwerer Verlust für die Berliner Kripo, dass ich weg bin, zumal mit 60, das wäre besonders bitter. – Hätte er sich ein bisschen früher überlegen können, der Komiker. Wer wollte denn, dass ich gehe? Na und am Ende, als es ums Anstoßen ging, hatte er Wasser im Becher und ich Sekt.«
Ostrowski aß eine zweite und eine dritte Scheibe Brot, während Hilde sich quälte und ignorierte, was vor ihr auf dem Teller lag. Er nahm ein weiteres Häppchen und führte es zu ihrem Mund, den sie daraufhin ein wenig öffnete. Von dem kleinen Brotstück biss sie noch einmal ab. Er schluckte seine Ermahnung herunter. Stattdessen versuchte er es kurz darauf erneut.
Sie neigte den Kopf. Ohne Ton sagte sie: »Ich habe keinen Hunger mehr.«
»Kriminalrat Sommerfeld«, fuhr er fort, »will mich übrigens unbedingt noch einmal sehen, keine Ahnung, wieso, ich soll zu ihm kommen, wenn ich Ende des Monats meine Marke und die Waffe abgebe. Das hat er zweimal betont. Ich soll das keinesfalls vergessen. Wahrscheinlich will er mir noch eine goldene Uhr in die Hand drücken. Dabei kann man so einen Mist nicht mal verkaufen. Ich werds trotzdem versuchen. Wenn ich eine bekomme, meine ich.«’
Mit der Spitze seines kräftigen Zeigefingers schob er ein weiteres Stückchen Brot in ihre Richtung.
Sie tat, als habe sie es nicht bemerkt.
Ihm lag auf der Zunge, sie zu bitten. Er ließ es bleiben.
Hauptsächlich ihretwegen hatte er eingewilligt, früher in den Ruhestand zu gehen. Er hatte mit ansehen müssen, dass Hilde immer weiter abbaute, seit die ersten Gespräche um seine Frühpensionierung geführt wurden – seit Kriminalrat Sommerfeld ihn dazu gedrängt hatte. Die Reha, im Anschluss an ihren Infarkt, hatte nicht viel geholfen, die Medikamente schlugen nur schlecht an. Er wusste, was ihr fehlte, er hatte es immer gewusst: die Arbeit. Das Gefühl, wichtig zu sein, etwas um die Ohren zu haben. Gebraucht zu werden, so wie sie als Chefsekretärin gebraucht worden war.
Nun war er in der gleichen Situation.
So könne er sich doch um seine Frau kümmern, hatte Sommerfeld gesagt; da trage er Verantwortung. Und mit der Verwaltung ausgehandelt, dass die Abschläge auf seine Pension kaum ins Gewicht fielen.
Einen gemeinsamen Ruhestand, einen, den man genießen konnte, würde es für sie allerdings nicht geben, es sei denn, ein Wunder geschah und Hilde fand den Weg heraus aus ihrer Düsternis.
Nur glaubte er an keine Wunder.
Sie hatten keine Reisen vor sich, auch keine Radtouren oder Wanderungen. Wahrscheinlich nicht einmal den Schrebergarten, denn es war mehr als fraglich, ob er sie im Frühling dort noch hinführen würde. Wozu auch? Damit sie dort saß und in die Luft starrte oder auf die Mattscheibe? Würde sie überhaupt registrieren, dass sie an einem anderen Ort war? Interessierte es sie noch?
Er hob die Flasche an die Lippen – sie hatte ihren Tee noch nicht einmal angerührt – und schob, während er trank, all diese Gedanken zur Seite. Er wollte all das nicht, wollte nicht jammern und keine Trübsal haben. Es war noch Zeit bis zum Frühling. Die Dinge konnten sich verändern. Auch ohne Wunder.
Bastian Siewert summte sein Lied.
Obwohl er nach einem langen Tag müde war, summte er es auf der Straße und im Treppenhaus. Das Lied, das ihm Mut gemacht hatte in all den langen Jahren.
Erst als er die Tür öffnete, hörte er auf. Seine Beine waren weich und der Kopf schwer. Er sehnte sich nach Schlaf.
Von Anfang an hatte dieses Zimmer in seinen Planungen eine große Rolle gespielt, schon zu einer Zeit, als er nicht sicher war, ob sein Wohnungsschlüssel überhaupt noch passte, oder ob sie das Schloss hatte auswechseln lassen. Nun, er hatte gepasst, die Tür war aufgesprungen. Den Riegel benutzte sie nicht.
Sie sperrte nicht einmal ab.
Was er sich nicht ausgemalt hatte, war, wie früh er dieses Zimmer brauchen würde. Er hatte es sich als Ausweichquartier für die letzten Tage vorgestellt. Doch es war anders gekommen.
Er schlich durch den Flur. Ihr Atem kam aus dem anderen Raum, ein schweres Luftholen, ein Schnarchen wie von einem groben Kerl, unterbrochen von Seufzern und lautem Schniefen.
Das kleine Zimmer – früher hatte er hier musiziert – sah aus wie ein Lager. Wie eine Halde. Alles, was sie nicht benötigte, schien sie hier hereinzuwerfen. Sie machte sich nicht die Mühe, ein Regal aufzustellen und Ordnung zu halten. Nicht einmal Staub wischte sie. Überall lagen die Knäuel, und die Spinnen konnten ihrer Arbeit nachgehen, ohne dass sie jemand störte.
Er musste Luft holen.
Zum dritten Mal war er hier und musste jedes Mal Luft holen, bevor er eintrat. In die Unordnung und den Dreck. Dabei hatte er ihr jahrelang beigebracht, Ordnung zu halten. Manchmal gewann er den Eindruck, das Leben fordere ihn heraus, indem es ihn absichtlich mit all diesen ekelhaften Dingen konfrontierte.
Eine kleine Ecke hatte er sich hergerichtet. Hatte gefegt und gewischt, während sie in ihrem Rausch war. Ordnung geschaffen und eine Grenze gezogen gegen den Rest des Zimmers. Nicht so hoch, dass sie es merken konnte, aber so, dass er es einigermaßen aushielt, sogar über Nacht. Dort stellte er seine Tasche ab. Den Mantel hängte er auf einen Haken, zog die Mütze ab und strich sich Haar und Halstuch glatt.
Einen zweiten Ort zu haben, diese Idee, auch wenn sie nicht von der Stimme stammte, hatte ihn gerettet. Aber war sie wirklich so gut? War seine Waffe hier sicher? Gesine konnte sie finden, und falls die Polizei ihn jagte, würden sie diese Wohnung bald durchsuchen.
Bevor Siewert ins Bad schlich, vergewisserte er sich erneut, dass seine Frau schlief. Sie lag auf dem Sofa, ihre Haltung war seltsam, ein Arm hing herab, eines ihrer Beine war angewinkelt, als wollte sie aufstehen. Aus dem Mund lief ihr Spucke, ein dünner Faden, der bis auf das Polster reichte. Der niedrige Tisch vor ihr war vermüllt, der Aschenbecher quoll über, Essensreste lagen daneben, Krümel und eingetrocknete Flecken, außerdem alte Zeitschriften, und in der Mitte thronte eine leere Flasche Goldkorn.
Wenn sie die an diesem Nachmittag ausgetrunken hatte, würde sie lange nicht wach werden.
Trotz seiner Müdigkeit ließ sich Siewert Zeit damit, sich gründlich zu säubern und den Dreck und Staub der Straße abzuschrubben. Er putzte seine Zähne und kämmte sich. Reinigte die Fingernägel.
Während er beschäftigt war, ging ihm seine Frau durch den Kopf, Gesine. Sie war ein Wrack. Es war ihm nicht mehr vorstellbar, dass er diesen Menschen einmal geheiratet hatte. Damals hatte er geglaubt, sie sei wie er, hasste allzu viel Nähe und Berührungen, und man könnte sich die Einsamkeit ein wenig teilen. Sie hatten ein ordentliches Arrangement gehabt, Respekt voreinander, Höflichkeit. Hatten sich manches erzählt. Und natürlich in getrennten Betten geschlafen, in unterschiedlichen Zimmern. Damals war die Frau eine vernünftige Person gewesen, konnte leidlich kochen und hatte sich zeigen lassen, wie man putzte – wirklich putzte – und aufräumte. Wo und wie die Dinge zu stehen hatten. Immer gleich, ein jedes an seinem Platz.
Was war passiert?
Jener Mann hatte nicht nur sein Leben, sondern auch ihres auf dem Gewissen. Es war nicht so, dass ihr Schicksal Siewert sonderlich gerührt hätte, doch er registrierte es. Und war sich einmal mehr sicher, dass sein Gegner verdiente, was er ihm zugedacht hatte.
Sein Lied kam ihm in den Sinn. Gegen seine Erschöpfung summte er es erneut und sang sogar im Kopf ein paar Zeilen mit, wie immer auf die Melodie von ›Die Gedanken sind frei‹. Er mochte dieses Lied. Und den Text, den er dazu geschrieben hatte: ›Die Vergeltung ist mein‹.
Im Bad stand die feuchte Luft, er öffnete das Fenster. Vor ihm lagen die beiden Hochhäuser, die es in Borsigwalde gab. Der Schneeregen hatte aufgehört, allerdings roch die Luft noch danach. In den meisten Wohnungen brannte Licht, in vielen flimmerten die Fernseher. Stundenlang schauten die Leute Nachrichten und Diskussionen, aber in Wahrheit wussten sie nichts. Sie wurden dumm gehalten. Ließen sich dumm halten.
Im Knast hatte es eine Zeit gegeben, da hatte er darüber nachgedacht, seine Vergeltung viel größer anzulegen, mit Sprengstoff, mit einem Bus, der in die Luft flog, oder mit Gift in der U-Bahn und vielen Toten. Auch wenn all das gerechtfertigt gewesen wäre, er hatte diese Gedanken verworfen, denn ihm ging es um eine spezifische Rache, um Vergeltung an einem einzigen Unmenschen. So hatte es ihm seine Stimme diktiert, so war der Plan. Und der durfte keinesfalls durcheinandergeraten.
Als er ein Geräusch hörte, ein Plumpsen, als wäre jemand hingefallen, schloss er das Fenster und schlich aus dem Bad. Gesine war dabei, sich aufzuraffen, wie er durch den Spalt in der Tür beobachten konnte. Als könnte sie vor lauter Schnaps nicht sehen, tastete sie sich vorwärts und stieß dabei gegen ein Stuhlbein, was sie fluchen ließ.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, zog sich der Mann in das kleine Zimmer zurück. Gesine wirkte wie ein Geist. Ihr Gesicht war aufgedunsen, die Haut fahl, die grauen Haare ließen ihn an einen Wischmob denken. Zum Glück war er ihr nicht so nahe, dass er sie riechen musste. Ihre Augen hatten sich inzwischen zu Schlitzen geöffnet, aber er bezweifelte, dass sie etwas erkannte.
Die Badezimmertür ließ sie offen, so bekam er mit, wie sie sich auf die Toilette fallen ließ. Bevor auch noch die Geräusche ihres Geschäfts zu ihm drangen, zog er seine Zimmertür zu.
Er war müde. So müde.
2. Kapitel
Das Blaulicht, das durch die Vorhänge und seine geschlossenen Augen drang, baute Thomas Ostrowski in seinen Traum ein, allerdings passte es nicht, ganz und gar nicht, so wurde er wach und stellte fest, dass es real gewesen war. Im Takt hatte es seinen Schlafraum gefärbt, der früher das Zimmer seiner Tochter gewesen war.
Er fühlte sich zerschlagen. Drei Mal war Hilde in der Nacht aufgestanden und durch die Wohnung gewandert, und jedes Mal hatte er sich aufgerafft und sie im Wohnzimmer gefunden. Da stand sie an der Balkontür im stockdunklen Raum und starrte hinaus, als läge dort, irgendwo in der schwarzen Nacht, ihre Erlösung.
Sein Herz klopfte, er wusste, er würde nicht wieder einschlafen. Als er aus dem Fenster schaute, sah er nichts. Die Straße lag friedlich unter ihm, dünner Nebel hatte sich über die Gärten gebreitet, die Gaslaternen brannten. Menschen, die das Idyll gestört hätten, waren nicht unterwegs. Ein Stück weiter begann der Tegeler See, und nur der dichte Baumbestand hinderte die Sicht auf ihn.
Hilde schlief.
Er zog sich an. Neugier trieb ihn, denn er hatte sich das Blaulicht, auch wenn es nicht mehr flackerte, sicher nicht eingebildet. Dennoch bremste er sich. Füllte die Kaffeemaschine und stellte sie an. Er mochte nicht der ehemalige Raucher sein, der es nicht lassen konnte, nicht der Pensionär, der angerannt kam, sobald er die ehemaligen Kollegen bei der Arbeit sah.
Die Maschine zischte, und Kaffeegeruch füllte die Küche.
Es zog ihn. Er hielt sich. Kämpfte die Neugier nieder. Sah zu, wie ein schwarzer Tropfen nach dem anderen aus dem Kaffeefilter fiel. Und war froh – war erleichtert –, als er doch einen Grund gefunden hatte, hinunterzulaufen. Die Zeitung. Was sollte das für ein Frühstück sein ohne Zeitung? Als Pensionär hatte er nun Muße, sie von vorne bis hinten durchzulesen, mit Sportteil und vermischten Meldungen, sogar einschließlich der Kulturseiten.
Auf der Straße, ein Stück weiter, standen drei Streifenwagen. Beamte waren dabei, ein rot-weißes Plastikband zu verknoten. Ein Tatort offenbar, ausgerechnet am Zeitungskiosk. Einer der Beamten erkannte ihn, nickte ihm zu und hielt ihm sogar das Absperrband in die Höhe.
Dann konnte man auch einen Blick werfen.
Es war noch dunkel, noch nicht einmal sechs Uhr. Er blickte in verschlafene Gesichter, sah manches unterdrückte Gähnen. Niemand, der auf ihn achtete; alle waren sie in ihre Arbeit vertieft. Köberle, Leiter der Spurensicherung, trug einen seiner weißen Overalls und Überschuhe aus Plastik. Die anderen, Rahlke, Paula Wahlis und der junge Edgar Becker, hatten Gummihandschuhe übergestreift. In einer anderen Ecke arbeitete Kemal und machte Fotos. Die 5. Mordkommission war angerückt, seine Mannschaft. Nur ohne ihn.
Über die Leiche hatte der Gerichtsmediziner bereits ein Tuch gedeckt.
»Haben wir eine Bestätigung der Identität?«, fragte Rahlke.
Paula Wahlis verneinte.
»Es kann doch nicht so schwer sein, die festzustellen«, sagte Rahlke.
Seine Stimme war ruhig, alles andere als herrisch. Er war blond, hatte aber, obwohl kaum 40, nur noch wenige Haare, eine Art Kranz auf dem Hinterkopf. Er trug Anzug, weißes Hemd, Krawatte und war rasiert. Durch den Gummihandschuh schimmerte sein Ehering. Ostrowski bemerkte, dass er umherging, aber kaum bei den Details verweilte.
Wie konnte man auf diese Weise einen Tatort begutachten?
Ostrowski selbst stand im Verkaufsraum, diesseits der Tür zum Nebenzimmer, in dem die Leiche lag. Ein junger Mann in grauer Jacke stapfte auf und ab und sah ununterbrochen auf die Uhr. Vermutlich der Zeuge, der die Leiche gefunden hatte. Dem Schriftzug auf seiner Jacke nach ein Lieferant, und er musste weiter. Ärgerte sich wahrscheinlich schon darüber, überhaupt die Polizei gerufen zu haben, die ihn so lange warten ließ.
»Hören Sie …«, sagte er, aber Ostrowski schüttelte den Kopf. Er war nicht zuständig. Nicht mehr.
»Hatte sie keinerlei Ausweis dabei?«, hörte er Rahlke im anderen Raum fragen. Es war unbestimmt, an wen er sich gerichtet hatte. »Führerschein, EC-Karte? Irgendwas?«
Keiner fühlte sich angesprochen, niemand gab ihm eine Antwort. Allein Paula Wahlis schaute ihn an, als hätte sie ihm gerne weitergeholfen.
»Decken Sie noch mal auf«, bat Rahlke den Gerichtsmediziner.
Der Arzt begriff den Sinn der Bitte offenbar nicht. Er zögerte, dabei musterte er den Kommissar, als wollte er sich ein Bild über dessen Gedanken machen. Rahlke stand neben ihm, schien aber mit seiner Aufmerksamkeit anderswo zu sein, er drehte den Kopf, blickte sonst wo hin. Es war in keiner Weise zu verstehen, warum er die Leiche noch einmal sehen wollte, da er überhaupt nicht hinschaute.
Aber er wich nicht von der Seite des Arztes. Und der gab schließlich nach und schlug das Leichentuch auf.
Ostrowski reckte den Hals.
Es traf ihn wie ein Schlag.
Seine Beine erstarrten, genauso der Oberkörper. Die Hand hatte er vor dem offenen Mund, seine Augen weiteten sich. Wie aus der Ferne nahm er wahr, dass der Zeitungslieferant ebenfalls hinüberspähte. Nur begriff der Kerl nicht, was Ostrowski gesehen hatte.
Es war nicht, dass er die Tote kannte. Damit hatte er gerechnet.
Sondern wie sie dalag.
Wie drapiert. Als hätte sich jemand viel Mühe gegeben, den Eindruck besonders schön aussehen zu lassen. Das lockige Haar der Toten fiel zur linken Seite, während die rechte kahl war. Die Hände hatte sie über dem Bauch gefaltet. Ein Bein war über das andere geschlagen, sodass es die Scham verdeckte.
Blut gab es kaum.
Es war ein Bild, als schliefe sie. Das blasse Mädchen mit dem Ring durch den Nasenflügel. Als träume sie. Ein Bild von Seligkeit – und eins, das er schon einmal gesehen hatte. Vor vielen Jahren.
Seine Hand war immer noch vor dem offenen Mund.
Der Gerichtsmediziner warf Rahlke einen fragenden Blick zu. Er wollte die Leiche wieder bedecken.
Ostrowski hörte sich sagen, und seine Stimme knarrte und klang wie die eines Fremden: »Die Tote heißt Sabine Vollmer. 26 Jahre, glaube ich. Oder 27. Arbeitet hier im Kiosk.«
Die Augen aller Kollegen richteten sich auf ihn.
»Der Thomas«, hörte er Kemal, der in einer Ecke kniete. »Ich dachte, du bist in Pension.«
Immer noch die fremde eigene Stimme: »Ich wohne in der Nachbarschaft. Und kaufe in diesem Kiosk seit vielen Jahren meine Zeitung.«
Die Kollegen glotzten ihn an, als hätten sie ihn seit Ewigkeiten nicht gesehen. Eine innere Uhr ließ ihn die Sekunden erleben, die verstrichen.
Der Erste, der zurückfand, war Rahlke. »Wie schön. Und nun lassen Sie uns bitte unsere Arbeit tun.«
Als hätte er Rahlke nicht gehört, schritt Ostrowski in die andere Richtung, in das Hinterzimmer hinein, auf den Leichnam zu. Er dachte nicht nach, hätte nicht sagen können, was er da wollte. Vor der Toten ging er in die Hocke, dass seine Knochen knackten, und schaute auf sie, wie man ein Gemälde ansieht, versunken, auf die Details achtend.
Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit verstrich.
Köberle von der Spurensicherung weckte ihn, indem er in breitem Schwäbisch sagte: »Thomas, das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Du setzt Fehlspuren. Mensch, Kerl, du warst doch selbst lange genug dabei.«
Ostrowski kam wieder hoch, starrte aber weiter.
Er gelang ihm nicht, den Blick von der Toten zu wenden. Was da vor ihm auf dem Boden lag, das war eine Erscheinung, und sie ging ihm immer noch durch und durch, obwohl er sie inzwischen ausgiebig betrachtet hatte, und trotz unzähliger Leichen, die er in 30 Jahren in der Mordkommission gesehen hatte.
Mit denen hatte diese Tote nichts gemein.
Er verharrte weiter und vergaß wieder alle Welt um sich und auch Köberles Ermahnung. Erst ein paar laute Schritte schreckten ihn auf, ein Getrampel, und dann war ihm sein Auftritt peinlich. Hatte er denn von einem Tag auf den anderen alle Professionalität verloren? War er jetzt wirklich ein neugieriger Pensionär? Ein dummer Ex-Bulle?
Ein Streifenbeamter hatte einen weiteren Mann bis an die Schiebetür geführt, einen Mittvierziger, unrasiert, das dünne Haar nach hinten gekämmt. Er trug eine ausgebeulte Cordjacke, zu dünn für die Jahreszeit, und einen breiten Ring am Finger. Ostrowski kannte ihn, da der Mann aus Tegel war, und nickte ihm zu, während er an ihm vorbei in den Verkaufsraum zurückkehrte. Der Besitzer des Kiosks.
Rahlke begrüßte den Mann und fragte ihn nach dem Namen der Toten, bekam aber keine Antwort, woraufhin er seine Frage wiederholte. Doch der Grauhaarige stand einfach nur da, als sei er verstummt.
»Hören Sie mich?«, fragte Rahlke.
»Der Mann steht unter Schock«, sagte Ostrowski und biss sich im nächsten Moment auf die Zunge. Aber das sah Rahlke natürlich nicht.
»Vielen Dank für die Belehrung, Herr Kollege. Herr Ex-Kollege.« Der Dezernatsleiter bekam Falten auf dem kahlen Kopf. Seine Erwiderung war noch nicht fertig, aber er zögerte, weiterzureden. Es machte den Eindruck, als pegle er noch an der Schärfe seines Tonfalls.
»Ich muss Sie bitten, zu gehen, Herr Ostrowski. Dies ist ein Tatort. Auf Wiedersehen.«
Trotz seiner Größe und seines Gewichts, trotz seines Alters kam sich Ostrowski vor wie ein Schuljunge. Bloßgestellt, gemaßregelt. Und auch wenn dieser Rahlke sein Nachfolger war und er selbst an einem Ort wie diesem nichts mehr zu suchen hatte, diesen Rauswurf mochte er nicht auf sich sitzen lassen. Er zog Luft aus der Wange durch die Zähne. Ein böses, quietschendes Geräusch entstand und wollte gar nicht wieder aufhören. Rahlke wurde rot. Kemal feixte, drehte sich aber eilig zur Seite, als sollte Ostrowski es nicht sehen. Die anderen taten, als hätten sie nichts bemerkt, im Gegenteil, sie waren besonders konzentriert bei der Spurensuche und der Dokumentation.
Ostrowski ging hinaus.
Als er auf die Straße trat, wo das rot-weiße Bändchen im Wind flatterte und der Streifenbeamte zum Gruß den Finger an die Mütze hob, spürte er seine weichen Beine und ein flaues Gefühl in der Bauchgegend. Von Morgendämmerung war noch nichts zu sehen. Er steuerte auf eine Bank zu und atmete durch. Dann schrieb er Kemal eine SMS, dass er ihn so schnell wie möglich sprechen müsse.
Jenny Ostrowski setzte sich in ihr Taxi, drehte den Schlüssel auf Vorglühen und ließ, als die Lampe erloschen war, den Motor an. Er hustete, und im Rückspiegel sah sie schwarze Abgase aufsteigen. Trotz des Partikelfilters, den sie hatte nachrüsten lassen. Alles, was sich unter der Haube in Bewegung gesetzt hatte, klang ausgeleiert. Im Wagen zitterten Sitze, Lenkrad und Schalthebel.
Sie legte den Gang ein und fuhr los. Ihr erster Halt war ein Taxistand vor den Borsighallen, ein paar 100 Meter entfernt, obgleich das ein Hunger-Standplatz war. Der Glasbau zog die Vorstädter an, die Randberliner, und die kamen in der Regel mit dem eigenen Auto. Und trotzdem hielt sie hier, jeden Morgen. Kaufte sich einen Kaffee.
Die Luft war feucht und kalt, und sie beeilte sich, in das geheizte Center zu gelangen. Drinnen war kaum Betrieb. Die alten Tegeler kauften in der Gorkistraße, der Fußgängerzone ein Stück weiter nördlich, wo sie ihre Markthalle hatten und eine heruntergekommene Ladenpassage und Bekannte trafen.
Im Center langweilten sich die Verkäuferinnen. Eine junge Frau am Info-Schalter gähnte; als sie es merkte, riss sie die Hand vor den Mund. Überall klang gedämpfte Musik. Jenny steuerte ihr Stamm-Café an.
Während sie auf ihre Bestellung wartete, hörte sie einer Unterhaltung am einzigen besetzten Tisch zu – es ging kaum anders, so laut, wie die wortführende Stimme war, hätte sie sich die Ohren zuhalten müssen. Der Alltag und seine Vielfalt: Eine Rentnerin ging ihre Erlebnisse durch, schilderte und bewertete Punkt für Punkt, Detail für Detail, was ihr geschehen war, beim Tierarzt, im Bus, im Supermarkt. Ihre beiden Zuhörer, im gleichen Alter, nickten im Takt.
Dann war Jenny dran, bekam ein paar freundliche Worte und ihren Kaffee im Pappbecher. Der zweite Koffeinschub des Tages.
Sie kehrte zu ihrem Wagen zurück, stieg ein, lehnte sich gegen den Sitz, stellte Musik an und schlürfte das heiße Getränk. Der Morgennebel lichtete sich, die Temperatur pendelte um den Gefrierpunkt, im Auto war sie kaum höher als draußen. Sie würde bald losfahren müssen, damit die Heizung auf Touren kam. Unterwegs zu sein war eh besser, wenn man Geld verdienen wollte. Auch der Kollege vor ihr machte sich auf den Weg, er schien die gleichen Gedanken zu haben und ebenfalls keine Standheizung.
Sie hatte noch nicht ausgetrunken, da wurde die hintere rechte Tür geöffnet, und ein Mann stieg ein.
Er wollte wissen, ob sie frei sei – eine Frage, die sich selbst beantwortete.
»Wo möchten Sie hin?«
»Zum Freibad Tegel.«
»Sie wollen baden? Im Februar?«
Er fiel in ein seltsames Kichern, wie ein Klirren von Eiszapfen. »Zu kalt. Ich möchte spazieren gehen.«
Bevor sie den Motor startete, versenkte sie den Becher in eine Halterung und stellte die Musik aus.
»Lassen Sie ruhig an«, sagte der Gast. Seine Stimme klang wie Metall, kalt, irgendwie gefühllos. »Ich mag schöne Musik. Was war das?«
»Element of Crime.«
»Element of … Crime? Nie gehört.«
»Die kennen Sie nicht?«
»Müsste ich?«
»Nein«, verbesserte sie sich. »Man muss niemanden kennen.«
Sie stellte wieder an, achtete aber auf angemessene Lautstärke und fädelte sich in den Verkehr ein. Wie immer, wenn ein Gast, besonders wenn es ein Mann war, hinten saß, tat sie einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Er schien zuzuhören. Ein schmaler Mensch mit scharfen Konturen, besonders an Wangen und Nase. Er trug eine Pudelmütze und einen wattierten schwarzen Mantel, der zu weit war und ihn einhüllte, und sah im Großen und Ganzen nach Hartz IV aus. Im Kontrast dazu stand das alberne Seidentuch, das er um den Hals gebunden hatte. Das sollte den Eindruck ›distinguierter Herr‹ vermitteln. Ein Verrückter, sagte sie sich. Der Gedanke beunruhigte sie in keiner Weise, sie hatte Hunderte, vielleicht Tausende von Halb- oder Viertelverrückten gefahren, Berlin war voll von solchen Leuten, einer mehr spielte keine Rolle. Das Freibad lag auf der anderen Seeseite, und sie musste mit ihm durch den Wald, doch auch das kümmerte sie nicht. Ihr Funkgerät war an.
Viel mehr störte sie, dass sie in eine tote Ecke unterwegs war, eingequetscht zwischen Tegeler See und Forst, in die Richtung gab es nur zwei Ortsteile, Konradshöhe und Tegelort, und sicher keine Tour zurück. Sie würde leer fahren müssen. Der Tag fing toll an.
Steigerungsfähig, verbesserte sie sich, freute sich an dem Begriff und erlaubte ihrer Fantasie für einen Moment, zu spinnen und sich große Fahrten auszumalen, nach Spandau, nach Zehlendorf, an den Müggelsee. Hinaus nach Brandenburg.
Als sie ein zweites Mal in den Spiegel schaute, trafen sich ihr Blick und der des Fahrgastes. Seine Augen waren grau wie Stahl. Er zwinkerte ihr zu.
Eher ein Halbverrückter als nur ein Viertel, stellte sie fest, während sie auf den Schwarzen Weg einbog, der durch den Tegeler Forst zum Freibad führte. Es gab wenig Verkehr, der Wald lag dunkel vor ihr. Ihr wurde unheimlich. Sie riss sich zusammen und achtete auf den Liedtext von der CD, der von Delmenhorst erzählte und von Getränke-Hoffmann.
Instinktiv fuhr ihre rechte Hand zum Funkgerät.
Der Mann hinter ihr kicherte erneut, und sie konnte nicht verhindern, dass ihr kalt wurde. Dabei arbeitete die Autoheizung inzwischen. Dann begann dieser Kerl auch noch, trotz der Musik im Wagen, eine Melodie zu summen. Es war irgendein Volkslied, sie kam nicht drauf, sie hörte nur, dass er die Töne präzise traf, fast wie ein Musiker. Er wusste genau, was er da trällerte.
Welches Lied war das noch?
Sie war drauf und dran, ihn zu fragen, ließ das aber sein. Lieber kein Gespräch mit diesem Kerl.
Die entgegenkommenden Autos hatten Licht an und fuhren schnell. Niemals würde einer von denen halten, wenn eine Taxifahrerin in Not wäre. Sie würden es nicht einmal bemerken, sondern erst am nächsten Tag in der Zeitung lesen und sich dann über die Schlechtigkeit der Welt aufregen.
In was steigerte sie sich da hinein? Jenny verscheuchte all diese Gedanken und drehte die Musik eine Spur lauter. Es war eines der besten Stücke der Band, voller beiläufiger Melancholie, ein Schmerz, den jemand nicht hochhängen wollte: »Ich hab jetzt Sachen an, die du nicht magst, und die sind immer grün und blau.«
Ihr Fahrgast schien sich gut zu fühlen, auf seinem Gesicht lag die Andeutung eines Lächelns. Gewalttätig, gar brutal, sah er nicht aus. Ganz und gar nicht. Aber auch nicht so, dass ihre Anspannung nachließ.
Vor ihr tauchte das Freibad auf. »Soll ich hier halten?«
»Ein Stück noch.«
Sie hasste diese Art, ohne klare Ansage weitergeschickt zu werden. Ein Stück noch – was sollte das heißen? Einen Kilometer oder drei? Sie war kein Pferd, erst recht kein Esel und hatte keine Lust, zu parieren, wenn der Reiter die Sporen gab.
Ohne seine Anweisung setzte sie den Blinker, um auf den Freibad-Parkplatz einzubiegen. Nicht ein einziges Auto stand dort. Im Februar badete niemand im See.
»Noch ein Stück.«
»Hier ist das Freibad.«
»Trotzdem.«
Ihr schwacher Trost war das Taxameter, das brav weiterlief. Dennoch war ihr nicht wohl. Was war der Grund? Der Mann regte sich nicht. Er sah seltsam aus.
Viele Kollegen, vor allem Kolleginnen, schworen auf Reizgas und hatten immer eine Dose griffbereit in der Türablage. Anders Jenny. Ihre Erfahrung aus fast acht Taxijahren mit anzüglichen Geschäftsmännern, arroganten Rentnern, türkischen Zuhältern, abgewrackten Weibern und Mengen von Besoffenen war, dass man abweisend wirken musste und Spinner am besten in Ruhe ließ. Dann war es in aller Regel nicht nötig, zu kämpfen.
Was war anders mit diesem Kerl? Warum machte der sie schaudern?
Sie warf einen weiteren Blick nach hinten. Der Gast sah zum Fenster hinaus. Angespannt wirkte er in keiner Weise, auch nicht wie jemand, der sie um den Fahrpreis prellen wollte. Hin und wieder erklang sein seltsames Kichern, als freue er sich über irgendeinen Triumph. Plante er doch, zu türmen? Sie tastete nach ihrem Handy, das in der Jeans steckte. Wenn der Mann Scheiße machte, würde sie die Polizei rufen, auch wenn er wahrscheinlich längst in Spandau war, bis die Freunde und Helfer eintrafen. Mindestens in Spandau.
»So, hier.«
Er zeigte auf ein totes Ende im Wald. Sie war nicht bereit, dort hineinzufahren, sondern hielt am Schwarzen Weg, aber so, dass der nachfolgende Verkehr vorbeikam. Dann stellte sie den Zähler aus.
Er reichte ihr einen Zwanziger. »Der Rest ist für Sie.« Und wieder ein kurzes Kichern, wie ein Tic. »Schade, dass die Fahrt schon vorüber ist.«
So kann man sich täuschen, dachte sie, als er ausgestiegen war. Ein dünner Geruch nach Rasierwasser blieb von ihm zurück.
Sie kurbelte das Fenster herunter.
Gegen Mittag hatte sie eine Tour nach Reinickendorf, kaufte sich bei einem Bäcker ein belegtes Brötchen, das sie im Auto aß, und fuhr bei ihrer Mutter vorbei. Als sie hereinkam, schaltete sie das Licht an, ging zu ihrem Sessel, hockte sich neben sie auf die Lehne. Sie nahm ihre Hand – die Hand eines alten Menschen, mit schmalen Fingern, schrumpliger Haut und Adern, die heraustraten.
»Jenny.«
»Ja, Mama.«
Der Infarkt, auch wenn es kein schwerer war, wie der Arzt versichert hatte, hatte ihre Mutter aus dem Leben gerissen. Seitdem war sie eine alte Frau, war von einem Tag auf den anderen dazu geworden. Nie wieder war sie an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt, den sie, trotz aller Belastung, geliebt hatte. Überhaupt hatte sie allen Elan verloren, und das so gründlich, dass man sich nicht vorstellen konnte, auch nur ein Teil davon würde jemals zurückkommen.
Dabei hatte sie eine Menge Schwung besessen. Jenny dachte manchmal daran zurück, wie sie als Kind im Büro ihrer Mutter angerufen hatte, nur um sich an ihrer Kraft wieder aufzurichten, um den Schulfrust zu vergessen. Und wenn die Mama nach Hause gekommen war, war immer noch genug davon für die Tochter übrig gewesen.
Mit der Frau im Sessel hatte das nichts mehr zu tun.
Jenny zog sie vorsichtig auf die Füße und nahm sie mit in die Küche, wo sie ihr ein Glas Wasser hinstellte und sich daran machte, Kartoffeln und Möhren zu kochen, ein Kindermenue; und als es gar war, zerdrückte sie beides zu Mus. Genauso hatte sie für Lotte gekocht. Mit dem kleinen Unterschied, dass ein Kind immer selbständiger wurde.
Die Mutter stocherte auf ihrem Teller umher, sie schob sich eine winzige Portion auf die Gabel und führte sie zum Mund. Aber bald war Schluss, nach einer Menge, von der ein Spatz nicht satt geworden wäre. Jenny war davon überzeugt, ihre Mutter wolle sich aushungern und auf diese Weise aus dem Leben herausschleichen.
Und wenn es so war, hatte man das nicht zu respektieren?
Es gelang ihr nicht. »Mama, lass doch nicht so viel liegen.«
Die Mutter verzog den Mund.
Jenny nahm ihre Gabel und füllte sie. »Komm, ein bisschen noch.«
Sie blickte in ein ausdrucksloses Gesicht – ohne Verlangen, aber auch ohne die Kraft, nein zu sagen.
Sie ließ es sein.
Als sie abdeckte, hörte sie die Wohnungstür und den Schlüssel, der auf den kleinen Flurtisch gepfeffert wurde. Sie empfand die Energie, die hinter diesen Bewegungen lag. Das war genau das, was der Mutter fehlte.
Jenny spürte ihren Widerwillen gegen den Ankömmling.
»Hilde!«
Er blieb an der Tür stehen und füllte ihren Rahmen vollständig aus, der große, massige Mann.
»Ach Jenny, du bist da. Wie geht’s?«
»Ganz gut«, antwortete sie, »wenn man davon absieht, dass ich Mama im stockdunklen Zimmer gefunden habe. Ihr Mund war vollkommen ausgetrocknet. Ich dachte, du kümmerst dich.«
Er schien den Vorwurf nicht hören zu wollen.
»Hilde, warum machst du denn so was? Du musst doch trinken. Und Licht kannst du dir auch anschalten.«
Von der Mutter kam keine Antwort.
»Nächstes Mal, Hilde. Ja?«
Jenny wurde rot. Am Hals begann ihre Schlagader zu klopfen. Sie musste sich zusammenreißen, um ihre Stimme auf Zimmerlautstärke zu halten. »Nun hast du aufgehört mit der Arbeit und bist trotzdem nicht da.«
Als er ein Lächeln versuchte, eine dümmliche Bitte um Nachsicht, konnte sie kaum anders, als noch einen draufzusetzen. »Wenn das so weitergeht, bringe ich sie ins Heim.«
Sein Gesichtsausdruck änderte sich augenblicklich, als wäre eine Wolke darüber gezogen, das Lächeln verschwand, die Augen wurden klein. »Du bringst sie nirgendwo hin.«
»Dann kümmere dich gefälligst!«
»Ich kümmere mich! Aber ich kann nicht den ganzen Tag in der Wohnung hocken. Ich war spazieren. Und musste mit dem Auto etwas unternehmen, das ist kaputt. Scheiß Werkstatt. Keine Termine, und das Ersatzteil ist auch nicht vorhanden. Immerhin durfte ich den Wagen auf dem Hof stehen lassen. Gnädigerweise. Das heißt aber, dass ich zu Fuß zurück bin.«
»Man muss den ganzen Tag aufpassen. Wie bei einem kleinen Kind auch. Das lässt man auch nicht allein, wenn man an die Luft geht oder zur Werkstatt. Sondern nimmt es mit.«
»Jenny …«
»Ist doch wahr! Oder hast du früher gesagt: Ich jage zwar meine Verbrecher, aber doch nicht den ganzen Tag, zwischendurch mache ich einen Spaziergang, schließlich will ich auch mal an die frische Luft.«
»Jetzt hör aber auf. Das ist doch etwas anderes.«
»Ist es nicht. Und im Übrigen braucht Mama auch Bewegung und Sauerstoff.«
»Vielen Dank für die Belehrung.«
»Gern geschehen. Ihre Medikamente sind auch alle. Und in eurem Kühlschrank, da herrscht … Nicht mal Butter gibt es.«
»Jaja, ich weiß. Ich wollte die Medikamente holen. Wenn du so freundlich wärst, noch so lange zu bleiben. Damit sie nicht alleine ist.«
»Dann beeile dich«, gab sie zurück. »Ich muss arbeiten. Und ich habe auch noch eine Tochter zu Hause, die auf mich wartet.«
Im Treppenhaus atmete Ostrowski durch. Jedes Zusammentreffen mit Jenny endete so. Mit seiner Tochter. Warum? War es seine Schuld? Oder ihre?
Eine Antwort, die ihn zufriedengestellt hätte, fand er nicht. Er lief die Treppe hinunter und ließ Sohle und Absätze auf die Stufen knallen. Die Wände waren nicht dünn, trotzdem würden die Nachbarn, wenn sie denn zu Hause waren, denken, er trample ihnen mitten durch die gute Stube. Es war ihm egal. Er hatte Druck auf der Brust. Lust, zu schreien.
Draußen wurde ihm etwas leichter, und ihm kamen auch die Antworten in den Sinn, nach denen er gesucht hatte. Jenny, die schlecht Gelaunte. Die Frustrierte. Wie leicht es war, diesen Gedanken weiterzuspinnen. Ohne Mann; ohne den Beruf, für den sie geschaffen war. Beim Taxifahren hängen geblieben. Wie lange ging das schon? Seit Lottes Geburt. Bald danach.
Zur Fontane-Apotheke war es ein gutes Stück zu Fuß die Berliner Straße hinunter. Dort wussten sie, welche Medikamente Hilde brauchte und hielten sie vorrätig. Normalerweise hätte er das Auto genommen, aber das stand nun auf dem Hof der Werkstatt. Während die kalte Luft ihm das Gesicht rötete, stapfte er vorwärts, durch Pfützen und nassen Schnee. Er hatte das Verlangen, nach irgendetwas zu treten. Aber da war nichts, und er fragte sich, ob er sich von Jenny die Stimmung verderben lassen sollte? Und vor allem: Hatte er nicht ganz andere Sorgen?
Kemal hatte sich noch nicht gemeldet.
Er war versucht, den Kollegen anzurufen, ließ das aber sein. Wahrscheinlich hatte Kemal mehr Arbeit, als er schaffen konnte. Eine neue Leiche – der erste Tag. Ostrowski konnte sich leicht ausmalen, was in der Mordkommission los war. Dennoch kehrte sein Ärger zurück. So viel Arbeit, dass man nicht ein paar Minuten für einen Rückruf hatte, das gab es doch gar nicht. Außerdem ließ sich Kemal nicht mehr aufbürden, als er bewältigen konnte.
Nein, er nahm ihn, den Pensionär, auf einmal nicht mehr wichtig.
Ostrowski zwang sich zu Kühle und Klarheit, und als er die Apotheke erreicht hatte, hatte er es fast geschafft.
Hinter dem Tresen stand eine Mitarbeiterin in ihrem weißen Kittel, eine junge blonde Frau mit aufgestecktem Haar und randloser Brille. Er kannte ihren Vornamen, Nadine.
»Hallo, schöne Frau«, sagte er und konnte, während er das Rezept aus der Tasche kramte, zusehen, wie der letzte Rest Ärger in ihm verrauchte.
»Bin ich aufgestiegen?« Eine zarte Röte legte sich auf die Wangen seines Gegenübers.
»Wieso?«
»Früher haben Sie gesagt: Hallo, junge Frau. Jetzt sagen Sie: Hallo, schöne Frau. Das klingt wie …«
Es war einfach die Wahrheit. Trotz ihres Namens war Nadine eine nordische Schönheit, sie hätte als Schwedin durchgehen können oder als Dänin, hatte blaue Augen und eine kleine Nase, dabei ein melancholisches Gesicht, als trüge sie alleine die Verantwortung für all die Medikamente und womöglich auch noch für die Krankheiten der Kunden.
Aus dem Nebenraum kam die Apothekerin.
Ostrowski sagte noch: »Die Wahrheit ist: schöne junge Frau.«
Auf Nadines Mund trat der Anflug eines Lächelns.
Ihre Chefin stellte sich neben sie: »Ich mach schon.« Dann wandte sie sich Ostrowski zu: »Guten Tag, Thomas.«
»Katja.«
Er reichte ihr das zerknitterte Rezept. Sie strich es glatt, ohne den Blick von Ostrowski zu nehmen.
»Und, helfen die Tabletten?«
Er hob die Schultern. »Ich weiß ja nicht, was ohne sie wäre. Aber Glückspillen sind es nicht gerade. Oder sie schlagen bei Hilde nicht richtig an.«
»Sie sollten ihre Stimmung aufhellen.«
»Naja«, sagte er. »Dann könnte man sein Geld zurückverlangen.«
Die Apothekerin war seit Ewigkeiten am Ort, eine feste Einrichtung in Tegel. Schon die Farbe des Hauses, in dem ihr Geschäft lag, war markant, es hatte den Ton reifer Aprikosen. Von Anfang an hatten die Ostrowskis bei ihr gekauft, schon als Jenny noch ein Kind war, und das nie verändert. Man kannte und duzte sich, und er mochte sie. Ihr Gesicht war voll, mit Grübchen an den Wangen, das helle Haar hatte vereinzelt weiße Strähnen. Unter ihrem Kittel trug sie einen wollenen Rollkragenpullover.
»Und wie geht es dir?«, fragte sie.
»Ich bin Pensionär. Seit gestern.«
»Oh, bis dahin fehlen mir noch ein paar Jährchen. Muss nett sein – die Freiheit.«
»Ich weiß nicht so recht. Ist noch zu frisch. Es könnte wohl nett sein. Doch wie es scheint, sind manche Verrückte unterwegs.«
Während sie die Rollschublade aufzog, um Hildes Medikament herauszunehmen, schaute er ihr zu. Auch sie war eine schöne Frau, auf andere Weise als ihre Mitarbeiterin, reifer, erfahrener. Eine Frau mit Ausstrahlung.
Sie reichte ihm das lilafarbene Päckchen. Antidepressiva. Pillen, die aus Hilde auch nicht die machen konnten, die sie einmal war.
Er bezahlte den Anteil, den er zu tragen hatte.
Sie reichte ihm das Wechselgeld. Dabei sagte sie: »Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst …«
Am Ende ihres Halbsatzes richtete sie ihren Blick auf ihn, schaute ihm mit ihren blauen Augen geradewegs ins Gesicht. Ihr Ausdruck war ernst. Er war zu überrascht für eine verbindliche Antwort und so nickte er nur.
Jemand zum Reden. Da wäre sie sicher eine gute Wahl.
Ihm fiel Hilde ein. Dann Jenny. Ihr Zorn, wenn er sich mit einer anderen Frau träfe.