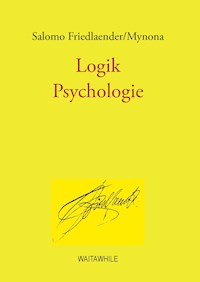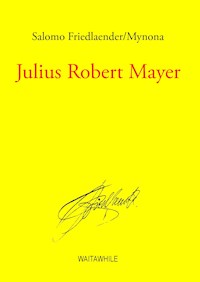Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedlaender/Mynonas Nietzschebuch, konzipiert seit 1906, erschienen Ende 1910, hat bei Philosophen und Literaten Spuren hinterlassen: im frühen Expressionismus, im Berliner Dada sowie im Kreis um Georg Simmel, dem es die Drucklegung verdankt. Noch um 1930 wurde es als ein herausragendes Werk anerkannt. Das Buch ist keine Biographie. Im Nachvollzug von Nietzsches Lehre entwickelt Friedlaender/Mynona aus dem zentralen Gedanken der 'Mitte' des Lebens - Ring der Ringe, ewige Wiederkehr - seine eigene Philosophie: den Indifferentismus polarer Observanz. Also wieder ein Nietzschebuch, das nur ein Gegenmodell aufstellt? Nein! Bei aller Intensität wahrt der Autor kritische Distanz; er zeigt Nietzsche, wo er vor sich selber zurückschreckte und wie er hätte weitergehen sollen. Der Herausgeber stellt in einer ausführlichen Einleitung Friedlaender/Mynonas gesamte, über 50 Jahre währende Auseinandersetzung mit Nietzsche dar: die abenteuerliche Entstehung des Buches, die Korrespondenz mit Elisabeth Förster-Nietzsche, die humoristisch-praktische Anwendung in den Grotesken und, im Pariser Exil, die radikale Kritik an Nietzsche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Salomo Friedlaender/Mynona
Gesammelte Schriften
Friedrich Nietzsche
Eine intellektuale Biographie
Herausgegeben von
Hartmut Geerken & Detlef Thiel
In Zusammenarbeit mit der
Kant-Forschungsstelle
der Universität Trier
Band 9
WAITAWHILE
Books on Demand
Inhalt
Einleitung: Die Tragödie der Unabhängigkeit. Friedlaender/Mynona opfert Nietzsche von Detlef Thiel
Friedrich Nietzsche. Eine intellektuale Biographie
Orientierung
I. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
II. Unzeitgemäße Betrachtungen
III. Menschliches, Allzumenschliches
IV. Morgenröte
V. Fröhliche Wissenschaft
VI. Also sprach Zarathustra
VII. Jenseits von Gut und Böse (Zur Genealogie der Moral)
VIII. Götzen-Dämmerung
IX. Umwertung aller Werte
Rezensionen
S. Friedlaender: Adler und Zaunkönig
[Selbstanzeige]
Anmerkungen
Verzeichnis der Abbildungen
Literaturverzeichnis und Abkürzungen
Namenverzeichnis
Sachverzeichnis
Detlef Thiel
Die Tragödie der Unabhängigkeit Friedlaender/Mynona opfert Nietzsche
1. „Um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort“
2. Der „bedauernswerte“ Herr Friedlaender – Simmels Korrespondenz mit dem Verlag Göschen
3. Nietzsche als Paradigma des philosophischen Polarismus
4. Frühe Rezeption: Expressionismus, Simmel-Kreis, Dada
5. Der Schlüssel zum Lachkabinett und die „stadtbekannte Schwester des weltberühmten Bruders“
6. Das Duell Kant contra Nietzsche
7. Politisierung und Kulturkritik – Debatten um 1930
8. Nietzsche im Exil
Was ist eine intellektuale Biographie?
Intellektuelle Bio- und Autobiographien gibt es viele; sie wollen in der Lebensbeschreibung eines Menschen den geistigen Werdegang betonen.1 Der Ausdruck ist so geläufig, daß er in der spärlichen Literatur zu dem hier nach fast 100 Jahren wieder vorgelegten Buch oft unvermerkt dessen Untertitel überdeckt. Ein zeitgenössischer Rezensent, der zugab, nichts verstanden zu haben, nannte es gar: „Eine intellektualistische Biographie“….
Der Ausdruck intellektual findet sich nur im Untertitel; Friedlaender/Mynona (im folgenden: F/M) erklärt ihn nicht, verwendet ihn sonst selten. 1907 urteilt er, die logische und die Assoziationspsychologie versagten „halb und halb auch auf intellektualem Gebiete“; gemeint ist das des Intellektes, des Erkenntnisvermögens, im Unterschied zur Empfindung und zum Willen.2 Später bezeichnet er einmal Platons Werke als „intellektuale Dialogtragödien“; er hat auch das Adjektiv ‚intellektuell’, meist im Unterschied zu ‚moralisch’ bzw. ‚ethisch’ und zu ‚ästhetisch’.3 Zweifellos wußte er, daß der Terminus zumindest bei Kant und Schopenhauer philosophische Grundfragen betrifft.4
Aber F/M teilt gar nichts Biographisches mit, nicht einmal Lebensdaten; er folgt der Chronologie der Werke. Bei aller Begeisterung wahrt er eine spezifische Distanz. Er stellt Nietzsches Lehre dar, ohne auch nur einen Augenblick die eigene Absicht zu vergessen. Hier findet eine seltene Osmose statt: Nietzsches Themen – Leben, Umwertung, Kultivierung, Erhöhung des Menschen – werden geprüft und weitergeführt zu einer ungeheuren Utopie: zum Entwurf der autonomen Person, der eignen Göttlichkeit.
Bereits zehn Jahre lang hatte F/M die Polarität ergründet, den Begriff der Unendlichkeit, die Funktion der Mitte, der infinitesimalen Quasi-Null zwischen Gegensätzen, das Verhältnis von Leben, Erlebnis und Welt. Hier zieht er zum ersten Mal Bilanz und entfaltet seinen Polarismus, der, wie alle tiefe Philosophie, eine Methodenlehre ist. Das zeitlose Duell Nietzsche – Kant läuft durch das ganze Buch; es atmet freilich die geistige Atmosphäre seiner Zeit: Neukantianismus, frühe Lebensphilosophie, Vitalismus, Frühexpressionismus usw. Doch ist es ganz anders orientiert. F/M zwingt Nietzsche durch das strenge polaristische Filter, zeigt, wo er strauchelte, wie er hätte weitergehen sollen.
Das Buch hat eine dramatische Genese; ohne Georg Simmels Unterstützung wäre es wohl nicht gedruckt worden. Die Zeitgenossen haben es beschimpft und bewundert. Es bildet den Humus der frühen Grotesken und noch der Schöpferischen Indifferenz. Trotz allem sieht F/M sich wenige Jahre später gezwungen, auf irreversible Distanz zu Nietzsche zu gehen – um ihm treu zu bleiben! Zeitlebens wird er bestimmte Impulse Nietzsches beibehalten und ausnutzen; bei aller oft vehementen Kritik wird er ihn immer wieder zitieren und kommentieren. Das ist die Tragödie: Nietzsche wird instrumentalisiert für eine Lehre, die ihn dann opfern muß.
Entstehung, Inhalt, Rezeption des Buches, F/Ms Korrespondenz mit Elisabeth Förster-Nietzsche 1902–14, seine spätere Stellung zu Nietzsche bis ins Exil – all das ist noch niemals in der nötigen Ausführlichkeit dargestellt worden.5 Im folgenden wird das Defizit beglichen.
1. „Um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort“
F/M, seit 1890 im Bann Schopenhauers, beginnt krankheitsbedingt erst mit 23 Jahren zu studieren: Winter 1894/95 Medizin in München; dann in Berlin zwei Semester Zahnmedizin und zwei Semester Philosophie. Im Herbst 1896 erscheint sein erster Aufsatz, Schopenhauers Pessimismus. Im Sommer 1897 wechselt er nach Jena. Drei Jahrzehnte später erinnert er sich:
„Zuweilen kehrten wir in den Bauernwirtshäusern der umliegenden Dörfer ein. An der Wand des Gastzimmers einer solchen Bauernkneipe sah ich einmal ein Porträt Friedrich Nietzsches mit offenbar eigenhändiger Unterschrift. Verwundert fragte ich den Wirt, wer das wäre. ‚Dees is doch dr Nietzschke,’ sächselte er, wie wenn er von einem alten Bekannten spräche, ‚Ja, der saß hier oft mit Peter Jasten.’ [Peter Gast] ‚Worüber unterhielten sich denn die?’ erkundigte ich mich. ‚Nur übers Essen,’ sagte der Wirt, ‚wie man in den verschiedenen Ländern zu essen pflegt.’ Das mochte stimmen, denn bekanntlich war Nietzsche Apologet der ‚kleinen Dinge’. Damals war er in der Binswangerischen Nervenheilanstalt unter Aufsicht. Kurioserweise nannte sich der Weg, der zu diesem Irrenhaus führte, oberer Philosophenweg; der untere führte zum Kirchhof. Welch plastische Symbolik!“6
Am 27. Februar 1899 schreibt F/M seinem Schwager Salomon Samuel: „Was ich in den Büchern der Menschen niemals las, es sei denn in der Runensprache, den Zaubersprüchen des hochheiligen Zarathustra: – ich sehe Wunderbares.“ Dann berichtet er von einem ekstatischen Erlebnis, datiert auf das Jahr 1896.7
Nietzsche selber hat er nicht gesehen. Im Oktober 1899, nach Abschluß des Studiums, veröffentlicht er einen kurzen Prosatext mit angehängten eigenen Aphorismen: Im Banne Friedrich Nietzsches – die tiefste Lust, die tragisch-dionysische, kann noch die furchtbarste Gestalt des Lebens ertragen, wird aber durch die Kultur narkotisiert; Nietzsche kämpft gegen die Zahmheit und Krankheit unserer Ideale (des Guten, Wahren, Schönen), nicht gegen diese selbst; er treibt einen systematischen Kultus des Lebensfeindlichsten, bis er am Ende sich selber verliert.8
Anfang 1902 promoviert F/M bei Otto Liebmann in Jena, die Dissertation über Schopenhauer und Kant enthält nur einen Hinweis auf Nietzsche (GS 2, 163 Anm.). Er zieht nach Berlin. Im Sommer des Jahres werden seine Philosophischen Aphorismen gedruckt; darin eine nachhaltige Kritik: „Nicht, wie Nietzsche meint, der Glaube an Gegensätze, sondern der Glaube, daß sie die Identität ausschlössen, ist aufzugeben.“9 Eine Berliner Zeitung bringt ein 33 Zeilen langes Gedicht, Zum Gedächtnis Friedrich Nietzsches; darin sind „Selbstentzweiung“ und „Selbstbefreiung“ verknüpft.10 Am 20. November schreibt F/M an Elisabeth Förster-Nietzsche:
„Ich gehöre zu denjenigen Lesern Ihres unsterblichen Bruders, die in seinen Werken ihr Schicksal sehen, jedem seiner Worte mit den Ohren des Herzens zuhören, denen es unerträglich dünkt, aus der Hörweite verbannt zu sein.“11
Er bittet um Einsichtnahme in das noch unpublizierte Manuskript von Ecce homo und bezeigt erneut seine „unaussprechlich innig gefühlte Verehrung gegen den herrlichsten Genius“.12
Zu Nietzsches 59. Geburtstag, 15. Oktober 1903, wird das neue Archiv in der von Henry van de Velde gestalteten Villa Silberblick in Weimar eingeweiht. Zur selben Zeit bringt René Schickele in seinem Magazin für Litteratur einen kurzen Prosatext unter dem Namen Friedlaender: Freier der Wahrheit. Er wird Ende August 1911 nochmals gedruckt, mit dem Untertitel (Zum Todestage Nietzsches) und unter dem Verfassernamen Mynona.13 Es ist die früheste jener Grotesken, die Mynona ab 1910 rasch berühmt machen werden. Die Folgen von Kants Widerlegung aller Gottesbeweise lesen sich so: Er beging „den berühmten Mord – Meuchelmord, wenn man will, – an der Wahrheit“, an jener alten, unsterblichen, die sich fortan, scheintot, nur noch „durch lauter theologische Kraftbrühen bei Lust und Liebe erhielt“.14 Schopenhauer erkundigte sich nach ihr, begab sich in ihr Grabkämmerchen, aber „Vera“ erwies sich als so lebendig, furios, heiratswütig, daß Arthur, tragisch angewandelt, die Flucht ergriff. Die Dame lugte nach einem neuem Freier aus, der erschien alsbald, verwirrte ihre Sinne, behandelte sie mit der Peitsche: „So ward sie von Friedrich, dem Großen, bezwungen.“ Diese Liebschaft war gefährlich heiß, doch am Ende ist die Wahrheit wieder einmal Witwe. –
„Damals war ich von der Nietzschiasis, von der sich mancher nie erholt hat, noch nicht geheilt. Zu den Unheilbaren gehörte Rudolf Pannwitz, der sich später gar den letzten Regierenden der Dynastie Nietzsche nannte. [...] Pannwitz war Hauslehrer beim Philosophen Georg Simmel, zu dem ich durch gemeinsame Bekannte in Beziehung trat.“15
Simmel hielt im Winter 1901/2 erstmals an einer deutschen Universität Vorlesungen über Nietzsche. Pannwitz, seit 1902 mit F/M bekannt und ebenfalls in Korrespondenz mit der Förster-Nietzsche, verschafft ihm einen Buchauftrag: eine populäre Biographie Julius Robert Mayers.
Im Herbst 1904 arbeitet F/M fieberhaft daran. Im Oktober erscheint in Schickeles Magazin der Aufsatz Friedrich Nietzsche. Ein Wink zum Verständnis seiner Lehre. F/M umreißt die Grundgedanken: Kant, Schopenhauer, Nietzsche sahen „die Gefahr des gottlosen Menschen“, die Gefahr der Freiheit; Kant behielt Gott bei, Schopenhauer sagte dem Leben ab; allein Nietzsche wagte sich an das Experiment einer Steigerung des Menschen zum Übermenschen. Dieser muß freilich erst noch erschaffen werden, der Wille zur Macht soll den rohen Typus kultivieren. F/M erläutert die Umwertung und den „uralten Gedanken des Kreisens der Zeit“, der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Das „Weltwesen“ ringt nach sich selber, polar – „Selbstsucht“, Sehnsucht nach einem Eigentum: das ist Philosophie. Im Zarathustra steht die „alles umspannende Formel“, mit der Nietzsche den Menschen erheben wollte – F/M wird sie zeitlebens wiederholen:
„Alles geht, alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. [...] In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist überall.“16
Am 20. Dezember 1904 dankt F/M Förster-Nietzsche für die „wohlwollenden Worte“ zu seinem „kleinen Artikel“. Er akzeptiert die Einwände:
„Individualistische Moral anlangend, beuge ich mich, gnädigste Frau, sehr gern Ihrer besseren Einsicht. Nietzsche, der Philosoph der Rangordnung, ist gar und ganz nicht etwa mit Stirner zu verwechseln, das wäre ein böses Quiproquo! Mein Ausdruck war hier, wie ich zugebe, nicht unzweideutig genug, etwas zu leichthin populär.“17
F/M berichtet über ein nicht überliefertes Manuskript:
„In ein paar kleinen Aufsätzen – ‚Mitte’, metaphysischer Versuch über die Welt als Polarität – habe ich den Gedanken der Periodizität des Unendlichen, den ich für den prinzipiellen Weltgedanken halte, tief zu begründen versucht. Jedoch ist für dieses Werkchen kein Verleger gewonnen worden.“
Er spricht die Hoffnung aus, in der von Georg Brandes herausgegebenen Sammlung Die Literatur etwas veröffentlichen zu können18 und kündigt das Mayer-Buch an: „darin ist mehrfach auf Nietzsche als auf den fruchtbarsten Vertiefer des Gedankens der Konstanz der Weltkraft hingewiesen.“ Das Buch erscheint Anfang 1905 – es „wurde günstig aufgenommen, und zum ersten Mal hielt ich selbsterworbenes Geld in Händen.“ (Autobiographie, 65)
Im Schlußabschnitt stellt F/M eine beachtliche These auf, die in der Forschung ignoriert wurde: Aus Mayers „Konstanzidee“, dem zunächst nur physikalischen Gesetz der Erhaltung der Energie, werde bei Nietzsche die Wiederkehr des Gleichen: „Zwischen Zerstörung und Erhaltung pendelt hier die ganze Welt aller Erscheinungen ewig hin und her.“19 Erst 1952 hat Alwin Mittasch, ohne F/M zu nennen, diesen Zusammenhang bestätigt.20 F/M entwickelt seine Idee der „proteischen“ Identität, der zwischen den Extremen aus gespannten elastischen oder komparativen Skala. Im Zarathustra sei das Gesetz der Mitte ausgesprochen – jene Formel der Polarität (Mayer, 195). –
Auch F/M gehört zu den Besuchern des Archivs; am 26. April 1905 dankt er der Schwester „für die gütige Aufnahme, deren wir uns erfreuen durften“.21 Erneut weist er auf sein Buch hin:
„daselbst ist mehrmals, zumal aber von Seite → an auf Nietzsche als den Entdecker der Polarität des Unendlichen der Blick gerichtet. Vielleicht entschließt sich Herr Brandes, der Verlagsfirma Bard, Marquardt & Co. einen Wink über mich zu geben. –“
Er bittet um Zusendung mehrerer Bände der Kleinoktav-Ausgabe. Förster-Nietzsche erklärt: „Ihr Wunschzettel war ein wenig lang“; man möge sich gedulden (12. Juni 1905). Am 29. Juli dankt F/M für zwei umfangreiche Büchersendungen: „Ich bin glücklich, mich in deren Studium jetzt mit aller Muße vertiefen zu können.“ Der Verleger Marquardt wolle den Band über Nietzsche nicht vor einem Jahr bringen – „hoffentlich vertraut er ihn mir an!“ Ein halbes Jahr später, am 25. Januar 1906, berichtet F/M:
die „höchst liebenswerte Zuwendung der Werke Nietzsche’s hat mir in seinen Geist eine Versenkung ermöglicht, aus der ich nun herzlich gern zu Ihrer und aller verständnisinnigen Freude bald auftauchen möchte.“
Er bittet die Förster-Nietzsche, bei Marquardt anzufragen. Sie antwortet am 12. Februar: Sie kenne beim Verlag niemanden, wüßte auch „gar nicht, wie ich plötzl. dazu kommen sollte mich an die Herrn zu wenden.“ Sie habe gehört, daß Brandes den Band selber verfassen wolle; F/M möge sich an ihn wenden:
„Sie wissen, dass mir einige Ihrer persönlichen u. gedruckten Bemerkungen sehr gut gefielen weil sie ein nicht ganz gewöhnliches Nietzsche-Verständniss verriethen.“
Postwendend dankt F/M für den Rat. „Ich behalte mir vor, sobald mein Manuskript druckfertig ist, mich Brandes in Ihrem Sinne zu offenbaren.“ Doch das Manuskript bleibt liegen, F/M arbeitet an vier anderen Büchern.22 Außer Vorabdrucken veröffentlicht er nur Gedichte in der von Otto zur Linde und Pannwitz herausgegebenen Zeitschrift Charon sowie im März 1907 einen Goethe-Aufsatz, der Simmels größtes Interesse findet (GS 2, 239 ff.).
2. Der „bedauernswerte“ Herr Friedlaender – Simmels Korrespondenz mit dem Verlag Göschen
Im Frühjahr 1907 ergreift ein Verleger die Initiative. Dr. Wilhelm v. Crayen, seit 1896 Inhaber der G. J. Göschen’schen Verlagshandlung in Leipzig, schlägt Simmel am 23. April 1907 vor, drei Bände der geplanten Reihe „Geschichte der Philosophie“ zu übernehmen.23 Simmel lehnt aus Zeitgründen ab; man möge in drei Jahren nachfragen (ebd. 575). Crayen sucht ihn in einem persönlichen Gespräch zu überreden; am 22. Mai schlägt Simmel vor, den Kant-Band nicht an Kurd Laßwitz zu geben, sondern an
„Dr. S. Friedlaender, ein jüngerer Gelehrter, von dem ich eine sehr gute Meinung habe u. der sich mehrfach grade mit der populären Darstellung philosophischer Materien beschäftigt hat. [folgt Liste der Bücher] Er ist ein durchaus moderner, allem Schulkram abgewandter, dabei aber durchaus solider Denker u. ich glaube, daß er für die Aufgaben Ihrer Sammlung der rechte Mann ist.“ (ebd. 582 f.)
Kurz darauf teilt Crayen mit, er habe inzwischen von Hans Vaihinger gehört, daß Bruno Bauch sich zur Bearbeitung der beiden Bände über Kant und die vorkantische Philosophie bereit erklärt habe.24 Simmel wiederholt seine Empfehlung F/Ms (29. Mai; ebd. 587 f.); nochmals eindringlich ein halbes Jahr später:
„Herr Dr. Friedlaender, den ich Ihnen seinerzeit für Ihre Verlagsunternehmungen warm empfahl, bittet mich ein Wort bei Ihnen dafür einzulegen, daß er den in Aussicht gestellten Auftrag möglichst jetzt erhalte. Er befindet sich in größter materieller Not, u. angesichts der großen Begabung, die er für populäre Darstellung philosophischer Lehren besitzt u. der großen Hoffnungen, die man überhaupt auf seine literarische Zukunft setzen darf, erfülle ich seine Bitte herzlich gern. Ich glaube entschieden, daß es auch im buchhändlerischen Interesse läge, sich diese Kraft zu erhalten, bezw. zu sichern.“ (11. Jan. 1908; ebd. 600)
Aus den Bearbeitungsnotizen von Crayen und seinem Prokuristen Konrad Grethlein geht hervor, daß die Verträge mit Bauch bereits abgeschlossen waren. Verleger unter sich – hier beweisen sie den Spürsinn von Piraten:
„Wenn aber Herr Friedlaender wirklich ein so großes Tier zu werden verspricht, wie S. es schildert, dann dürfen wir die günstige Gelegenheit, ihn zu kapern, nicht vorübergehen lassen!“ (ebd.)
Gesagt, getan. Am 24. Januar 1908 schreibt Crayen an Simmel:
„Selbstverständlich bin ich mit dem größten Vergnügen bereit, mit Herrn Dr. Friedlaender in Verbindung zu treten! Ich habe infolgedessen heute an ihn geschrieben und ihn gebeten, mit mitzuteilen, welche Themata aus dem großen Gebiete der Philosophie ihm wohl am besten lägen, er möchte mir Vorschläge machen [...]. Ihnen aber, sehr verehrter Herr Professor, bin ich, wie gesagt, außerordentlich verbunden, daß Sie mir die Verbindung mit Herrn Dr. Friedlaender ermöglicht haben! Empfangen Sie wiederholt meinen aufrichtigsten Dank dafür!“ (ebd. 601 f.)
Am 19. Februar teilt Crayen mit, daß er „mit Herrn Dr. Friedlaender soeben über ein Bändchen ‚Die Philosophie Nietzsches’ abgeschlossen habe.“ (ebd. 603) Der Verlagsvertrag sieht vor: Umfang acht bis neun Bogen, abzuliefern bis 31. August; Honorar 500,- Mark, zahlbar „sofort nach definitiver Annahme des Manuskriptes“. Ein Zusatz überläßt dem Verlag die Entscheidung, ob das Werk in der Sammlung Göschen aufgenommen oder selbständig veröffentlicht wird.
Damit tritt in dieser Korrespondenz eine Pause ein; auch, soweit bekannt, in F/Ms Veröffentlichungen. Das letzte Gedicht im Charon erscheint im April 1908. Er ist mit der Ausarbeitung jenes Manuskriptes von 1906 beschäftigt.
Dabei entstand eine Nebenarbeit zu dem befreundeten Schriftsteller und Whitman-Übersetzer Johannes Schlaf. Er hatte drei Jahre zuvor F/Ms Mayer-Buch und seine Lyrik sehr gelobt.25 Ebenfalls Gast des Archivs, steigerte er sich jedoch in eine regelrechte Kampagne für seine auf Hegel gestützte „Überwindung“ des dekadenten Nietzsche, des verhängnisvollsten „Irrlehrers“ in Europa, der verkannt habe, daß das Christentum nicht im Untergang, sondern in seiner Vollendung begriffen sei.26 Am 27. September 1907 antwortet er auf einen nicht überlieferten Brief F/Ms; er klagt, sein Buch, in dem er „meine ganze Weltanschauung, mein bestes Leben und Wissen“ usw. niedergelegt habe, werde ignoriert; er dankt für F/Ms Angebot, sich öffentlich darüber zu äußern.27 F/M hält sein Versprechen: Er erwähnt den „tiefsinnigen deutschen Mystiker“ Schlaf (143); doch seine eigentliche Kritik publiziert er erst 1919: eine scharfe Zurechtweisung im Zuge einer heftigen Konfrontation von Philosophie und Wissenschaft, von Erleben und Kulturkonsum.29 Später wird er Schlaf, der sich nach 1933 zum Nationalsozialismus bekennt, wegen seines monistisch-pantheistischen und anti-koper-nikanischen Weltbildes verspotten.
Im Mai 1908 wird die „Stiftung Nietzsche-Archiv“ gegründet, mit 300.000 Reichsmark finanziert durch den schwedischen Bankier, Galeristen und Nietzsche-Enthusiasten Ernst Thiel.30 F/Ms materielle Situation dagegen ist verzweifelt. Sein in Weimar lebender Freund, der Literaturhistoriker Samuel Lublinski, schreibt ihm am 1. August 1908:
„Wegen des Stipendiums vom Nietzsche-Archiv wandte ich mich um Rat an Paul Ernst, der dort persona grata ist, während ich ihr [gemeint ist E. F.-N.] ziemlich gleichgültig bin und nur selten Besuch dort mache. Ernst sagte mir, daß seines Wissens – übrigens hörte ich das auch von anderer Seite – die Stiftung erst nach ihrem Tod in Kraft treten soll und er meint, daß viele vorgemerkt wären und hält die Sache für aussichtslos. Trotzdem könnte ich mich ja versuchsweise an Sie wenden. Das will ich auch tun, aber erst im Herbst, wenn die Empfangstage sind. Gegenwärtig ist ihr Neffe, Oberleutnant Öhler, da und man kann sie nicht allein sprechen. Der Herr Oberleutnant ist kein unsympathischer Mensch, aber sein Blick für geistige Rangordnung noch nicht übermäßig geschärft, und er hält es für seine Pflicht, seine Tante vor Ausnutzung zu schützen. Ich würde mich also einer Abweisung aussetzen, und die könnte möglicherweise in einer Form geschehen, daß ein Bruch da wäre. Aber im Herbst will ich sehen, was ich machen kann, wiewohl ich fürchte, es wird nicht viel sein. Vielleicht schikken Sie ihr das Nietzschebüchlein, wenn die ‚Überwindung’ nicht zu schlimm ist.“31
Über seinen inneren Zustand bemerkt F/M später:
„Übrigens ekstatisierte mich die Konzeption meines ‚Nietzsche’ dermaßen, daß Simmel der ersten Skizze das wohl anspürte, mir aber gestand, er verstehe vor der Hand weder das Ganze noch auch nur Einzelheiten, und mir riet, das Manuskript aus dem Esoterischen ins Exoterische zu übersetzen.“ (Autobiographie, 71)
Ein Zeugnis dieses Zustandes ist F/Ms Brief vom 2. August 1908 an Martin Buber. Der sieben Jahre Jüngere, der 1895 den ersten Teil des Zarathustra ins Polnische übersetzt hatte, arbeitet gerade an den Ekstatischen Konfessionen; im Vorwort beschreibt er die Ekstase als „undifferenziertes Erleben“; später wird er die „Indifferenz“ und die „Unabhängigkeit des Nullpunkts“ hervorheben.32 F/M dankt für ein zurückgegebenes Manuskript und legt sein ekstatisches Bekenntnis ab:
„Ich bin der Wiederentdecker des magnetischen Weltleibes, der von seiner Indifferenz, der ‚Seele’ aus, in deren Gewalt ist: eine Balanßirmagie der Seele, also des Weltleibes [...] Ich habe in alle Werte der ‚Erde’ das ∞ mit Gewalt eingeführt, vor Allem in die verfluchte stockige ‚Identität’ der scholastischen Logik. Ich habe mein Blut, mein Herz infinitesimalisirt. [...] Die Gefahr des ∞, das ich bin, das Alles ist, persönlich (!!!) ist, kenne ich, es ist unendlicher Differenzirung und daher Verwirrung, Verrenkung seiner ‚Seele’, seiner Indifferenz (= 0!) fähig: allein ich lasse mich nicht wie Hamlet in’s Boxhorn jagen: ich bin ein Einrenker und damit erst echter Differenzirer [...] Imprägniren Sie mich und Sich in Gedanken mit lauter Fragezeichen. –“33
F/M hielt die vereinbarte Frist von einem halben Jahr ein. Am 18. September 1908 sieht sich Crayen zu einem außergewöhnlichen Schreiben an Simmel veranlaßt. Es wird hier fast vollständig wiedergegeben – zweifellos „eine der bösesten Angelegenheiten“, die je ein Verleger philosophischer Bücher angezettelt hat:
„[...] Der Herr Verfasser hat seine Arbeit nun vor kurzem abgeliefert, sie ist aber derartig ausgefallen, dass ich mir keinen anderen Rat weiss, als Ihnen ganz offen meinen Eindruck mitzuteilen. Ich habe mit schmerzlichem Bedauern beim Durchlesen die vollkommen klare Überzeugung gewonnen, dass Herr Dr. Friedlaender wohl infolge von Überarbeitung in einer Weise krankhaft exaltiert ist, die die Grenze des Psychiatrischen bereits erreicht, wenn nicht überschritten haben dürfte. Ja, sein Zustand erscheint mir ein derartiger, als ob schleunigstes Eingreifen des Arztes dringend notwendig wäre. Vielleicht erleichtert es den Fall, dass das Bewusstsein seines Zustandes wenigstens zeitweise dem Kranken selbst nicht ganz fremd zu sein scheint. Angesichts des freundlichen Interesses, dass Sie, sehr geehrter Herr Professor, an dem bedauernswerten Herrn nehmen, werden Sie es verstehen und entschuldigen, das ich mich mit dieser Mitteilung an Sie wende: Sie werden sich aus dem Wortlaut der beifolgenden beiden Kapitel selbst davon überzeugen, dass meine traurige Vermutung in vollem Umfange zutrifft. Ich halte es mit Rücksicht auf den zweifellos höchst reizbaren Zustand des Herrn Dr. Friedlaender nicht für richtig, des Manuskripts wegen im gegenwärtigen Moment an ihn selbst zu schreiben, möchte vielmehr Sie, sehr geehrter Herr Professor, bitten, zu gelegener Zeit über das Manuskript zu verfügen, das ich hier inzwischen aufbewahren will. Falls Sie den übersandten Manuskriptteil zunächst nicht zur Vorlage an einen Psychiater verwenden wollen, ersuche ich Sie höflichst, ihn nach Kenntnisnahme mir zurücksenden zu wollen, damit das Manuskript vollständig hier lagert. Leider ist dieses bereits in einem so vorgerückten Stadium der Psychose entstanden, dass auch nicht ein Teil davon verwendbar ist oder eine spätere Umarbeitung wesentliche Teile davon verwendbar machen könnte.
Ich bedauere aufs wärmste das schwere Unglück, das den sichtlich hochbegabten Herrn Verfasser betroffen hat, und möchte nur wünschen, dass es gelänge, eine baldige Wiedergenesung herbeizuführen.
Sollten Sie irgendwelche Schritte ergreifen wollen, zu denen Sie meiner Mithilfe bedürfen, so stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung, falls Sie aber Ihre Einmischung in die Angelegenheit nicht für richtig halten, so wäre ich Ihnen für einen freundlichen Rat ausserordentlich dankbar, wo die Verwandten des Herrn Dr. Friedlaender sind, bezw. an welche sonst ihm nahestehende Persönlichkeit ich mich in der Angelegenheit, die eine der bösesten ist, die mir je vorgekommen sind, wenden könnte.
Ich bleibe Ihrer geschätzten Rückäusserung gern gewärtig und bin, mit der Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung Ihr ganz ergebener
Wilhelm Crayen“ (Simmel 2005, 649 f.)
Simmel erhielt diesen Brief mit Verspätung, er war seit August in der Schweiz. Drei Wochen später, 7. Oktober, schickt Crayen ihm ein tags zuvor zugegangenes Schreiben F/Ms,
„in dem dieser selbst den Wunsch ausspricht, sein Manuskript nochmals umarbeiten zu dürfen. Ich kann mir davon freilich keinen Erfolg versprechen, es sei denn, dass sich die zweifellos bei Abfassung der Handschrift vorhandene Nervosität des Herrn Dr. Friedlaender ganz beträchtlich gelegt hat. Aber auch dann fürchte ich, dass die erneute Beschäftigung mit dem Stoff nur zu leicht einen Rückfall im Gefolge haben kann.“ (ebd. 651)
Crayen bittet um raschen Bescheid. Simmel antwortet zwei Tage später; er sucht zu dämpfen, distanziert sich: Er habe die Sendung vom 18. September erst heute erhalten und beeile sich,
„Ihnen zu sagen, daß ich Ihre Meinung, man habe hier mit einem im ärztlichen Sinne ‚Verrückten’ zu tun, nicht ohne Weiteres teilen kann. Vielleicht haben Sie recht – allein es giebt heute eine ganze Anzahl von im Übrigen ‚gesunden’ Menschen, die aus Nervosität, Größenwahn, Sucht nach ‚Besonderheit’ derartiges Zeug verfassen. Ich will indeß, wie Sie es andeuten, die Bogen einem Psychiater vorlegen u. Ihnen das Resultat baldmöglichst mitteilen.
Herr Dr. Friedlaender steht mir persönlich in keiner Weise nahe, ich weiß nichts von seinen Lebensumständen, als daß er sehr arm ist; nur seine zweifellose Begabtheit hat mich veranlaßt, mich mehrfach für ihn zu verwenden. Vielleicht ist es am besten, Sie warten das Urteil des Arztes ab, ehe Sie einen weiteren Schritt tun.“ (ebd. 652)
Crayen dankt; er wolle abwarten (ebd. 654). Am 11. Oktober teilt Simmel mit, ein Brief Crayens sei irrtümlich nach Lugano gegangen; F/M sei ungeduldig, daher sei es besser, „das Urteil des Irrenarztes, das nicht so schnell zu erlangen ist, nicht abzuwarten“, sondern F/M zu sagen, das Manuskript passe nicht in das Konzept der Sammlung; eventuell möge man dem „sehr armen und unglücklichen Menschen“ einen Vorschuß anbieten, den er zurückzahlen solle, sobald ein anderer Verleger gefunden sei (ebd. 654 f.). Crayen & Grethlein verständigen sich untereinander:
„Mir liegt natürlich nicht daran, daß nun durchaus ein Psychiater eingreifen soll! Im Gegenteil, es wäre zweifellos bedeutend einfacher, wenn wir Friedlaender einfach abhalftern könnten, aber es wird nicht so leicht gehen [...]. Es wird Fr. eher Mühe machen und ich weiß nicht, ob der auf die Drohung mit dem Popanz Simmel zielt!! Nehmen thu ich das Mscr. natürlich keinesfalls, nur über das ‚Wie?’ der Ablehnung bin ich mir nicht klar [...]“ (ebd. 655)
Simmel hakt nach, bittet um Entscheidung: entweder lege er die Arbeit einem Psychiater vor oder schicke sie zurück; ersteres werde ihm allerdings „immer weniger plausibel“, er habe kein unbedingtes Zutrauen zu einem irrenärztlichen Urteil (ebd. 661 f.). Crayen antwortet am 3. November: Er habe F/M das Manuskript zurückgesandt, von ihm anliegendes (nicht überliefertes) Schreiben erhalten und kurz beantwortet; hoffentlich sei die Situation nun geklärt (ebd. 668).
Zum dritten Mal gibt sich F/M an eine Revision. Ein Jahr später, 10. Oktober 1909, antwortet ihm Simmel aus Rom auf einen nachgesandten Brief: „Soweit es an mir liegt, soll unser neuliches Zusammensein lieber einen Anfang als einen Abschluß bedeuten. – Ihren Nietzsche durchzusehn bin ich gern bereit.“ (ebd. 727)
Mitte Dezember wird Mynonas erste Groteske gedruckt, in der von Herwarth Walden kurzzeitig redigierten Zeitschrift Das Theater.34 Um diese Zeit kommt F/Ms Manuskript zum Abschluß. Der Verleger, der sich freilich für „absolut nicht kompetent hält“, interveniert am 25. Januar 1910 erneut bei Simmel: F/M habe
„jüngst seine neue Arbeit über Nietzsche übersandt und ich habe mich auch sofort daran gemacht, um zu sehen, ob das Manuskript diesmal anders ausgefallen ist [...]. Und da muss ich denn leider sagen, dass ich zwar die Arbeit wörtlich durchgelesen habe, dass es mir aber dabei trotz besten Willens absolut nicht möglich gewesen ist, zu ersehen, was der Verfasser eigentlich will, nur soviel glaube ich mit Sicherheit ersehen zu haben, dass es sich hier weder um eine populäre, noch um eine wissenschaftliche, noch um eine populärwissenschaftliche Arbeit handeln kann. Ja, wenn ich offen sein darf, vermag ich mich auch diesmal wiederum des Eindruckes leider nicht zu verschliessen, dass die Arbeit das Produkt einer schweren Psychose, vielleicht einer überaus genialen, aber eben doch einer Psychose, ist, wenn sie auch in zusammenhängender Gedankenführung entschieden weniger angreifbar ist, als die frühere, und ebensowenig glaube ich mir verhehlen zu können, dass dem Verfasser ein grosser Gefallen geschehen dürfte, wenn die Arbeit nicht publiziert wird. Indess ich fühle mich in der ganzen Sache absolut nicht kompetent und deshalb möchte ich Ihnen die höfliche Anfrage unterbreiten, ob Sie eventuell sich das Manuskript einmal ansehen würden?“ (ebd. 780 f.)
Crayen schlägt nochmals vor, Simmel möge die Arbeit durch „ein kurzes erläuterndes Vorwort“, also durch seinen Namen „wenigsten bis zu einem gewissen Grade“ decken; andernfalls wolle er lieber den Verlag ablehnen und den Vorschuß nicht zurückfordern (ebd. 781 f.). Zwei Tage später bestätigt Simmel, er sei zu einer Durchsicht ohne weiteres bereit, könne aber keinen festen Termin Zusagen; ein Geleitwort halte er keinesfalls für sinnvoll:
„denn entweder ist die arbeit in sich wertvoll, so wird sie ihren weg von selbst machen (die blosse extravaganz des ausdrucks u. paradoxität des gedankens sind ja heute keine hindernisse mehr); oder sie ermangelt der wesentlichen qualitäten – dann würde meine empfehlung ihr so wenig nützen, wie sie im ersteren fall ihrer bedarf. ich bin allerdings der meinung, dass ein buch über nietzsche heute nur noch eine existenzberechtigung hat, wenn es etwas ganz eigenartiges u. hervorragendes bietet.“ (ebd. 783)
Crayen schickt das Manuskript am 28. Januar (ebd. 784). Knapp vier Wochen später, 25. Februar, bewirkt Simmel die Peripetie. Er erklärt dem Verleger:
„ich habe jetzt eine reihe von stichproben aus dem friedlaenderschen manuskript gelesen. um es gleich vorweg zu sagen: mir erscheint diese arbeit im höchsten grade interessant u. tiefsinnig. sie trägt den stempel eines zwar wunderlichen, oft chaotischen u. schwer verständlichen, aber durchaus bedeutenden denkers. – damit ist freilich die frage der buchhändlerischen zweckmässigkeit der publikation noch nicht entschieden. ob das buch gekauft werden wird, wie sich die kritik dazu stellen wird – darüber lässt sich, angesichts seiner eigenart, zu der sich wenig analogien finden, garnichts vorherbestimmen.
ich hoffe, dass sich herr f. noch wird bereit finden lassen, eine reihe von undeutlichkeiten, auch von exkursen, die meiner ansicht nach entbehrlich sind, zu entfernen. wenn ich von ihnen gehört haben werde, wie sie nun über die sachlage denken, werde ich herrn f. um seinen besuch bitten u. über eine gewisse ‚humanisirung’ seiner arbeit mit ihm verhandeln.“ (ebd. 793)
Angesichts dieser starken Verteidigung diskutieren Crayen und Grethlein drei Möglichkeiten: Ablehnen, Veröffentlichen mit Vorwort von Simmel oder außerhalb der Sammlung Göschen, in einer Auflage von 1000 Exemplaren, „zumal Nietzsche nach wie vor viel Interesse begegnet und es eine ganze Menge Leute giebt, die alles kaufen, was über ihn erscheint“ (ebd. 794 f.). Am 5. März sucht Crayen Simmel erneut zu einem Vorwort zu bewegen, mit dem Argument, sein in philosophischen Kreisen noch unbekannter Verlag solle zu Anfang nicht mit einem Opus auf den Markt kommen, „dessen Wert doch immerhin stark angezweifelt werden kann und das zum mindesten ungemein eigenartig ist.“ Falls Simmel einwillige, wolle Crayen „den ziemlich sicheren finanziellen Misserfolg des Buches“ auf sich nehmen, „weil Ihre Empfehlung mich wenigstens moralisch decken würde“; andernfalls wolle er lieber nicht verlegen (ebd. 798 f.).
Simmel antwortet am 7. März ausweichend: Bevorwortungen seien in der Philosophie ganz ungewöhnlich; er selber stehe trotz eines gewissen Kreises von Anhängern in der „offiziellen“ akademischen Philosophie eher isoliert; F/Ms Buch habe „doch eine art u. einen rang, die eine öffentliche ‚protegirung’ durch einen dritten als einigermaassen schief u. ungeeignet erscheinen lassen“; F/M könne Einspruch erheben; und wenn nicht, „so würde ich selbst mich fast schämen, mir dem buche gegenüber die superiore stellung anzumaassen, wie eine derartige empfehlung sie voraussetzt.“ Jedenfalls müsse er das Manuskript genau kennen lernen; da ihm die Zeit dazu fehle, wolle er mit F/M sprechen (ebd. 801 f.). Crayen dankt am 12. März; da „die Sache sich doch sowieso schon ziemlich lange hingezogen“ habe, komme es auf einige Wochen oder Monate nicht an.35 Am 25. April schreibt Simmel an F/M:
„verehrter herr doktor,
ich danke ihnen dafür, dass sie meine vorschläge der beachtung wert finden. bitte, glauben sie nicht, dass ich damit ‚verbesserungen’ ihrer arbeit gemeint habe. ich wollte nur bewirken, dass ich u. andre von ihren gedanken noch mehr erfahren, als bis jetzt in ihrer arbeit gegeben ist. ich meine dieses ‚mehr’ nicht nur im quantitativen sinn. sondern auch das bisher gegebne möchte ich ‚mehr’, d. h. aus einem weiteren u. deutlicher gesehenen umfange heraus begreifen. übrigens glaube ich nicht, dass die isolation, zu der sie sich verurteilt glauben, in wirklichkeit besteht. ich kenne doch eine ganze reihe von persönlichkeiten, denen ihre denkweise zugängig sein u. die sie mit dank u. freude aufnehmen würden.“ (ebd. 824)
F/M möge seine Bearbeitungen rasch erledigen. Am selben Tag setzt Simmel gegen Crayen den gewaltigen Schlußakkord:
„ich habe mich in der letzten zeit mit dem manuskript von herrn dr. friedlaender ausführlich beschäftigt. das ergebniss davon ist, dass ich ihnen vorbehaltlos u. dringend zu der veröffentlichung rate. das buch ist freilich paradox u. ungewöhnlich genug u. mancher bürgerlich regulirte kopf wird darüber geschüttelt werden. allein es ist von einer so genialischen tiefe, es enthält so erschütternde aspekte des lebens, so viel grossartigen u. seherischen schwung, dass ein von grossen gesichtspunkten ausgehender verleger keinerlei bedenken, es aufzunehmen, hegen sollte. wie der finanzielle erfolg sein wird, kann ich natürlich nicht prognostiziren. bei büchern dieser art ist es kaum mehr als ein zufall, ob sie zunächst liegen bleiben oder einen ganz weiten erfolg haben. ausgeschlossen ist das letztere keineswegs u. ebensowenig ist es ausgeschlossen, dass es einmal zu den ruhmestiteln ihres verlages gerechnet werden wird, dieses buch veröffentlicht zu haben.“ (ebd. 825)
Er habe dem Autor vorgeschlagen, „ein paar vielleicht unnötig chokirende härten auszumerzen u. ein paar ausführungen, die das verständniss erleichtern, hinzuzufügen“; F/M habe zugestimmt.
Verleger zähneknirschend unter sich: „Auf diesen Brief [B: der von der größten Unverschämtheit des Jahrhunderts ist] können wir doch nun wohl nicht anders, als das Opus verlegen“… zu Simmels Formulierung vom „bürgerlich regulirten kopf“: „das geht auf Sie!!!!!!! [B: Jawohl! gottlob!!]“… zu seiner Schmeichelei von den „ruhmestiteln“: „hört, hört!!!“ und: „Unverschämtheit!“ Doch planen sie bereits Ausstattung und Typographie.36 Am 4. Mai 1910 – F/Ms 39. Geburtstag – bestätigt Crayen, er lasse nun alle Bedenken fallen und erkläre sich endgültig damit einverstanden, das Manuskript zu verlegen (ebd. 829 f.).
Die Jugend bringt Ende August einen neuen Nietzsche-Aufsatz F/Ms;37 im Oktober einen Vorabdruck;38 ein zweiter Vorabdruck steht im November im Sturm.39 Am 2. Dezember 1910 schickt Crayen Simmel „ein Exemplar des soeben erschienenen Werkchens“; er dankt nochmals herzlich für die Ratschläge „in bezug auf dieses Opus“.40
Das Opus – Impressum 1911; Preis 2,80 Mark – wird am 15. Dezember in der Rubrik „Beachtenswerte Bücher“ im Sturm aufgelistet sowie in vielen wissenschaftlichen Zeitschriften.41 F/M vermerkt im Rückblick: „Lublinski, der berufenste Kritiker dieses Buches, starb gerade, als ich es ihm zusandte.“ (Autobiographie, 71) Lublinski starb am 25. Dezember 1910 in Weimar; in seinem letzten Buch, Der Ausgang der Moderne, hatte er mit Blick auf Johannes Schlaf von der „rätselhaften Indifferenz“ gesprochen und F/M als einen „der feinsten und geistvollsten Vertreter der modernen Naturempfindung und Polaritätslehre“ bezeichnet.42
3. Nietzsche als Paradigma des philosophischen Polarismus
Ein Buch ohne Fußnoten, ohne Bibliographie, ohne Zitate. Hier und da ein Wort in Anführungszeichen, aber kein ganzer Satz. Zu Beginn von Kapitel I wird der Leser gebeten, beim Verfasser die Kenntnis aller Texte Nietzsches vorauszusetzen. F/M folgt damit unwillkürlich einem hermeneutischen Grundsatz, aufgestellt im 15. Jh. von einem Autor, der mit Nietzsche herzlich wenig zu tun hat – Nikolaus von Kues:
„Denn es gehört sich, daß, wer die Ansicht eines Schriftstellers über irgendeine Sache untersucht, dessen sämtliche Schriften aufmerksam liest und in einen zusammenstimmenden Satz auflöst.“43
Diesen Satz gibt F/M vorweg in der „Orientierung“. Auch damit folgt er einem Rat des Cusanus:
„Worauf aber blickt nun ein Mensch zurück [respiciat], der irgendein Buch lesen will [qui vult legere aliquem librum]? Blickt er nicht zuerst zurück ins Gedächtnis, bevor er die Seite liest? Er wird nämlich das auf der Seite lesen, was er zuvor in sich sah, im Begriff, der aus dem Gedächtnis floß.“44
Vor der Lektüre muß ich den Begriff dessen haben, was ich in der Lektüre finden will – das haben moderne Hermeneutiker 450 Jahre später als einen Zirkel gebrandmarkt.
Das Buch beginnt mit einem von Kant entlehnten Bild – wer sich orientieren will, soll das Auge in die Sonne einsetzen45 –, und es endet mit einem Satz aus Kants Motto zur KrV. Inzwischen scheint Nietzsche diesen Rahmen zu sprengen; jedenfalls läßt F/M auf Kant kein allzu helles Licht fallen. In den folgenden Jahren wird sich das Verhältnis umkehren. Bei aller sachlichen und sprachlichen Anverwandlung bleibt F/M distanziert. Mehrmals unterstreicht er: Alle Werke Nietzsches sind Maske; unter der Maske des Denkers verbirgt sich ein tiefer Dichter; dieser sah oft klarer als jener, beide kommen nicht überein. Nietzsche versteht sich selber nicht völlig. Er ahnte, was F/M ihm nahelegt: die Polarität, die Funktion der Mitte; aber er ahnte es nur poetisch, brachte es nicht auf logische Begriffe. Ihm fehlte die rechte Methode, er verfehlte den letzten Schritt zum Indifferentismus.46
Nietzsche ersetzt Kants kritische Methode durch die historische; so kann er unbeirrt von Vormeinungen Neues entdecken. Aber das genealogische Verfahren paßt nicht auf ihn selber. Daher muß man, um den frühesten Nietzsche zu verstehen, den spätesten in ihn hineinverstehen – und umgekehrt; jedes Werk ist allegorisch für das folgende (109, 115). F/M markiert Entwicklungsstufen (142 f.); doch bemerkt er auch ein unterirdisches Fließen der Gedanken; die einzelnen Werke sind Eruptionen. Man muß mehr beachten, wohin Nietzsche will, als woher er kam.
F/M zieht Nietzsches Werke nur philosophisch in Betracht, läßt „poetische Schönheiten“ und Philologisches beiseite (123, 157). Er selbst erweist sich als ungeheurer Stilist: der Text ist ausgefeilt, intensiv bis in das mitunter fast rasende Tempo, Stakkato – oft Gedankenstriche statt Kommata – Doppelpunkte, Parenthesen gliedern lange Perioden: zahllose seltene Ausdrücke, Neologismen; manchmal sind ganze Bündel von Anspielungen und Verweisen geschnürt – alles in der ersten Person Plural, nur zweimal taucht ein auf den Autor beziehbares ‚ich’ auf.
Das Buch läßt sich scheinbar leicht auf Thesen bringen. Aber dabei geht seine eigentümliche Disposition verloren. Es gibt hier keine bequeme lineare Gliederung in Haupt- und Unterpunkte, sondern der eine Gedanke wird unermüdlich eingekreist. F/M verweilt bei Fundstücken und Problemknäueln, nimmt das Thema wieder auf. Zweimal heißt es, das eben Gesagte sei keine „Abschweifung“ (154, 164). Die Kapitelfolge wird überlagert von einer spiralförmigen Entwicklung oder einer arithmetischen Progression, ähnlich jener, mit welcher der Erfinder des Schachspiels den indischen König zum Ankauf verleitete – von einem Reiskorn ad infinitum… Im folgenden sei ein Stenogramm gegeben.
Orientierung. Welchen Satz, welchen „logischen Augenpunkt“ (91, 99) gibt F/M? Den Begriff der Polarität. Wie jeder echte Philosoph will Nietzsche der logischen Unendlichkeit eine Orientierung abgewinnen. F/M betont die Spannung; seine Terminologie stammt nicht von Nietzsche. Einerseits der Gedanke Unendlich (∞), der „so weit und metaphorisch“ wie nur möglich gefaßt werden müsse; andererseits das „selbsteigene Erlebnis“. F/M nennt es ‚infinitesimal’, unendlich klein.47 Doch zugleich ist es unermeßlich, unbeschränkt bis zur Unmöglichkeit – ohne die unendliche Freiheit haben wir gar kein Motiv zur Philosophie. Diese ist die „Autobiographie der Welt“.48
Erstes Grundmotiv. Allein der Philosoph realisiert „die universale Regel, daß keine Vorstellung unabhängig vom erkennenden Wesen bestehe“ (Mahnruf, 53), also den fundamentalen Zusammenhang von Allem und Nichts, die unauflösliche Korrelation von Weltall und Weltnichts:
„Sehr wenige wissen, daß die Welt sich in ihnen für sich selber persönlich interessiert“… „Der mächtigste Gedanke ist der Gedanke von der leiblichen Persönlichkeit als der Weltvermittlung. Ich bin die persönliche Bekanntschaft der Welt mit sich selber.“… „Merkwürdig, daß man verabsäumt hat, der gewaltigen Konzeption des Weltalls die ebenbürtige des ihm wesentlich korrelativen Weltnichts beizugesellen. Es sind dies gleichsam die Pole der Unermeßlichkeit…“49
Zweites Grundmotiv. Die „ureigenste Infinitesimalität“, das persönliche Erleben des Zustandes einer präzisen Indifferenz – „sternartig schweben“ zwischen allen Gegensätzen, „fliegen“ inmitten aller konträren Kräfte und Zerrungen. Solches Balancement, vom Seiltanz bis zur „Sternbahn“, zum „Sternflug“, „Sternsein“, zum „sternartigen Mittelstand“,50 muß unausgesetzt kultiviert werden. Disziplin ist nötig. Das empirische Ich ist belanglos, das innerste Selbst nicht empirisch (92).
Viertes Grundmotiv. Nietzsches Heroismus bildet die letzte Stufe einer längeren Entwicklung. Die Funktion der Mitte zwischen Extremen, die Instanz, welche die in Gegensätze (Idealität/Realität, Ja/Nein usw.) auseinanderfallende Welt zusammenhält, „wie zwischen den Elektroden den Lebensfunken überspringen läßt“ (173); die Notwendigkeit, Identität als elastisch und damit als lebenstauglicher zu denken, als dehn-, aber nicht zerreißbar – Nietzsche ahnte dies nur dunkel. F/M bringt es auf Begriffe und skizziert die Genealogie: Kant hatte jene „Idee der Ideen“, doch ging er einen Umweg, stellte eine Jakobsleiter, eine Skala zwischen Gott und Mensch. Er hielt Idee und Empirie, Noumenon und Phänomenon besonnen auf Distanz, ihm gelingt nicht die Ver-irdenung (92 f.). Schopenhauer zerbricht die Distanz, macht eine Alternative daraus. Nietzsche setzt den Akzent auf die Realität; es geht um amor fati, nicht um amor dei (94). Seine Umwertung ist kein Pantheismus. Gott, die Sonne, der Wert mit seinem Doppelsinn von Plus und Minus soll wie ein Blitz in die Realität fahren, der Richtungsunterschied muß in die Welt hinein, die „Reziprozität der Extreme“ soll fungieren. F/M sagt es drastisch: Die alte Idee des Unendlichen, tollkühn gemacht durch die Skepsis, die historische Methode, springt „die Realität wie ein Tiger mit einer noch nie dagewesenen Furchtbarkeit“ an.52
Fünftes Grundmotiv. Der Mensch ist ein sordinierter (gedämpfter) Gott; er möge wenigstens in Gedanken seine „eigene Göttlichkeit“ fassen (92, 96). Das ist F/Ms Variante eines weitverzweigten Themas, das etwa bei Platon als Theosis faßbar wird und wiederum im 15. Jh. zu neuer Aktualität gelangt. Cusanus erwägt, wenn auch selten und vorsichtig, eine gewisse Erhöhung des Menschen: „Der Mensch ist nämlich Gott“ – „aber nicht absolut, da er ja Mensch ist; er ist also ein menschlicher Gott“.53
Sechstes Grundmotiv. Extreme streiten nicht gegeneinander, sondern um ihre Harmonie, ihr Neutrum (96, 168). Bisher wurde Polarität nur „logisch hybrid“ gefaßt oder, bei E. A. Poe, mythologischpoetisch (99). – Im März 1935 notiert F/M:
„Nietzsche hat so wenig gemerkt, daß er Polarist ist, daß er nicht einmal das Wort gebraucht. Er hat mit der Polarität schlecht verkehrt. Es ist nicht leicht, mit ihr umzugehen, weil es auch nicht schwer, sondern – gewichtslos (‚Indifferenz’) ist.“ (Tagebuch 24)
Allerdings ist das Wort bei Nietzsche einmal belegt: Heraklit begriff das Werden und Vergehen „unter der Form der Polaritat“, „als das Auseinandertreten einer Kraft in zwei qualitativ verschiedne, entgegengesetzte und zur Wiedervereinigung strebende Tätigkeiten…“54
I. Geburt der Tragödie. Programmatisch beginnt Nietzsche mit einer Untersuchung des Tragischen als der Kunst, das Schreckliche, den Tod ästhetisch, angenehm, annehmbar zu machen. Schopenhauer sah in der Tragödie seine Lebensentsagung bestätigt; darin erkennt Nietzsche christliche Züge: die verhüllte Macht der Ohnmacht, den Stolz im Kleid der Demut, den Stachel der Lust im Leiden. Das Leiden kommt aus dem Leben, Vernichtung aus dem Überschuß. Ursprünglich ist die Barbarei; die Natur siegt über sich selber durch Kunst. Gott leidet an seiner Übermacht, er ist erlösungsbedürftig.55
Dionysos: Musik, Rausch, natura naturans, Leben ohne Begriff, Instinkt, Trieb. Dagegen Apoll: Visualität, Traum, natura naturata, Reflexion, Kunst, Schleier. Apoll setzt die individuellen Unterschiede fest, Dionysos verschmilzt sie im Anonymen. Doch der Gegensatz ist weder ursprünglich noch unwiderruflich. Im Widerspruch steckt schon Vermittlung, Verbindung, ausgleichende Gerechtigkeit. Sie wird zerstört durch die „logische Reflexion“, personifiziert in Sokrates. In den Dramen des Euripides wird aus Kunst nachgeahmte Natur; Platons Bildkraft entartet in den Schematismus seiner ‚Ideen’. Aber Sokrates endet tragisch; indem er die Logik vollendet, kehren alle Rätsel zurück. Die Wissenschaft, zu apollinischem Akademismus erstarrt, muß zuletzt wieder künstlerisch, dionysisch werden. Ihr Ursprung ist das Leben, es kann nur deshalb analytisch sein, weil es vor allem synthetisch ist.
F/M beurteilt das Buch: Es klingt verschämt, verhalten, „homöopathisch“, anfängerhaft. Nietzsche greift zurück auf den Idealismus, sein Dionysos ähnelt Hamlet. Nötig ist ein Denken in Extremen: Je grauenhafter die Realität gesehen wird, desto echter kann das Ideal herauskommen. Nietzsche befragt den Kulturbegriff: Man maskiert die Sklaverei mit Formeln wie „Würde der Arbeit“, daher droht stets die Gefahr der Revolution. In der Polarität von Dionysos und Apollo erkennt F/M die „Formel für alle menschlichen Probleme vom Organischen bis zum Technischen, ja Mathematischen“. Nietzsche sucht den Ausgleich, die Balance, den Bund. Das in der Frühschrift Vorgezeichnete wird später immer klarer ausgesprochen: die Lösung des sokratischen Problems: „Wissenschaft als dionysische Weisheit“, Ahnung eines „dionysisch wissenschaftlichen Lebens“.
II. Unzeitgemäße Betrachtungen. Nietzsche fehlten die richtigen Feinde; vielleicht kämpfte er immer nur gegen Windmühlen. Seine Streitschrift gegen Strauß richtet sich weder gegen dessen Person noch gegen dessen Buch, sondern prototypisch gegen den „Bildungsphilister“. Der weiß alles nur, um zu wissen; konserviert, musealisiert, dünkt sich Gipfel der Kultur, ist aber unfähig, die Vergangenheit zur Zukunft umzubilden. Strauß spielt ahnungslos mit dem Dynamit des Atheismus.
Geschichte, Erinnerung muß nicht als Selbstzweck betrieben werden, sondern um des Lebens willen. Soll es nicht am eigenen Ballast zugrundegehen, so kann gar die „Brutalität der Pietätlosigkeit“ nötig sein, das Un-, ja Antihistorische, sonst verlernen die Instinkte ihre Echtheit, man fühlt sich fertig, quasi tot. Vergangenheit tötet, Zukunft verlebendigt. F/M streut ein: Das philosophische Wissen ist ungeheuer, aber niemand will ernsthaft philosophisch leben; die Wissenschaften pflegen einen falschen Begriff von Objektivität: die Person, das Subjekt soll auf keinen Fall in der Sache aufgehen. Vielleicht mußte zur antiken Religion der Jugend die christliche Religion des Todes hinzukommen, um die Religion des tragischen Lebens zu bilden? Mit Nietzsche diagnostiziert F/M hier einen „Bruch der Kulturen“.56
„Das Ziel der Menschheit“, sagt Nietzsche, „liegt in ihren höchsten Exemplaren“, nicht im Staat, wie Eduard v. Hartmann und Hegel meinen. Kultur zielt nicht auf Pluralität, auf Verteilung des Gesamtglücks an die Masse, wie es die englischen Utilitaristen wollen, sondern auf Singularität, den genialen Einzelnen, die „eigenste Person“. Wissen muß im Dienst des Lebens stehen. Das Selbst ist unvernichtbar, aber schwer kultivierbar. Für die „Selbsterziehung zur Einzigkeit und Selbsteigenheit“ (120) gibt Nietzsche zwei Vorbilder: Schopenhauer und Wagner; freilich sind es Selbstporträts: der Philosoph, der Künstler.
III. Menschliches, Allzumenschliches. Skepsis, konsequent betrieben, darf nicht haltmachen vor der Wahrheit aller Wahrheiten, vor Gott. Soweit ging Kant nicht; er hob das Wissen, das Erkenntnisvermögen auf, um dem Glauben Platz zu machen. Nietzsche führt die Skepsis bis zum radikalen Bruch mit der Vergangenheit, er entzaubert die religiösen, moralischen, ästhetischen Werte, bis sie als allzumenschlich dastehen. Kant ließ die Bedingungen der Möglichkeit der reinen Vernunft unbefragt; Nietzsche erklärt sie „tollkühn“ historisch. Reine Vernunft erscheint ihm als Machtspruch, als erstarrter Strom von Lebensillusionen.57
Kant vernichtet die metaphysische Theorie, läßt die metaphysische Praxis bestehen. Schopenhauer vernichtet auch diese, verehrt das übriggebliebene Nichts an der Stelle des alten Gottes; sein Wille kapituliert vor derjenigen Moral, welche das Leben pessimistisch mißachtet. Aber zum echten Atheismus, d. h. Nihilismus, so F/Ms paradoxe Folgerung, scheint die Kraft eines Gottes nötig: es ist eine übermenschliche Anforderung (126). Nietzsche nimmt den Reduktionsprozeß auf. Er verwandelt Ehrfurcht in Ehrmut. Wo es nichts mehr zu verehren, zu schätzen gibt, da bleibt noch die Kraft des Schätzens selbst. Wo die alten Werte zu Illusionen explodiert sind, das ganze Jenseits sich als Lug und Trug erwiesen hat, da kann das Schätzen tatkräftig, wissenschaftlich im Diesseits, im Allzumenschlichen neue Wurzeln schlagen. Dabei geben jene Ideale ihr Wesen, ihre Substanz an die Realität ab, behalten aber ihren Wert. Die Dinge an sich sind allein für die Welt da – F/M erkennt hier zwischen den Philosophien Nietzsches und Kants eine Verwandtschaft wie zwischen Enkelinnen und Großmüttern (die übersprungene Mutter wäre Schopenhauer).
Bei Kant wird die Realität nur mittelbar vom Ideal belebt, von Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Schopenhauer, erzürnt über solche Dürftigkeit, zerreißt die Verbindung, wirft die Realität weg. Nietzsche wirft die Idealität hinterher – im selben Moment beginnt die Verflüssigung aller Werte. Die historische Methode (Hegel, Darwin, bereits Goethe und Lamarck: Evolution, Geschichte, Entwicklung, Genealogie) hatte alle Wesen ineinander umdeklinierbar gemacht. Mit Nietzsche wird der Wertende selber chaotisch: ein „Experimentator“, für den Wahrheit, Logik, Wissenschaft nur schöpferische Wagnisse sind. Eine solche eigene Ursprünglichkeit war bisher verborgen, verboten, die Wissenschaft pflegte falsche Objektivität: Der Schöpfer ist nicht das Geschöpf.58
Den Ursprung der Moral erkennt Nietzsche in der Angst vor der Realität, vor Leib und Leben. Der Idealismus setzt die Werte ins Jenseits, der Positivismus setzt sie richtig, aber zu kraftlos ins Diesseits. Der „Vampyr des Idealismus“59 saugt alle Dämonie aus dem Leben; Nietzsche gibt sie ihm zurück. Indem er die Moral vermenschlicht, gibt er auch dem Unmoralischen die Unschuld zurück. Er betont die Nachtseite, mildert alle Dualismen, verstärkt aber den Kontrast (Gott/Natur, Moral/Natur, Schuld/Unschuld usw.). Das ‚Menschlich, Allzumenschliche’ bedeutet den Tod Gottes. Mit Schiller unterstreicht F/M: Schuld, Sünde, böses Gewissen sind Angstprodukte; die Gegensätze sind aus einem Stoff.
IV. Morgenröthe. Sokrates, der Typus des theoretischen Menschen (Geburt, Nr. 12-18), die „Fleisch gewordene Logik“, der „dialektische Held im platonischen Drama“, der sich gegen Mystik, Irrationalität, Instinkt wendet, bildet das Gegenstück zu Dionysos. Platon folgte seinem Willen zur Wahrheit und Wissenschaft, dabei zertrennte er das Leben in Diesseits und Jenseits.
F/M trägt eine von Nietzsche infizierte Kant-Kritik vor. Beide sagen der Menschennatur, der grausamsten Bestie: Handle wie du willst, aber möglichst logisch! Doch warum soll ich so handeln? Kant antwortet: um die Natur, den Leib, das Leben zu überwinden, um das Gesetz zu werden. Nietzsche dagegen: um aus Chaos Kosmos zu werden und richtig zu leben. Nietzsche läßt den kategorischen Imperativ beiseite, die „logischste Zuflucht“ des Christentums, sofern dieses die Chiffre ist für jene Zertrennung von Logik und Natur und für die Orientierung an einem Jenseits hinter, über der Welt. Ein „Schalk“ – F/M selber – könnte beide Denker fragen: Warum laßt ihr denn die Möglichkeit außer Acht, den Gegensatz persönlich im leiblichen Leben zu lösen? Der Leib ist unschuldig, neutral; er ist das Reale jener beiden Ideale, welche hier nur Logik, dort nur Natur erlügen; er ist die Stereoskopie jener beiden Flachansichten, „Doppelnatur“ (136).
Der verhängnisvolle Immoralismus von Nietzsches Buch liegt darin, daß hier ein Christ sich gezwungen sieht, „aus tiefster Christlichkeit sein Christentum aufzuheben“. Sobald der Aberglaube der „überlebensgroßen Moralität“ beseitigt ist, wird sich, so F/M, ein „sternartig schwebender“ Zustand einstellen. Das Leben bedarf der Gegensätze; doch polaristisch betrachtet ist ein Extrem das verhüllte andere. Die Logik des Lebens ist nicht die der Schule. Kant übersah die Lebendigkeit der Logik; Nietzsche dagegen hatte keine Furcht vor der Natur.60 Warum legte Kant einen übernatürlichen Maßstab an, die moralische Vernunft? Die Natur hat eigene Gesetze, kann sich selber regulieren: Selbstorganisation statt theologischer Dogmen. Nietzsches Immoralismus zielt nicht gegen die Natur, sondern gegen die „Widernatur“, gegen die Entartung der menschlichen Natur statt ihrer Höherzüchtung. Wie Kant sagt er: Natur ist nicht böse; aber anders als Kant: sie ist gut! Natur ist ein zerrissener Mensch, der Mensch ist Natur. Der Mensch ist der Messende; der beste Mensch der, der am meisten Schlechtes verdauen kann. Der wahre Kapellmeister muß auch mit falschen Tönen, mit der Grausamkeit arbeiten können.
V. Fröhliche Wissenschaft. Erneut legt F/M sein Leitmotiv dar. Logik und Mathematik sind Produkte des Lebens; das mathematisch Unendliche zeigt das kolossalste Leben an. Das Unendliche ist aber gerade nichts Apersonales, sondern Leben in eigener Person. Diese abstrakte Einsicht soll konkret, einverleibt werden, ins Leben, in den Leib hinein. Das Hindernis besteht in der alogischen Moral und Kultur. Nietzsche wagt das „Abenteuer im Unendlichen“: Der Mensch, bloßes Tier eines „Winkelplaneten“, hat gleichwohl den Sinn ∞. Zwar fatalisiert Kant die Humanität, aber er kennt einen „Urverstand“, einen intellectus archetypus, der seine Sinnesempfindungen selbst erschüfe.
Die Schullogik ist „Illogik“, „Petrefakt“, starr, denn sie kennt kein Unendliches, verabscheut das Tertium, den Dreh- und Angelpunkt aller Gegensätze. So versperrt sie den Blick auf die „metamorphosisch proteische“ Identität des Lebens, den Magnetismus, die Magie der Polarität, die Stereoskopie. Nietzsche sprengt die Starrheit auf – das Echo des obigen Satzes („Der Schöpfer ist nicht das Geschöpf“) lautet nun: „Das Geschöpf wurde Schöpfer, der Schöpfer Geschöpf.“ (151) Allerdings identifiziert das Unendliche sich mit sich selber; Gott muß sich selber schaffen.
Hier, in der Mitte des Buches, übt F/M zum ersten Mal Kritik. Nietzsche entschließt sich zur eigenen Unendlichkeit, aber er faßt sie nur halbherzig auf, als eine fremde. Er setzt sich selber nicht a priori