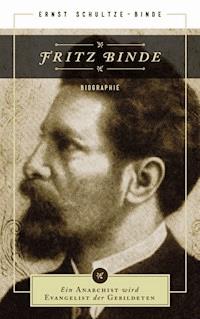
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Linea
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Dagegen hätten auch fünfzig Bebel nicht ankommen können!" Von Fabrikarbeitern mit August Bebel, der Gründerfigur der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, verglichen zu werden hatte Seltenheitswert. Erst recht, da sich der Redner, Fritz Binde (1867-1921), schon wieder von Sozialdemokratie und Sozialismus getrennt hatte. Wer hätte seinen Lebensweg erahnen können? Weder seine idyllische Kindheit in Thüringen, noch seine naturromantische Sehnsucht als wandernder Handwerkergeselle wiesen in die politische Richtung. Doch innerlich ist der Uhrmacher von Unruhe getrieben. Er schließt sich freidenkerischen Kreisen an und hofft, hier seine Ideale vom Guten und Schönen zu verwirklichen. Doch mehr und mehr entwickelt er sich zum kritischen Denker und Zweifler. Dann feiert er Erfolge in der Arbeiterbewegung - als Schriftsteller und Redner. Doch letztlich bleibt er unzufrieden und unerfüllt. Schließlich wird gerade ein persönlicher Zusammenbruch zu einem neuen Anfang: Fritz Binde findet zum Glauben an den verborgenen und doch lebendigen Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Schultze-Binde
Fritz Binde
Ein Anarchist wird Evangelist der Gebildeten
1. Auflage
So spricht der Herr:
Tretet auf die Wege,
seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit,
wo denn der Weg zum Guten sei
und geht ihn!
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
© 2012 Verlag Linea, Bad Wildbad
Umschlaggestaltung: Peter Voth
eBook Herstellung: eWort, Stefan Böhringer (www.ewort.de)
ISBN 978-3-939075-52-3
ISBN 978-3-939075-53-0 eBook (epub)
Vorwort
Fritz Binde (1867–1921) – ein bewegtes Leben in einer von vielen Umbrüchen in Deutschland und ganz Europa geprägten Zeit.
Doch wer hätte seinen Lebensweg vorhersagen können? Die Jugendjahre, Lehr- und Wanderzeit entführen den Leser in eine dörfliche Idylle, Naturromantik und ein beschauliches Handwerker-Dasein des 19. Jahrhunderts. Man spürt etwas von heiler Welt und von einem Leben fern von Zeitdruck, Fabrikarbeit und Untergehen des Einzelnen im anonymen (Groß-)Stadtleben.
Doch der Uhrmacherlehrling wird von innerer Unruhe und Unzufriedenheit umgetrieben. Er gerät in verschiedene politische, freidenkerische und künstlerische Kreise, die ihn prägen und in denen er seine Ideale vom Guten und Schönen verwirklichen will. Mehr und mehr wird er zum Philosophen, Zweifler und Spötter, der dem kritischen Denken unserer Zeit sehr nahesteht.
Als politischer Schriftsteller und Redner in den Anfangsjahren der noch jungen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung feiert er Erfolge und bleibt doch unbefriedigt und ruhelos. Er erlebt viele Enttäuschungen – an den Menschen, die er an seinen hohen Erwartungen misst, und an sich selbst –, bis er nach einer langen inneren Reise wie Augustinus sagen kann: „Meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in Dir!“
Dann nimmt sein Leben eine große Wendung: Fritz Binde findet nach vielen Irr- und Umwegen den „unbekannten Gott“ – und seine Berufung. Von nun an reist er bis an sein Lebensende durch Deutschland und die Schweiz, um einer hoffnungslosen Welt seine neu gefundenen und wirklich lebensverändernden Ideale zu bringen.
Durch zahlreiche Originaldokumente konnte Ernst Schultze-Binde ein authentisches Lebensbild zeichnen. Dem Schweizer Pfarrer standen als Schwiegersohn Bindes dessen schriftliche Jugenderinnerungen zur Verfügung. Fritz Binde selbst hatte sich mit dem Gedanken getragen, in seinem Alter die Geschichte seines bewegten Lebens zu verfassen, und viele seiner Erlebnisse notiert. Neben Erinnerungen, die Schultze-Binde selbst an seinen Schwiegervater hat, lagen ihm Zuschriften von Gästen des „Asyls Rämismühle“ und Briefe der reichen seelsorgerlichen Korrespondenz Fritz Bindes als Grundlage des Lebensbildes vor.
So entstand die Geschichte eines Lebens, wie man sie sich kaum ereignisreicher ausmalen könnte und die von großen Gegensätzen bestimmt war. Der Leser wird hineingenommen in ein Leben, das sich in manchem Äußerlichen stark vom 21. Jahrhundert unterscheidet, und doch von den gleichen grundlegenden Fragen, Zweifeln, Sehnsüchten und Lebenszielen geprägt ist.
Dabei geht es in der Biographie nicht zuerst und allein um die äußerlichen Ereignisse und was Fritz Binde „geleistet“ hat, sondern vor allem um seine innere Entwicklung; das Unverstandensein eines Menschen, der das Gute sucht; das Erleben von zerbrochenen Idealen und enttäuschten Illusionen und den Kampf eines Menschen mit seiner eigenen Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit. Vor allem jedoch zeigt sein Leben, was aus einem Menschen unter der Leitung des göttlichen Geistes werden kann, und wie Gott ein Leben gegen allen Anschein neu machen und verändern und sich der Friede aus der himmlischen Welt in einem Menschenleben auswirken kann.
Im Frühjahr 2012, Verlag Linea
Eine Uhrmacherfamilie
Der Name Binde leitet sich her von dem in der Nähe von Gardelegen in der Mark Brandenburg gelegenen Ort Bünde. Vater, Großvater und Urgroßvater Fritz Bindes waren Uhrmacher gewesen. Besonders gern dachte Fritz Binde an seine Großmutter, eine adlige Dänin, die er zwar nicht mehr persönlich kannte, von der ihm jedoch gesagt wurde, dass sie eine sonderbare Empörerin gegen alles Gewöhnliche gewesen sei. Ein alter Onkel beschrieb sie ihm mit den Worten: „Sie war eine fromme Schöngeistin, die Jung-Stilling, Lavater und empfindungsreiche Gebetbücher zum Entsetzen ihres Mannes las, der ein hitziger Knicker war.“ Das idealistische Erbe der Mutter hatte ihr Sohn Robert, der spätere Oberlehrer und schriftstellerische Philosoph, übernommen, während der Jüngere, Otto, Fritz Bindes Vater, an den Widersprüchen seiner Natur zeitlebens schwer getragen hat. In Otto Binde verband sich die hohe Sehnsucht der Mutter mit der Leidenschaftlichkeit seines Vaters. Das Zusammentreffen dieser Gegensätze machte die Tragik seines Lebens aus. Schon als Junge hatte er abschiedslos sein Elternhaus verlassen. Er sah seine Eltern erst wieder, als die Mutter mit weiß gewordenem Haar auf der Bahre lag. Sein unruhiges Wesen war auch schuld daran, dass er in seinem Beruf als Uhrmacher kein Vorankommen sah. An Klugheit und Tüchtigkeit hat ihn dagegen nicht gleich einer übertroffen. Als er noch ein Kind war, soll ein Metzgermeister zu ihm gesagt haben: „Junge, du bist so klug, dass du vor lauter Klugheit nicht wachsen kannst“, worauf er schlagfertig antwortete: „Na, dann weiß ich auch, Meister G., warum Sie so groß geworden sind.“ Als er für diese Antwort eine Ohrfeige einstecken sollte, machte er dem dicken Fleischermeister eine lange Nase und verschwand um die nächste Ecke.
In seinen Jugenderinnerungen spricht Fritz Binde von dem „edel geformten Gesicht“ und den „hinsinnend leuchtenden Augen“ seines Vaters. Gelegentlich rühmt er auch die schöne Handschrift des Vaters. Hervorragendes leistete Otto Binde als Erzähler. Wenn er einen Kreis von Menschen durch seine Gewandtheit im Erzählen beherrschen konnte, dann war ihm das Seligkeit. Besonders auf seinen Berufsgängen liebte es der ehrgeizige Mann, mit seinem Erzählertalent zu glänzen. Im Nu war seine Ankunft im Dorf bekannt; und wenn die Bauern von Stall und Sense laufen mussten, so kamen sie doch, denn kein Pfaff, kein Schulmeister, kein Oberförster konnte so erzählen wie der Uhrmacher Binde. Oft sagten sie: „Otto, erzähl noch einmal von der Achtundvierziger Revolution, wie du gesehen hast, wie der König von Preußen vor den Demokraten den Hut abnehmen musste.“ „Und, Otto, noch einmal, wie dich der Fürst von Rudolstadt gegrüßt hat, als du als junger Handwerksbursch an seinem Schloss vorbeigekommen bist.“ „Und, Otto, wie war es doch, wie ihr mit der Kuh vor der Kutsche über den Effeldererberg gefahren und umgestürzt seid?“
Mit Worten, Würsten, Schinken und Käsen suchten sie die Ehre zu gewinnen, ihn „Otto“ und „Du“ nennen zu dürfen.
Dann qualmten die Lampen über den Wirtstischen, beißender Tabakrauch umzog in langen, unruhigen Wolken die breit dahockenden Gestalten, unter denen Bindes Vater wie ein König saß. Immer verschwenderischer gab er ihnen Geschichte um Geschichte … Wie ein Feldherr führte er diese Bauernseelen über die Hochgebirge erhabener Begeisterung. Oder er erschütterte sie wie ein Volksredner durch den dröhnenden Ernst gerechter Entrüstung. Wie ein Schauspieler ließ er sie erbeben, indem er sie mit hinabzog in die Tiefen des Wehs, das Menschen erleben müssen, oder er ließ sie sich schütteln vor Lachen.
Wenn sie aber ermüdet, überreizt oder gar angetrunken in ihre Bauernart zurückfielen, wenn sie anfingen ihm dazwischenzureden, oder unter Lachen und Spucken das Erzählte bezweifelten, ja, dann schwieg Vater Binde urplötzlich, stand auf und bezahlte sein Bier.
Als ein Mann von so hoher Begabung konnte Otto Binde in seinem Uhrmacherhandwerk keine volle Befriedigung finden. Oft machte er sich bittere Vorwürfe, dass er in jugendlichem Unverstand seinen Beruf verfehlt und sich dadurch ein verpfuschtes Dasein bereitet habe. Wenn er studiert hätte, meinte er, wäre aus ihm etwas geworden. Doch vielleicht lag der Grund, warum seinem Lebensgang jeder Erfolg und Aufstieg versagt blieb, mehr in seiner persönlichen Eigenart als in der verfehlten Bildung.
Otto Binde war eine Natur, die die klaffendsten Gegensätze unausgeglichen in sich trug. Mit einem zarten Gemütsleben verband er den Sinn für das Geheimnisvolle und Ehrfurchtgebietende. Er sammelte Erinnerungsschätze seiner Familie: von seinem Vater eine Strähne weißgelblicher Haare, eine Hornkrücke mit silbernem Ring, zwei Orden aus den Befreiungskriegen und eine große Pistole. Sodann in einer Messingkapsel eine weiße Locke von seiner Mutter und eine Brotkrume, die er in der Hand seines entschlafenen Söhnleins Otto gefunden hatte.
Auch konnte er sich freuen wie ein Kind, wenn beim Frühlingserwachen die Schwalben kamen oder wenn auf den Wiesen die ersten Gänseblümchen erblühten. Da jubelte er: „Mutter, der Frühling kommt. Nun blüht die Hoffnung wieder.“ Dann träumte er jedes Mal von Lebensmöglichkeiten, die sein verfehltes Dasein doch irgendwie noch zum Grünen bringen könnten. Bis zum Winter aber waren alle seine Hoffnungen zusammengeschrumpft.
Unvergesslich blieben Fritz Binde jene Augenblicke, wo sie von guten Geschäften heimkehrten. Da ließ sich sein Vater auf stillen Bergeshöhen hinnehmen von Sonnenuntergängen, bunten Wolkenspielen, schwarzen Tannenwäldern und von flimmernden Sternennächten. Dann lehnte er sich zärtlich an die Schulter seines Sohnes und fing an mit tränenden Augen zu deklamieren:
„Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.“
„Fritz, Junge“, sagte er dann, „wenn ich einmal nicht mehr bin, denke daran, was du mit deinem Vater hier oben erlebt hast, und habe deine Mutter lieb – deine Mutter ist gut.“
Dieser stimmungsvollen Weichheit der guten Stunden stand aber ein jäh aufbrausendes, zu Willkür und Gewalttat neigendes Gemüt gegenüber. Wegen lächerlicher Kleinigkeiten konnte der Vater das seelische Gleichgewicht und klare Urteil verlieren. Es kam vor, dass er seinen Jungen zum Brotholen schickte, ohne ihm Geld mitzugeben. Wenn Fritz dann zögerte, verprügelte er ihn mit einem Rohrstock. Einmal hatten die Buben mit Bohnenstangen Krieg gespielt. Danach lagen die zersplitterten Stangenenden auf der Straße. Ein solches Holzstück warf einer von ihnen aus Ärger, weil Fritz ihn besiegt hatte, in eine vor dem stehende Kalkmasse. Über und über weiß bespritzt lief Fritz dann heulend heim. Bei diesem Anblick schob sein Vater die Brille auf die Stirn, griff nach dem bekannten Stock, und schlug einfach auf seinen Jungen los, ganz gleich, ob er Kleider, Hände, Kopf oder das Gesicht traf. Zuletzt warf er ihn in den finsteren Vorratsraum hinter der Küche, wo er ihn einschloss.
Am grausigsten in der Erinnerung des Sohnes waren die Gänge, wenn der Vater von schlechten Geschäften mit Fluchen und Toben heimkehrte. Einmal blieb er an einem Kreuzweg mit grässlichem Lachen stehen und höhnte in die nächtliche Finsternis hinein: „Wenn es etwas gibt über den Tod hinaus, das des Lebens und Sterbens wert ist, so mag es sich jetzt melden in drei Teufels Namen.“ Schauerlich dröhnte das Echo. Hohnlachend wankte der Vater weiter und sein Junge folgte ihm mit Grauen.
Otto Binde hatte übrigens seine eigene Religion. „Wenn es irgendetwas Wunderbares in der Welt gibt, so ist es die Zeit. Man steht in ihr, sie liegt hinter uns und zugleich auch vor uns. Sie kommt und zugleich trägt sie uns sich entgegen. Sie flutet über uns hinweg und reißt einen doch nicht rückwärts, sondern vorwärts. Man schreitet mit ihr fort und doch macht sie einen alt. Sonderbar, sonderbar! Ich habe die größte Achtung vor der Zeit. Sie enthält alles. Sie bringt alles. Sie verschlingt alles. Weiß der Teufel, wo sie es hernimmt und hinbringt. Darum ist das Geheimnisvollste und Grauenhafteste im Leben die Sekunde. Das sage ich als Uhrmacher. Und wenn es einen Gott gibt, so kann er nirgends stecken als in diesen unheimlich heranschleichenden Sekunden, die uns mit heuchlerischem Wahn nahen, um uns nachher mit allem Furchtbaren zu überfallen, das sie heranschleppen und auf uns wälzen, bis wir erdrückt von ihrer Last ins Grab sinken. Nichts Furchtbareres gibt es als das Kommende. Das ist Gott. Nichts Erdrückenderes gibt es als das, was hinter uns liegt, denn es ist der Inhalt unseres Lebens. Entsetzlich, diese Umformung der heranstürmenden, flüchtigen, geisterhaften Sekunden in den unveränderlichen, bleiernen Inhalten unseres Lebens. Das Entsetzlichste ist, das Gewordene, das Vergangene kommt wieder und steht gegen uns auf. Das Vergangene als das letzte Zukünftige – es ist zum Wahnsinnigwerden – das ist Gottes Gericht.“
Das war Otto Bindes Neujahrspredigt. Darum ging er nur ein Mal im Jahr zur Kirche, nämlich am Silvesterabend. Die Predigt des Pfarrers verachtete er, aber er brauchte die feierliche Stätte, die festlichen Menschen, die Orgelklänge und die flackernd herabbrennenden Kerzen, um sich durch seine eigene Predigt aufs Wirksamste zu berauschen.
Im Übrigen war ihm die Kirche gerade gut genug, um als Zielscheibe seines Spottes zu dienen. Es bereitete ihm das größte Vergnügen, wenn sein kleiner Fritz zu Hause mit schauspielerischer Gewandtheit den Herrn „Suppedenten“ auf der Kanzel nachahmte. Für dieses Schauspiel bezahlte er gern zwei Pfennige und sagte dabei wohlgefällig zur Mutter: „Das hat er nun doch von mir, den Pfaffenschwindel gebührend zu durchschauen, das ist allezeit mein Geschäft gewesen.“
Einmal, es war bei einer häuslichen Tauffeier, hörte Fritz seinen Vater zum ersten Mal über Jesus Christus reden. „An einen Gott glaube ich auch“, sagte er zum Pfarrer. „Doch wie schon Goethe sagt, ist Name Schall und Rauch und umnebelt die Himmelsglut. Aber Jesus Christus quasi als Vizegott, als himmlischen Feldwebel, durch dessen Blut wir allein Vergebung der Sünden und Zugang zu Gott haben sollen, lehne ich ab.“
Später, als Fritz den Konfirmandenunterricht besuchte, und sich bemühte, die langen Sätze des Paulus im Römerbrief auswendig zu lernen, indem er immer lauter vor sich hin sprach, hörte er auf einmal seinen Vater von der Schlafkammer herüberrufen: „Unsinn, Unsinn, Unsinn. Maul halten. Will nichts mehr hören von dem sinnlosen Pfaffenzeug.“ Diese Auslegung seines Vaters des Römerbriefes 2, 14–16 gehörte zu den wenigen Erinnerungen, die Fritz Binde aus der Konfirmationszeit ins Leben mitnahm.
Dieser Mann nun, der sich in Gesellschaft als Freigeist gebärdete und die Wahrheit der Bibel verächtlich abtat, war im Grunde ein Sklave des lächerlichsten Aberglaubens. Einmal musste die Familie eine andere Wohnung beziehen. Schon wollte man die ersten Körbe voll Hausrat die Treppe hinuntertragen, da rief der Vater: „Halt, hierbleiben. Alles wieder auspacken. Zuerst die Bibel in einen Korb!“
Eilig holte Fritz aus Mutters Nachtschrank die elterliche Traubibel herbei.
Diese legte dann der Vater eigenhändig auf den Boden des Korbes.
„So, nun das Brot“, befahl er weiter und legte dann den Rest seines Brotes auf die schwarze Bibel.
„Jetzt noch das Salz.“ Nun stand auch das weiße Porzellansalzfass auf der schwarzen Bibel.
„So, dieser Korb kommt als Erstes in die neue Wohnung, damit es Glück gibt. Verstanden?“
„Warum tut das der Vater?“, fragte Fritz die Mutter auf der Treppe.
„Das ist sein Aberglaube“, war die Antwort.
Beim darüber Nachdenken erriet Fritz einen Zusammenhang.
„Warum macht er denn immer drei Kreuze mit dem Messer auf den Rücken eines neuen Brotlaibes, bevor er ihn anschneidet?“, forschte Fritz weiter, „und warum spuckt er immer drei Mal auf das erste Geld, das er am Sonntagmorgen einnimmt? Und warum kehrt er immer um, wenn ihm beim Weggehen zuerst eine alte Frau begegnet?“
„Das ist alles sein Aberglaube“, wiederholte die Mutter.
„Aber Mutterle, warum liest er denn nicht in der Bibel, wenn doch die Bibel Glück bringt?“
Die Kinderweisheit hatte wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Mutter war um eine Antwort verlegen. Das war eben der Widerspruch an dem Otto Binde zeitlebens krankte, dass er zwar die fromme Scheu vor den Hintergründen des Daseins nicht loswerden konnte, aber doch jede wirkliche Begegnung mit dem lebendigen Gott, der sich in der Bibel kundtut, fürchtete.
Fritz Bindes Mutter, eine geborene Langbein, stammte aus einer ehrenwerten, thüringischen Handwerkerfamilie. Durch ihre Heirat mit dem ungewöhnlichen und widerspruchsvollen Uhrmacher war ihr eine nicht leichte Aufgabe zugefallen. Doch ihr stilles, sanftes, friedliebendes Wesen war dazu geeignet, den unruhigen Mann immer wieder zu besänftigen und ihm sein Heim lieb zu machen. Ihrer praktischen Hausfrauenklugheit war es wohl zu verdanken, dass die Familie in Ehren durchkommen konnte.
Doch auch ihre Kraft reichte nicht aus, um ihren Mann auf eine andere Bahn zu bringen. Ihre Stärke lag im Nachgeben, im Bewahren, nicht aber in einem zielbewussten Umgestalten. Ihre Frömmigkeit bewegte sich in herkömmlichen Gleisen. Sie glaubte an das Dasein eines lieben Gottes, der den Menschen alles zum Besten wendet. Sie las nach altem Brauch im Gebetbuch und lehrte auch die Kinder beten. Ihr Glaube war jedoch nicht ein persönlich erlebtes Christentum, das im Vertrauen auf die sieghafte Kraft des Evangeliums an der Umformung der Familie arbeitet. Sie hatte auch nicht den Trieb, das Wort Gottes regelmäßig zu hören und Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Deshalb konnte sie wohl das Schlimmste verhüten, war aber ganz unfähig, das Familienleben in christlichem Sinn zu gestalten. Kein Wunder, dass ihr Sohn sie als arm und schwach in Erinnerung hatte.
Mit ihrem Mann teilte sie übrigens auch den Hang zum Aberglauben. Als ihr ein Söhnlein gestorben war, holte sie sich bei der Wahrsagerin den Bescheid, dass sie noch mehr Kinder bekommen werde, aber nur zwei behalten. Wie ein dunkles Verhängnis lastete dieser Spruch über ihrem Haus. Und es kam leider so, dass von den sieben Kindern, die sie zur Welt brachte, nur zwei am Leben blieben. – Beim letzten Wohnungswechsel, den sie mit ihrem Mann erlebte, war es ihr eine böse Vorahnung, als ein schwarzer Vogel in der Ecke des Schlafzimmers, wohin das Bett des Vaters zu stehen kam, hin und her flatterte. Einige Jahre später ist dieser auch tatsächlich in jener Ecke nach einem Hirnschlag gestorben.
Eine besondere Gabe dieser Mutter war das Zeichnen und Malen, worauf sie sich meisterhaft verstand. Im Übrigen hatte sie alle Eigenschaften einer tüchtigen Hausfrau. Sie war fleißig, sparsam, reinlich und liebte die Ordnung. Mit ihrer unbegrenzten Fähigkeit zum Schweigen und Dulden war sie die rechte Frau für ihren ungestümen, von seiner inneren Unruhe gepeitschten Mann.
In Coburg, einer der Hauptstädte Thüringens, hatte Otto Binde in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sein erstes Geschäft eingerichtet. Dort gründete er auch seine Familie, in welcher ihm als viertes Kind am 30. Mai 1867 das Söhnchen Fritz geschenkt wurde.
Der junge Fritz
Kinderaugen tragen
Unversehrtes, heil’ges Himmelslicht,
Kinderlippen fragen,
Und das morsche Holz der Lüge bricht,
Kinderherzen klagen – :
Eltern, das bedeutet ernst’ Gericht.
F. Binde
„Das größte Wunder, das es in der Welt gibt, ist, dass du überhaupt lebst“, erklärte die Mutter einmal ihrem geschichtenhungrigen Jungen. Fritz Binde war nämlich ein Siebenmonatskind. Er kam in einem Gasthof in der Nähe von Heldburg zur Welt, als die Eltern auf einer Reise waren. Nicht einmal Fingernägel soll er gehabt haben und der Arzt glaubte nicht, dass das schwächliche Kind den zweiten Tag überleben werde. Dennoch gedieh das Kind unter der sorgfältigen Pflege seiner Mutter sowie der Aufsicht Gottes und überlebte alle seine Geschwister.
Als Fritz zirka vier Jahre alt war, verließen die Eltern Coburg, wo der Vater das Geschäft nicht mehr halten konnte, und zogen in das thüringische Städtchen Neustadt um. Hier, in diesem Kleinstädtchen und im trauten Umgang mit einer an malerischen Bildern so reichen Natur, erlebte Fritz Binde seine Kindheit.
Früh schon zeigte der junge Fritz auffallende geistige Gaben. Er war noch nicht schulpflichtig, als er zur Verwunderung der Nachbarn einige Gläser kunstgerecht abzeichnete. Seiner älteren Schwester Berta lauschte er gereimte Verse ab, um sie vor Hühnern und Katzen und vor sich selbst aufzusagen. „Das hat das Fritzle nun doch von seinem gescheiten Vater“, erklärte die Hausbesitzerin bestimmt. „Nein, das habe ich von mir selbst“, antwortete der Kleine in kindlichem Trotz und erwachendem Selbstgefühl.
Als Fritz zur Schule kam, konnte er kaum warten, Lesen und Schreiben zu lernen. Auch sonst hoffte er, viel Wunderbares in der Schule zu hören, besonders vom „lieben Gott“. Er wurde darin jedoch enttäuscht. Der Lehrer war wie sein Vater ein jähzorniger Mensch, der schon am ersten Schultag einen Jungen verprügelte. In der Menge der Schüler fühlte sich Fritz eingeengt und unverstanden und der Schleier über dem Gottesgeheimnis enthüllte sich ihm auch nicht. Der Schulbetrieb blieb ihm immer etwas Fremdes und hatte keinen tieferen Einfluss auf sein Innenleben, obgleich er zu den begabtesten Schülern zählte.
Umso mehr wandte sich sein Kinderherz zum Spielen und der Natur zu. Im Schreibtisch seines Vaters war eine Schublade ganz mit seinen Spielsachen gefüllt – das war sein Paradies. Stundenlang konnte er sich hier vergnügen mit Zinnsoldaten und Kinderpistolen, mit Bilderbogen und Zeichenheften, worin er seine kindliche Malkunst übte. Was sonst noch sein Bubenherz erfreute, waren Glaskugeln, Steine, tote Käfer, Schmetterlinge und getrocknete Blätter und Blumen. Wenn er dann die Schätze seines Paradieses immer wieder neu ordnete, wenn er Neues und Altes sinnvoll zusammenstellte, war er ganz in seinem Element. Und doch wurde ihm der Schein der Lust manchmal zu einer Qual, weil ihn keine Zusammenstellung auf Dauer befriedigte. Auch später, als er Mann wurde, ging es ihm nicht anders als dem Kind: kein irdisches Paradies und keine menschliche Ordnung konnte seinem Vollkommenheitstrieb genügen. Er begriff nach und nach, dass, wer den unbekannten Gott suchen und finden will, dem muss jeder Schein der Lust zuvor zu einer Qual werden.
Neben den Spielen war es vor allem die Natur, die den sinnigen Jungen fesselte. Da lag er bei blinkendem Sonnenschein mit der Brust im weichen Gras. Die nackten Füße hämmerten in die Luft. Die Lippen sogen an einem Blumenstengel. Die Augen aber beobachteten einen Käfer, wie der bis zur Spitze eines Grashalms hinauf- und oben in der grünen, schwankenden Höhe umkehrend wieder hinab- und dann ebenso auf einen anderen Halm kletterte. Dazwischen hielt er inne, lüftete die sonnenbeschienenen Flügelchen ein wenig, als wollte er schnurstracks auf und davon fliegen. Stattdessen marschierte er jedoch wieder tapfer weiter, halmauf und halmab. „Du lieber Käfer“, redete Fritz ihn an, „warum krabbelst du denn so mühsam hinauf und hinab? Was hast du davon?“ Und er meinte die Antwort des Käfers zu hören:
„So hat es mich der liebe Gott gelehrt, und deshalb bleibe ich dabei und bin fröhlich.“
Er schaute die Blumen an, ihre vielfältigen Formen und Farben, ihren wunderbaren Bau und den zarten Stoff, aus dem sie gemacht sind. „Oh, ihr Blumen“, redete er sie an, „wie seid ihr prächtig und sinnig. Wie habe ich euch so lieb.“ Und neigte sein Gesicht innig kameradschaftlich zu ihnen herab, küsste sie auf ihre bunten zarten Wangen und streichelte mit seligen Fingern ihr zartes Leben.
Danach, als sein Gesicht die Zierde am Boden begrüßt hatte, dachte er an den hohen blauen Himmel, der alles überwölbt, und schaute auf das reichbewegte Spiel der schnell vorüberziehenden Wolken. Das alles war ihm wie ein Gruß vom lieben Gott, der ihm durch seine Schöpfung bekannter wurde, und dem sein Herz dankbarer entgegenschlug.
Erlebte er im Umgang mit der Natur viel Freude, so galt das nicht in gleicher Weise von den Menschen, mit denen ihn sein Weg zusammenführte. Der junge Fritz hatte ein ausgeprägtes Empfinden für das Rechte und Wahre. Nichts berührte ihn schmerzlicher, als wenn er Menschen, zu denen er mit Ehrfurcht emporgeschaut hatte, von der vermeintlichen Wahrheit abirren sah.
Einst schob er in der Schule einem Proletarierjungen einen Zettel zu, auf den er folgendes gekritzelt hatte: „Ist es wahr, dass dein Vater Sozialdemokrat ist? Und was ist das?“ Der Gefragte schickte den Zettel zurück mit der vielsagenden Antwort: „Ein Sozialdemokrat ist, wer Gerechtigkeit in der Welt schaffen will.“ Das imponierte Fritz sehr und er nahm sich vor, den Vater des Jungen einmal über das Nähere zu befragen. Doch ehe es dazu kam, sah er den einmal betrunken auf einer Brücke, wie er zum Wasser redete. Hier erfuhr er dieselbe Enttäuschung, die er in seinen Mannesjahren nochmal in viel gewaltigerem Ausmaß erleben sollte.
Je näher ihm die Menschen standen, desto mehr litt er darunter, wenn von dem Idealbild, das er von ihnen im Herzen trug, Abstriche gemacht werden mussten. So war er gewohnt, in seiner Mutter den Inbegriff alles Guten und Wahren zu sehen, bis ihm auch dieser Glaube einmal in die Brüche ging. Es war kurz vor Weihnachten und die Mutter erzählte ihm vom Christkind, das mit goldenen Flügeln vom Himmel komme, um den Weihnachtsbaum und Geschenke in die Häuser zu tragen. „Du darfst aber nicht gucken, Christkind kratzt dir sonst die Augen aus“, sagte die Mutter zu ihm, als sie den Jungen früh ins Bett brachte. Fritz wollte aber wenigstens einen Strahl der Herrlichkeit des Christkinds auffangen. Da er von seinem Fenster aus in die Wohnstube sehen konnte, schob er sachte den Vorhang zurück und bedeckte zugleich mit seinen Händen die Augen. Da sah er Mutter und Berta um den Tisch sitzen, als sie sich mit dem Versilbern und Vergolden der Nüsse beschäftigten. Aber wo saß denn das Christkind? Er gab sich alle Mühe, besser sehen zu können, und sah doch nichts. „Gelogen, gelogen, Mutterle hat gelogen“, kam es bitter von seinen Lippen, und er warf sich weinend in die Kissen. Nicht das war ihm das Schwerste, dass er sich vergeblich auf das Christkind gefreut hatte, sondern dass es nun kein zuverlässiges Mutterwort mehr für ihn gab. Manches andere Kind hätte bei einer solchen Lüge nichts Arges gefunden. Doch zeugt es für die sittliche Natur des jungen Fritz, dass sich dieses kleine Erlebnis so tief in seine kindliche Seele eingrub.
Eine Reihe von Jahren waren seit diesem Erlebnis vergangen und der junge Fritz stand in seinem schönsten Knabenalter. Eben fing er an, sich für Vaters Bücher zu interessieren. Er hatte einen Band Schiller-Dramen aufgegabelt, den er mit zunehmender Begeisterung las. Der Vater aber gab ihm eine Ohrfeige und hat ihn gescholten: „Wenn etwas die Menschen unglücklich macht, so sind es Bücher! Merk dir das!“ Aber das hielt ihn nicht von der verbotenen Lektüre ab. Seitdem er Schillers „Räuber“ gelesen hatte, glaubte er an die Existenz „erhabener Menschen“. Eine böhmische Schauspielertruppe, die gerade im Städtchen gastierte, konnte ihn zwar in dieser Überzeugung kaum bestärken, da sie einen üblen Ruf hinterließ, aber Fritz verzweifelte nicht, sondern gründete eine eigene kleine Theatergesellschaft.
Hatte er bisher keinen „erhabenen Menschen“ gefunden, so wollte er jetzt selbst auf eigene Faust einer werden; die anderen würden ihm dann schon folgen.
Auf Bierbrauer Schindhelms Hopfenboden richteten sie eine Bühne auf, zu der Fritz selbst die Dekorationen gemalt hatte. In von ihm gekürzter Form studierten sie Schillers Räuber ein. Nun konnte Fritz selbst als Karl Moor wie ein Held denken, reden und handeln. Überrascht davon, wie leicht ihm das gelang, war er völlig von sich befriedigt. Das Dasein eines „erhabenen Menschen“ schien ihm gesichert. Auch schienen ihm die andern, von ihm hingerissen, zu allem bereit zu sein. So geschah es, dass Schüler und Kinder ihnen zusahen und zuhörten mit vor Erstaunen erstarrten Gesichtern. Selbst die Erwachsenen weinten Tränen der Rührung. Fritz aber wähnte sich ins Göttliche aufgestiegen.
Als sie den „Fiesko“ einstudieren wollten, bekam Fritz ein Brieflein von einem Mädchen, das im Theater mitspielte und das er hatte küssen müssen. Sie schrieb: „Ich muss Dir mitteilen, dass ich Dich gern mag. Du hast mich ja auch viel zu richtig geküsst.“
Mit geschlossenen Lippen und kleinen, müden Augen saß er, den zerknitterten Zettel in der Faust, auf dem Holzboden. In jenen Stunden erlebte er die erste tiefergreifende Enttäuschung am Menschen und die erste gefährlich-herbe Süßigkeit des Entschlusses, ein Einsamer zu werden. Keiner sollte ihn mehr lachen sehen. Verstummen wollte er vor allen Menschen, ja verachten und meiden wollte er sie. Mit dem Ernst eines „erhabenen Menschen“ würde er sich ihrem Lob und ihrem Spott überlegen erweisen, und sollte er dabei in der Einsamkeit zugrunde gehen.
Fritz stieg vom Holzboden herab und da stand Frau Ehrhard vor ihm. „Ei, das Fritzle!“, rief sie händeklatschend. „Ja, darf man denn überhaupt noch Fritzle sagen? Du bist ja jetzt ein großer Schauspieler geworden! Was mag aus dir noch werden? Das steckt nun einmal von deinem Vater her in dir! Ha, komm doch, wir haben frische Butter gemacht, da muss ich dir doch einen Butterwecken schmieren, weil du halt gar so schön reden kannst! Komm nur!“
Und der Fritz vergaß sich, und folgte ihr selig lächelnd in die liebe Stube und biss da mit Behagen in das dickgestrichene goldgelbe Butterbrot.
Danach erlebte er zum ersten Mal etwas von der wehesten und heilsamsten Enttäuschung, die es im Leben gibt, nämlich von der Enttäuschung an sich selbst. Wie oft hat er die noch erleben müssen, ehe er es ganz begriff, dass ohne diese weheste Enttäuschung wohl niemand den unbekannten Gott zu finden vermag!
Seit diesem Erlebnis fühlte Fritz, wie nie zuvor, seine innere Armut und Hilfsbedürftigkeit. Aber wer konnte ihm helfen oder ihn zumindest verstehen? Seinen Vater fürchtete er, seiner Mutter traute er keine helfende Kraft zu und mit den Menschen seiner Umgebung hatte er bisher nur Enttäuschungen erlebt. Seinen stolzen Glauben an sich selbst hatte er gleichfalls verloren. Doch sein Herz brannte vor Sehnsucht nach etwas Großem, Gutem, Erhabenem, das er eigentlich immer gesucht, bisher aber nur ungenügend gefunden hatte. Im tiefsten Grund war es ja der Hunger nach Gott, nach dem lebendigen Gott, der so in seiner Jungenseele eine immer deutlichere Gestalt gewann.
Einer seiner Lehrer scheint das innere Werden und Ringen in der Seele des Jungen bemerkt zu haben. Einst begegneten sie sich vor dem Haus des Lehrers, worauf dieser teilnehmend fragte: „Nun, mein lieber Fritz, was willst du denn eigentlich werden?“ Ganz hingenommen von der Liebe, die ihm im Wort und Blick des Lehrers entgegentrat, wusste er zuerst nicht, was antworten. Soldat hatte er einmal werden wollen, dann Sozialdemokrat, dann Maler, dann Schauspieler und zuletzt Menschenfeind. In diesem Augenblick aber, wo sein Lehrer als Seelsorger ihn so ernsthaft und liebevoll nach seinem Lebenslauf fragte, war es ihm klar, das alles wäre als Inhalt seines ganzen Lebens zu wenig gewesen. „Ein Christ“, wollte er fröhlich ausrufen, aber da schämte er sich der Antwort, weil das Christwerden ja kein Beruf war. „Pfarrer“, glaubte er dem Lehrer zuliebe sagen zu müssen, aber das wäre ja gelogen gewesen. So antwortete er einfach: „Lehrer“. Der Herr Lehrer hatte wohl etwas von der Unsicherheit in der Antwort seines Schülers bemerkt. Er sagte aber mit zarter Stimme, in der das Verstehen der Liebe lag: „Nun, was du auch werden magst, Fritz – ich weiß, du suchst den lieben Gott und du wirst ihn auch finden. Er selbst wird dich zu sich leiten. Adieu, mein Junge.“ Beschämt und verlegen nahm Fritz Abschied, denn der Lehrer hatte sein Innerstes entdeckt, in das bisher niemand hineingeschaut hatte. Zugleich freute er sich aber innig, hatte er doch einen Menschen gefunden, der ihn wirklich verstand und der ihm raten und helfen konnte, den unbekannten Gott zu finden und ein Christ zu werden. Leider ging diese Hoffnung nicht mehr in Erfüllung denn kurz nach diesem Gespräch erkrankte der treue Lehrer an der Schwindsucht und starb bald. So kam sich Fritz aufs Neue verlassen und hilfsbedürftig vor wie einer, der seinen besten Freund verloren hatte.





























