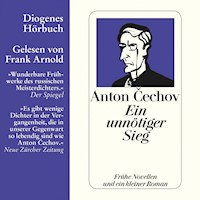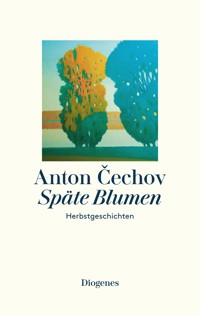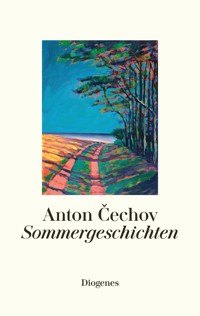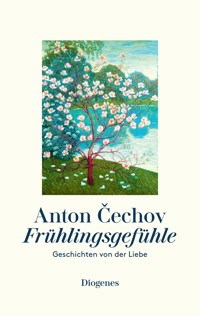
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Am liebsten erinnern sich die Frauen an die Männer, mit denen sie lachen konnten.« So Anton Cechov, der die Frauen und die Liebe kannte wie kein anderer. Voller Witz und ohne Illusionen verewigt er eines der facettenreichsten Gefühle. Rendezvous, Seufzeralleen und Küssereien sind ebenso vertreten wie leise Sehnsucht, verflogener Zauber, vertagte Geständnisse und gute Partien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anton Čechov
Frühlingsgefühle
Geschichten von der Liebe
Aus dem Russischen von Peter Urban und Beate Rausch
Ausgewählt von Christine Stemmermann
Diogenes
Meine »Sie«
Sie wurde, wie meine Eltern und Vorgesetzten glaubhaft versichern, vor mir geboren. Ob sie damit recht haben oder nicht, ich weiß lediglich, daß ich mich keines Tages in meinem Leben entsinne, an dem ich nicht ihr gehört und nicht ihre Macht über mich verspürt hätte. Sie läßt mich weder tags noch nachts allein; ich erhebe auch keinen Anspruch, sie zu verlassen – also eine starke, eine feste Bindung … Aber beneiden Sie mich nicht, jugendliche Leserin! … Diese rührende Bindung bringt mir nichts als Unglück. Erstens läßt mich meine »Sie«, da sie mich weder tags noch nachts allein läßt, nicht arbeiten. Sie hindert mich am Lesen, am Schreiben, am Bummeln, am Genießen der Natur … Ich schreibe diese Zeilen, und sie stößt mich gegen den Ellbogen und lockt mich jede Sekunde, wie die alte Kleopatra den nicht minder alten Antonius, zum Bett hinüber. Zweitens ruiniert sie mich wie eine französische Kokotte. Der Bindung an sie habe ich alles geopfert: Karriere, Ruhm, Komfort … Dank ihrer Gnade gehe ich ärmlich gekleidet, wohne in einem billigen Zimmer, ernähre mich miserabel, schreibe mit dünner Tinte. Alles, alles verschlingt sie, unersättlich! Ich hasse, verachte sie … Ich hätte mich längst von ihr scheiden lassen sollen, habe mich aber bisher nicht scheiden lassen, weil die Moskauer Anwälte für eine Scheidung viertausend verlangen … Kinder haben wir noch keine … Wollen Sie ihren Namen wissen? Bitte sehr … Er ist poetisch und erinnert an Flaum, Faulbaum, laue Luft …
Sie heißt – Faulheit.
Zelënaja Kosa
Kleiner Roman
I
Am Ufer des Schwarzen Meeres, an einem Fleckchen, das in meinem Tagebuch und in den Tagebüchern meiner Helden und Heldinnen »Zelënaja Kosa« heißt, steht eine wunderschöne Villa. Aus der Sicht des Architekten, der Liebhaber alles Strengen, Gesetzmäßigen, Stilvollen mag diese Villa nirgendwohin passen, aus der Sicht des Poeten, des Künstlers dagegen ist sie einfach wunderschön. Sie gefällt mir in ihrer bescheidenen Schönheit, darin, daß sie weder die Kälte von Marmor verströmt noch die Gewichtigkeit von Säulen. Sie blickt einladend, warm, romantisch drein … Hinter schlanken Silberpappeln blickt sie mit ihren Türmchen, Spitzen, Zacken, Säulchen irgendwie mittelalterlich hervor. Wenn ich sie anschaue, denke ich an sentimentale deutsche Romane mit ihren Rittern, Schlössern, Doctores der Philosophie, geheimnisvollen Gräfinnen … Diese Villa steht auf einem Berg; rings um die Villa ist ein dichter-dichter Garten mit Alleen, kleinen Springbrunnen, Orangerien, und unten, unterhalb des Berges – das rauhe blaue Meer … Eine Luft, in der beständig ein leichter, feuchter, koketter Wind weht, alle möglichen Vogelstimmen, der ewig klare Himmel, das durchsichtige Wasser – ein wunderschönes Fleckchen!
Die Besitzerin der Villa, Marja Egorovna Mikšadze, ist die Ehefrau eines kleinen georgischen oder tscherkessischen Fürsten, eine Dame um die 50, groß, füllig, und war zu ihrer Zeit zweifelsohne als Schönheit berühmt. Sie ist eine gutherzige, liebe, gastfreundliche, aber etwas zu strenge Dame. Übrigens nicht streng, sondern launisch … Sie gab uns ausgezeichnet zu essen, vorzüglich zu trinken, lieh uns aus vollen Händen Geld und quälte uns gleichzeitig furchtbar. Die Etikette ist ihr Steckenpferd. Daß sie Ehefrau eines Fürsten ist – ist ihr anderes Steckenpferd. Auf diesen beiden Steckenpferden reitend, übertreibt sie ewig und furchtbar. Sie lächelt zum Beispiel nie, wahrscheinlich deshalb, weil sie das für sich und überhaupt für grandes-dames für unschicklich hält. Wer auch nur um ein Jahr jünger ist als sie, ist ein Milchbart. Angesehen zu sein ist ihrer Meinung nach eine Tugend, der gegenüber alles übrige der unsinnigste Blödsinn ist. Sie ist eine Feindin von Unbesonnenheit und Leichtsinn, liebt das Schweigen usw. usw. Manchmal konnten wir diese Herrin kaum ertragen. Wäre ihre Tochter nicht gewesen, so würden wir heute die Erinnerungen an Zelënaja Kosa kaum genießen. Die gute Frau ist in unseren Erinnerungen der graueste Fleck. Die Zierde von Zelënaja Kosa ist – Marja Egorovnas Tochter, Olja. Olja ist ein kleines, schlankes, hübsches Blondinchen von 19 Jahren. Sie ist lebhaft und nicht dumm. Sie zeichnet schön, befaßt sich mit Botanik, spricht ausgezeichnet Französisch, schlecht Deutsch, liest viel und tanzt wie Terpsichore persönlich. Musik hat sie am Konservatorium studiert und spielt nicht übel. Wir Männer liebten dieses blauäugige Mädchen, wir waren nicht »verliebt«, sondern liebten es. Sie war für uns alle etwas Vertrautes, zu uns Gehörendes … Zelënaja Kosa ohne sie wäre für uns undenkbar. Ohne sie wäre die Poesie von Zelënaja Kosa unvollständig gewesen. Sie ist die hübsche weibliche Gestalt in wunderschöner Landschaft, und ich mag keine Bilder ohne menschliche Gestalten. Das Plätschern des Meeres und das Flüstern der Bäume sind an und für sich schön, aber wenn sich damit, zur Begleitung unserer Bässe, Tenöre und des Flügels, noch Oljas Sopran vereinigt, dann werden Meer und Garten zum Paradies auf Erden … Wir liebten die Prinzessin; anders konnte es gar nicht sein. Wir nannten sie die Tochter unseres Regiments. Und Olja liebte uns. Es zog sie zu unserer Männergesellschaft hin, und nur unter uns fühlte sie sich in ihrem Element. Wenn wir nicht in ihrer Nähe waren, magerte sie ab und hörte auf zu singen. Unsere Gesellschaft besteht aus Gästen, sommerlichen Bewohnern von Zelënaja Kosa und Nachbarn. Zu ersteren gehören: Doktor Jakovnin, der Odessaer Zeitungsmann Muchin, der Magister der Physik Fivejskij (inzwischen Dozent), drei Studenten, der Maler Čechov, ein Baron und Jurist aus Charkov und ich, Oljas ehemaliger Repetitor (der ihr beigebracht hat, schlecht Deutsch zu sprechen und Stieglitzküken zu fangen). Wir trafen uns jedes Jahr im Mai in Zelënaja Kosa und belegten für den ganzen Sommer die überzähligen Räume des mittelalterlichen Schlosses und alle Nebengebäude. Jeden März luden uns nach Zelënaja Kosa zwei Briefe ein: ein bedeutungsvoller, strenger, voller Ermahnungen – von der Fürstin, ein anderer sehr langer, heiterer, voll mit allen möglichen Plänen – von der sich nach uns sehnenden Prinzessin. Wir kamen und blieben bis September zu Gast. Die Nachbarn, die täglich zu uns kamen, waren der verabschiedete Leutnant der Artillerie Egorov, ein junger Mann, der zweimal das Examen zur Akademie abgelegt hatte und zweimal durchgefallen war, ein sehr gebildeter, belesener Mensch; der Medizinstudent Korobov mit seiner Ehefrau Ekaterina Ivanovna, der Gutsbesitzer Aleutov und eine Unmenge von Gutsbesitzern, Verabschiedeten, Nichtverabschiedeten, Lustigen und Langweiligen, Faulenzern und Herumtreibern … Die ganze Bande aß, trank, spielte, sang, brannte Feuerwerk ab, riß Witze ohne Ende, Tag und Nacht, den ganzen Sommer hindurch … Olja liebte diese Bande besinnungslos. Lauter als alle schrie sie, wirbelte umher und lärmte. Sie war die Seele der Kompanie.
Jeden Abend versammelte uns die Fürstin im Salon und warf uns mit purpurrotem Gesicht »gewissenloses« Benehmen vor, beschämte uns und schwor, dank unseren Bemühungen Kopfschmerzen zu haben. Sie liebte es, uns zu ermahnen; sie tat dies aufrichtig und war zutiefst davon überzeugt, daß uns ihre Ermahnungen zum Nutzen gereichten. Am meisten bekam Olja von ihr ab. Ihrer Meinung nach war an allem Olja schuld. Olja füchtete die Mutter. Sie vergötterte sie und lauschte ihren Ermahnungen stehend, schweigend, errötet. Die Fürstin hielt Olja für ein kleines Kind. Sie stellte sie in die Ecke, ließ sie ohne Frühstück, ohne Mittagessen stehen. Olja in Schutz zu nehmen bedeutete, Öl ins Feuer zu gießen. Wäre es ihr möglich gewesen, sie hätte auch uns in die Ecke gestellt. Sie schickte uns zur Abendmesse, befahl uns, die »Leben der Heiligen« vorzulesen, kontrollierte unsere Wäsche, mischte sich in unsere Angelegenheiten … Immer wieder hatten wir ihre Schere verschleppt, vergessen, wo ihr Riechfläschchen stand, konnten ihren Fingerhut nicht finden.
– Schlafmütze! – rief sie immer wieder. – Hast es im Vorbeigehen runtergeworfen und hebst es nicht auf! Hebs auf! Heb es sofort auf! Gestraft hat mich der Herrgott mit euch … Laß mich in Frieden! Steh nicht im Durchzug!
Manchmal läßt sich einer von uns zum Spaß etwas zuschulden kommen und wird zum Rapport zu der Alten gerufen.
– Warst du das, der auf die Rabatte getreten ist? – beginnt die Gerichtsverhandlung. – Wie konntest du es wagen?
– Es war aus Versehen …
– Schweig! Wie konntest du es wagen, frage ich dich?
Die Gerichtsverhandlung endete immer mit Begnadigung, mit Handküssen und, nach Verlassen der Gerichtsstube, mit homerischem Gelächter. Liebevoll war die Fürstin zu uns nie. Liebevolle Worte sagt sie nur zu alten Frauen und kleinen Kindern.
Ich habe sie nicht ein einziges Mal lächeln sehen. Dem alten General, der an Sonntagen zu ihr gefahren kam, um Piquet zu spielen, versicherte sie flüsternd, daß wir, Doktoren, Magister, teilweise Barone, Maler, Schriftsteller, ohne ihren Verstand und Beistand verloren wären … Wir gaben uns auch keine Mühe, sie eines Besseren zu belehren … Lassen wir ihr doch ihren Spaß, dachten wir … Die Fürstin wäre erträglich gewesen, wenn sie nicht von uns verlangt hätte, spätestens um acht Uhr aufzustehen und spätestens um 12 schlafen zu gehen. Die arme Olja legte sich um 11 Uhr schlafen. An Widerspruch war nicht zu denken. Aber wir machten uns ja auch lustig über die Alte wegen dieses unrechtmäßigen Eingriffs in unsere Freiheit! In Scharen gingen wir zu ihr, um Vergebung zu erflehen, verfaßten für sie Glückwunschgedichte im Stile Lomonosovs, zeichneten den Stammbaum der Fürsten Mikšadze usw. Die Fürstin nahm alles für bare Münze, und wir lachten schallend. Die Fürstin liebte uns. Sie seufzte tief und sehr aufrichtig, wenn sie uns ihr Bedauern darüber ausdrückte, daß wir keine Fürsten seien. Sie war an uns gewöhnt wie an die eigenen Kinder.
Lediglich Leutnant Egorov liebte sie nicht. Sie haßte ihn mit ganzer Seele, hegte gegen ihn die unmöglichste Antipathie. Sie empfing ihn nur, weil sie in Geldangelegenheiten mit ihm zu tun hatte und die Etikette wahrte. Der Leutnant war einmal ihr Liebling gewesen. Er ist hübsch, macht gelungene Witze, schweigt viel und ist Militär (das schätzte die Fürstin sehr). Aber manchmal überkommt es Egorov … Er setzt sich hin, stützt den Kopf in die Fäuste und fängt an, furchtbar zu lästern. Er lästert über alles und jeden, verschont weder die Lebenden noch die Toten. Die Fürstin geriet jedesmal außer sich und scheuchte uns aus dem Zimmer, wenn er anfing, boshafte Dinge zu sagen.
Einmal beim Essen stützte Egorov den Kopf in die Faust und hielt, aus heiterem Himmel, eine Rede auf die kaukasischen Fürsten, dann zog er die »Strekoza« aus der Tasche und besaß die Frechheit, in Anwesenheit der Fürstin Mikšadze folgendes vorzulesen: »Tiflis ist eine hübsche Stadt. Zu den Vorzügen der schönen Stadt – wo ›Fürsten‹ sogar die Straßen kehren und in den Hotels putzen – gehört …« usw. Die Fürstin stand vom Tisch auf und ging schweigend hinaus. Sie begann Egorov noch heftiger zu hassen, als er in ihr Merkbüchlein neben unsere Vornamen unsere Familiennamen eintrug. Dieser Haß war um so unerwünschter und unpassender, als der Leutnant von einer Heirat mit Olja träumte und Olja in den Leutnant verliebt war. Der Leutnant träumte schrecklich davon, auch wenn er kaum an die Erfüllung seiner Träumereien glaubte. Olja liebte ihn insgeheim, im stillen, für sich, schüchtern, kaum spürbar … Liebe war für sie Konterbande, ein Gefühl, über das ein grausames Veto verhängt war. Ihr war nicht gestattet zu lieben.
II
In dem mittelalterlichen Schloß hätte sich beinahe eine jener dummen mittelalterlichen Geschichten abgespielt.
Vor sieben Jahren, als Fürst Mikšadze noch lebte, kam Fürst Čajchidzev nach Zelënaja Kosa zu Gast, Gutsbesitzer aus Ekaterinoslav, ein enger Freund Mikšadzes. Er war ein sehr reicher Mann. Er hatte sein Leben lang gelumpt, bis zur Raserei gelumpt, und war ungeachtet dessen bis ans Ende seiner Tage ein reicher Mann geblieben. Mikšadze war seinerzeit sein Saufkumpan gewesen. Zusammen mit Mikšadze hatte er das Mädchen aus dem Elternhaus entführt, das später zur Fürstin Čajchidzeva wurde. Dieser Umstand hielt beide in fester Freundschaft verbunden. Čajchidzev kam zu Gast mit seinem Sohn, einem glupschäugigen, schmalbrüstigen, schwarzhaarigen Knaben, der auf das Gymnasium ging. Čajchidzev gedachte, als erster Pflicht, der guten alten Zeiten und begann mit Mikšadze zu saufen, der Jüngling machte Olja den Hof, damals ein Mädchen von dreizehn. Das Hofieren wurde bemerkt. Die Väter zwinkerten einander zu und bemerkten, der Knabe und Olja würden kein übles Pärchen abgeben. Die betrunkenen Fürsten befahlen den Kindern, sich zu küssen, drückten einander die Hände und küßten sich ebenfalls. Mikšadze brach sogar in Tränen der Rührung aus. – Gott hat es so gefallen! – sagte Čajchidzev. – Du hast eine Tochter, ich habe einen Sohn … So hat es Gott gefallen!
Den Kindern gaben sie Ringe und verewigten beide auf einem Photo. Dieses Photo hing im Saal und ließ Egorov lange keine Ruhe. Es war Zielscheibe ungezählter Witze. Fürstin Marja Egorovna hatte die künftigen Eheleute bedeutungsvoll gesegnet. Ihr hatte die Idee der Väter aus Langeweile gefallen. Einen Monat nach Abreise der Čajchidzevs erhielt Olja per Post ein sehr kostbares Geschenk. Solche Geschenke erhielt sie später jedes Jahr. Der junge Čajchidzev nahm die Sache, wider Erwarten, ernst. Er war ein ziemlich beschränkter Bursche. Jedes Jahr kam er nach Zelënaja Kosa und blieb eine Woche lang zu Gast, wobei er die ganze Zeit schwieg und Olja von seinem Zimmer aus Liebesbriefe schrieb. Olja las die Briefe und wurde verlegen. Das kluge Mädchen wunderte sich, wie ein so großer Mann so dummes Zeug schreiben konnte! Und er schrieb dummes Zeug … Vor zwei Jahren war Mikšadze gestorben. Auf dem Sterbebett hatte er zu Olja folgendes gesagt: »Sieh dich vor, daß du nicht irgendeinen Trottel heiratest! Heirate Čajchidzev. Er ist ein kluger und würdiger Mann.« Olja kannte Čajchidzevs Klugheit, widersprach dem Vater aber nicht. Sie gab ihm ihr Wort, daß sie Čajchidzev heiraten werde.
– Es ist Papas Wille! – sagte sie uns oft und sagte es mit einem gewissen Stolz, so als würde sie eine ungeheure Heldentat vollbringen. Sie war stolz darauf, daß der Vater ihr Versprechen mit ins Grab genommen hatte. Dieses Versprechen war so ungewöhnlich, so romantisch!
Aber Natur und Verstand forderten das Ihre: der verabschiedete Leutnant scharwenzelte vor ihren Augen herum, und Čajchidzev wurde in ihren Augen mit jedem Jahr dümmer und dümmer …
Als der Leutnant es eines Tages wagte, ihr eine Anspielung auf seine Liebe zu machen, bat sie ihn, nicht weiter von Liebe zu sprechen, erinnerte an das dem Vater gegebene Versprechen und weinte die liebe lange Nacht. Die Fürstin schrieb jede Woche einen Brief an Čajchidzev nach Moskau, wo er an der Universität studierte, und befahl ihm, das Studium so schnell wie möglich abzuschließen. »Ich habe nicht solche Rauschebärte wie dich zu Gast; die, die hier sind, haben ihr Studium längst abgeschlossen«, – schrieb sie ihm. Čajchidzev antwortete ihr ehrerbietigst auf rosa Papier und wies auf zwei Seiten nach, daß das Studium vor Ablauf eines bestimmten Zeitraums nicht abgeschlossen werden könne. Auch Olja schrieb ihm. Oljas Briefe an mich waren bei weitem besser als ihre Briefe an diesen Bräutigam. Die Fürstin glaubte fest daran, daß Olja Čajchidzevs Frau werden würde, sonst hätte sie nicht zugelassen, daß ihre Tochter sich herumtreibt und »mit Lappalien abgibt« in der Gesellschaft von Händelsuchern, Windbeuteln, Gottlosen und »Nicht-Fürsten« … Darüber konnte sie keinen Zweifel aufkommen lassen … Der Wille ihres Mannes war ihr heilig … Olja glaubte ebenfalls, daß sie irgendwann als Čajchidzeva unterschreiben würde …
Aber daraus wurde nichts. Die Idee beider Väter platzte unmittelbar vor ihrer Durchführung. Čajchidzevs Roman ging nicht gut aus. Diesem Roman war bestimmt, als Vaudeville zu enden.
Im vorigen Jahr war Čajchidzev Ende Juni nach Zelënaja Kosa gekommen. Dieses Mal kam er nicht mehr als Student, sondern als Wirklicher Student. Die Fürstin empfing ihn mit bedeutungsvollen feierlichen Umarmungen und einer überaus langen Ermahnung. Olja trug ein teures Kleid, eigens zum Empfang des Bräutigams geschneidert. Aus der Stadt wurde Champagner gebracht, Feuerwerk wurde abgebrannt, und am andern Tag sprach, vom frühen Morgen an, ganz Zelënaja Kosa wie aus einem Munde von der Hochzeit, die, so hieß es, auf Ende Juli festgesetzt worden sei. »Arme Olja! – flüsterten wir, ziellos von einer Ecke in die andere gehend, und schauten böse zu den Fenstern auf, die aus dem Zimmer des uns verhaßten Orientalen in den Garten blickten. – Arme Olja!« Olga ging durch den Garten, bleich, mager, halbtot. »So hat es Papa und Mama gefallen!« – sagte sie, als wir anfingen, ihr unsere freundschaftlichen Ratschläge aufzudrängen. »Aber das ist doch töricht! Unzivilisiert!« – schrien wir sie an. Sie zuckte die Schultern und wandte ihr kummervolles Gesicht von uns ab; der Bräutigam saß in seinem Zimmer, schickte Olja durch Lakaien zärtliche Briefe und wunderte sich, wenn er aus dem Fenster sah, über die Kühnheit, mit der wir mit Olja sprachen und uns ihr gegenüber benahmen. Er verließ sein Zimmer nur zum Essen. Er aß schweigend, ohne jemanden anzusehen, antwortete spröde auf unsere Fragen. Nur einmal wagte er, einen Witz zu erzählen, aber selbst der war so alt, daß der Bart schon zum Fenster hinaushing. Nach dem Essen setzte die Fürstin ihn neben sich und brachte ihm bei, Piquet zu spielen. Čajchidzev spielte voller Ernst, nachdenklich, mit hängender Unterlippe und verschwitzt … Diese Einstellung zum Piquet gefiel der Fürstin.
Einmal nach dem Essen entwischte Čajchidzev dem Piquet und lief Olja nach, die sich in den Garten begeben hatte.
– Olga Andreevna! – begann er. – Ich weiß, Sie lieben mich nicht. Unsere Hochzeitsvorbereitungen sind wirklich, zugegeben, sonderbar und töricht. Aber ich, aber ich hoffe, Sie werden mich einmal lieben …
So sagte er, wurde furchtbar verlegen und schlich sich unsicher aus dem Garten auf sein Zimmer.
Leutnant Egorov saß auf seinem Gut und zeigte sich nirgends. Er konnte Čajchidzev nicht leiden.
Am Sonntag (dem zweiten nach Čajchidzevs Ankunft), ich glaube, es war der 5. Juli, erschien frühmorgens bei uns im Nebengebäude ein Student, ein Neffe der Fürstin, und überbrachte uns einen Befehl. Der Befehl der Fürstin bestand darin, daß wir uns gegen Abend alle in ordentlichem Zustand zu befinden hätten: ganz in Schwarz gekleidet, weiße Halsbinden, Handschuhe; wir hätten ernst, klug, geistreich, gehorsam und gelockt wie die Pudel zu sein; keinen Lärm zu machen; in unsern Zimmern hätte es anständig auszusehen. Auf Zelënaja Kosa wurde so etwas wie eine Verlobung geplant. Aus der Stadt wurden Weine, Vodka, Zakuski gebracht … Unsere Dienstboten wurden uns entzogen und zum Küchendienst eingeteilt. Nach dem Essen begannen Gäste einzutreffen, und sie trafen bis zum späten Abend ein. Um acht Uhr, nach dem Bootfahren, begann der Ball.
Vor dem Ball hatten wir, die Männer, eine Zusammenkunft. Auf dieser Zusammenkunft beschlossen wir einstimmig, Olja, koste es, was es wolle, von Čajchidzev zu erlösen, sie zu erlösen, selbst wenn wir den größten Skandal vom Zaun brechen sollten. Nach der Zusammenkunft stürzte ich los, um Leutnant Egorov aufzusuchen. Er lebte auf seinem Gut, 20 Verst von Zelënaja Kosa entfernt. Ich raste zu ihm und traf ihn zu Hause an, aber in welchem Zustand ich ihn antraf! Der Leutnant war sturzbetrunken und schlief wie ein Toter. Ich rüttelte den Leutnant wach, wusch ihn, kleidete ihn an und brachte ihn, seinem Sträuben und Geschimpf zum Trotz, nach Zelënaja Kosa.
Um zehn Uhr war der Ball in vollem Gange. Man tanzte in vier Räumen zum Spiel zweier schöner Flügel. In den Entr’acten spielte im Garten auf einer Anhöhe ein dritter Flügel. Sogar die Fürstin war von unserem Feuerwerk entzückt. Feuerwerk brannten wir im Garten ab, am Ufer und weit draußen auf dem Meer in den Booten. Auf dem Schloßdach wechselten bunte bengalische Feuer einander ab und beleuchteten ganz Kosa. Getrunken wurde an zwei Buffets: ein Buffet war in der Gartenlaube, das andere im Haus. Held des Abends war offensichtlich Čajchidzev. Mit rosa Flecken auf den Wangen, schweißnasser Nase, in einen zu engen Frack gezwängt, tanzte er mit Olja, lächelte wehmütig und spürte, wie ungeschickt er war. Er tanzte und beobachtete dabei jeden seiner »pas«. Er wollte leidenschaftlich gern mit wenigstens irgend etwas glänzen, aber er hatte nichts zum Glänzen. Olja sagte mir später, an diesem Abend habe ihr der arme kleine Fürst sehr leid getan. Sie fand ihn erbärmlich. Er schien zu ahnen, daß man ihm seine Braut wegnehmen würde, an die er ständig gedacht hatte, bei jeder Vorlesung, beim Zubettgehen und beim Aufwachen … Wenn er uns ansah, blickten seine Augen flehentlich. Er ahnte in uns mächtige und gnadenlose Rivalen.
Aus dem Auftragen hoher Champagnerkelche und den Blicken der Fürstin zur Uhr schlossen wir, daß der feierlichoffizielle Augenblick nahe bevorstand, daß Čajchidzev aller Wahrscheinlichkeit nach um 12 Uhr die Erlaubnis erhalten würde, Olja zu küssen. Es mußte gehandelt werden. Um halb zwölf puderte ich mich, um bleich zu wirken, schob die Halsbinde zur Seite und trat mit besorgtem Gesicht und zerzaustem Haar auf Olja zu.
– Olga Andreevna, – begann ich und ergriff ihre Hand, – um Gottes willen!
– Was ist denn?
– Um Gottes willen … Erschrecken Sie nicht, Olga Andreevna … Es mußte ja so kommen. Das war zu erwarten …
– Worum geht es?
– Erschrecken Sie nicht … Sozusagen … Um Gottes willen, meine Teure! Evgraf …
– Was ist mit ihm?
Olga erbleichte und hob ihre großen, vertrauensvollen, freundschaftlichen Augen zu mir auf …
– Evgraf liegt im Sterben …
Olga taumelte und fuhr sich mit den Fingern über die erbleichte Stirn.
– Es ist geschehen, was ich erwartet habe, – fuhr ich fort. – Er liegt im Sterben … Retten Sie ihn, Olga Andreevna!
Olga ergriff meine Hand.
– Er … er … wo ist er?
– Hier im Garten, in der Laube. Schrecklich, meine Teure! Aber … man schaut auf uns. Gehen wir auf die Terrasse … Er gibt Ihnen keine Schuld … Er hat gewußt, daß Sie ihn …
– Was … was ist mit ihm?
– Schlimm steht es, sehr schlimm!
– Gehen wir … ich gehe zu ihm … Ich will nicht, daß er meinetwegen … meinetwegen …
Wir traten auf die Terrasse hinaus. Olja knickten die Knie ein. Ich tat so, als wischte ich mir eine Träne ab. An uns vorbei liefen immer wieder bleiche, aufgeregte Mitglieder unserer Bande mit besorgten, erschreckten Gesichtern.
– Der Blutfluß ist gestillt … – flüsterte mir der Magister der Physik zu, so daß Olja es hörte.
– Gehen wir! – flüsterte Olja und hakte sich unter.
Wir gingen die Terrasse hinab … Die Nacht war still, hell … Die Klänge des Flügels, das Flüstern der dunklen Bäume, das Zirpen der Grillen schmeichelten dem Ohr; unten plätscherte leise das Meer.
Olja konnte kaum gehen … Die Beine knickten ihr ein und verhedderten sich in dem schweren Kleid. Sie zitterte und drückte sich vor Angst an meine Schulter.
– Aber ich bin doch nicht schuld … – flüsterte sie. – Ich schwöre Ihnen, ich bin unschuldig. Papa hat es so gewollt … Er muß das verstehen … Ist es gefährlich?
– Ich weiß nicht … Michail Pavlovič hat sein möglichstes getan. Er ist ein guter Arzt und liebt Egorov … Wir sind gleich da, Olga Andreevna …
– Ich … ich werde nichts Schreckliches sehen müssen? Ich habe Angst … Ich kann nicht sehen … Was hat er sich nur dabei gedacht?
Olja war in Tränen aufgelöst.
– Ich bin unschuldig … Er muß das verstehen. Ich werde es ihm erklären.
Wir waren bei der Laube angekommen.
– Hier, – sagte ich.
Olja schloß die Augen und klammerte sich mit beiden Händen an mich.
– Ich kann nicht …
– Erschrecken Sie nicht … Egorov, bist du noch nicht gestorben? – rief ich, zur Laube gewandt.
– Bis jetzt noch nicht … Wieso?
Am Eingang der Laube zeigte sich, vom Mond beschienen, der Leutnant, zerrauft, bleich vom Suff, mit aufgeknöpfter Weste.
– Wieso? – wiederholte er.
Olja hob den Kopf und erblickte Egorov … Sie sah mich an, dann Egorov, dann wieder mich … Ich fing an zu lachen … Ihr Gesicht erstrahlte. Sie schrie vor Freude auf, machte einen Schritt nach vorn … Ich hatte gedacht, sie würde böse auf uns werden … Aber dieses Mädchen konnte nicht böse werden … Sie machte einen Schritt nach vorn, dachte nach und stürzte auf Egorov zu. Egorov knöpfte rasch seine Weste zu und breitete die Arme aus. Olga flog ihm an die Brust. Egorov fing vor Vergnügen an zu lachen, drehte den Kopf beiseite, um Olja nicht anzuhauchen, und murmelte irgendeinen Blödsinn.
– Sie haben nicht das Recht … Ich bin unschuldig, – stammelte Olja. – So haben Papa und Mama es gewollt.
Ich wandte mich um und schritt rasch auf das illuminierte Schloß zu.
Im Schloß war das Publikum inzwischen bereit, Bräutigam und Braut zu gratulieren, und blickte ungeduldig auf die Uhr … In den Vorzimmern drängten sich Lakaien mit Tabletts; auf den Tabletts standen Flaschen und Sektkelche. Čajchidzev knetete ungeduldig die rechte Hand in der linken und suchte mit den Augen nach Olja. Die Fürstin lief durch die Räume und suchte nach Olja, um ihr vorzuschreiben, wie sie sich zu benehmen, was sie der Mutter zu antworten habe usw. Die Unsern lächelten.
– Weißt du nicht, wo Olja ist? – fragte mich die Fürstin.
– Nein.
– Geh und such sie.
Ich trat in den Garten hinaus und ging, die Hände auf dem Rücken, zweimal ums Haus. Unser Maler fing an, Trompete zu spielen. Das bedeutete: »Halt sie fest, laß sie nicht gehen!« Egorov antwortete aus der Laube mit dem Ruf des Käuzchens. Das bedeutete: »In Ordnung! Ich halte sie fest!«
Nach meinem Rundgang betrat ich das Haus. In den Vorzimmern setzten die Lakaien die Tabletts auf den Tischen ab und schauten, nun mit leeren Händen, stumpfsinnig ins Publikum. Das Publikum seinerseits schaute mit Befremden auf die Uhr: der große Zeiger zeigte bereits ein Viertel. Die Flügel verstummten. In allen Räumen herrschte tiefe, quälende, dumpfe Stille.
– Wo ist Olja? – fragte mich die Fürstin, purpurrot.
– Ich weiß es nicht … Im Garten ist sie nicht.
Die Fürstin zuckte die Schultern.
– Weiß sie denn nicht, daß es längst Zeit ist? – fragte sie, mich am Ärmel zupfend.
Ich zuckte die Schultern. Die Fürstin wandte sich von mir ab und flüsterte Čajchidzev etwas zu. Čajchidzev zuckte ebenfalls die Schultern. Die Fürstin zupfte auch ihn am Ärmel.
– Trottel! – brummte sie und lief durchs ganze Haus. Dienstmädchen und Gymnasiasten, die Verwandten der Fürstin, alle liefen sie lärmend die Treppen hinab und begaben sich tief in den Garten, um die verschwundene Braut zu suchen. Ich ging ebenfalls in den Garten. Ich fürchtete, Egorov würde Olja nicht festhalten können und den von uns ausgeheckten Skandal verderben. Ich begab mich zur Laube. Ich fürchtete umsonst! Olja saß neben Egorov, fuhr ihm mit ihren Fingerchen vor den Augen herum und flüsterte, flüsterte … Wenn Olja zu flüstern aufhörte, begann Egorov zu murmeln. Er flößte ihr ein, was die Fürstin »Ideen« nennt … Jedes Wort versüßte er mit einem Kuß. Er sprach, suchte sie alle Augenblicke zu küssen und wandte gleichzeitig den Mund ab, weil er befürchtete, Olja könne die Vodkafahne riechen. Beide waren glücklich, hatten offensichtlich alles auf der Welt vergessen und achteten nicht auf die Zeit. Ich blieb ein wenig am Eingang der Laube stehen, freute mich im Geist und ging, um die glückliche Ruhe nicht zu stören, zum Schloß zurück.
Die Fürstin war außer sich und roch an ihrem Riechfläschchen. Sie verlor sich in Vermutungen, ärgerte sich, schämte sich vor den Gästen, dem Bräutigam … Sie wird nie handgreiflich, gab aber dem Dienstmädchen eine Ohrfeige, als dieses ihr meldete, die Prinzessin sei nirgends zu finden. Die Gäste warteten nicht länger auf Champagner und Gratulation, fingen an zu lächeln, Klatschgeschichten zu erzählen und machten sich wieder ans Tanzen. Es schlug ein Uhr, Olja zeigte sich nicht. Die Fürstin platzte vor Wut.
– Das sind alles eure Scherze! – zischte sie, wenn sie an einem von uns vorbeiging. – Die kann was erleben! Wo ist sie?
Schließlich fand sich ein Wohltäter, der ihr mitteilte, wo Olja war … Als dieser Wohltäter erwies sich ein kleiner, dickbäuchiger Gymnasiast, ein Neffe der Fürstin. Der kleine Gymnasiast kam wie von der Tarantel gestochen aus dem Garten gelaufen, sprang auf die Fürstin zu, setzte sich ihr auf die Knie, zog ihren Kopf zu sich herab und flüsterte es ihr ins Ohr … Die Fürstin erbleichte und biß sich die Lippe blutig.
– In der Laube? – fragte sie.
– Ja.
Die Fürstin erhob sich und erklärte den Gästen mit einer Grimasse, die einem offiziellen Lächeln ähnlich sah, Olja habe Kopfschmerzen, sie bitte zu entschuldigen usw. Die Gäste äußerten ihr Bedauern, nahmen auf die Schnelle das Souper und begannen, sich auf den Heimweg zu machen.
Um zwei Uhr (Egorov hatte sich ins Zeug gelegt und Olja bis zwei festgehalten) stand ich am Aufgang zur Terrasse hinter einer Mauer aus Oleanderbäumchen und wartete auf Oljas Rückkehr. Ich wollte Oljas Gesicht sehen. Ich liebe weibliche Gesichter, die glücklich sind. Ich wollte sehen, wie sich die Liebe zu Egorov und zugleich die Angst vor der Mutter auf ein und demselben Gesicht vereinbaren ließen; und was stärker sei: die Liebe oder die Angst? Nicht lange atmete ich Oleanderduft. Olja zeigte sich bald. Ich verschlang ihr Gesicht mit den Augen. Sie ging langsam, das Kleid ein wenig geschürzt und ihre kleinen Schühchen zeigend. Ihr Gesicht war gut beleuchtet vom Mond und den Lampions, die in den Bäumen hingen und mit ihrem Geflacker den Mondschein verdarben. Ihr Gesicht war ernst, bleich. Nur die Lippen lächelten ein wenig. Die Augen blickten nachdenklich zu Boden; mit solchen Augen löst man gewöhnlich schwierige Aufgaben. Als Olja die erste Stufe betrat, wurden ihre Augen unruhig, huschten hin und her: sie dachte an die Mutter. Olja berührte mit der Hand leicht die zerdrückte Frisur, stand einige Zeit unschlüssig auf der ersten Stufe, schüttelte den Kopf und ging tapfer auf die Tür zu … Und hier war mir beschieden, ein Bild zu sehen … Die Tür öffnete sich, und Oljas bleiches Gesicht wurde von grellem Licht beleuchtet. Olja fuhr zusammen, machte einen Schritt zurück und duckte sich leicht … als drücke sie etwas nieder … Auf der Schwelle stand, hoch erhobenen Hauptes, die Fürstin, bebend vor Zorn und Scham … Wohl an die zwei Minuten dauerte das Schweigen.
– Die Tochter eines Fürsten, – begann die Fürstin, – und die Braut eines Fürsten geht zum Stelldichein mit einem Leutnant?! Und dann noch mit diesem Evgraška! Widerliche!
Olja krümmte sich, schlüpfte bebend, wie eine kleine Schlange an der Fürstin vorbei und flog hinauf in ihr Zimmer. Sie setzte sich auf ihr Bett und ließ die Augen, voller Entsetzen und Besorgnis, die ganze Nacht nicht vom Fenster.
Gegen drei Uhr nachts hatten wir wieder eine Zusammenkunft. Auf dieser Zusammenkunft lachten wir über den glücktrunkenen Egorov und schickten den Juristen-Baron aus Charkov zu Čajchidzev. Der Fürst schlief noch nicht. Der Juristen-Baron aus Charkov sollte Čajchidzev »in aller Freundschaft« auf die Peinlichkeit seiner, Čajchidzevs, Lage hinweisen, ihn bitten, er, der Fürst, als gebildeter Mensch möge die Mühe auf sich nehmen, sich über diese Peinlichkeit klarzuwerden, und ihn unter anderem bitten, er möge uns unsere Einmischung vergeben, vergeben »in aller Freundschaft«, als gebildeter Mensch … Čajchidzev antwortete dem Baron, er »verstehe das alles sehr wohl«, er messe dem väterlichen Vermächtnis keinerlei Bedeutung bei, aber er liebe Olja und sei deshalb auch so hartnäckig gewesen … Gefühlvoll drückte er dem Baron die Hand und versprach, noch morgen abzureisen.
Am nächsten Morgen erschien Olja zum Tee – bleich, zerschlagen, erfüllt von den verzweifeltsten Erwartungen, sie hatte Angst und schämte sich auch … Aber ihr Gesicht erstrahlte, als sie im Speisezimmer uns sah und hörte. Wir standen in versammelter Kompanie vor der Fürstin und schrien. Schrien alle gleichzeitig. Wir hatten unsere kleinen Masken abgeworfen und flößten der alten Fürstin lauthals »Ideen« ein, denen sehr ähnlich, die Egorov gestern Olja eingeflößt hatte. Wir sprachen von der Persönlichkeit der Frau, von der Rechtmäßigkeit der freien Wahl usw. Die Fürstin hörte uns schweigend, mürrisch zu und las einen Brief, den Egorov ihr geschickt hatte, – dieser Brief war von der gesamten Bande abgefaßt und vollgestopft mit Worten wie: »wegen Unmündigkeit«, »aus Unerfahrenheit«, »mit Ihren Segenswünschen« usw. Die Fürstin hörte uns bis zu Ende an, las Egorovs langen Brief bis zu Ende und sagte:
– Nicht euch Milchbärten steht es zu, mir, einer alten Frau, Belehrungen zu erteilen. Ich weiß, was ich tue. Trinkt euren Tee aus und fahrt von hier weg, um anderen die Köpfe zu verdrehen. Ihr könnt mit mir alter Frau nicht leben … Ihr seid klug, und ich bin dumm … Gott befohlen, meine kleinen Herrchen! … Mein Leben lang werde ich euch dankbar sein!
Die Fürstin warf uns raus. Wir schrieben ihr einen Dankesbrief, küßten ihr ehrerbietig die Hand und reisten noch am selben Tag schweren Herzens auf Egorovs Gut. Mit uns reiste auch Čajchidzev ab. Bei Egorov waren wir ausschließlich damit beschäftigt herumzulumpen, uns nach Olja zu sehnen und Egorov zu trösten. Wir verbrachten etwa zwei Wochen bei ihm. In der dritten Woche erhielt unser Juristen-Baron einen Brief von der Fürstin. Die Fürstin bat den Baron, nach Zelënaja Kosa zu kommen und irgendein Papier für sie aufzusetzen. Der Baron fuhr hin. Drei Tage nach seiner Abreise fuhren auch wir hin, unter dem Vorwand, den Baron abzuholen. Nach Zelënaja Kosa kamen wir vor dem Essen. Das Haus betraten wir nicht, sondern schlichen durch den Garten und schauten zu den Fenstern auf. Die Fürstin sah uns durchs Fenster.
– Seid ihr da gekommen? – rief sie.
– Ja, wir sinds.
– Habt ihr etwas vor, oder was?
– Den Baron abholen.
– Der Baron hat keine Zeit, sich mit euch Galgenstricken herumzutreiben! Er schreibt.
Wir zogen die Hüte und traten unters Fenster.
– Wie ist Ihr Befinden, Fürstin? – fragte ich.
– Was schleicht ihr hier ums Haus? – antwortete die Fürstin. – Kommt herein!
Wir gingen ins Innere und verteilten uns artig auf die Stühle. Der Fürstin, die sich schrecklich nach unserer Kompanie gesehnt hatte, gefiel diese Artigkeit. Sie behielt uns zum Essen da. Beim Essen beschimpfte sie einen von uns, der einen Löffel hatte fallen lassen, als Schlafmütze und warf uns vor, wir könnten uns bei Tisch nicht benehmen. Wir gingen mit Olja spazieren, blieben über Nacht … Wir blieben auch die folgende Nacht und saßen auf Zelënaja Kosa fest bis Ende September. Die Welt hatte sich von selbst wieder eingerenkt.
Gestern erhielt ich von Egorov einen Brief. Der Leutnant schreibt, er habe sich den ganzen Winter bei der Fürstin »lieb Kind gemacht« und es sei ihm gelungen, den Zorn der Fürstin in Gnade umzuwandeln. Er versichert, im Sommer werde seine Hochzeit stattfinden.
Bald darauf sollte ich zwei Briefe erhalten: der eine streng offiziell, von der Fürstin, der andere lang, heiter, voller Pläne, von Olja. Im Mai fahre ich wieder nach Zelënaja Kosa.
Die grüne Witwe
Lëlja NN, eine hübsche zwanzigjährige Blondine, steht am Palisadenzaun ihres Sommerhauses und schaut, das Kinn auf einen Pfosten gestützt, in die Ferne. Das weite Feld, die flockigen Wolken am Himmel, die in der Ferne dunkelnde Bahnstation und das Flüßchen, das zehn Schritt vom Palisadenzaun entfernt vorbeiläuft, sind vom Licht des purpurroten, über den Kurganen aufgehenden Mondes übergossen. Ein leichter Wind kräuselt, da er nichts Besseres zu tun hat, heiter das Flüßchen und raschelt im Gras … Stille ringsumher … Lëlja denkt nach … Ihr hübsches Gesicht ist so traurig, in ihren Augen dunkelt so viel Wehmut, daß es wirklich fühllos und grausam wäre, ihren Kummer nicht mit ihr zu teilen.
Sie vergleicht Gegenwart und Vergangenheit. Im vergangenen Jahr, in demselben duftigen und poetischen Mai, war sie noch im Institut und hatte die Abschlußexamina abgelegt. Sie erinnert sich, wie die Klassenlehrerin Mlle. Morceau, ein geschlagenes, krankes und engherziges Geschöpf mit ewig erschrockenem Gesicht und einer großen, schweißnassen Nase, die Examenskandidatinnen ins Photographische Atelier führte, um eine Aufnahme machen zu lassen.
– Ach, ich flehe Sie an, – bat sie die Kontoristin im Photographischen Atelier, – zeigen Sie ihnen keine Bilder von Männern.
Sie bat mit Tränen in den Augen. Diese arme Eidechse, die nie einen Mann gekannt hatte, versetzte der Anblick einer männlichen Physiognomie in heiliges Entsetzen. Im Schnurrbart und Bart jedes »Dämons« las sie die paradiesische Seligkeit, die unweigerlich in einen unbekannten, schrecklichen Abgrund führt, aus dem es keinen Ausweg gibt. Die Institutsinsassinnen lachten über die dumme Morceau, aber bis an den Hals mit »Idealen« gefüttert, konnten sie nicht anders, als ihr heiliges Entsetzen zu teilen. Sie glaubten, daß es dort draußen, jenseits der Institutsmauern, den katarrhgeplagten Vater und die frei über sich bestimmenden Brüder nicht gerechnet, nur so wimmle von zottigen Poeten, bleichen Sängern, galligen Satirikern, verzweifelten Patrioten, unermeßlichen Millionären, zu Tränen rührenden, interessanten Beschützern … Und unter dieser wimmelnden Menge sollte man nun wählen! Im Grunde war Lëlja überzeugt, daß sie unweigerlich auf Turgenevsche und andere Helden treffen werde, auf Kämpfer für Wahrheit, Gerechtigkeit und Fortschritt, von denen wie um die Wette alle Romane handeln, auch alle Lehrbücher der Geschichte – der alten, mittleren und neuen …
In diesem Mai ist Lëlja bereits verheiratet. Ihr Mann ist schön, reich, jung, gebildet, von allen geachtet, aber trotz alledem ist er (peinlich, dies vor dem poetischen Mai einzugestehen!) grob, ungeschliffen und plump wie vierzigtausend plumpe Brüder.
Er erwacht um Punkt zehn Uhr morgens und setzt sich, den Chalat übergezogen, ans Rasieren. Er rasiert sich mit