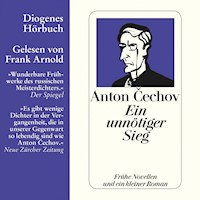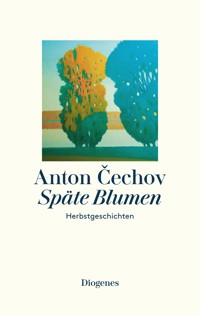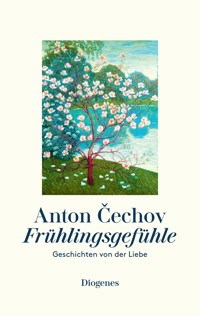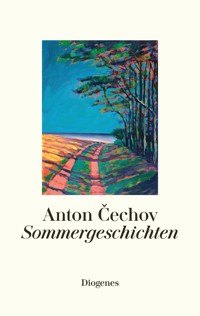11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Tannenbaum des Schicksals, der die Gaben verteilt, eine Schlittenfahrt, feiertägliche Erregung, Könige-Spiel, Wodka, Kaviar und Lachs: Tiefer Winter herrscht in diesen einzigartigen Geschichten, die gerade durch ihre klare Sprache besonders ergreifend sind: »Wenn der erste Schnee fällt, am Tag der ersten Schlittenfahrt, ist es angenehm, die weiße Erde, die weißen Dächer zu sehen, es atmet sich weich und wunderbar, und dann erinnert man sich an die Jugendjahre.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anton Čechov
Wintergeschichten
Aus dem Russischen von Peter Urban.
Ausgewählt von Christine Stemmermann
Diogenes
Knaben
Volodja ist da! – rief jemand auf dem Hof.
– Volodička ist da! – jammerte Natalja und kam ins Esszimmer gelaufen. – Ach, mein Gott!
Die gesamte Familie Korolev, die Stunde um Stunde auf ihren Volodja gewartet hatte, stürzte an die Fenster. An der Auffahrt stand ein großer Schlitten, und von den drei Schimmeln stieg Nebel auf. Der Schlitten war leer, denn Volodja stand schon im Flur und knüpfte sich mit roten, verfrorenen Fingern die Kapuze auf. Sein Gymnasiastenmantel, die Uniformmütze, Galoschen und Haare waren reifbedeckt, und er verströmte von Kopf bis Fuß einen so appetitlichen Frostgeruch, dass man bei seinem Anblick am liebsten nach draußen gelaufen wäre und gesagt hätte: »Brrr!« Mutter und Tante stürzten ihm in die Arme, Natalja fiel ihm zu Füßen auf die Knie und begann, ihm die Filzstiefel auszuziehen, die Schwestern erhoben ein Gezeter, Türen quietschten, schlugen, und Volodjas Vater kam, nur in der Weste, eine Schere in der Hand, in den Flur gelaufen und rief erschrocken:
– Aber wir haben dich schon gestern erwartet! Bist du gut hergekommen? Wohlbehalten? Herrgott, lass ihn doch auch seinen Vater begrüßen! Bin ich etwa nicht sein Vater, wie?
– Haw! Haw! – heulte mit Bassstimme Mylord, der riesige schwarze Hund, der mit dem Schwanz gegen Wände und Möbel klopfte.
All das vermengte sich zu einem einzigen freudigen Geschrei, das ein, zwei Minuten anhielt. Als der erste Freudensturm sich gelegt hatte, bemerkten die Korolevs, dass außer Volodja sich im Flur noch ein kleiner Mensch befand, in Tücher, Schals und Kapuzen gehüllt und reifbedeckt; er stand, einen großen Fuchspelz übergeworfen, reglos in einer Ecke im Schatten.
– Volodička, und wer ist das? – flüsterte die Mutter.
– Ach! – erinnerte sich Volodja plötzlich. – Habe die Ehre vorzustellen, das ist mein Schulkamerad Linseničin, Schüler der 2. Klasse … Ich habe uns einen Gast mitgebracht.
– Sehr angenehm, seien Sie uns willkommen! – sagte freudig der Vater. – Entschuldigen Sie, ich bin im Hauskleid, ohne Jackett … Kommen Sie herein! Natalja, hilf Herrn Plinseničin beim Auskleiden! Herr du mein Gott, jagt endlich diesen Hund weg! Er ist eine Strafe!
Wenig später saßen Volodja und sein Freund Linseničin, betäubt von dem stürmischen Empfang und noch immer rosig von der Kälte, am Tisch und tranken Tee. Die Wintersonne, den Schnee und die Eisblumen an den Fenstern durchdringend, zitterte auf dem Samovar und badete ihre reinen Strahlen im Spucknapf. Im Zimmer war es warm, und die Knaben spürten, wie in ihren durchgefrorenen Körpern, ohne dass eines dem anderen nachgeben wollte, Wärme und Frost sich gegenseitig kitzelten.
– Ja, nun haben wir schon wieder Weihnachten! – sprach in singendem Tonfall der Vater, während er sich aus dunkelrotem Tabak eine Zigarette drehte. – Und war nicht vor kurzem noch Sommer, hatte Mutter nicht geweint, als sie dich begleitete? Und jetzt bist du wieder da … Die Zeit, Freund, vergeht so schnell! Kaum sagst du Ach!, schon ist das Alter gekommen. Herr Flinteničin, bitte greifen Sie zu, genieren Sie sich nicht! Bei uns gehts ungezwungen zu.
Volodjas drei Schwestern, Katja, Sonja und Maša – die älteste war elf Jahre alt –, saßen am Tisch und ließen kein Auge von dem neuen Bekannten. Linseničin war so alt und von gleichem Wuchs wie Volodja, aber nicht so pummelig und weiß, sondern mager, dunkel und mit Sommersprossen bedeckt. Er hatte borstige Haare, schmale Augen, dicke Lippen und war überhaupt sehr hässlich, und hätte er nicht die Uniformjacke eines Gymnasiasten angehabt, so hätte man ihn, dem Äußeren nach, für den Sohn der Köchin halten können. Er war griesgrämig, schwieg die ganze Zeit und lächelte kein einziges Mal. Die Mädchen, die ihn ansahen, waren sich sofort darüber im Klaren, dass er ein sehr kluger und gelehrter Mensch sein müsse. Er dachte die ganze Zeit über etwas nach und war so sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, dass er, wenn man ihn nach etwas fragte, zusammenfuhr, den Kopf schüttelte und bat, die Frage zu wiederholen.
Die Mädchen bemerkten, dass auch Volodja, der immer heiter und gesprächig gewesen war, dieses Mal wenig sprach, überhaupt nicht lächelte und irgendwie gar nicht froh war, wieder zu Hause zu sein. Solange sie beim Tee saßen, wandte er sich nur ein einziges Mal an die Schwestern, und auch das mit seltsamen Worten. Er zeigte mit dem Finger auf den Samowar und sagte:
– In Kalifornien trinkt man Gin statt Tee.
Auch er war mit irgendwelchen Gedanken beschäftigt, und wie es schien, den Blicken nach zu schließen, die er bisweilen mit seinem Freund Linseničin wechselte, hatten die Knaben gemeinsame Gedanken.
Nach dem Tee gingen alle ins Kinderzimmer. Der Vater und die Mädchen setzten sich an den Tisch und nahmen die Arbeit wieder auf, die durch die Ankunft der Knaben unterbrochen worden war. Sie machten aus Buntpapier Blumen und Ketten für den Weihnachtsbaum. Das war eine schöne und geräuschvolle Arbeit. Jede neu gemachte Blume begrüßten die Mädchen mit begeisterten Schreien, sogar mit entsetzten Schreien, so als sei die Blume vom Himmel gefallen; Papaša verfiel ebenfalls in Begeisterung und warf bisweilen die Schere zu Boden, aus Ärger darüber, dass sie stumpf war. Mamaša kam ins Kinderzimmer gelaufen, machte ein besorgtes Gesicht und fragte:
– Wer hat meine Schere genommen? Hast du schon wieder meine Schere genommen, Ivan Nikolaič?
– Herr du mein Gott, nicht mal eine Schere geben sie einem! – antwortete Ivan Nikolaič mit weinerlicher Stimme und nahm, gegen die Stuhllehne zurückgelehnt, die Pose des Gekränkten ein, geriet jedoch eine Minute später erneut in Begeisterung.
Früher, wenn Volodja nach Hause kam, hatte auch er sich am Vorbereiten des Weihnachtsbaums beteiligt oder war auf den Hof gelaufen, um zuzusehen, wie der Kutscher und der Hirte die Rodelbahn machten, jetzt jedoch schenkten er und Linseničin dem Buntpapier keinerlei Beachtung und waren kein einziges Mal im Pferdestall, sondern saßen am Fenster und flüsterten miteinander; dann schlugen beide gemeinsam den Weltatlas auf und begannen, irgendeine Karte zu betrachten.
– Zuerst nach Perm… – sagte Linseničin leise … – von dort nach Tjumen … dann Tomsk … dann … dann … nach Kamčatka … Von hier bringen uns die Samojeden in Booten über die Beringstraße … Und dann bist du in Amerika … Hier gibt es viele Pelztiere.
– Und Kalifornien? – fragte Volodja.
– Kalifornien ist weiter unten … Wenn wir erst in Amerika sind, ist Kalifornien nicht mehr weit. Ernähren werden wir uns von Jagd und Raub.
Linseničin mied die Mädchen den ganzen Tag, sah sie nur aus den Augenwinkeln an. Nach dem abendlichen Tee geschah es, dass man ihn für fünf Minuten mit den Mädchen allein ließ. Zu schweigen wäre peinlich gewesen. Also räusperte er sich streng, rieb die linke Hand in der rechten Handfläche, blickte Katja griesgrämig an und fragte:
– Haben Sie Mayne Reid gelesen?
– Nein, hab ich nicht … Hören Sie, und können Sie Schlittschuh laufen?
In seine Gedanken vertieft, antwortete Linseničin nichts auf diese Fragen, sondern blies nur die Wangen auf und stieß einen Seufzer aus, als sei ihm sehr heiß. Er hob noch einmal die Augen auf Katja und sagte:
– Wenn eine Bisonherde durch die Pampas rast, dann bebt die Erde und die Mustangs schlagen aus und wiehern.
Linseničin lächelte traurig und setzte hinzu:
– Außerdem überfallen die Indianer die Eisenbahnen. Aber das Schlimmste sind die Moskitos und die Termiten.
– Was ist denn das?
– Das ist etwas wie die Ameisen, nur mit Flügeln. Sie beißen sehr schmerzhaft. Wissen Sie, wer ich bin?
– Herr Linseničin.
– Nein, ich bin Montigomo, Habichtskralle, Häuptling der Unbesiegbaren.
Maša, die Kleinste, sah ihn an, dann das Fenster, hinter dem bereits der Abend anbrach, und sagte nachdenklich:
– Bei uns hat es gestern Linseneintopf gegeben.
Die völlig unverständlichen Worte Linseničins und der Umstand, dass er beständig mit Volodja flüsterte, dass er nicht mitspielte, sondern ständig über etwas nachdachte – all das war seltsam und rätselhaft. Und die beiden älteren Mädchen, Katja und Sonja, begannen, die Knaben wie ein Luchs zu beobachten. Am Abend, als die Knaben sich schlafen gelegt hatten, stahlen sich die Mädchen an die Tür und belauschten ihr Gespräch. Oh, was sie da erfuhren! Die Knaben wollten irgendwohin nach Amerika fliehen, um Gold zu graben; sie hatten schon alles für die Reise beisammen: eine Pistole, zwei Messer, Zwieback, eine Lupe zum Feuermachen, einen Kompass und in barem Geld vier Rubel. Sie erfuhren, was die Knaben alles zu bestehen hatten: einige Tausend Werst zu Fuß zurücklegen, unterwegs mit Tigern und Wilden kämpfen, dann nach Gold graben und Elfenbein gewinnen, Feinde töten, unter die Seeräuber gehen, Gin trinken und am Ende zwei schöne Frauen heiraten und Plantagen bearbeiten. Volodja und Linseničin sprachen miteinander und unterbrachen sich in ihrer Begeisterung gegenseitig. Sich selbst nannte Linseničin »Montigomo, Habichtskralle«, Volodja hingegen »meinen bleichgesichtigen Bruder«.
– Aber pass auf, erzähl das nicht Mama –, sagte Katja zu Sonja, als sie zu Bett gingen. – Volodja bringt uns aus Amerika Gold und Elfenbein mit, wenn du es aber Mama erzählst, lassen sie ihn nicht fort.
Den ganzen Tag vor Heiligabend studierte Linseničin die Asienkarte und machte Notizen, während Volodja gequält, pummelig rund, als hätte ihn eine Biene gestochen, griesgrämig durch die Zimmer schlich und nichts aß. Einmal im Kinderzimmer blieb er sogar vor der Ikone stehen, bekreuzigte sich und sagte:
– Herrgott, vergib mir Sünder! Herrgott, beschütze meine arme, unglückliche Mama!
Gegen Abend fing er an zu weinen. Als er schlafen ging, umarmte er den Vater, die Mutter und die Schwestern lange, Katja und Sonja begriffen ja, worum es ging, wohingegen die Jüngste, Maša, nichts, entschieden nichts begriff und beim Anblick Linseničins nachdenklich wurde und mit einem Seufzer sagte:
– Njanja sagt, wenn Fasten sind, soll man Erbsen und Linsen essen.
Am frühen Morgen von Heiligabend erhoben sich Katja und Sonja leise und gingen zusehen, wie die Knaben nach Amerika flohen. Sie stahlen sich an die Tür.
– Du kommst also nicht mit? – fragte Linseničin zornig. – Sprich: du kommst also nicht mit?
– Herrgott! – weinte Volodja leise. – Wie kann ich denn mitkommen? Mama tut mir leid.
– Mein bleichgesichtiger Bruder, ich bitte dich, komm mit! Du hast versichert, dass du mitkommst, du selbst hast mich angestiftet, und jetzt, wo es losgeht, kriegst dus mit der Angst.
– Ich … ich habe keine Angst, mir … mir tut Mama leid.
– Sprich: kommst du mit oder nicht?
– Ich komme mit, nur … nur warte. Ich möchte noch ein bisschen zu Hause bleiben.
– Wenn das so ist, gehe ich eben allein! – entschied Linseničin. – Ich komme auch ohne dich aus. Dabei hast du doch selber auf Tigerjagd gehen und kämpfen wollen! Wenn das so ist, gib mir meine Zündstifte zurück!
Volodja fing bitterlich an zu weinen, dass die Schwestern es nicht aushielten und ebenfalls zu weinen anfingen. Stille trat ein.
– Du kommst also nicht mit? – fragte Linseničin noch einmal.
– Ich … ich komme mit.
– Dann zieh dich an!
Und Linseničin pries, um Volodja zu überzeugen, Amerika in höchsten Tönen, brüllte wie ein Tiger, stellte einen Dampfer dar, schimpfte und versprach Volodja, ihm alles Elfenbein und alle Löwen- und Tigerfelle abzugeben.
Und dieser magere dunkle Knabe mit den Borstenhaaren und Sommersprossen erschien den Mädchen als ganz ungewöhnlich, bemerkenswert. Er war ein Held, ein entschlossener, unerschütterlicher Mensch, und er brüllte so, dass man, vor der Tür stehend, tatsächlich denken konnte, es sei ein Tiger oder ein Löwe.
Als die Mädchen in ihr Zimmer zurückgekehrt waren und sich ankleideten, sagte Katja mit Tränen in den Augen:
– Ach, ich habe solche Angst!
Bis zwei Uhr, als man sich zu Tisch setzte, war alles still, aber bei Tisch stellte sich plötzlich heraus, dass die Knaben nicht zu Hause waren. Man schickte in die Gesindeküche, in den Pferdestall, ins Nebengebäude zum Verwalter – auch dort waren sie nicht. Auch den Tee trank man ohne die Knaben, und als man sich zum Abendbrot setzte, war Mamaša sehr besorgt, sie weinte sogar. Und nachts ging man wieder ins Dorf, suchte, ging mit Laternen an den Fluss. Gott, was erhob sich da ein Gezeter!
Am andern Tag kam der Landgendarm, im Esszimmer schrieben sie irgendein Papier. Mamaša weinte.
Doch da hielt vor dem Nebengebäude der große Schlitten, und von den drei Schimmeln stieg Dampf auf.
– Volodja ist da! – rief jemand auf dem Hof.
– Volodička ist da! – jammerte Natalja und kam ins Esszimmer gelaufen.
Auch Mylord fing mit Bassstimme an zu bellen: »Haw! haw!« Es stellte sich heraus, dass man die Knaben in der Stadt festgenommen hatte, im Kaufhaus (dort waren sie umhergegangen und hatten ständig gefragt, wo es Schießpulver zu kaufen gäbe). Als Volodja den Flur betrat, brach er in Schluchzen aus und stürzte der Mutter um den Hals. Die Mädchen dachten bebend, voller Entsetzen, daran, was jetzt geschehen würde, sie hörten, wie Papaša Volodja und Linseničin in sein Kabinett führte und dort lange mit ihnen sprach; Mamaša sprach ebenfalls und weinte.
– Wie kann man nur so etwas tun? – redete Papaša auf sie ein. – Wenn man das im Gymnasium erfährt, fliegt ihr. Und Sie, Herr Linseničin, sollten sich schämen! Wie hässlich von Ihnen! Sie sind der Anstifter, und ich hoffe, Ihre Eltern werden Sie bestrafen. Wie kann man nur so etwas tun? Wo haben Sie übernachtet?
– Auf dem Bahnhof! – antwortete Linseničin stolz.
Volodja lag danach auf dem Bett, auf die Stirn hatte man ihm ein mit Essig getränktes Handtuch gelegt. Man schickte ein Telegramm irgendwohin, und am andern Tag kam eine Dame, Linseničins Mutter, und holte ihren Sohn ab.
Als Linseničin abreiste, war sein Gesicht streng, hochmütig, und zum Abschied von den Mädchen sagte er kein einziges Wort; er nahm nur Katjas Album entgegen und schrieb zur Erinnerung hinein:
»Montigomo, Habichtskralle.«
Kleiner Scherz
Ein klarer Wintertag, um Mittag … der Frost ist stark, er klirrt, und Nadjenka, die sich an meinen Arm klammert, hat silbrigen Reif an den Schläfenlöckchen und Flaum über der Oberlippe. Wir stehen auf einem hohen Berg. Vor unseren Füßen bis hinab zur Erde erstreckt sich eine abschüssige Fläche, in der sich die Sonne betrachtet wie in einem Spiegel. An unserer Seite ein kleiner Schlitten, mit hellrotem Stoff ausgeschlagen.
»Fahren wir hinunter, Nadežda Petrovna!«, bettle ich. »Nur ein Mal! Ich versichere Sie, wir kommen heil unten an.«
Aber Nadjenka hat Angst. Der gesamte Raum vor ihren kleinen Galoschen bis zum Ende des Eisbergs erscheint ihr als ein schrecklicher, unermesslich tiefer Abgrund. Es erstirbt ihr Denken, es verschlägt ihr den Atem, wenn sie nach unten blickt, wenn ich ihr nur vorschlage, sich in den Schlitten zu setzen, denn was wird geschehen, wenn sie es riskiert, in den Abgrund zu fliegen! Sterben wird sie, den Verstand verlieren.
»Ich flehe Sie an!«, sage ich. »Sie brauchen keine Angst zu haben! Begreifen Sie doch, das ist Kleinmut, ist Feigheit!«
Endlich gibt Nadjenka nach, und ich sehe in ihrem Gesicht, sie gibt nach, den Tod vor Augen. Ich setze sie, bleich, zitternd, in den Schlitten, umfasse sie mit einem Arm und stürze mich mit ihr in den Höllenschlund.
Der Schlitten fliegt wie eine Kugel. Die durchschnittene Luft schlägt ins Gesicht, heult, pfeift in den Ohren, kneift schmerzend vor Wut, will einem den Kopf von den Schultern reißen. Vor dem Ansturm des Windes lässt sich nicht atmen. Es scheint, als halte uns der Teufel leibhaftig in den Tatzen und zerre uns unter Geheul in die Hölle. Die Gegenstände ringsum verschwimmen zu einem langen, dahinrasenden Band … Noch einen Augenblick, und wir sind, so scheint es, verloren!
»Ich liebe Sie, Nadja!«, sage ich halblaut.
Dann fährt der Schlitten immer langsamer und langsamer, das Heulen des Windes und das Surren der Kufen sind nicht mehr so schrecklich, der Atem erstirbt nicht länger, und schließlich sind wir unten. Nadjenka ist mehr tot als lebendig. Sie ist bleich, atmet kaum … Ich helfe ihr beim Aufstehen.
»Noch einmal fahre ich um keinen Preis«, sagt sie und schaut mich mit großen, vor Entsetzen geweiteten Augen an. »Um nichts in der Welt! Ich wäre fast gestorben.«
Etwas später kommt sie zu sich und blickt mir bereits fragend in die Augen: habe ich diese vier Worte gesagt, oder hat sie sie nur gehört im Brausen des Windes? Und ich stehe neben ihr, rauche und mustere eingehend meine Handschuhe.
Sie hakt sich bei mir unter, und wir gehen lange am Fuß des Berges spazieren. Das Rätsel lässt ihr, wie ich sehe, keine Ruhe. Sind diese Worte gesagt worden oder nicht? Ja oder nein? Das ist eine Frage der Eitelkeit, der Ehre, des Lebens, des Glücks, eine sehr wichtige Frage, die wichtigste auf Erden. Nadjenka schaut mir ungeduldig, traurig, mit forschendem Blick ins Gesicht, gibt unpassende Antworten, wartet, ob ich nicht beginnen würde zu sprechen. Oh, was für ein Spiel in diesem netten Gesicht, was für ein Spiel! Ich sehe, sie kämpft mit sich, sie muss etwas sagen, muss etwas fragen, aber sie findet nicht die Worte, ihr ist es peinlich, sie hat Angst, die Freude hindert sie …
»Wissen Sie was?«, sagt sie, ohne mich anzusehen.
»Was?«, frage ich.
»Lassen Sie uns noch einmal … rodeln.«
Wir steigen die Treppe hinauf auf den Berg. Wieder setze ich die bleiche, zitternde Nadja in den Schlitten, wieder fliegen wir in den schrecklichen Abgrund, wieder heult der Wind und surren die Kufen, und wieder, im schnellsten und lautesten Moment des Fluges, sage ich halblaut:
»Ich liebe Sie, Nadjenka!«
Als der Schlitten anhält, lässt Nadjenka den Blick über den Berg schweifen, den wir eben heruntergerodelt sind, dann schaut sie mir lange ins Gesicht, horcht auf meine Stimme, die gleichgültig und leidenschaftslos ist, und ihr ganzer Körper, sogar ihr Muff, ihre Kapuze, ihre ganze kleine Gestalt drücken äußerstes Befremden aus. Und ins Gesicht geschrieben steht ihr:
›Was ist nur? Wer hat jene Worte gesprochen? War er es, oder hat es sich nur so angehört?‹
Diese Ungewissheit beunruhigt sie, raubt ihr die Geduld. Das arme Mädchen antwortet nicht mehr auf Fragen, wird mürrisch, fängt gleich an zu weinen.
»Wollen wir nicht nach Hause gehen?«, frage ich.
»Mir … mir gefällt dieses Rodeln«, sagt sie, errötend. »Wollen wir nicht noch einmal fahren?«
Ihr »gefällt« dieses Rodeln, dabei ist sie, als sie sich in den Schlitten setzt, wie die vorigen Male bleich, atmet kaum und zittert vor Angst.
Wir fahren zum dritten Mal hinunter, und ich sehe, wie sie mir ins Gesicht blickt, meine Lippen beobachtet. Doch ich halte das Taschentuch an die Lippen, räuspere mich, und als wir die Hälfte des Berges hinter uns haben, gelingt es mir zu sagen:
»Ich liebe Sie, Nadja!«
Das Rätsel bleibt ein Rätsel! Nadjenka schweigt, denkt über etwas nach … Ich begleite sie von der Rodelbahn nach Hause, sie bemüht sich, langsam zu gehen, verlangsamt den Schritt und wartet und wartet, ob ich ihr nicht jene Worte sage. Und ich sehe, wie sie leidet, wie sehr sie sich beherrscht, um nicht zu sagen:
›Der Wind kann sie nicht gesagt haben! Ich will auch nicht, dass der Wind sie gesagt hat!‹
Am andern Tage bekomme ich morgens einen Zettel: »Wenn Sie heute rodeln gehen, holen Sie mich ab. N.« Und seit diesem Tage gehen Nadja und ich jeden Tag rodeln, und wenn wir auf dem Schlitten hinunterfliegen, sage ich jedesmal halblaut dieselben Worte:
»Ich liebe Sie, Nadja!«
Bald gewöhnt sich Nadjenka an diesen Satz, wie an Alkohol oder Morphium. Sie kann ohne ihn nicht mehr leben. Zwar hat sie vor dem Fliegen nach wie vor Angst, doch inzwischen verleihen jene Worte von der Liebe der Angst und Gefahr einen besonderen Reiz, Worte, die nach wie vor ein Rätsel bleiben und das Herz schwer machen. In Verdacht stehen immer dieselben zwei: ich und der Wind … Wer von beiden ihr die Liebe erklärt, weiß sie nicht, aber es ist ihr offenbar auch schon egal; egal ist, aus welchem Glas man trinkt, Hauptsache, man wird betrunken.
Eines Tages ging ich um Mittag allein rodeln; in der Menge verloren, sehe ich, wie Nadjenka zum Berg kommt, wie sie mit den Augen nach mir sucht … Dann steigt sie schüchtern die Treppe hinauf … Sie hat Angst, allein zu fahren, ach, welche Angst! Sie ist bleich wie der Schnee, zittert, sie geht wie zur eigenen Hinrichtung, aber geht, geht ohne sich umzuschauen, entschlossen. Offenbar hat sie beschlossen, endlich die Probe zu machen: werden diese wunderbaren süßen Worte auch zu hören sein, wenn ich nicht mitfahre? Ich sehe, wie sie, bleich, mit vor Schrecken geöffnetem Mund, sich in den Schlitten setzt, die Augen schließt, der Welt für immer Lebewohl sagt und sich abstößt … »Ssss …«, surren die Kufen. Ob Nadjenka die Worte hört, ich weiß es nicht … Ich sehe nur, wie sie sich erschöpft und schwach vom Schlitten erhebt. Und ihrem Gesicht ist anzusehen, sie weiß selbst nicht, ob sie die Worte gehört hat oder nicht. Die Angst, während sie den Berg hinunterfuhr, hat sie der Fähigkeit beraubt zu hören, Laute zu unterscheiden, zu verstehen …
Da naht jedoch der Frühlingsmonat März … Die Sonne beginnt zu liebkosen. Unser Eisberg dunkelt, verliert seinen Glanz, schließlich taut er. Wir können nicht mehr rodeln. Die arme Nadjenka wird nirgends mehr jene Worte hören, und es ist auch niemand mehr da, der sie sagen könnte, denn kein Wind ist zu spüren, und ich reise bald nach Petersburg – für lange Zeit, wahrscheinlich für immer.
Irgendwann vor der Abreise, ein zwei Tage vorher, sitze ich bei Dämmerlicht im Garten, der von dem Hof, auf dem Nadjenka lebt, durch einen hohen Bretterzaun mit Nägeln getrennt ist … Noch ist es ziemlich kalt, unter dem Mist liegt noch der Schnee, die Bäume sind tot, doch es riecht schon nach Frühling, und beim Aufsuchen ihres Nachtlagers krächzen laut die Krähen. Ich trete an den Zaun und schaue lange durch einen Spalt. Ich sehe, wie Nadjenka auf die Freitreppe hinaustritt und einen kummervollen, sehnsüchtigen Blick zum Himmel richtet … der Frühlingswind bläst ihr direkt ins bleiche, bedrückte Gesicht … Er erinnert sie an den Wind, der uns damals auf dem Berg entgegenheulte, als sie jene vier Worte hörte, und ihr Gesicht wird traurig, so traurig, über die Wange rollt eine Träne … Und das bleiche Mädchen streckt beide Arme aus, wie um den Wind zu bitten, ihr noch einmal jene Worte zuzutragen. Und ich warte einen Windstoß ab und sage halblaut:
»Ich liebe Sie, Nadja!«
Mein Gott, was geschieht da mit Nadjenka? Sie schreit auf, lächelt, strahlt über das ganze Gesicht und streckt dem Wind die Arme entgegen, voller Freude, glücklich und so schön.
Und ich gehe packen …
Das alles ist lange her. Heute ist Nadjenka verheiratet; ob man sie verheiratet hat oder ob sie selbst gewählt hat – es ist der Sekretär am Vormundschaftsgericht, und sie hat heute drei Kinder. Dass wir damals zusammen rodeln gingen und ihr der Wind die Worte zutrug »Ich liebe Sie, Nadjenka«, ist nicht vergessen; für sie ist das heute die glücklichste, die anrührendste und schönste Erinnerung ihres Lebens …
Und ich kann heute, da ich älter bin, nicht mehr begreifen, warum ich jene Worte gesagt habe, wozu ich mir diesen Scherz erlaubt habe …
Volodja der Große und Volodja der Kleine
Lasst mich, ich will selber lenken! Ich setze mich zum Kutscher! – sagte Sofja Lvovna laut. – Kutscher, warte, ich komme zu dir auf den Bock.
Sie stand im Schlitten, ihr Ehemann Vladimir Nikityč und der Freund ihrer Kindheit Vladimir Michajlyč hielten sie an den Händen, damit sie nicht fiel. Die Trojka fuhr schnell.
– Ich sagte dir doch, man darf ihr keinen Cognac geben, – flüsterte Vladimir Nikityč seinem Gefährten ärgerlich zu. – Du bist mir einer, wirklich!
Der Oberst wusste aus Erfahrung, dass bei Frauen wie seiner Ehefrau Sofja Lvovna auf die stürmische, leicht angetrunkene Heiterkeit gewöhnlich hysterisches Gelächter folgte und dann Weinen. Er befürchtete, dass er sich jetzt, wenn sie nach Hause kämen, statt zu schlafen, mit Kompressen und Tropfen werde abgeben müssen.
– Brrr! – rief Sofja Lvovna. – Ich will lenken!
Sie war aufrichtig heiter und genoss ihren Triumph. Die letzten beiden Monate, seit dem Tage ihrer Hochzeit, hatte sie der Gedanke bedrückt, sie habe Oberst Jagič aus Berechnung geheiratet, wie man so sagt, par dépit; doch heute im Restaurant vor der Stadt hatte sie sich endlich davon überzeugt, dass sie ihn leidenschaftlich liebe. Trotz seiner vierundfünfzig Jahre war er so rank, so schlank und gewandt, scherzte und sang so nett mit den Zigeunerinnen. Wirklich, heutzutage sind die alten Männer tausendmal spannender als die jungen, es sieht so aus, als hätten Alter und Jugend die Rollen getauscht. Der Oberst ist zwei Jahre älter als ihr Vater, aber was kann dieser Umstand schon bedeuten, wenn er, offen gestanden, an Lebenskraft, an Mut und Frische so unermesslich viel mehr hatte als sie, die sie erst dreiundzwanzig war?
»Oh, mein Liebster! – dachte sie. – Wunderbarer!«
Im Restaurant hatte sie sich auch davon überzeugt, dass von dem früheren Gefühl in ihrer Seele nicht einmal ein Funken mehr vorhanden war. Gegen den Freund ihrer Kindheit, Vladimir Michajlyč, oder einfach Volodja, den sie noch gestern bis zum Wahnsinn, bis zur Verzweiflung geliebt hatte, fühlte sie sich heute völlig gleichgültig. Den ganzen heutigen Abend war er ihr schlaff und verschlafen erschienen, uninteressant, unbedeutend, und die Kaltschnäuzigkeit, mit der er sich gewöhnlich um das Zahlen der Zeche drückte, hatte sie diesmal empört, es hatte sie Beherrschung gekostet, ihm nicht zu sagen: »Wenn Sie kein Geld haben, bleiben Sie lieber zu Hause.« Bezahlt hatte alles der Oberst.
Vielleicht, weil an ihren Augen Bäume, Telegraphenmasten und Schneewächten vorbeiflogen, kamen ihr die verschiedensten Dinge in den Sinn. Sie dachte: die Rechnung im Restaurant betrug einhundertundzwanzig, für die Zigeuner noch einmal einhundert, und morgen, wenn sie Lust dazu verspürte, könnte sie sogar tausend Rubel in den Wind werfen, vor zwei Monaten dagegen, vor ihrer Hochzeit, hatte sie nicht einmal drei Rubel eigenes Geld und musste sich wegen jeder noch so kleinen Kleinigkeit an ihren Vater wenden. Was für eine Veränderung im Leben!
Ihre Gedanken gingen durcheinander, und sie erinnerte sich, wie Oberst Jagič, ihr jetziger Ehemann, als sie zehn Jahre alt war, ihrer Tante den Hof gemacht hatte und alle im Hause sagten, er habe ihr Leben ruiniert, und in der Tat kam die Tante oft mit verweinten Augen zum Essen und reiste ständig irgendwohin, und man sagte von ihr, die Ärmste fände keinen Platz für sich im Leben. Er war damals ein sehr schöner Mann und hatte außergewöhnlichen Erfolg bei den Frauen, so dass die ganze Stadt ihn kannte und man von ihm erzählte, er führe jeden Tag zu seinen Verehrerinnen auf Visite wie ein Arzt zu seinen Patienten. Noch heute, trotz grauer Haare, Falten und der Brille, erscheint manchmal sein hageres Gesicht, besonders im Profil, sehr schön.
Sofja Lvovnas Vater war Militärarzt und hatte eine Zeitlang im selben Regiment wie Jagič gedient. Volodjas Vater war ebenfalls Militärarzt und hatte ebenfalls im selben Regiment gedient wie ihr Vater und Jagič. Trotz oft sehr komplizierter und unruhiger Liebesabenteuer war Volodja ein sehr guter Student gewesen; er hatte sein Studium mit großem Erfolg abgeschlossen und danach als Spezialgebiet ausländische Literatur gewählt und schreibt nun, wie man erzählt, an seiner Dissertation. Er lebt in der Kaserne, bei seinem Vater, dem Militärarzt, und hat kein eigenes Geld, obwohl er schon dreißig Jahre alt ist. Als Kinder lebten Sofja Lvovna und er in verschiedenen Wohnungen, aber unter demselben Dach, und er kam oft zum Spielen zu ihr, sie lernten gemeinsam Tanzen und Französisch; als er jedoch erwachsen und ein schlanker, schöner junger Mann geworden war, schämte sie sich vor ihm, dann verliebte sie sich in ihn bis zum Wahnsinn und liebte ihn bis zuletzt, bis Jagič sie heiratete. Er hatte ebenfalls außergewöhnlichen Erfolg bei den Frauen, schon seit er vierzehn war, und die Damen, die ihre Ehemänner mit ihm betrogen, rechtfertigten sich damit, dass Volodja so klein war. Neulich hatte jemand von ihm erzählt, er habe als Student in einem Zimmer gewohnt, in Universitätsnähe, und jedes Mal, wenn man bei ihm anklopfte, habe man hinter der Tür seine Schritte zu hören bekommen und dann, halblaut, die Entschuldigung: »Pardon, je ne suis pas seul.« Jagič war von ihm entzückt und hatte ihm fürs Weitere seinen Segen erteilt, wie Deržavin Puškin, er mochte ihn ganz offensichtlich. Beide spielten stundenlang schweigend Billard oder Piquet, und wenn Jagič mit der Trojka irgendwohin fuhr, nahm er Volodja mit, Jagič war auch der Einzige, den Volodja in die Geheimnisse seiner Dissertation eingeweiht hatte. In der ersten Zeit, als der Oberst noch jünger war, waren beide oft als Rivalen aufeinandergetroffen, aber nie eifersüchtig aufeinander gewesen. In der Gesellschaft, in der sie gemeinsam auftraten, nannte man Jagič Volodja den Großen, seinen Freund hingegen Volodja den Kleinen.
In dem Schlitten saß, außer Volodja dem Großen, Volodja dem Kleinen und Sofja Lvovna, noch eine weitere Person – Margarita Aleksandrovna oder, wie man sie sonst nannte, Rita, die Cousine von Frau Jagič, eine Jungfer von über dreißig, sehr blass, mit schwarzen Augenbrauen, pince-nez, Kettenraucherin selbst bei strengem Frost; ständig lag ihr die Asche auf der Brust, auf den Knien. Sie sprach durch die Nase, jedes einzelne Wort in die Länge ziehend, war kalt, konnte Cognac und Liqueur trinken, so viel sie wollte, ohne betrunken zu werden, und erzählte ständig zweideutige Witze, aber träge und geschmacklos. Zu Hause las sie von früh bis spät dicke Zeitschriften, um sie mit Asche zu bestreuen, oder aß gefrorene Äpfel.
– Sofja, hör auf zu toben, – sagte sie näselnd. – Wirklich, es ist geradezu töricht.
Im Angesicht des Stadttors fuhr die Trojka langsamer, Häuser und Menschen flogen vorbei, und Sofja Lvovna wurde ruhiger, schmiegte sich an ihren Mann und gab sich ganz ihren Gedanken hin. Volodja der Kleine saß ihr gegenüber. Jetzt mischten sich unter die heiteren, leichten Gedanken bereits finstere. Sie dachte: dieser Mensch, ihr gegenüber, wusste, dass sie ihn liebte, und hatte ihrem Gerede natürlich geglaubt, dass sie den Obersten par dépit geheiratet habe. Sie hatte ihm noch nie eine Liebeserklärung gemacht und wollte nicht, dass er es wusste, und so verbarg sie ihr Gefühl, seinem Gesicht jedoch war anzusehen, dass er sie sehr genau verstand – und ihre Eitelkeit war gekränkt. Das Erniedrigendste an ihrer Lage aber war, dass Volodja der Kleine ihr plötzlich, nach der Hochzeit, Beachtung schenkte, was früher nie der Fall gewesen war, dass er stundenlang bei ihr saß, schweigend oder über irgendwelche Kleinigkeiten schwatzend, oder jetzt im Schlitten, ohne sich mit ihr zu unterhalten, ihren Fuß berührte und ihr die Hand drückte; offenbar hatte er nur darauf gewartet, dass sie heiraten würde; und offenbar war auch, dass er sie verachtete und dass sie in ihm lediglich das Interesse der bewussten Art weckte, wie eine schlechte, unanständige Frau. Und als in ihrer Seele der Triumph und die Liebe zu ihrem Ehemann verschmolzen mit dem Gefühl der Erniedrigung und des gekränkten Stolzes, da überkam sie die Aufsässigkeit, da wollte sie sich auf den Kutschbock setzen und schreien, pfeifen …
Genau zu dem Zeitpunkt, als sie am Nonnenkloster vorbeifuhren, erscholl der Schlag einer tausend Pud schweren Glocke. Rita bekreuzigte sich.
– In diesem Kloster ist unsere Olja, – sagte Sofja Lvovna, bekreuzigte sich ebenfalls und fuhr zusammen.
– Warum ist sie ins Kloster gegangen? – fragte der Oberst.
– Par dépit, – gab Rita zornig zur Antwort, offenbar in Anspielung auf Sofja Lvovnas Ehe mit Jagič. – Das par dépit ist heute in Mode. Die Herausforderung an alle Welt. Sie lachte gern, war furchtbar kokett, liebte nichts als Bälle und Kavaliere und plötzlich – seht her! Hat sie uns überrascht!
– Das stimmt nicht, – sagte Volodja der Kleine, schlug den Kragen seines Pelzmantels herab und zeigte sein schönes Gesicht. – Das war kein par dépit, sondern das blanke Entsetzen, wenn Sie so wollen. Man hat ihren Bruder, Dmitrij, zu Zwangsarbeit verurteilt, und niemand weiß heute, wo er ist. Ihre Mutter ist vor Kummer gestorben.
Er schlug den Kragen wieder hoch.
– Und Olja hat recht getan, – fügte er dumpf hinzu. – Ein Dasein als Pflegetochter, noch dazu mit einem Goldstück wie Sofja Lvovna an der Seite – das muss man sich schon überlegen!
Sofja Lvovna hörte den verächtlichen Ton in seiner Stimme und wollte ihm eine Frechheit erwidern, schwieg aber. Wieder überkam sie die Aufsässigkeit. Sie hob sich auf die Füße und rief mit weinerlicher Stimme:
– Ich will zur Frühmesse! Kutscher, zurück! Ich will Olja sehen!
Sie wendeten. Der Klang der Klosterglocke war voll und erinnerte, wie es Sofja Lvovna schien, durch irgendetwas an Oljas Leben. Geläutet wurde auch in den anderen Kirchen. Als der Kutscher die Trojka zum Stehen gebracht hatte, sprang Sofja Lvovna aus dem Schlitten und ging allein, ohne Begleitung, schnellen Schrittes auf das Tor zu.
– Bitte, beeil dich! – rief ihr der Ehemann nach. – Es ist schon spät!
Sie ging durch das dunkle Tor, dann die Allee entlang, die vom Tor zur Hauptkirche führte, und der Schnee knirschte unter ihren Füßen, der Glockenklang erscholl bereits direkt über ihrem Kopf und durchdrang, wie es schien, ihr ganzes Wesen. Da die Kirchentür, drei Stufen abwärts, dann die Vorhalle mit den Heiligenbildern auf beiden Seiten, es roch nach Wacholder und Weihrauch, wieder eine Tür, und ihr öffnet eine dunkle kleine Gestalt und verbeugt sich tief, tief … Der Gottesdienst in der Kirche hatte noch nicht begonnen. Eine Nonne ging vor dem Ikonostas auf und ab und steckte die Kerzen auf den Ständern an, eine andere den Kronleuchter. Da und dort, in der Nähe der Säulen und Nebenaltäre, standen reglos schwarze Gestalten. »Wenn sie jetzt schon da stehen, stehen sie da bis zum Morgen«, – dachte Sofja Lvovna, und es schien ihr hier dunkel, kalt, langweilig – langweiliger als auf einem Friedhof. Gelangweilt schaute sie auf die reglosen, erstarrten Gestalten, und plötzlich krampfte sich ihr Herz zusammen. Aus irgendeinem Grunde erkannte sie in einer der Nonnen, einer kleinen, mit schmächtigen Schultern und schwarzem Kopftuch, Olja, obwohl Olja, als sie ins Kloster ging, kräftig und wohl auch größer gewesen war. Unschlüssig, in unerklärlich heftiger Erregung trat Sofja Lvovna auf die Novizin zu und blickte ihr über die Schulter ins Gesicht, und erkannte Olja.
– Olja! – sagte sie und klatschte in die Hände, und konnte vor Erregung nicht weitersprechen. – Olja!
Die Nonne erkannte sie sofort, hob erstaunt die Brauen, und ihr bleiches, frisch gewaschenes, reines Gesicht, sogar das weiße Tuch, das unter dem Kopftuch hervorschaute, schienen vor Freude zu strahlen.
– Der Herr hat ein Wunder vollbracht, – sagte sie und klatschte ebenfalls in ihre mageren, bleichen Händchen.
Sofja Lvovna umarmte sie fest und küsste sie, wobei sie befürchtete, sie könne nach Alkohol riechen.
– Wir sind eben hier vorbeigefahren und haben an dich gedacht, – sagte sie, schwer atmend wie von schnellem Gehen. – Herrgott, bist du blass! Ich … ich freue mich sehr, dich zu sehen. Und, was ist? Wie geht es? Hast du Sehnsucht?
Sofja Lvovna wandte sich zu den anderen Nonnen um und fuhr nun mit leiser Stimme fort:
– Bei uns gibt es so viele Veränderungen … Du weißt, ich habe Jagič geheiratet, Vladimir Nikityč. Du erinnerst dich wahrscheinlich an ihn … Ich bin sehr glücklich mit ihm.
– Na, Gott sei Dank. Und geht es deinem Vater gut?
– Ja. Er denkt viel an dich. Olja, komm uns doch an den Feiertagen besuchen. Hörst du?
– Ich werde kommen, – sagte Olja und lächelte zwinkernd. – Am zweiten Feiertag.
Ohne zu wissen worüber, fing Sofja Lvovna an zu weinen und weinte einen Augenblick schweigend, dann wischte sie sich die Augen und sagte:
– Rita wird es sehr bedauern, dich nicht gesehen zu haben. Sie ist mit uns hier. Volodja auch. Sie halten am Tor. Sie würden sich so freuen, dich zu sehen! Gehen wir, die Messe hat ja noch nicht angefangen.
– Gehen wir, – willigte Olja ein.
Sie bekreuzigte sich dreimal und ging mit Sofja Lvovna dem Ausgang zu.
– Du sagst also, Sonečka, du seist glücklich? – fragte sie, als das Tor hinter ihnen lag.
– Ja, sehr.
– Na. Gott sei Dank.
Volodja der Große und Volodja der Kleine stiegen beim Anblick der Nonne aus dem Schlitten und begrüßten sie ehrerbietig; beide waren sichtlich gerührt von ihrem bleichen Gesicht und ihrem schwarzen Nonnengewand, und beiden war angenehm, dass sie sich ihrer erinnert hatte und gekommen war, sie zu begrüßen. Damit ihr nicht kalt wurde, hüllte Sofja Lvovna sie in ein Plaid und deckte eine Hälfte ihres Pelzmantels über sie. Die kurz zuvor vergossenen Tränen hatten ihre Seele erleichtert und aufgehellt, und sie war froh, dass diese geräuschvolle, unruhige und im Grunde unreine Nacht unverhofft ein so reines und sanftes Ende gefunden hatte. Um Olja noch länger um sich zu haben, schlug sie vor:
– Fahren wir spazieren. Olja, steig ein, nur ein Stückchen.