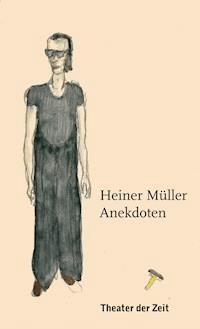17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer ist es an der Zeit, die Texte Heiner Müllers neu zu lesen. Der Begriffsflitter der verflossenen Postmoderne konnte ihnen ebenso wenig etwas anhaben wie die ideologische Zensur der Open Society. Zu entdecken sind prophetische Analysen, die Elend und Schrecken des triumphierenden Kapitalismus im Voraus zur Sprache bringen.
Der Band legt eine Auswahl bekannter und weniger bekannter Texte Heiner Müllers zum Kapitalismus vor. Die Gliederung orientiert sich an fünf grundlegenden Aspekten der Kritik, die das Gesamtwerk durchziehen: die Dialektik des Kapitals, der Affekt des Ekels, die Kritik der Sprache, die Frage der Religion, die Permanenz des Krieges. Eingeleitet werden die einzelnen Kapitel jeweils durch ein kurzes Vorwort, das einen möglichen Zugriff auf die Texte eröffnen soll. Es geht darum, der Chance, die Heiner Müller als Dialektiker noch in der völligen »Ratlosigkeit des Denkens« erkannt hat, einen Denkraum zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Ähnliche
Der Band legt eine Auswahl bekannter und weniger bekannter Texte Heiner Müllers zum Kapitalismus vor. Die Gliederung orientiert sich an fünf grundlegenden Aspekten der Kritik, die das Gesamtwerk durchziehen: die Dialektik des Kapitals, der Affekt des Ekels, die Kritik der Sprache, die Frage der Religion, die Permanenz des Krieges. Eingeleitet werden die einzelnen Kapitel jeweils durch ein kurzes Vorwort, das einen möglichen Zugriff auf die Texte eröffnen soll. Es geht darum, der Chance, die Heiner Müller als Dialektiker noch in der völligen »Ratlosigkeit des Denkens« erkannt hat, einen Denkraum zu geben.
Heiner Müller (1929-1995) war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und Theaterregisseure nach 1945. Berühmt wurde er unter anderem durch die Stücke Der Lohndrücker, Germania 3 Gespenster am Toten Mann und Die Hamletmaschine sowie – insbesondere nach 1989 – durch zahlreiche Interviews und Gespräche. Sein Werk, das auch Lyrik und Prosa umfasst, ist im Suhrkamp Verlag erschienen.
Heiner Müller
»Für alle reicht es nicht«
Texte zum Kapitalismus
Herausgegeben von Helen Müller und
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der edition suhrkamp 2711.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept
Inhalt
Vorwort
IKapitalismus und Kapitalismuskritik
Der doppelte Betrug
Texte
IIEkel
Leben in diesem trüben Menschenbrei
Texte
IIISprache
Die Wahrheit ist konkret, ich atme Steine
Texte
IVReligion
Gott ist die Wüste
Texte
VKrieg
Vorwort
SOLANGE ES HERREN UND SKLAVEN GIBT, SIND WIR AUS UNSEREM AUFTRAG NICHT ENTLASSEN.
Das Grundprinzip der Wirtschafts- und Sozialordnung, die im Dienst der Erwirtschaftung von Mehrwert steht, des Kapitals also, ist ebenso einfach wie dunkel. Heiner Müller hat es 1994/95 umschrieben: »Und jetzt heißt es in den reichen Ländern, mit Blick auf die wachsenden, übervölkerten und näher rückenden Armutszonen: ›Für alle reicht es nicht.‹ Daraus folgt die Selektion.«1 Die Sätze betreffen den dunklen, negativen Kern einer Produktions-, Arbeits- und Konsumordnung, die davon lebt, dass permanent Ungleichgewichte, Differenzen, Konkurrenzen, Niveauunterschiede, Armut und Mangel entstehen: »ein paar müssen verhungern, damit die andern essen können«.2 Denn Mehrwert entsteht zwar dadurch, dass die Angebote die Nachfragen befriedigen, aber eben nur für die, die dafür zahlen können. Die Nachfrage aller anderen bleibt unbefriedigt, und das in Permanenz: Es wird nie ganz reichen für alle, ganz gleich, wie viel Überfluss vorhanden ist. Das Lebensprinzip des Kapitalismus ist gerade nicht die Befriedigung der sogenannten Bedürfnisse. Es ist ihre auf Dauer gestellte Nichtbefriedigung, die allein die Dynamik der fortgesetzten Wertschöpfung gewährleistet. Müllers lakonische Wendungen formulieren keine frohe Botschaft. Sie widersprechen dem Optimismus eines politisch-ökonomischen Systems, das sich selbst als emanzipatorische Fortschrittsdynamik, den Garanten individueller Freiheit, des friedlichen Tauschhandels und des allgemeinen Wohlstands beschreibt. Müller bestreitet diese Selbstpräsentation mit Marx sowohl theoretisch als auch – mit dem traumatisierten Blick auf die Geschichte – empirisch. Im Gespräch mit Frank Castorf zeichnet er die historische Linie der kapitalistischen Selektionswirklichkeit – explizit gemacht im dramatischen Text Germania 3 Gespenster am toten Mann und im Langgedicht Ajax zum Beispiel – unmissverständlich nach.
Gegen die kommunistische Lebenslüge ›Keiner oder alle‹ hat Hitler gesetzt: ›Für alle reicht es nicht‹. Das hat Hitler auf den Punkt gebracht, schon in seiner Rede vor dem Industrieclub 1932: Der Lebensstandard der weißen Rasse kann nur gehalten werden, wenn der der anderen Rassen sinkt. Die Selektion ist nach wie vor das Prinzip der Politik der Industriestaaten. Insofern hat Hitler gewonnen.3
1994/95, im Jahrzehnt der boomenden New Economy, der privatisierten Telekommunikation, der Börsengänge und irren Gewinnmargen, der Abwicklung der öffentlichen Dienste und strategischen Fusionen, fielen jene Sätze Müllers, welche den Triumph des kapitalistischen Prinzips der Selektion über das Prinzip einer gerechten Verteilung für alle konstatierten, in taube, unverständige Ohren. Die Behauptung, dass es einen systematischen Zusammenhang gebe zwischen Hitlers massenmörderischen Selektionen und der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, zwischen Auschwitz und der Deutschen Bank (aber auch: I. G. Farben, VW, Thyssen, Bertelsmann, Audi, Hugo Boss, Oetker usw.), erschien verrückt. Sie wurde als vollkommen obsolete, irrige und bösartige Geschichtsauffassung disqualifiziert, die mit dem zur Evidenz geronnenen politischen Konsens unvereinbar war. Im bundesrepublikanischen Westen hatte man derlei zuletzt in den 1970er Jahren aus dem Mund verblendeter RAF-Terroristen gehört. Diese hatten (aufgrund mangelnden historischen Differenzierungsvermögens) nicht vergessen wollen, dass (und weswegen) Hanns-Martin Schleyer, der ehemalige SS-Untersturmführer und nachmalige Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, ab dem 1. April 1943 als Sachbearbeiter im Zentralverband der Industrie für Böhmen und Mähren mit der Arisierung der tschechischen Wirtschaft und der Beschaffung von Zwangsarbeitern für das Deutsche Reich befasst gewesen war.
Die Mehrheit der deutschen Intelligenz hielt Müllers Äußerungen für postmodernen Trash-Talk beziehungsweise für das apokalyptische Bühnenbild eines zynisch verzweifelten DDR-Dramatikers, dem gerade Land und Publikum abhandengekommen waren. Oder aber man denunzierte ihn als politisch unverbesserlichen Stalinisten, SED- und Stasi-Sympathisanten, der von Demokratie, Marktwirtschaft, Freiheit, reflexiver Moderne, Menschenrechten, Eigenverantwortung usw. (noch immer) nichts verstand und der überdies die ehrlichen deutschen Bemühungen um Vergangenheitsbewältigung und Versöhnung böswillig ignorierte. Hatte die BMW-Group nicht gerade eine Studie zur Aufarbeitung ihrer Verstrickungen in das NS-Regime in Auftrag geben wollen? – Müllers Behauptungen erschienen als boshafte Verleumdung: als Theater-Donner eines DDR-Nostalgikers oder – so die andere Seite der Kritik – als schamlose Selbstvermarktungsaktion eines Radical chic-Autors, der den internationalen Erfolg von Stücken wie Germania Tod in Berlin, Mauser, Hamletmaschine, Wolokolamsker Chaussee auf die Leichenberge der Weltkriege und der Lager gebaut hatte. Im Kontext der Berliner Republik, des Postnationalismus und ökumenischen Multi-Kulturalismus, der friedlichen deutschen Revolution und der Beendigung der Konfrontation der Blöcke, des globalen Welthandels und des Endes der kommunistischen Illusion schienen Müllers blutige Katastrophenszenarien längst überholt zu sein, angestaubte Dokumente einer »enigmatischen Gestrigkeit«,4 die demnächst nur noch mit Hilfe spezialisierter Historiker zu entziffern sein würden.
Doch dann ist alles ganz anders gekommen. Die DDR war zwar 1990 untergegangen, aber gewonnen hatten nicht allein Demokratie und Freiheit, sondern auch das von Müller als strukturimmanent verstandene Selektionsprinzip. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts klingt seine provokante Faustformel zum Kapitalismus – Für alle reicht es nicht – jedenfalls entschieden weniger enigmatisch als die Triumph- und Wohlstandsreden der Sieger aus dem Kalten Krieg. In den Jahrzehnten nach 1990 haben nicht Frieden und Wohlstand, nicht blühende Landschaften und das kindlich-naive Vertrauen in die Gesetzlichkeiten oder harmonischen Gleichgewichte des freien Marktes zugenommen, sondern zugenommen haben (vom Reichtum der Reichen und Superreichen einmal abgesehen) Arbeitslosigkeit, Armut, Kriege, soziale und politische Gewalt; die Beschäftigungsverhältnisse sind in einem bisher ungeahnten Ausmaß prekär geworden; die Jugendarbeitslosigkeit hat in Teilen der europäischen Welt beschämende Prozentziffern erreicht; Deutschland hat sich den Ausbau eines Niedriglohnsektors geleistet; die weltweit ungleiche Verteilung der Reichtümer hat massiv zugenommen. »Das reichste Prozent der Weltbevölkerung«, so die Oxfam-Studie aus dem Jahr 2016, »verfügt über mehr Vermögen als der Rest der Welt zusammen – dies zeigt eine Analyse der Zahlen des Credit Suisse Wealth Reports 2015. 2015 besaßen 62 Einzelpersonen (davon 53 Männer) genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das heißt rund 3,6 Milliarden Menschen.«5
Auch hat der Sieg des realexistierenden Kapitalismus über den realexistierenden Sozialismus nicht zu einem friedlicheren Miteinander sowohl innerhalb der Gesellschaften als auch zwischen ihnen geführt. Die Fragen, die sich ein Vierteljahrhundert nach dem Triumph stellen, lauten anders: »Warum beklatschen Leute in Sachsen brennende Asylbewerberheime? Warum marschieren 5000 Menschen durch Zagreb und rufen den Ustaša-Gruß ›Fürs Vaterland bereit‹ – das ist unser ›Sieg Heil!‹? Warum schießen junge Leute in Paris in volle Konzertsäle?«6 Genauso wenig hat der Sieg des Kapitalismus zu einem globalen Konsens über das Telos oder das Ende der Geschichte geführt.
Was 1990 begann, war lediglich – hier ist die marxistische Diagnose des Dramatikers Müller genauer als die Spekulationen des Neoliberalismus – eine weitere Epoche innerhalb der kapitalistischen Krisengeschichte, die mit neuen dramatischen Zusammenbrüchen, neuen sozialen Konflikten und neuen Nationalismen aufwartete, mit Finanzkrisen ungeahnter Größe, mit ökologischen und soziopolitischen Katastrophen, mit neofeudalen Formen der Lohnabhängigkeit und Tagelöhnerei und, last but not least, mit dem Aufbrechen einer Unzahl neuer, ebenso asymmetrisch wie barbarisch geführter Terrorkriege mitsamt den entsprechenden Flüchtlingsströmen: in Afrika, Südosteuropa, Asien, im Nahen und im Mittleren Osten. In deutschen Tageszeitungen finden sich seit der Finanzkrise von 2007 Sätze, die in den 1990er Jahren noch als linksradikale Delirien denunziert worden wären: »Verteilungskämpfe sind in dieser Gesellschaft unvermeidlich. […] Sie werden den Alltag der Menschen bestimmen, die die vergleichsweise schlechtesten Lebensbedingungen haben.«7 Der römische Papst gibt im Jahr 2014 Erklärungen zur Lage der Welt ab, die in den Ohren der Aufsichtsräte und Vorstandsvorsitzenden der DAX-NIKKEI-NASDAQ-DOW-JONES-Konzerne wie Reden des einstigen großen kommunistischen Widersachers klingen:
Wenn man Fotos von unterernährten Kindern in verschiedenen Teilen der Welt sieht, dann fasst man sich an den Kopf. Das ist nicht zu verstehen! Wir befinden uns in einem Weltwirtschaftssystem, das nicht gut ist. Im Zentrum jedes Wirtschaftssystems muss der Mensch stehen […]. Aber wir haben das Geld zu Gott gemacht. Wir sind […] dem Götzendienst des Geldes verfallen. Die Wirtschaft wird nur vom Bestreben in Gang gehalten, immer mehr zu haben. […] Jetzt ist es Mode geworden, die Jugendlichen durch Arbeitslosigkeit auszuschließen. Die Arbeitslosenquote in manchen Ländern beträgt mehr als 50 Prozent. Jemand hat mir gesagt, dass in Europa 75 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos sind. Das ist Wahnsinn, es ist barbarisch. Wir schließen eine ganze Generation aus, um ein Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, das nicht mehr zu ertragen ist; ein System, das Krieg führen muss, um zu überleben, wie es die großen Imperien immer getan haben. Aber weil man keinen Dritten Weltkrieg führen kann, führt man regionale Kriege. Und was bedeutet das? Dass Waffen produziert und verkauft werden. Dadurch wird offenbar die Bilanz der Wirtschaft saniert, und so sanieren sich die wichtigsten Wirtschaftsblöcke der Welt, die dem Götzen Geld den Menschen als Opfer vor die Füße legen.8
Kurzum, Müllers ätzender Satz aus dem Jahr 1995 war alles andere als ein zu spät gekommenes stalinistisches Hirngespinst. Es war die hellsichtige Beschreibung einer mörderischen geschichtlichen Realität, die vor den Küsten Lampedusas und Siziliens, in den Transitzonen der Flughäfen, in allen Auffang- und Durchgangslagern, an den Grenzzäunen Spaniens, Ungarns oder Mazedoniens Alltag geworden ist. Selbst den allerletzten Anhängern der Open Society dürfte das allmählich einleuchten – wie dunkel und unbehaglich auch immer.
Reden, die von den historischen Zeitgenossen für verrückt erklärt werden, ein paar Jahre später aber alle Evidenz des Realen auf ihrer Seite haben, sind prophetische Reden. Prophetien sind Einspruch, nicht Irrsinn. Sie haben – wie ein Blick in die Bibel zeigt, auf Moses oder Jonas – mit der Zerstörung von Götzen, Kultpraktiken und Ideologien zu tun, mit dem Außerkraftsetzen von Wahrnehmungsroutinen, dem Anprangern von Ungerechtigkeit und Ignoranz, mit dem Zorn auf unerträgliche Verhältnisse. Gilles Deleuze und Félix Guattari haben die Figur des Propheten deswegen auch als Figur des antiimperialen Widerstands und des ideologischen Verrats charakterisiert.
Der Prophet, der wahre Mensch, hört in seinem göttlichen Zorn nicht auf – das ist die Positivität seiner Fluchtlinie –, Gott zu verraten, so wie Gott umgekehrt nicht aufhört, den Menschen zu verraten. […] Der Prophet ist kein Priester, er interpretiert nicht. […] Er spürt stattdessen die Mächte des Kommenden auf, die Zukunft, die sich bereits ankündigt.9
Die Wirklichkeit, wie sie sich in der semiotischen Ordnung der Prophetie zeigt, geht prinzipiell aus einem geschichtlichen Auftrag hervor: Knechtschaft und Unterdrückung zu beseitigen, ideologische Götzenbilder zu stürzen, Gerechtigkeit herzustellen. Während die intellektuellen Angestellten der herrschenden Mächte die Welt stets nur im Rahmen der etablierten Ordnung rechtfertigen, erklären und auslegen, zielt die prophetische Rede auf etwas anderes, nämlich auf etwas, das jene mit allen Mitteln zu verhindern suchen: das Ende der Welt, wie sie ist, kurz, auf den revolutionären Zusammenbruch und ein noch ungesehenes Jenseits der historisch gegebenen Welt. Ein prophetischer Blick auf die Wirklichkeit sieht immer auch – das trägt ihm prompt den Vorwurf des Nihilismus, der Zerstörungswut und des Größenwahns ein – ihre Vergänglichkeit in der Geschichte; einfacher gesagt, er nimmt sie als veränderliche, wandelbare Wirklichkeit wahr, als Welt, die gekommen ist, die aber auch wieder gehen wird. Er hängt nicht an ihr – und er ist ihr nicht zu Diensten.
Dass Heiner Müller die Welt mit prophetischen Augen sieht, dass sein Blick aus der Welt des Auftrags stammt, nicht aus der Welt der staatstragenden Intellektuellen, der Experten, Journalisten, Pressesprecher und Kommunikationsstrategen, wird nicht nur an Texten wie dem des Engels der Verzweiflung deutlich: »Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem.«10 Ebenso bilden Müllers Sätze zum Kapitalismus kein ökonomisches Theorem und keine wissenschaftliche, theoretische Hypothese, sondern sind Einspruch gegen die »schaurige kapitalistische Welt«.11 Es ist ein analytischer, zersetzender Blick, der die heraufziehenden Verteilungskämpfe sieht, wie sie aus dem Ausschluss derjenigen entstehen, für die es nicht gereicht haben wird. Weil es schon da und absehbar war, konnte Heiner Müller im Jahr 1991 lapidar beschreiben, was spätestens seit dem zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sichtbare Realität für jedermann geworden ist.
Das [Horkheimers Vision der Zukunft als total verwalteter Welt und Aldous Huxleys Schöne neue Welt] ist die pessimistische Variante der Hoffnung, dass die Festung Europa auf Dauer gehalten werden kann. All diese Visionen unterschlagen, dass die dritte Welt eine Macht ist; dass die, auf deren Kosten man lebt, dem nicht ewig tatenlos zusehen werden. Dazu bedarf es keiner militärisch-ökonomischen Stärke. Es reicht völlig, wenn sich Millionen Verelendeter in Bewegung setzen.12
Und nicht weniger prophetisch ist der Blick, den Müller auf diejenigen wirft, die von der Verelendung, die sie geschäftig vorantreiben, nichts wissen wollen, die dennoch aber – jetzt schon, auch wenn niemand es sehen und hören will – gerichtet sind:
NACHTFLUG FRANKFURT TOKYO
Stewardessen trippeln
Durch den fliegenden Sarg
Die Leichen
Schlafen
MORGEN FRÜH WENN GOTT WILL
Die Geschäfte13
Im Rückblick wird deutlich, wie ungenau Heiner Müllers präzise formulierten Texte in der gerade verflossenen Postmoderne der 1990er und 2000er Jahre gelesen worden sind, wie unverständlich sie im Kontext des ruchlosen Optimismus waren, der das Ende des Kalten Krieges begleitete, und wie wenig ernst man seine Bilder und Szenen, seine analytischen Überlegungen und prognostischen Beobachtungen in einer Welt nehmen konnte, die Kapitalismuskritik für eine überwundene Kinderkrankheit hielt.
Der vorliegende Band schlägt deswegen vor, die Texte noch einmal neu zu lesen, und zwar nicht nur als das abgeschlossene literarische Werk eines Klassikers, zu dem Müller inzwischen geworden ist, sondern als weiterhin aktuellen Eingriff in die geschichtliche Wirklichkeit und ihre Widersprüche, Konflikte und Kriege. Der Band enthält eine anthologische Zusammenstellung von lyrischen, dramatischen und Prosatexten sowie von Auszügen aus den Gesprächen, die Müller seit den siebziger Jahren mit Vertretern der Intelligenz aus Ost und West zur Wirklichkeit des Kapitalismus geführt hat. Es geht darum, den prophetischen, Konflikt- und Zerstörungslinien präzise nach- und vorauszeichnenden Blick Müllers für die Gegenwart präsent und kritisch offen zu halten.
Die fünf Kapitel der vorliegenden Anthologie greifen spezifische Aspekte der Auseinandersetzung Müllers mit dem Kapitalismus auf. Im Einzelnen geht es um die kapitalismuskritische Analyse der Konfrontation der Blöcke, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind (1), um den Affekt des Ekels angesichts der unmenschlichen Verelendung und des kannibalischen Konsums, die der Kapitalismus erzeugt (2), um die kapitalistisch instrumentalisierte Sprache (3), um die nach wie vor virulente Frage der Religion (4) und schließlich um die kontinuierliche Gegenwart des Krieges (5).
Eingeleitet werden die Kapitel jeweils von einem knappen Problemaufriss, der einen theoretischen Horizont bieten will, innerhalb dessen die ausgewählten Texte – vielleicht anders als bisher – kontextualisiert werden können. Im besten Fall sind die Einleitungen als Lesehilfen zu verstehen, während die Texte und Textauszüge aus dem Werk für sich selbst sprechen und sprechen sollen. Müllers Texte folgen keiner Idee systematischer Ganzheit oder Geschlossenheit, auch keiner theoretisch ausgearbeiteten Ästhetik; dementsprechend wird auch mit der vorliegenden Auswahl kein Anspruch auf systematische Vollständigkeit erhoben. Es geht nicht um die Rekonstruktion einer Müller'schen Theorie des Kapitalismus (die es nicht gibt), sondern um die kritische Problematisierung einer Welt, die es verdient hat, wahrgenommen, gedacht und verändert zu werden.
Die Zusammenstellung der Texte nach thematischen Aspekten führt jenes Prinzip fort, das sich bei der Sichtung der Manuskripte des Autors als dessen Arbeitsprinzip gezeigt hat: die konstellative Zusammenstellung von Namen, Gedanken, Zitaten, Zeiten, Orten, Stückfragmenten zu graphischen Gebilden, die vielleicht den Denkbildern von Walter Benjamin am nächsten kommt; eine schwebende Vermittlung von Poesie und Reflexion, im Sinne anschaulicher Erkenntnis. Denn, wie Müller 1991 formulierte,
in dieser Ratlosigkeit des Denkens liegt auch die Chance, zu etwas anderem zu kommen – zur Verbindung von Kunst und Philosophie, die nicht mehr auflösbar ist. Bislang hatte die Philosophie keine Chance, in Kunst aufzugehen, und die Kunst keine in Philosophie. Das ist seit Jahrhunderten der Normalzustand. Nach dem Ende der Aufklärung bleibt nur noch die Kunst. Alles andere ist ruiniert, der Glaube und das Denken. Jetzt wird es möglich, das zusammenzubringen, was die Aufklärung so sorgsam getrennt hat.14
Anmerkungen
1
Heiner Müller, »›Die Wahrheit, leise und unerträglich‹. Ein Gespräch mit Heiner Müller. Von Peter Becker«, in: Werke, Band 12: Gespräche 3. 1991-1995, herausgegeben von Frank Hörnigk, redaktionelle Mitarbeit: Kristin Schulz, Ludwig Haugk, Christian Hippe und Ingo Way, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, S. 767.
2
Ders., »Die Reflexion ist am Ende, die Zukunft gehört der Kunst«, in: Werke 12, S. 12.
3
Ders., »Endlich hat Hitler den Krieg gewonnen. Gespräch mit Heiner Müller über Hitler und Stalin und den Humanismus als letzten Mythos (Teil 2)«, in: Werke 12, S. 689f.
4
Eleonore Büning, »Wolfgang Rihm in Zürich. Plaste-Haie singen sie zur Ruh«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Januar 2016.
5
Ein Wirtschaftssystem für die Superreichen. Wie ein unfaires Steuersystem und Steueroasen die soziale Ungleichheit verschärfen, herausgegeben von Oxfam Deutschland e. V., Berlin: Selbstverlag 2016, S. 2.
6
Nenad Popovic, »Neue Rechte. Ein Gespräch«, in: Die Zeit, Nr. 10, 26. Februar 2016, S. 40.
7
Frank Lübberding, »Verteilungskämpfe werden unvermeidlich«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Februar 2016.
8
Papst Franziskus, in: La Vanguardia, 9. Juni 2014.
9
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Mille Plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit 1980, S. 155f. (Aus dem Französischen von C. P.); vgl. dies., Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus, aus dem Französischen von Gabriele Ricke und Ronald Vouillié, Berlin: Merve 1992, S. 172f.
10
Heiner Müller, »Ich bin der Engel der Verzweiflung«, in: Warten auf der Gegenschräge. Gesammelte Gedichte, herausgegeben von Kristin Schulz, Berlin 2014, S. 76.
11
Vgl. Gottfried Benn, »Können Dichter die Welt verändern?«, in: Essays und Reden. In der Fassung der Erstdrucke
Der doppelte Betrug
»Das Kapital ist schlauer / Geld ist die Mauer« zitiert Heiner Müller ein »Westberliner linkes Flugblatt« in seinem Plädoyer für den Widerspruch,1 darin er sich erklärt – erklärt, wieso er am 4. November 1989 auf einer der größten Demonstrationen der DDR-Geschichte statt eines eigenen Redebeitrags den kurzen Aufruf einer Initiative zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften verlesen hat. Neben Friedrich Schorlemmer, Günter Schabowski, Gregor Gysi, Lothar Bisky, Christa Wolf, Stefan Heym, Jens Reich, Ulrich Mühe, Jan Josef Liefers, Steffi Spira und anderen, die mit mehr oder auch weniger Herzblut von der Sache sprachen, fordert Müller auf dem Berliner Alexanderplatz Solidarität statt Privilegien, verliest, die Forderung konkret machend, den Aufruf, den er mit eigenen Worten beendet: »Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden«2 – und geht ab.
Seit Monaten schon brechen die Vorgänge auf den Straßen des zusammenbrechenden Staates in die Proben Müllers von Hamlet/Maschine am Deutschen Theater ein.3 Diese stören die Arbeit auf der Bühne weniger, als dass sie die Inszenierung in ein neues Licht rücken und sie zum Kommentar eben jener Ereignisse werden lassen. »Dunkel«, rezensiert Henrichs am 30. März 1990 die Aufführung in der Zeit, »überglänzt« Hamlet »den fahlen Zerfall um sich herum. Seine Einsamkeit wirkt grenzenlos, unbeschreiblich – die Verlorenheit des denkenden Menschen in einer dumpfdämmernden Welt.«4 Müller dagegen lakonisch: »Aus Stalins Geist, der in der ersten Stunde auftrat, wurde in der letzten Stunde der Aufführung die Deutsche Bank.«5 Von der Tragödie also bleibt nur mehr ein deutsches Trauerspiel, in welchem die eine Ideologie die andere ersetzt.
Nicht umsonst fällt der Blick des Dramatikers am 4. November auf jenes Flugblatt einer linken Gruppierung aus Westberlin, dessen Aufschrift dann als Zitat im Plädoyer wiederkehrt. Und nicht ganz zufällig verliest er den Aufruf. »Ich stand«, heißt es in Krieg ohne Schlacht,
mit andern Nationalpreisträgern, Vertretern der Opposition und zwei Funktionären auf der Rednerliste, und als ich hinkam, hatte ich das ungute Gefühl, dass da ein Theater inszeniert wird, das von der Wirklichkeit schon überholt ist […]. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, das nicht wie ein Nachvollzug geklungen hätte. Ich hatte daran gedacht, den Brecht-Text »Fatzer komm« vorzutragen, mit der Aufforderung an die Staatsmänner, den Staat herauszugeben, der sie nicht mehr braucht. Ich hatte den Text in der Tasche, aber vor den 500 000 Demonstranten kam es mir plötzlich albern vor, dem kranken Löwen einen Tritt zu versetzen, der mir sicher Applaus eingetragen hätte. Ich habe Wodka getrunken und gewartet, ratlos. Die Kulturverantwortliche der Bezirksleitung Berlin wollte mit mir diskutieren über einen Satz von mir in einem Interview, über die Trennung der Kommunisten von der Macht als der einzigen Chance für den Kommunismus. Sie hatten nichts begriffen. Dann kamen drei junge Leute mit einem Flugblatt zu mir, das sie verfasst hatten, es war ein Aufruf zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften, und sie fragten mich, ob ich das für sie vorlesen könnte, weil sie keine Redezeit kriegten. Das Programm wäre so dicht, es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah keinen Grund, nein zu sagen. Also habe ich es vorgelesen, mit einem Satz über die Trennung der Intelligenz von der Bevölkerung durch Privilegien. […] Das klang sicher fremd aus meinem Mund, und es war kein Text für 500 000 Menschen, die glücklich sein wollten. […] Als ich nach Pfiffen und Buh-Chören von dem Podest herunterstieg, stand unten ein alter Ordner und sagte zu mir: »Das war billig.« Auch Stefan Heym hat mir den Text übelgenommen. Für ihn war es ein glücklicher Tag. Die Arbeiter hatten die ökonomische Daumenschraube kommen sehn, er sah die endliche Heraufkunft eines demokratischen Sozialismus.6
An jenem Freudentag blickt Heiner Müller auf das, was größer ist als dieser Tag, größer als die historisch-politischen Ereignisse dieser Umbruchszeit, die das Ende des Kalten Krieges markieren, größer als die mit diesem Umbruch einhergehenden Debatten um Worte und Positionen, größer als die Hoffnung auf die Heraufkunft eines demokratischen Sozialismus, größer noch als die deutsche und größer als die deutsch-deutsche Geschichte, größer, weil es nicht nur vor zwanzig Jahren, sondern je schon nur international zu denken gewesen ist: auf das Kapital – das Kapital ist schlauer.
Und dieser Blick ist sowohl im Kleinen als auch im Großen stets ein doppelter. Zum einen umfasst er beide deutsche Staaten zugleich, zum anderen die durch die Mauer des Kapitals gespaltene Welt. Vom Kapital, mehr noch vom Scheitern, von Tierlauten, von Ekel, Sprachlosigkeit und Tod, aber auch vom Warten, von Flaschenpost und Hoffnung sprechen nicht nur die späteren und späten, sowohl dramatischen als auch lyrischen Texte, die in ihrer verdichtenden Lakonie eine immer geopolitischer und zeitloser werdende Dimension durchschreiten. Auch umkreisen die zahllos geführten Gespräche jener Jahre dieses harte Segment, unnachgiebig und mit dialektischem Witz. Diesen Texten und Gesprächen zugrunde liegt, mit der auf das Ende des Kalten Kriegs voranschreitenden Geschichte, ein zunehmend skelettierender, Geschichte zum Modell zuschneidender Blick, der dann genauso gnadenlos und hart ist wie die Welt, auf die er fällt. Denn diese Welt, zeigt er, ist nicht gut – noch nicht, vielleicht nie: »Die Wahrheit ist konkret. Ich atme Steine.«7 Nicht mehr, wie noch in den ganz frühen Arbeiten, fällt der Blick des Dramatikers – im Bewusstsein des Scheiterns – auf das Mögliche einer Zukunft, vielmehr – im Angesicht des Scheiterns – auf die Gespenster, die nun vermehrt nicht allein aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Zukunft kommend die Gegenwart bedrängen: all die busybodies des pausenlosen Konsums.8 Das heißt, dass nach dem Fall der Mauer zur von den Toten der Vergangenheit eingeforderten Schuld nun noch die Verschuldung der Zukunft tritt. Die Lage: ausweglos.
Doch nicht nur – »Mein Blick aus dem Fenster fällt auf den Mercedesstern«9 – zitiert Müller die kapitalismuskritische Aufschrift des Westberliner Flugblatts, auch verliest er eben jenen Aufruf der Initiative zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften. Damit ordnet er sich als Privilegierter in die Genealogie der ewig Nichtprivilegierten ein – Die Arbeiter hatten die ökonomische Daumenschraube kommen sehen –, und zwar in die Tradition der deutschen Arbeiterbewegung, in der auch Vater und Großvater standen. Vater und Großvater im Angesicht des doppelten Betrugs (vom vielbesprochenen »Verrat« des Sohnes am Vater ganz zu schweigen). Betrogen zum einen von der Sozialdemokratie, zum anderen von DDR-Stalinismus und LENINDADA, der Sohn, wenn auch wissend, betrogen vom Phantom des Arbeiter- und Bauernstaates, der als ideologische Fratze einer politischen Idee genau das reproduziert, was in jenem eigentlich aufgehoben sein sollte: die »Trennung von Wissen und Macht«.10 Diese systembedingte Spaltung zwischen Macht und Intelligenz führt einerseits zur fatalen Trennung des Dramatikers von seinem Publikum, dessen Sprache er dann nicht mehr spricht, zum anderen zu jenem Privileg, das ihn diesem Publikum zugleich so entfremdet, dass er seine Sprache notwendig verfehlen muss.
Dennoch bleibt die Lage für Müller alternativlos, denn die Geschichte, die sich aus der Perspektive des doppelten Betrugs heraus weiter als eine Geschichte der Klassenkämpfe fortschreibt, wird bis auf weiteres nicht an ihr Ende kommen. Vielmehr schreibt sie sich – mitten im Kalten Krieg und über das Ende dieses Krieges hinaus – entlang eben jener Mauer weiter, die in Form von Eigentums- und Produktionsverhältnissen die Welt teilt. Anders gesagt: Sie hat zu siegen nicht aufgehört, oder wie es Brecht in dialektischer Wendung im Fatzer-Fragment formuliert: »Und von jetzt ab und eine ganze Zeit über / Wird es keinen Sieger mehr geben / Auf eurer Welt, sondern nur mehr / Besiegte«.11 So erkennt im Anschluss an diese Tradition auch Müller in dialektischer Verkürzung im Kapital weiterhin den Feind, der sich bereits im geteilten Deutschland in seiner hässlichen Doppelfratze gezeigt hat: Tierlaute dort wie hier.
Anmerkungen
1
Heiner Müller, »Plädoyer für den Widerspruch«, in: Werke, Band 8: Schriften, herausgegeben von Frank Hörnigk in Zusammenarbeit mit der Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, redaktionelle Mitarbeit: Kristin Schulz, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 361-363.
2
Vgl. Christoph Rüter, Die Zeit ist aus den Fugen [DVD mit Beiheft], Frankfurt am Main 2009.
3
Vgl. ders., »Was man auf der Bühne gesagt hat, kann man nicht mehr zurücknehmen. Christoph Rüter erinnert sich an die Dreharbeiten zu Die Zeit ist aus den Fugen«, in: Rüter, Zeit [Beiheft], S. 5-13.
4
Benjamin Henrichs, »Acht Stunden sind kein Theater. Tod um Mitternacht: Premiere am Deutschen Theater in Ost-Berlin«, in: Die Zeit, Nr. 14, 30. März 1990.
5
Heiner Müller, Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiographie, in: Werke, Band 9: Eine Autobiographie, herausgegeben von Frank Hörnigk, redaktionelle Mitarbeit: Christian Hippe, Kristin Schulz, Ludwig Haugk und Ingo Way, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005, S. 278.
6
Ebd., S. 278f.
7
Ders., »Das Gefühl des Scheiterns«, in: Werke 8, S. 87.
8
Vgl. Bertolt Brecht, Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer [Bühnenfassung von Heiner Müller], in: Heiner Müller, Werke, Band 6: Die Stücke 4. Bearbeitungen für Theater, Film und Rundfunk, herausgegeben von Frank Hörnigk, redaktionelle Mitarbeit: Kristin Schulz, Christian Hippe, Ludwig Haugk und Ingo Way, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, S. 104 sowie Eric L. Santner, The Weight of all Flesh. On the Subject-Matter of Political Economy, Oxford: Oxford University Press 2015.
9
Heiner Müller, »Ajax zum Beispiel«, in:
Texte
[In ärmlichen Verhältnissen …]
In ärmlichen Verhältnissen wächst Clyde Griffith auf, seine Eltern sind Straßensänger, Sektierer, von Gott »auserwählt«, aber von der Gesellschaft geächtet.
Clyde wird Hotelboy, dann, in der Wäschefabrik eines Onkels, Angestellter. So lernt er den Luxus, Glanz u[nd] Glück der Erfolgreichen kennen. Er fürchtet, weil er sie erfahren hat, nichts mehr als Armut, wünscht, das Leben der Besitzenden vor Augen, nichts sehnlicher, als daran teilzuhaben. Dreiser zeigt nun, wie der persönliche Ehrgeiz, das Streben nach dem Aufstieg in die herrschende Klasse – »Ausweg« des Kleinbürgers aus dem Dilemma der Klassengesellschaft – notwendigerweise den Verrat an der eigenen, unterdrückten Klasse bedingt.
Vor die Wahl gestellt, seine Schwester dem Elend preiszugeben, als sie, völlig mittellos, ein Kind erwartet oder auf einen Ausflug zu verzichten, entscheidet er sich für den Ausflug. Aber auf dem Rückweg wird ein Kind überfahren. Und wenn Clyde sich mit den Freunden nach der Flucht vor der Polizei im Schnee vor Chikago unter den Trümmern des »geborgten« Wagens hervorarbeitet, ist sein erster Versuch, am Besitz teilzuhaben, gescheitert. Und so geht es weiter. Denn die Möglichkeiten sind nicht mehr unbegrenzt in Amerika, das Eigentum ist verteilt, die Plätze sind vergeben.
Es gibt Ausnahmen, aber Clyde ist keine. Dazu fehlt ihm die letzte Brutalität. Er wird so, weil er zwischen den Klassen steht, zwischen ihnen zermahlen, und das ist die Regel. Schuldig-unschuldig – Opfer wie die ertrunkene Näherin, die sterben mußte, damit er frei würde für die Unternehmertochter, für den Aufstieg – sitzt er am Ende auf d[em] elektr[ischen] Stuhl statt auf dem goldenen. Die Gesellschaft ließ ihn fallen: Er hat die Spielregeln verletzt: der einfache Mord gehört nicht mehr zu den legitimen Mitteln des »Fortkommens«.
Der Rom[an] »Eine am[erikanische] Tr[agödie]« erschien 1925. Er ist heute so gegenwärtig wie damals. An dem erschütternden Ablauf des Einzelschicksals macht er ein entscheidendes Stück Geschichte des Kapitalismus in Amerika deutlich und trägt so bei zum Verständnis des USA-Imperialismus in der Gegenwart.
[1952]
Drei Parabeln
Zwei Knaben hatten jeder einen Vogel in der Hand. Die Vögel sollten singen, sagten sie.
Da machte der eine die Hand mit dem Vogel darin zur Faust. Aber der Vogel sang nicht, schrie nur, und auch das nicht lange.
Der andere machte die Hand auf und ließ den Vogel fortfliegen.
Dein Vogel ist dir fortgeflogen, sagte der erste.
Er singt, erwiderte der andere.
*
Ein Redner redete in einem großen Saal vor vielen Menschen über eine Sache, die alle anging. Aber die Menschen hörten ihm nicht zu. Da unterbrach er seine Rede und fragte die Versammelten, ob sie ihn nicht hörten.
Nein, wurde ihm gesagt, du sprichst zu laut.
*
Ein Mann hatte in seinem Beruf einen Fehler gemacht. Das bereitete ihm großen Ärger. Um dem abzuhelfen, hatte er die Wahl, entweder seine Frau anzuschreien, die sehr zänkisch war, oder den Fehler gutzumachen.
Er erschlug seinen Kanarienvogel.
[1953]
Gespräch mit Heiner Müller
GIRNUS Es gab noch eine weitere sehr spezifizierte Kritik: In Ihrem Stück sagt der Brigadier Barka von sich selbst »Ich bin die Fähre zwischen Eiszeit und Kommune«; in dieser Bemerkung – im Zusammenhang mit anderen Sätzen – komme zum Ausdruck, so wurde bemerkt, daß der Aufbau des Sozialismus als eine von lauter Schwierigkeiten und Aufopferung erfüllte Phase erscheine; die Kritik meinte, Ihnen schwebe ein utopisch-illusionäres Bild des Kommunismus vor, das aber entspreche nicht unserer Realität. Wie stehen Sie zu dieser Kritik, Heiner Müller?
MÜLLER Dieser Brigadier ist aufgewachsen im Kapitalismus, und das Stück beschreibt, wie er zu einem sozialistischen Bewußtsein kommt. Und jede Auseinandersetzung um eine neue Sicht und Haltung zur Welt beginnt, nach meiner Erfahrung, allgemein.
GIRNUS Was aber verstehen Sie unter »Eiszeit«?
MÜLLER Den Kapitalismus.
GIRNUS Und warum nennen Sie ihn »Eiszeit«? Das ist doch eine Metapher, denn Sie sind ja wohl nicht der Überzeugung, der Kapitalismus habe in der Eiszeit geblüht.
MÜLLER Die Metapher steht für eine Welt, in der es für Barka nicht möglich war, menschliche Kontakte zu finden …
GIRNUS … in der also eine Vereisung der Beziehungen zwischen den Menschen eintrat, eine Vereinzelung und Entfremdung? Wie Marx im »Kommunistischen Manifest« sagt, die moderne Bourgeoisie habe kein anderes Band zwischen den Menschen übriggelassen als die gefühllose bare Zahlung und alles andere »im eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt«.
MÜLLER Und Barka sagt das an dem Punkt des Stückes, wo er »auftaut«, um im Bild zu bleiben.
GIRNUS Wenn ich Sie recht verstanden habe, soll die Metapher der »Fähre« zum Ausdruck bringen: Er, Barka, empfinde sich als aktive Kraft der Veränderung, des Übergangs von der Eiszeit zum Kommunismus. Oder?
MÜLLER Ja.
[…]
MÜLLER Sie kennen den Goethetext: »Der Mensch muß wieder ruiniert werden.« Hier ist ein Positives negativ formuliert. Was Sie zitieren, sind Stationen auf dem Weg des Brigadiers Barka zu der Erkenntnis, daß sich der Glücksbegriff in der Arbeit am sozialistischen Aufbau neu definiert. Es gibt da kein privates, unverbindliches, kein Rentner- und Konsumentenglück mehr. Ein Fehler im Stück: Der neue Glücksbegriff wird vorausgesetzt, nicht formuliert. Das muß korrigiert werden.
GIRNUS Um auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen: Heiner Müller ist angefüllt mit einer Gärung von Metaphern, ja das ganze Stück kann man als Eruption, als eruptive Kaskade von Metaphern bezeichnen. Nun sind Metaphern natürlich immer mehrdeutig, deshalb können sie aber auch problematisch werden. Daher würde unsere Leser sicher interessieren, in welcher Richtung Sie Ihre Arbeit zur bereits angedeuteten Vervollständigung des Stücks weiterzutreiben gedenken.
MÜLLER Es geht einmal darum, alles zu verstärken, was die Kontinuität der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik deutlich macht und zweitens alles hervorzuheben, was die Grundtendenz dieser Entwicklung betont, nämlich, daß die Menschen immer mehr aus einem Objekt der Produktion und der Geschichte zu ihrem Subjekt werden.
[1966]
Stahlnetz oder Die teilbare Freiheit
Ein Deutschlehrer, den ich immer für besonders reaktionär gehalten hatte, ein Fanatiker der »Gliederung«, gab uns im Abitur als Aufsatzthema den Herwegh-Satz »Die Freiheit der Welt ist unteilbar«. Das war 1948 in Sachsen, und ich weiß nicht, ob er uns damit das Abitur leicht oder das Leben schwermachen wollte.
Wie schreibt man, auf einem Balkon in Pankow mit mehr Vogel- als Verkehrslärm, von Parkbäumen zuverlässig sogar vor den Blicken der Nachbarn geschützt, und in einer Wohnung, die gerade renoviert wird, ausgerechnet für den »Spiegel« über ein im Westberliner Rotbuch-Verlag erschienenes Chile-Buch,[1] vielleicht das wichtigste seit dem Putsch, geschrieben im politischen Asyl in der italienischen Botschaft in Santiago, in einer andern Stunde der wahren Empfindung, »inmitten eines Blutbads«, nach drei Jahren Arbeit an einer Hoffnung, die seit September 1973 von Militärstiefeln mit dem Blut chilenischer Arbeiter, Bauern, Intellektueller in unser Gedächtnis geschrieben wird, vertagt, nicht verjährt.
Die Kategorien der Literaturkritik werden fragwürdig vor den Umständen dieser Autorschaft. Stuparich nennt sein Buch einen »Roman in Verhören«. Die Verhöre sind mehr Dokument als Fiktion, und hier literarische Maßstäbe anlegen heißt, sich auf die Seite derer stellen, die den Verhörten die Handschellen angelegt haben. Die Einheit von Politik und Literatur zerreißt unter dem Druck einer Erfahrung wie der chilenischen, und auf bricht die Kluft zwischen Worten und Taten, von der Gollwitzer gesprochen hat, unsre eigene Schizophrenie der Redner und Schreiber, die nichts tun können als ihre Arbeit, die wenig Folgen hat und für die Toten keine.
Der Propagandawert des Buches mit dem ungeschickten Reiseführer-Titel (im Original so präzis wie unübersetzbar »Comprometerse con una clase«) ist von seinem Materialwert nicht zu trennen.
Der Roman verhört einen Bauern, der aus dem Süden in die Hauptstadt kommt (»Ich weiß noch, ich träumte, ich falle von diesen hohen Gebäuden herunter«), Industriearbeiter wird (»ich werd' ganz viel Geld verdienen und einmal Millionär sein«) und durch Saufen arbeitslos. Bei Gelegenheitsarbeit in der Oberstadt lernt er den Standard der Besitzenden kennen, holt, um ihn zu erreichen, in Abendkursen die Volksschule nach.
Der Griff nach der Brust einer Frau (»… wie ich es im Kino gesehen hatte«) beendet das Studium: Die Familie vermehrt sich zu schnell. Er wählt »die Konservativen, die die Ordnung und den Respekt vor der Obrigkeit garantieren«, bis ein Fremder ihn »plötzlich mit ganz ruhiger Stimme: Du verdammtes Verräterschwein« nennt; er schließt sich der Unidad Popular an, nimmt an einer Landbesetzung teil, dann am bewaffneten Widerstand gegen die Junta, wird im Dezember 1973 »auf der Flucht erschossen«.
Die Vita belegt die Chance der Unterentwicklung, das Stahlnetz der kapitalistischen Strukturen zu sprengen, bevor es engmaschig (»organisch«) genug ist, die Masse der Ausgebeuteten in Gruppen von mehr und weniger Ausgebeuteten aufzuspalten. Und die Gefährdung dieser Chance durch die heilige Allianz traditioneller patriarchaler Strukturen mit den faschistischen Militärtechnokratien, den mehr oder weniger potenten Schamteilen der USA im Süden des Kontinents.
Ein Beispiel: die Erscheinung der heiligen Kuh im Kapitel über die Landbesetzung. Nach dem Auftritt des Gutsbesitzers, der den Landbesetzern mit Polizei und Gefängnis droht, »passierte mir etwas Eigenartiges … Während die Posten verteilt wurden, erregte eine Kuh meine Aufmerksamkeit … zum erstenmal hatte ich den Eindruck, daß wir uns auf fremdem Grund und Boden befanden … als ob darin 40 Jahre Arbeit und Leistung des Gutsbesitzers steckten. Ich überlegte mir, ob wir nicht Eindringlinge waren, die hier eine Entwicklung störten, die dieser Herr in feiner Kleidung und glänzenden Schuhen mit viel Verstand in Gang gesetzt und aufgebaut hatte. Die Kuh war so was wie der lebende Beweis … Das Viech war schön dick, mit vollem Euter, und ganz sicher war dafür gesorgt, daß auch an diesem Morgen einer der Angestellten mit einem Eimer kam, um die Kuh zu melken. Dieses Gefühl, unrechtmäßig Besitz ergriffen zu haben, ist erst später verschwunden, als eine Gruppe von uns das erste Rind schlachtete«.
Der Erzähler hat ein Gespenst gesehn, die heilige Kuh des Privateigentums. Gespenster leben von Gespensterfurcht, die bei den Unterprivilegierten besonders verbreitet ist. Nicht jedes Gespenst verschwindet, wenn man es anspricht oder Schlag zwölf. Der beste Exorzismus ist die Schlachtung.
Während ich das schreibe, läßt nebenan im Werbefernsehen das Kapital seine heiligen Kühe steuerbegünstigt aufmarschieren, bestaunt von Leuten, denen durch revolutionäre Gewalt versagt ist, am eigenen Leib zu erfahren, daß die Endlösung des Konsumproblems für den Kapitalismus im Ernstfall immer die Wegrationalisierung der Konsumenten ist; und man muß weder Kommunist noch Mitglied des Club of Rome sein, um zu prophezeien, daß auch diese Gespenster ihrer natürlichen Bestimmung nicht entgehen werden.
Mit einer Frau »aus betuchtem Haus«, ihr Vater »progressiver Humanist« und Freund Allendes, befaßt sich das zweite Roman-Verhör. Ihre Lebensgeschichte ist die Geschichte ihres Lebens mit, nacheinander, drei Männern. Den ersten, mit dem sie eine »Ehe in Weiß« führt, erschreckt ihre sexuelle Emanzipation, den zweiten die politische. Sie erfährt den Zusammenhang von Mutterbindung und Machismo. Die Niederhaltung der Frau durch die Mutterschaft. Neben dem dritten wäre Platz für sie, aber da ist kein Platz mehr: Der Weg führt ins Nationalstadion, in die sexuelle Folter.
Machismo – während ich das schreibe, höre ich von der Straße her einen vertrauten Ton: Eine Frau weint. Ich sehe mir vom Fenster aus die Szene an, in der wir alle gelegentlich auftreten, steif wie ein Torero, wenn der Stier angreift: »Warte bis wir zu Hause sind.« Es ist eine gute Wohngegend. Variante für weniger gute Wohngegenden: »Komm du nach Hause!«
Ein radikaler Intellektueller, mit Spuren von Autobiographie, auch von Selbstkritik – seine Liebe gehört nicht ihm –, ist die dritte Bezugsfigur. Er reflektiert die Schwierigkeit, die sozialistische Todsünde zu meiden: »Für das Volk statt mit ihm«; die Sprachstörung der linken Intelligenz beim Dialog mit der Arbeiterklasse. Sie schlägt sich formal, zumindest in der Übersetzung (von Rainer Enrique Hamel), nieder: Kein Arbeiter redet so »klasse« wie ein linker »Typ«.
In den Gang der Tragödie sind, wie Akzente gegen den Eindruck der Zwangsläufigkeit, polit-ökonomische Analysen montiert, relevant nicht nur für Chile, ein aktueller Kommentar zu Lenins »Staat und Revolution«. Der Zusammenhang zwischen Allendes »Politik der weichen Hand«, seiner Weigerung, aus Treue zu den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie, das Volk zu bewaffnen gegen den Würgegriff ebendieser Demokratie, seiner Illusion vom »Volk in Uniform«, und dem Atavismus der Junta wird schmerzhaft deutlich. Mit dem zu späten Griff nach der Maschinenpistole hat Allende seine Politik korrigiert, nicht zu spät für Lateinamerika.
[1975]
Die Hamletmaschine
Fernsehn Der tägliche Ekel Ekel
Am präparierten Geschwätz Am verordneten Frohsinn
Wie schreibt man GEMÜTLICHKEIT
Unsern Täglichen Mord gib uns heute
Denn Dein ist das Nichts Ekel
An den Lügen die geglaubt werden
Von den Lügnern und niemandem sonst Ekel
An den Lügen die geglaubt werden Ekel
An den Visagen der Macher gekerbt
Vom Kampf um die Posten Stimmen Bankkonten
Ekel Ein Sichelwagen der von Pointen blitzt
Geh ich durch Straßen Kaufhallen Gesichter
Mit den Narben der Konsumschlacht Armut
Ohne Würde Armut ohne die Würde
Des Messers des Schlagrings der Faust
Die erniedrigten Leiber der Frauen
Hoffnung der Generationen
In Blut Feigheit Dummheit erstickt
Gelächter aus toten Bäuchen
Heil COCA COLA
Ein Königreich
Für einen Mörder
ICH WAR MACBETH DER KÖNIG HATTE MIR SEIN DRITTES KEBSWEIB ANGEBOTEN ICH KANNTE JEDES MUTTERMAL AUF IHRER HÜFTE RASKOLNIKOW AM HERZEN UNTER DER EINZIGEN JACKE DAS BEIL FÜR DEN / EINZIGEN / SCHÄDEL DER PFANDLEIHERIN
In der Einsamkeit der Flughäfen
Atme ich auf Ich bin
Ein Privilegierter Mein Ekel
Ist ein Privileg
Beschirmt mit Mauer
Stacheldraht Gefängnis
Fotografie des Autors.
Ich will nicht mehr essen trinken atmen eine Frau lieben einen Mann ein Kind ein Tier. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr töten.
Zerreißung der Fotografie des Autors.
Ich breche mein versiegeltes Fleisch auf. Ich will in meinen Adern wohnen, im Mark meiner Knochen, im Labyrinth meines Schädels. Ich ziehe mich zurück in meine Eingeweide. Ich nehme Platz in meiner Scheiße, meinem Blut. Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Irgendwo werden Leiber geöffnet, damit ich allein sein kann mit meinem Blut. Meine Gedanken sind Wunden in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist eine Narbe. Ich will eine Maschine sein. Arme zu greifen Beine zu gehen kein Schmerz kein Gedanke.
Bildschirme schwarz. Blut aus dem Kühlschrank, Drei nackte Frauen: Marx Lenin Mao. Sprechen gleichzeitig jeder in seiner Sprache den Text ES GILT ALLE VERHÄLTNISSE UMZUWERFEN, IN DENEN DER MENSCH … Hamletdarsteller legt Kostüm und Maske an.
[1977]
Der Mann im Fahrstuhl
Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden, der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich habe einen Termin beim Chef (in Gedanken nenne ich ihn Nummer Eins), sein Büro ist in der vierten Etage, oder war es die zwanzigste; kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die Nachricht von meinem Termin beim Chef (den ich in Gedanken Nummer Eins nenne) hat mich im Kellergeschoß erreicht, einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte und ziehe den Knoten fest. Ich hätte gern einen Spiegel, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann. Unmöglich, einen Fremden zu fragen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Die Krawatten der andern Männer im Fahrstuhl sitzen fehlerfrei. Einige von ihnen scheinen miteinander bekannt zu sein. Sie reden leise über etwas, wovon ich nichts verstehe. Immerhin muß ihr Gespräch mich abgelenkt haben: beim nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhltür mit Schrecken die Zahl Acht. Ich bin zu weit gefahren oder ich habe mehr als die Hälfte der Strecke noch vor mir. Entscheidend ist der Zeitfaktor. FÜNF MINUTEN VOR DER ZEIT / IST DIE WAHRE PÜNKTLICHKEIT. Als ich das letztemal auf meine Armbanduhr geblickt habe, zeigte sie Zehn. Ich erinnere mich an mein Gefühl der Erleichterung: noch fünfzehn Minuten bis zu meinem Termin beim Chef. Beim nächsten Blick war es nur fünf Minuten später. Als ich jetzt, zwischen der achten und neunten Etage wieder auf meine Uhr sehe, zeigt sie genau vierzehn Minuten und fünfundvierzig Sekunden nach der zehnten Stunde an: mit der wahren Pünktlichkeit ist es vorbei, die Zeit arbeitet nicht mehr für mich. Schnell überdenke ich meine Lage: ich kann beim nächsten möglichen Halt aussteigen und die Treppe hinunterlaufen, drei Stufen auf einmal, bis zur vierten Etage. Wenn es die falsche Etage ist, bedeutet das natürlich einen vielleicht uneinholbaren Zeitverlust. Ich kann bis zur zwanzigsten Etage weiterfahren und, wenn sich das Büro des Chefs dort nicht befindet, zurück in die vierte Etage, vorausgesetzt der Fahrstuhl fällt nicht aus, oder die Treppe hinunterlaufen (drei Stufen auf einmal), wobei ich mir die Beine brechen kann oder den Hals, gerade weil ich es eilig habe. Ich sehe mich schon auf einer Bahre ausgestreckt, die auf meinen Wunsch in das Büro des Chefs