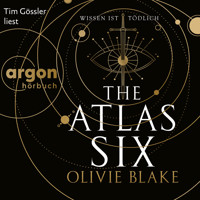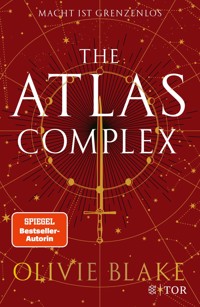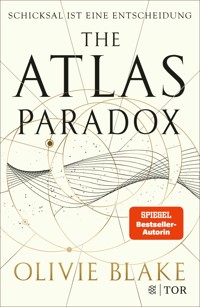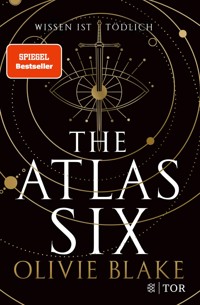22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Romantasy-Roman von der Bestsellerautorin Olivie Blake ("The Atlas Six") über zwei rivalisierende Hexenfamilien in New York und eine unmögliche Liebe. Die Antonova-Schwestern sind schön, klug und begabt. Außerdem leiten sie ein nicht ganz legales Familien-Imperium, das die besten magischen Drogen herstellt, die in New York zu bekommen sind. Ihre Gegner in Crime sind die einflussreichen Fedorov-Brüder, die ihnen die Herrschaft um die Straße streitig machen. Immerhin: Ein Vernunftfrieden zwischen den beiden Familien sorgt dafür, dass in Manhattan seit zwölf Jahren ein prekäres Gleichgewicht herrscht. Deshalb ist es mehr als unglücklich, dass der jüngste Fedorov und die jüngste Antonova Gefühle füreinander entwickeln. Denn was für Lev und Sasha Liebe auf den ersten Blick und eine herrlich unvernünftige Leidenschaft ist, könnte nicht nur innerhalb der Familien zu Komplikationen führen, sondern ganz New York zum Schauplatz einer blutigen Fehde machen. Mit sechs Original-Illustrationen von Little Chmura. Für Leser*innen von Rebecca F. Kuang, V.E. Schwab, Rebecca Yarros oder Carissa Broadbent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Olivie Blake
Für immer dein Feind
Über dieses Buch
Zwei verfeindete Familien. Eine unsterbliche Liebe. Kein Happy End.
Die Antonova-Schwestern sind schön, klug und begabt. Außerdem leiten sie ein nicht ganz legales Familien-Imperium, das die besten magischen Drogen herstellt, die in New York zu bekommen sind. Ihre Gegner in Crime sind die einflussreichen Fedorov-Brüder, die ihnen die Herrschaft um die Straße streitig machen. Immerhin: Ein Vernunftfrieden zwischen den beiden Familien sorgt dafür, dass in Manhattan seit zwölf Jahren ein prekäres Gleichgewicht herrscht.
Deshalb ist es mehr als unglücklich, dass der jüngste Fedorov und die jüngste Antonova Gefühle füreinander entwickeln. Denn was für Lev und Sasha Liebe auf den ersten Blick und eine herrlich unvernünftige Leidenschaft ist, könnte nicht nur innerhalb der Familien zu Komplikationen führen, sondern ganz New York zum Schauplatz einer blutigen Fehde machen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olivie Blake liebt und schreibt Geschichten – die meisten davon fantastisch. Besonders fasziniert ist sie dabei von der endlosen Komplexität des Lebens und der Liebe. Sie arbeitet in Los Angeles, wo sie von ihrem Lieblings-Pitbull gnädig toleriert wird. Ihr selbst publiziertes Buch »The Atlas Six« wurde auf TikTok zur Sensation, bevor es von Tor Books erneut veröffentlicht und in über zwanzig Sprachen übersetzt wurde.
Inhalt
[Widmung]
Die Figuren
Die Fedorovs
Die Antonovas
Weitere Figuren
Prolog
Akt I Verständige Raserei
I. 1 (Auftritt Gebrüder Fedorov)
I. 2 (Was die Leute sehen.)
I. 3 (Leben unter den Todlosen.)
I. 4 (Die erste Runde.)
I. 5 (Schattenwesen.)
I. 6 (Wachsamkeit.)
I. 7 (Nicht dein Problem.)
I. 8 (Vorsichtsmaßnahmen.)
I. 9 (Diamanten.)
I. 10 (Unruhe.)
Die Szenenbilder
Die Fedorovs
Die Antonovas
Akt II Des Himmels Antlitz
II. 1 (Die Matriarchin.)
II. 2 (So tun, als ob.)
II. 3 (In aller Herrgottsfrühe.)
II. 4 (Moralische Abwägungen.)
II. 5 (Gedanken und Fragen.)
II. 6 (Visionen.)
II. 7 (Spiele.)
II. 8 (Luxus.)
II. 9 (Verbrechen.)
II. 10 (Kostenanalyse.)
II. 11 (Vipernbaby.)
II. 12 (Angebote.)
II. 13 (Kleinigkeiten.)
II. 14 (Pläuschchen.)
II. 15 (Feierabend.)
II. 16 (Zurechtweisung.)
II. 17 (Ein wahrer Gentleman.)
II. 18 (Rückschau.)
II. 19 (Versprechungen.)
II. 20 (Lange Spiele.)
II. 21 (Die Erstgeborene.)
II. 22 (Epos.)
Eine Inventarliste
Koscheis Lager
Baba Yagas kleine Drogerie
Akt III All dies Leiden dient
III. 1 (Ablauf.)
III. 2 (Versprechen.)
III. 3 (Sieh mich brennen.)
III. 4 (Schuld.)
III. 5 (Es ist die Nachtigall.)
III. 6 (Übertragung.)
III. 7 (Unter uns.)
III. 8 (Der Mittler und seine Mittel und Wege.)
III. 9 (Rat.)
III. 10 (Der Deal.)
III. 11 (Eine Tasse Tee.)
III. 12 (Untergrund.)
III. 13 (Der Abschluss.)
III. 14 (Was uns trennt.)
III. 15 (Heilige Gräber.)
III. 16 (Elementare Prinzipien.)
III. 17 (Der Löwe und seine Gaben.)
III. 18 (Die kannst du nicht haben.)
III. 19 (Blut um Blut.)
III. 20 (Frieden.)
III. 21 (Das Herz.)
III. 22 (Vitalität und Organe.)
III. 23 (Ein kleiner Tod.)
Die Schwestern Antonova, gestern
Irina und Katya.
Lena.
Galya.
Akt IV Sei mein allein
IV. 1 (In Dunkelheit.)
IV. 2 (Strippen ziehen.)
IV. 3 (Geschäftsbedingungen.)
IV. 4 (Jeder Mythos hat seinen Schurken.)
IV. 5 (Strippen ziehen, Reprise.)
IV. 6 (Sei brav und hol’s.)
IV. 7 (Inventur.)
IV. 8 (Nachgeschmack.)
IV. 9 (Im Nachhinein.)
IV. 10 (Ärgerliche Drohgebärden.)
IV. 11 (Spuk.)
IV. 12 (Geister.)
IV. 13 (Finde den Zusammenhang.)
IV. 14 (Es ist die Nachtigall, Reprise.)
IV. 15 (Alte Seelen, alte Soldaten.)
IV. 16 (Nicht die Lerche.)
IV. 17 (Verbündete.)
IV. 18 (Allein die Heiligen.)
IV. 19 (Schmutziges Geld, böses Blut.)
Akt V Eure Freuden töten
V. 1 (Der Patriarch.)
V. 2 (Vergiftete Brunnen.)
V. 3 (Trauer.)
V. 4 (Untot.)
V. 5 (Verhindert.)
V. 6 (Solnyshko.)
V. 7 (Scharf beobachtet.)
V. 8 (Détente.)
V. 9 (Koscheis Problem.)
V. 10 (Happy Heimsuchung.)
V. 11 (Der Hexer aus Brooklyn.)
V. 12 (Verlust.)
V. 13 (Dunkelheit.)
V. 14 (Ruf Sie Nicht An.)
V. 15 (Lange Geschichte.)
V. 16 (Populismus.)
V. 17 (Erlösung.)
V. 18 (Die Garderobenfrage.)
V. 19 (Zäsur.)
V. 20 (Geschichte.)
V. 21 (Tote Mädchen.)
V. 22 (Eine Abrechnung.)
V. 23 (Treffer.)
V. 24 (Entscheidungen.)
V. 25 (Unausweichlichkeit.)
V. 26 (Erbe.)
V. 27 (Der Himmel findet Wege.)
Epilog
Danksagung
Januar 2019
September 2022
Für Little Chmura,
die meine Tagträume zum Leben erweckt,
im Tausch für die seltene Gabe, die du so selbstlos teilst,
und für die Magie, die du mir geschenkt hast:
Nimm dieses Buch.
Die Figuren
Die Fedorovs
Koschei der Todlose, manchmal Lazar genannt, Patriarch der Familie Fedorov
Dimitri, genannt Dima, ältester der Gebrüder Fedorov
Roman, genannt Roma oder Romik, zweitältester der Gebrüder Fedorov
Lev, manchmal Leva, Lyova, Lyovushka oder gelegentlich Solnyshko genannt, jüngster der Gebrüder Fedorov
Die Antonovas
Baba Yaga, manchmal Marya genannt, Matriarchin der Familie Antonova
Marya, nach ihrer Mutter benannt, Masha oder manchmal Mashenka genannt, älteste der Schwestern Antonova
Ekaterina, genannt Katya, Zwillingsschwester von Irina, gemeinsam die zweitältesten Schwestern Antonova
Irina, manchmal Irka genannt, Zwillingsschwester von Ekaterina, gemeinsam die zweitältesten der Schwestern Antonova
Yelena, genannt Lena oder manchmal Lenochka, die vierte der Schwestern Antonova
Liliya, manchmal Lilenka genannt, die fünfte der Schwestern Antonova
Galina, genannt Galya oder manchmal Galinka, die sechste der Schwestern Antonova
Alexandra, ausschließlich Sasha oder manchmal Sashenka genannt, die jüngste der Schwestern Antonova
Weitere Figuren
Ivan, der Leibwächter von Marya Antonova
Eric Taylor, John Anders, Nirav Vemulakonda, Kommilitonen von Sasha Antonova
Luka, der Sohn von Katya Antonova
Stas Maksimov, der Ehemann von Marya Antonova
Taqriaqsuit, Schattenwesen unter der Kontrolle von Koschei
Antonov, der verstorbene Ehemann von Baba Yaga
Brynmor Attaway, oft der Mittler genannt, Halb-Elb und Informant von Marya Antonova
Anna Fedorov, verstorbene Ehefrau von Koschei dem Todlosen
Raphael Santos, einer von Koscheis Immobilienverwaltern
Jonathan Moronoe, ein einflussreicher Ratshexer aus Brooklyn
Hexenrat, Leitungsgremium des magischen New York
Schauplatz: New York City, New York. Gegenwart.
Prolog
Viele Dinge sind nicht, was sie scheinen. Einige jedoch meinen es mit dem Schein ernster.
Baba Yagas Kleine Drogerie war ein gemütliches Geschäft in Lower Manhattan mit ausgezeichneten Yelp-Bewertungen (hauptsächlich von Frauen) und einem ansprechenden, anlockenden Schaufenster. Das Schild – schon deshalb ein kleines Wunder, weil nicht mit Sans-Serif-Leuchtschrift versehen – war so außergewöhnlich gestaltet wie die im Laden angebotenen farbenfrohen Badebomben und luxuriösen Tinkturen. Die Worte Baba Yaga schwangen sich in ausladender Schrift über einen Mörser mit Stößel – eine Anspielung auf die Figur aus alten russischen Erzählungen.
Dass der Schein dieses Geschäfts trog, war eine maßlose Untertreibung.
Ich liebe diesen Laden, verkündete eine Yelp-Bewertung. Die Produkte sind einfach toll. Der Laden selbst ist ziemlich klein und die Auswahl wechselt häufig, aber die Qualität stimmt. Andere Läden haben ein größeres Angebot an Standardprodukten, aber wenn man die perfekte handgemachte Duftkerze oder ein individuelles Geschenk für eine Freundin oder Kollegin kaufen will, würde ich Baba Yaga empfehlen.
Der Nährstoffkomplex für Haar und Nägel hat meine traurigen Fussel in nur einem Jahr doppelt so lang werden lassen!, schwärmte eine andere Nutzerin. Das ist Magie, ich schwör’s!
Kunden werden sehr nett beraten, was in Manhattan echt selten vorkommt, schrieb eine weitere Kundin. Die Besitzerin habe ich noch nie gesehen, aber ihre Töchter (von denen meist ein oder zwei da sind, um Fragen zu beantworten) sind die hübschesten, hilfreichsten jungen Frauen, die ich je getroffen habe.
Der Laden ist nie voll, bemerkte ein Nutzer geradeheraus. Aber irgendwie kommt er trotzdem gut über die Runden …
Ein absoluter Schatz, hieß es weiter, und ein echter Geheimtipp.
Ein Geheimnis war das Geschäft wirklich.
Ein Geheimnis innerhalb eines Geheimnisses sogar.
Südöstlich von Yagas Drogerie, an der Bowery Street, befand sich ein Geschäft für antike Möbel namens Koscheis Antiquitäten. Im Gegensatz zu Baba Yagas Geschäft brauchte man hier einen Termin.
Die Schaufenster sehen immer so cool aus, aber der Laden hat nie auf, beschwerte sich ein Rezensent und gab dem Geschäft drei Sterne. Ich hab mal versucht, einen Termin zu machen, um mir was aus dem Schaufenster näher anzusehen, aber ich habe wochenlang keinen ans Telefon bekommen. Dann hat mich ein junger Kerl (ein Sohn des Besitzers, glaube ich) zwanzig Minuten lang reingelassen, aber fast alles im Laden war schon reserviert. Das ist okay, aber ich hätte es trotzdem gerne vorher gewusst. Ich hab mich in eine kleine Vintage-Truhe verliebt, aber er meinte, die ist nicht zu verkaufen.
SEHR TEUER, schrieb eine andere Rezensentin. Geht lieber zu Ikea oder CB2.
Dieser Laden sieht irgendwie gruselig aus, fügte ein weiterer Nutzer hinzu. Und dauernd schleppen irgendwelche komischen Typen Sachen rein und raus. Die Möbel sehen alle cool aus, aber der Laden selbst könnte mal etwas aufgehübscht werden.
Man könnte meinen, die wollen keine Kunden, beschwerte sich ein aktueller Rezensent.
Und er hatte recht; Koschei wollte keine Kunden.
Zumindest keine, die von Yelp kamen.
Akt IVerständige Raserei
Lieb ist ein Rauch, den Seufzerdämpf erzeugten,
Geschürt, ein Feur, von dem die Augen leuchten,
Gequält, ein Meer, von Tränen angeschwellt;
Was ist sie sonst? Verständge Raserei
Und ekle Gall und süße Spezerei.
Romeo zu Benvolio
Romeo und Julia(Akt I, Szene I)
I. 1(Auftritt Gebrüder Fedorov)
Die Gebrüder Fedorov neigten dazu, sich wie die Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks aufzustellen.
An der Spitze stand Dimitri, der Älteste und unangefochtene Erbe; der Kronprinz, der sein Leben einer Dynastie aus Kommerz und Reichtum verschrieben hatte. Er reckte oft das Kinn, trug die unsichtbare Krone hoch auf dem Haupt, straffte die Schultern und drückte selbstsicher die Brust heraus. Wer sollte ihm schon gefährlich werden? Niemand, der ein langes Leben führen wollte, so viel war sicher. Dimitri hatte nie Grund gehabt, einen misstrauischen Blick über die Schulter zu werfen. Er fixierte seinen Gegner frontal, während die Welt sich hinter ihm weiterdrehte.
Hinter Dimitri zu seiner Rechten: Der zweitälteste der Gebrüder Fedorov, Roman, Spitzname Roma. War Dimitri die Sonne der Fedorovs, so war Roman der Mond, der sie umkreiste. Wachsam musterte er die Umgebung, warnte alle, die es auf Dimitri abgesehen hatten. Romans Blick reichte aus, um einen Mann zögerlich, beunruhigt, verängstigt einen Schritt zurücktreten zu lassen. Roman hatte ein Rückgrat wie Blitz, einen Schritt wie Donnerhall. Er war die Schneide einer scharfen, blutigen Klinge.
Neben Roman stand Lev, der Jüngste. Wenn seine Brüder Himmelskörper waren, war Lev eine Welle. Er war unablässig in Bewegung, wie Gezeiten, die aufzogen und wieder vergingen. Selbst jetzt, wo er hinter Dimitri stand, ballte er die Hände reflexartig zu Fäusten, trommelte sich mit dem Daumen auf den Oberschenkel. Lev hatte ein Gespür für Gefahr, und gerade witterte er sie in der Luft, spürte sie zwischen den Schulterblättern. Sie kroch ihm unter die Haut, in die Knochen, und ließ ihn erzittern.
Lev hatte ein Gespür für Gefahr, und er war sich sicher, dass sie gerade höchstpersönlich den Raum betreten hatte.
»Dimitri Fedorov«, sagte die Frau, und von ihren Lippen klang es wie eine Drohung, sei es als Ruf über das Schlachtfeld oder als Flüstern zwischen Seidenlaken. »Du weißt doch noch, wer ich bin, oder?«
Lev beobachtete, wie sein Bruder ungerührt stehen blieb. Wie immer.
»Natürlich, Marya«, antwortete Dimitri. »Und du kennst mich, nicht wahr? Selbst jetzt noch?«
»Davon war ich jedenfalls ausgegangen«, sagte Marya.
Sie war ein Jahr älter als Dimitri, erinnerte Lev sich dunkel. Also war sie knapp über dreißig. Man sah es ihr nicht im Entferntesten an. Aus der Nähe betrachtet hatte Marya Antonova, die Lev seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte, noch immer den Schmollmund, der sowohl zu der Maybelline-Plakatwerbung vor dem Fedorov-Haus in Tribeca als auch zu ihrem Ausdruck milden Interesses passte. Die Zeit, die sich so oft auf Gesichtern abzeichnete – Falten um Augen oder Mund, tiefe Täler auf der Stirn hinterließ –, war nahezu spurlos an ihr vorübergezogen. Jedes Detail ihres Aussehens, von ihrem maßgeschneiderten Kleid bis hin zu ihren polierten Lederschuhen, war genauestens ausgewählt, gebügelt, fleckenfrei und ordentlich. Ihr dunkles Haar fiel ihr, sorgsam zu einer Frisur aus den 1940ern gewellt, bis knapp unter das Schlüsselbein.
Konzentriert streifte sie sich jetzt den Mantel ab, reichte ihm dem Mann neben sich und verkündete mit dieser simplen Geste ihre Herrschaft über den Raum und seinen Inhalt.
»Ivan«, sagte sie, »halte das doch bitte, während ich meinen alten Freund Dima besuche, ja?«
»Dima«, wiederholte Dimitri, ließ sich die Koseform seines Namens über die Zunge perlen, während der groß gebaute Mann neben Marya Antonova sich ihren Mantel sorgsam und nicht minder akribisch als seine Arbeitgeberin über den Arm legte. »Also bist du auf Freundschaftsbesuch, Masha?«
»Das kommt ganz darauf an«, erwiderte sie, unbeeindruckt von der Erwähnung ihres eigenen Spitznamens und ganz offensichtlich nicht in Eile, den Grund für ihren Besuch preiszugeben. Stattdessen betrachtete sie den Raum ausgiebig, ließ den Blick flüchtig über Roman wandern, bevor sie mit einiger Überraschung Lev fixierte.
»Du liebe Zeit«, murmelte sie. »Der kleine Lev ist ganz schön groß geworden, nicht wahr?«
Zweifellos sollte ihr ach so sanftes Lächeln ihn verunsichern.
»Bin ich«, sagte Lev warnend, doch Dimitri gebot ihm mit erhobener Hand Schweigen.
»Setz dich, Masha.« Er deutete auf einen Sessel.
Sie belohnte ihn mit einem Lächeln, strich sich den Rock glatt, bevor sie sich auf dem Rand des Sessels niederließ. Dimitri setzte sich ihr gegenüber auf ein Ledersofa. Roman und Lev stellten sich, nachdem sie einen argwöhnischen Blick getauscht hatten, hinter das Sofa, so dass die beiden Erben über die Interessen ihrer jeweiligen Familien verhandeln konnten.
Dimitri sprach zuerst. »Kann ich dir etwas anbieten?«
»Nein, danke«, antwortete Marya.
»Wir haben uns lange nicht gesehen«, bemerkte Dimitri.
Im darauffolgenden Schweigen schwangen Dinge mit, die weder laut ausgesprochen werden mussten noch einer Erklärung bedurften.
Allenthalben wurde sich geräuspert.
»Wie geht’s Stas?«, fragte Dimitri beiläufig – zumindest wäre sein Tonfall einem anderen Beobachter so vorgekommen. Lev erschien der erzwungene Small-Talk seines Bruders etwa so fehl am Platz wie die Vorstellung, Marya Antonova wolle ihre Zeit mit Höflichkeitsfloskeln vergeuden.
»Gut aussehend und gut ausgestattet, genau wie vor zwölf Jahren.« Marya lächelte Roman vielsagend an, der wiederum Lev einen verwirrenden Blick zuwarf. Der Ratshexer Stas Maksimov schien als Thema dieser Unterhaltung so unpassend, wie Ratshexen es immer waren. Keiner der drei Fedorovs verschwendete je viele Gedanken an den Hexenrat, da das Geschäft ihres Vaters dafür sorgte, dass die Familie viele der Hexen seit Jahrzehnten in der Tasche hatte.
»Wie laufen die Geschäfte, Dima?«, fragte Marya, bevor Lev sich einen Reim auf seine Überlegungen machen konnte.
»Ach, komm schon, Masha.« Seufzend ließ sich Dimitri in die Kissen sinken. »Du bist doch bestimmt nicht den ganzen Weg hierhergekommen, um über die Arbeit zu reden, oder?«
Die Frage schien sie zu amüsieren, oder zumindest nicht zu beleidigen. »Du hast recht. Ich bin nicht hier, um über die Arbeit zu reden, nein.« Sie gestikulierte über die Schulter zu ihrem Begleiter. »Das Paket bitte.«
Ivan trat vor und reichte ihr ein schmales, ordentlich verpacktes, rechteckiges Päckchen, das Lev nicht verdächtig vorgekommen wäre, wenn es nicht mit solch offensichtlicher Vorsicht behandelt worden wäre. Marya betrachtete es nur kurz, bevor sie es Dimitri hinstreckte.
Roman zuckte, wollte sie aufhalten, doch Dimitri hob erneut eine Hand, um ihm Einhalt zu gebieten, während er das Päckchen entgegennahm.
Sein Daumen strich kurz über Maryas Finger. »Was ist das?«
»Ein neues Produkt«, sagte Marya lächelnd, während Dimitri das dicke Pergament aufschlug und einige schmale Pillen in einem Plastikblister enthüllte. Sie sahen aus wie farbenfrohe Aspirin. »Sie sollen Euphorie auslösen. Unseren anderen Waren nicht ganz unähnlich, doch diese hier sind etwas weniger Samthandschuh und mehr Achterbahn; ein bisschen deutlicher als reine Einbildung. Immer noch ein Halluzinogen, doch mit einem Hauch … Innovation, wenn man so will. Natürlich passt es zu unseren bekannten Produkten. Zur Marke«, führte sie achselzuckend aus. »Du kennst das ja.«
»Tatsächlich kenne ich das nicht«, erwiderte Dimitri, und Lev beobachtete, wie ein Muskel am Kiefer seines Bruders zuckte; neben der Resignation in seiner Stimme ein weiteres, uncharakteristisches Merkmal der Anspannung. »Du weißt, dass Koschei nur auf explizite Anfrage mit magischen Rauschmitteln handelt. Mit so was machen wir keine Geschäfte.«
»Interessant«, sagte Marya leise. »Sehr interessant.«
»Ach ja?«
»Oh, ja. Ich bin sogar erleichtert, dass du das sagst. Ich habe nämlich Dinge gehört, schlimme Gerüchte über die neuesten Geschäftstätigkeiten deiner Familie …«
Lev blinzelte überrascht und warf Roman einen Blick zu, der jedoch mit einem warnenden Kopfschütteln antwortete.
»… aber wenn du sagst, dass ihr mit solcher Ware nicht handelt, glaube ich dir nur zu gern. Immerhin sind sich unsere Familien geschäftlich in der Vergangenheit nicht in die Quere gekommen, nicht wahr? Das ist wohl für alle das Beste.«
»Ja.« Dimitri ließ die Tabletten sinken. »Wars das, Masha? Wolltest du nur ein wenig mit der neuesten Errungenschaft deiner Mutter angeben?«
»Angeben? Wirklich? Das würde ich nie tun«, erwiderte Marya. »Aber wo ich schon mal hier bin, wäre es doch schön, wenn ihr sie als Erste probieren würdet. Ein Zeichen unseres guten Willens. Ich kann meine Produkte bedenkenlos mit euch teilen, nicht wahr? Zumindest, wenn man dir Glauben schenken darf.« Sie forderte ihn geradezu zum Widerspruch heraus. »Immerhin sind wir doch alte Freunde. Oder nicht?«
Dimitri biss erneut die Zähne zusammen; Roman und Lev warfen einander einen weiteren Blick zu.
»Masha …«, setzte Dimitri an.
»Oder etwa nicht?« wiederholte Marya. Ihr Tonfall wurde schärfer, und jetzt sah Lev den Blick, den er als Junge so sehr gefürchtet hatte; den eiskalten, abweisenden Blick, den sie ihm bei ihren seltenen Begegnungen hatte zuteilwerden lassen. Offenbar hatte sie gelernt, ihre schneidenden Charakterzüge mit einem Fitzelchen Unschuld zu tarnen, doch ganz verstecken konnte sie diesen Blick nie. Auf Lev hatte er dieselbe Wirkung wie ein über ihm kreisender Raubvogel.
»Probier mal eine, Dima«, forderte Marya ihn in einem Tonfall auf, der keine Widerrede duldete, keine Ablehnung. »Ich denke mal, du weißt, wie man sie nimmt?«
»Masha«, wiederholte Dimitri und verlieh seiner Stimme einen diplomatischen Ton. »Sei doch vernünftig. Hör zu …«
»Nein, Dima«, unterbrach sie ihn ausdruckslos, und die aufgesetzte, unbeschwerte Höflichkeit verschwand.
Es schien, als hätten sie beide die Schauspielerei aufgegeben, als würden die Konsequenzen von etwas Ungesagtem die Unterhaltung zu einem plötzlichen Wendepunkt bringen, und Lev wartete ungeduldig darauf, dass sein Bruder ablehnte. Das schien die sinnvollere Option zu sein, die rationale; Dimitri nahm gewöhnlich keine Rauschmittel und hätte nur zu leicht ablehnen können, denn es gab keinen offensichtlichen Grund für Furcht.
(Keinen Grund, dachte Lev finster, abgesehen von der Frau, die ihm gegenübersaß, reglos und doch so bedrohlich wie eine Waffe.)
Doch dann – zu Levs unterdrücktem Schrecken – nickte Dimitri, nahm eine lilafarbene Tablette zwischen die Fingerspitzen und betrachtete sie einen Moment. Neben ihm zuckte Roman fast unmerklich vor, zwang sich dann aber zur Ruhe, den Blick besorgt auf seinen Bruder gerichtet.
»Tu es«, sagte Marya, und Dimitri versteifte sich sichtbar.
»Masha, lass es mich erklären«, sagte er mit leiser Stimme, in der Lev vielleicht sogar ein Flehen gehört hätte, wenn er denn geglaubt hätte, dass sein Bruder flehen konnte. »Schuldest du mir nach all dem denn nicht wenigstens das? Ich verstehe, dass du wütend bist …«
»Wütend? Worüber sollte ich denn wütend sein? Nimm sie einfach, Dima. Was hast du schon zu befürchten? Immerhin sind wir doch Freunde, oder etwa nicht?«
Die Worte perlten Marya mit beißendem Sarkasmus von der Zunge, begleitet von einem maskenartigen Lächeln. Dimitris Mund öffnete sich, er zögerte und Maya lehnte sich vor. »Oder etwa nicht?«, wiederholte sie, und dieses Mal zuckte Dimitri ganz offensichtlich zusammen.
»Du gehst jetzt wohl besser«, platzte Lev unüberlegt heraus und trat vor seinen Bruder.
Marya blickte auf, betrachtete ihn, und von einer Sekunde zur nächsten veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, wurde wieder freundlich, als hätte sie sich gerade erst daran erinnert, dass Lev überhaupt im Raum war.
»Weißt du, Dima, wenn die Brüder Fedorov den Schwestern Antonova auch nur im Geringsten ähneln, wäre es wirklich falsch von mir, sie nicht auch für ihre Freundschaft zu belohnen. Vielleicht sollten Lev und Roma auch eine Tablette probieren«, überlegte sie laut und ließ ihren Blick langsam wieder zu Dimitri gleiten. »Meinst du nicht?«
»Nein«, sagte Dimitri so entschieden, dass Lev sich versteifte. »Nein, sie haben damit nichts zu tun.« Er drehte sich leicht zu Lev um. »Bleib, wo du bist, und rühr dich nicht vom Fleck. Roma, sorg dafür, dass er da bleibt«, befahl er mit seiner tiefen Kronprinzenstimme.
Roman nickte und warf Lev einen warnenden Blick zu.
»Dima, du musst das wirklich nicht …«, setzte Lev an, dessen Sinne inzwischen laut Alarm schlugen.
»Ruhe«, sagte Marya, und tödliche Stille senkte sich über die Köpfe. »Du hast es mir versprochen«, sagte sie und hielt Dimitris Blick. Für sie existierte außer ihm offenbar niemand Wichtiges in diesem Raum. »Ich werde dir ja wohl nicht sagen müssen, warum du mir gehorchen wirst, oder?«
Und dann, langsam, überwand Dimitri sich, den Mund zu öffnen, sich die Tablette auf die Zunge zu legen und zu schlucken, während Lev einen stummen Schrei ausstieß.
»Wie gesagt ist es ein neues Produkt«, teilte Marya den Anwesenden mit und strich sich den Rock glatt. »Diese Tablette unterscheidet sich nicht von denen, die auf den Markt kommen werden.« Sie musterte Dimitri mit ruhiger Gleichgültigkeit. »Das Interessante an unseren Rauschmitteln ist jedoch, dass es Voraussetzungen für ihren Genuss gibt.« Dimitri schüttelte sich leicht. »Natürlich müssen wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, mit wem wir es zu tun haben, also gibt es mögliche Nebenwirkungen. Diebe, zum Beispiel«, sagte sie leise, ohne den Blick von Dimitris Gesicht abzuwenden, »erleben unangenehme Reaktionen. Lügner auch. Eigentlich wird sogar jeder, der unsere Produkte berührt, ohne dafür bezahlt zu haben, feststellen, dass sie … recht unangenehme Wirkungen zeigen.«
Dimitri hob eine Hand an den Mund und würgte mehrere Sekunden lang. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, hob er so würdevoll wie möglich den Kopf und wischte sich mit dem zitternden Handrücken über die Nase.
Blut bedeckte den Knöchel seines Zeigefingers.
»Dass unsere Dealer sich auch mal eine Tablette genehmigen wollen, ist nur verständlich, deshalb tragen sie einen geheimen Schutzzauber. Das weißt du höchstwahrscheinlich nicht«, bemerkte Marya. Lev begriff nicht, warum das relevant war. »Es ist ja auch ein Geschäftsgeheimnis, nicht wahr? Dass es ziemlich gefährlich ist, unsere Produkte ohne ausdrückliche Erlaubnis zu verkaufen, meine ich. Das soll ja niemand wissen, sonst bricht unser System zusammen.«
Dimitri hustete erneut unterdrückt. Jetzt rann ihm das Blut ohne Unterlass aus der Nase, tropfte auf seine Hände und bedeckte sie mit zähem, schlammigen Rot, durchzogen von Schwarz. Er versuchte gurgelnd, Worte zu formulieren; wollte verhindern, dass das Blut in seine Kehle rann, während er von Husten geschüttelt wurde.
»Wir haben mehrere Informanten, weißt du? Sie sind sehr schlau und gut versteckt. Leider hat uns einer von ihnen mitgeteilt, dass irgendjemand unsere Rauschmittel verkauft«, fuhr Marya fort. »Diese Person kauft sie von uns und verkauft sie dann für nahezu das Vierfache weiter. Wer würde wohl so etwas tun, Dima?«
Dimitri gab einen Laut von sich, Maryas Namen vielleicht, und sackte auf alle viere vor das Sofa. Ein Schauer lief durch seinen Körper, dann noch einer, er schlug sich den Kopf an der Tischecke an und fiel zu Boden.
Lev rief ihn beim Namen, doch der Schrei wurde von Maryas Zauber erstickt. Sie war bei Weitem die bessere Hexe – das hatte ihr Vater immer gesagt. Er selbst sprach von der jungen Marya Antonova wie von einem Dämon aus der Alten Welt, als sei sie die böse Hexe, vor der man Kinder warnte. Dennoch sprang Lev panisch vor, spürte dann aber den eisernen Griff seines Bruders Roman am Kragen, der ihn an Ort und Stelle hielt, während Dimitri sich mühsam aufsetzte, um dann doch wieder zu Boden zu sinken. Unter seiner Wange sammelte sich eine Blutlache.
»Es schmerzt mich, Dima, ehrlich«, sagte Marya ausdruckslos. »Ich war wirklich davon ausgegangen, dass wir Freunde sind, weißt du? Ich hatte gedacht, ich könnte dir vertrauen. Früher warst du immer so aufrichtig … Natürlich, in zehn Jahren kann viel passieren, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mal in dieser Situation wiederfinden.« Sie seufzte und schüttelte den Kopf. »Es schmerzt mich ebenso sehr wie dich.« Dimitri rang um Luft; sie wandte den Blick nicht eine Sekunde lang ab, selbst als er von heftigen Krämpfen geschüttelt wurde. »Und dich scheint es ja wirklich sehr zu schmerzen.«
Lev spürte erneut, wie er den Namen seines Bruders schrie, wie er sich durch seine Kehle kämpfte, bis Dimitri endlich, endlich aufhörte zu krampfen und erschlaffte. Das Ganze mutete an wie ein barockes Porträt; von seinem verdrehten Oberkörper bis hin zu dem ausgestreckten Arm und der geöffneten Hand, die neben Maryas Füßen lag.
»Na dann.« Marya seufzte und stand auf. »Das wär’s dann wohl. Ivan, meinen Mantel, bitte.«
Nachdem Roman ihn losgelassen hatte, ging Lev neben Dimitri in die Knie. Roman sah angespannt und hilflos zu, wie Lev nach dem Puls ihres Bruders tastete und panisch Zauber um Zauber wirkte, um das übrige Blut in seinem Körper zu halten, um seine Lungen zur Arbeit zu bewegen. Dimitris Atem ging flach, seine Brust bewegte sich kaum noch, und in einem Moment der Hoffnungslosigkeit blickte Lev zu Marya auf, die sich gerade schwarze Lederhandschuhe anzog.
»Warum?«, krächzte er, ohne groß darüber nachzudenken.
Er war nicht überrascht, dass er die Kontrolle über seine Stimme wiedererlangt hatte, und sie war ebenso wenig überrascht, dass er eine Frage an sie richtete. Vorsichtig wischte sie einen Fleck vom Glas ihrer übergroßen, schwarzen Sonnenbrille, bevor sie sie aufsetzte.
»Sag Koschei, dass Baba Yaga lieb grüßen lässt«, sagte sie schlicht.
Übersetzung: Ihr seid dran.
Dann drehte Marya Antonova sich um, bedeutete Ivan, ihr zu folgen, und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
I. 2(Was die Leute sehen.)
»Alexandra Ant … oh, sorry, Anto-no-va?«
»Hi, das bin ich.« Sasha hob schnell die Hand. »Man spricht das An-ton-ova aus. Aber alle nennen mich Sasha.«
»Ah, okay, cool«, sagte der Aushilfsdozent und hatte es offensichtlich im nächsten Augenblick schon wieder vergessen. »Du arbeitest mit ähm …« Er überflog die Liste in seiner Hand. »Eric Taylor, John Anders und Nirav äh …«
»Vemulakonda«, warf jemand eine Reihe hinter Sasha kühl ein.
»Genau, der«, stimmte der Aushilfslehrer zu. »Okay, setzt euch einfach zusammen und besprecht alles, ja? Ihr habt noch zehn Minuten. Ich bin hier, falls ihr Fragen habt«, fügte er hinzu, doch seine Worte gingen in dem Lärm der Studenten unter, die sich auf ihren Sitzen umdrehten und sich neue Plätze im Hörsaal suchten.
»Hey«, sagte Sasha und nickte, als der andere Student mit dem unaussprechlichen Namen zu ihr trat. Sein schwarzes Haar hing ihm in einer dramatischen Welle in die Stirn. »Nirav, richtig?«
»Genau. Und du bist Sasha«, erwiderte Nirav. »Das gefällt mir. Sa-sha«, wiederholte er nachdrücklich und entblößte seine Zähne, während er die Silben kostete. »Guter Name.«
»Danke. Gute Markenpolitik«, erwiderte sie trocken, und er lachte leise und nickte den anderen beiden Gruppenmitgliedern zu, die hinter ihr erschienen waren.
»Eric«, sagte der eine und streckte ihnen die Hand hin. Sein blondes Haar war ordentlich gescheitelt und so gepflegt wie sein blauer Pullover mit V-Ausschnitt. »Das ist John«, sagte er und deutete auf den ruhigen, Schwarzen Studenten neben ihm, der oft einige Reihen hinter Sasha saß. »Wollen wir ein Treffen vereinbaren und dann die Details besprechen?«
Wenig überraschend schwang Eric sich bereits zum Anführer auf.
»Mir würde morgen um zwölf in der Bobst Library passen«, schlug Sasha vor. »Oder, wenn ihr lieber einen Kaffee trinken wollt, dann können wir uns nach meinem Unterricht um zwei bei …«
»Wie wäre es stattdessen mit einem Drink?«, unterbrach Eric sie und wandte sich dabei ausschließlich an John und Nirav. »Heute Abend im Misfit? Wir können den Geschäftsplan durchgehen und dann die Rollen aufteilen.«
»In einer Bar?«, fragte Sasha zweifelnd. Sie spürte, wie ihr Gesichtsausdruck versteinerte, als Nirav und John zustimmten. »Findet ihr das nicht etwas …«
»Brillant?«, warf Eric ein und grinste sie an. Er wäre attraktiv gewesen, wenn er nicht so durch und durch nervig gewesen wäre; so musste sie gegen den Drang ankämpfen, ihn mehrere Sitzreihen nach hinten zu schleudern. »Was meint ihr? So gegen acht heute?«
Sasha räusperte sich, verkniff sich ein Aber es ist mitten in der Woche und sagte stattdessen: »Ich glaube wirklich nicht, dass das …«
»Acht klingt gut«, unterbrach John sie und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Sorry, ich muss zur nächsten Vorlesung …«
»Ich auch«, fügte Nirav hinzu, schulterte seinen Rucksack und warf Sasha einen entschuldigenden Blick zu, der sie nur noch mehr frustrierte. »Cool, dann also bis acht …«
»Ja, bis dann …« Verstimmt sah Sasha zu, wie die anderen drei den Hörsaal verließen.
Eric zwinkerte ihr über die Schulter zu, bevor er zu den anderen beiden aufschloss. Sie verzog das Gesicht, ballte die Hand zur Faust. Ihrer Mutter würde das gar nicht gefallen, und um ehrlich zu sein hatte sich Sasha in all ihren zweiundzwanzig Jahren noch nie groß in Bars herumgetrieben. Langsam verließ sie das Gebäude, schlang sich ihren Schal um den Hals und bereitete sich innerlich auf die kalte Luft des späten Winters vor.
»Sasha!«
Sie hielt inne, als ihre älteste Schwester sie rief, wandte sich um und sah Marya auf sich zukommen. Sie hielt die Hand ihres dick eingepackten, zwei Jahre alten Neffen Luka. Luka war der Sohn ihrer Schwester Katya, doch in letzter Zeit kam es häufig vor, dass Marya halb heruntergebeugt an seiner Seite lief, weil sie sich sowohl weigerte, Lukas Hand loszulassen, als auch ihre Stilettos gegen Sneaker zu tauschen.
»Sasha«, rief sie erneut, nahm Luka auf den Arm und lief die letzten Schritte bis zu ihr. Sofort griff Luka nach einer ihrer Haarsträhnen und zog heftig daran, doch Marya schien das nichts auszumachen. »Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde«, sagte sie und schob vorsichtig Lukas Hand beiseite. »Gehst du zum Laden?«
»Ja, natürlich«, antwortete Sasha, erschauerte kurz vor Kälte und begrüßte Luka mit einem freudigen Winken. »Das war doch die Abmachung. Nach dem Unterricht sofort an die Arbeit …«
»Ist dir kalt?« Marya sah die zitternde Sasha stirnrunzelnd an. Sie nahm Luka auf die andere Hüfte und griff nach Sashas Fingern. »Hier, komm her, gib mir deine Hand …«
»Du kannst hier keine Magie wirken, Masha, das fällt den Leuten doch auf«, fauchte Sasha und funkelte ihre Schwester warnend an, doch Marya schnappte sich katzengleich ihre Hand. »Nein, Masha … Masha, stopp …«
»Die Leute sehen nur, was sie sehen wollen, Sashenka«, sagte Marya in ihrem brüsken, abgeklärten Tonfall, verstärkte den Griff um Sashas widerspenstige Finger und pustete leicht über ihre Knöchel, bis sie warm wurden. »Da. Besser?«
»Komm mir nicht mit ›Sashenka‹, Marya Maksimova«, entgegnete Sasha, auch wenn sie sich viel besser fühlte, als hätte sie sich die Hände an einem leise knisternden Feuer gewärmt. Das war eine von Maryas Spezialitäten – diese kleinen Zauber, die einen großen Unterschied machten, wie der richtige Schnitt eines Kleides oder die passende Tischdecke für ein Abendessen. Ihrem selbstzufriedenen, beerenfarbenen Siegesgrinsen nach zu urteilen, wusste ihre Schwester das genau.
»Ich bin eine Antonova, genau wie du auch, Sashenka«, erwiderte Marya geradeheraus. »Und sogar eine Maryovna«, sagte sie, womit sie sich auf den Namen ihrer Mutter bezog, nach der Marya benannt war, »aber das klingt dämlich.«
Das stimmte. »Na schön.«
Marya machte sich in ihrem üblichen flotten Tempo auf den Weg, richtete Lukas Strickmütze und steuerte die drei in Richtung des Ladens. Dass sie und Marya ein gemeinsames Ziel hatten, erinnerte Sasha daran, dass sie sich noch überlegen musste, auf welches ihrer Probleme sie heute Abend Energie verschwendete, denn der Abend würde noch anstrengend genug werden.
»Arbeitet Galya gerade?«, fragte Sasha. »Sie muss heute Abend für mich einspringen. Nur für eine Stunde«, fügte sie schnell hinzu, um neugierigen Nachfragen zu entgehen. Die Regel besagte, dass Sasha nie irgendwo hin ging. (Die Regel hatte sie nicht selbst aufgestellt, aber sie galt trotzdem.)
»Oh?«, fragte Marya so neugierig wie erwartet. Sie hatte den scharfen, fragenden Ton ihrer Mutter geerbt, auch wenn ihr Blick weicher und mitfühlender auf Sasha, der jüngsten der Antonova-Töchter, ruhte. »Was hast du denn heute Abend vor?«
»Nichts. Nur eine dumme Gruppenarbeit«, murmelte Sasha, und Marya zog zweifelnd eine Augenbraue hoch. »Unikram.«
»Ah. Tja, Galya wird das nicht gut finden«, bemerkte Marya. »Sie hat was von einem Date heute Abend erzählt, aber du kennst sie ja.« Galya hatte nie ernsthafte Dates; soweit Sasha es beurteilen konnte, war Dating für sie eher eine Freizeitbeschäftigung. Etwas, um ihre Reflexe zu schulen. »Leih ihr den Pulli, den sie so mag, dann ist sie nicht so lange sauer auf dich.«
Sasha machte ein unverbindlich-zustimmendes Geräusch. Sie war von ihren eigenen Problemen abgelenkt. »Das muss ich wohl hoffen, denn zu dem Termin muss ich hin.« Marya sah sie fragend an, und Sasha verschaffte sich nur zu gern Luft. »Einer der Typen aus dem Kurs ist so ein Pfosten, der meine Ideen eher abschmettert als zuzugeben, dass ich ein Hirn habe. Das weiß ich jetzt schon.«
»Ach, was ein Mist.« Marya blickte auf ihren Neffen hinab, der mit verzückter Aufmerksamkeit lauschte. »Du wirst doch kein Klinkenputzer des Patriarchats, oder?«, fragte sie Luka. »Da wäre ich nämlich wahnsinnig enttäuscht.«
Luka gab nur unverständliche Laute von sich und steckte sich den Fäustling in den Mund.
»Luka hat schon recht. Ein Zauber könnte helfen«, schlug Marya vor und nickte ihrem Neffen weise zu, als hätte er etwas Sinnvolles beigetragen. »Mama und ich könnten bestimmt dafür sorgen, dass der Kerl besser zuhört. Ansonsten verhexen wir ihn so gründlich, dass er nie wieder nervt.«
»Das ist wirklich nett von dir, Masha, aber ich muss wohl einfach damit klarkommen. Wir können ja nicht jeden einzelnen Mann auf dem Planeten verfluchen, oder?«
»Jedenfalls nicht an einem Tag«, erwiderte Masha. »Versuchen tu ich’s aber dauernd.« Als sie nebeneinander an einer roten Ampel warteten, betrachtete sie Sasha, während vor ihnen Taxis über die Kreuzung zischten. »Ich vertrete dich, Sashenka, keine Sorge. Aber sag Mama nicht, dass es um die Uni geht, okay?«
Sasha wusste es besser – Galya ging unbehelligt jede Woche auf mehrere Dates, während Sasha einen Pullover opfern musste, um etwas für die Uni zu erledigen. (Galya würde ihr den Pullover schon zurückgeben. Irgendwann.) Trotzdem fühlte sie sich wegen der Großzügigkeit ihrer Schwester schlecht. »Du hast schon im Laden gearbeitet, Masha, das passt schon. Wenn Galya nicht bleiben kann, komme ich eben etwas zu spät und …«
»Nein, das tust du nicht«, warf Marya streng ein und wich geschickt einem Mann aus, der stehen geblieben war, um sie anzustarren. Sie ließ sich durch nichts anmerken, dass sie ihn bemerkt hatte, sondern stupste Sasha an, damit sie schneller lief. »Du musst da sein, um den Typen zurechtzustutzen, Sasha, sonst vergebe ich dir nie. Außerdem schadet es nicht, zu lernen, wie man mit solchen Männern umgeht. Sogar Mama und ich haben dauernd mit denen zu tun.«
»Sie können wohl nicht alle so toll sein wie Stas«, bemerkte Sasha trocken. Maryas Ehemann Stanislav war einer der vielen Gründe, warum Marya nie darauf einging, wenn einer ihrer Bewunderer auf offener Straße stehen blieb. »Aber danke, Masha.«
»Wozu hat man Schwestern denn sonst?«, erwiderte Marya achselzuckend. »Armer Luka«, fügte sie hinzu und nahm ihn auf die andere Seite, so dass er Sasha mit großen Augen musterte und ihr mit einer dicken Hand zuwinkte. »Er wird nie wissen, wie es ist, wenn sechs Schwestern sich seine Klamotten ausleihen.«
»Ach, vielleicht ja schon«, zog Sasha sie auf. »Katya sagt immer, dass sie mehr Kinder will, und vielleicht hast du eines Tages selber sieben Töchter.«
»Wäre es okay, wenn du mir heute keinen Fluch auf den Hals jagst?«, fragte Marya. »Mein Vormittag war hart, und so finstere Zukunftsaussichten brauche ich jetzt nicht auch noch.«
Es sollte ein Witz sein, aber Sasha entging nicht, wie erschöpft ihre Schwester klang. Und plötzlich ging ihr auf, warum. »Du hast dich heute mit den Fedorovs getroffen, oder?«
Sasha wusste wenig über das Alltagsgeschäft ihrer Schwester (was eher an Maryas Verschwiegenheit als an mangelndem Interesse seitens Sasha lag), doch selbst die beiläufigste Erwähnung der Familienrivalen war unvergesslich. Ein Treffen mit den Fedorovs musste Ärger bedeuten – allein der Name kam im Hause Antonova einem Schimpfwort gleich. Sasha hatte keinen der Fedorov-Söhne je getroffen, doch in ihrer Vorstellung waren sie alt, böse und hatten die gleichen grausamen Augen wie Koschei der Todlose, den sie nur aus den Geschichten ihrer Mutter kannte.
»Hm?«, erwiderte Marya reflexartig. Sie wirkte zerstreut. »Oh, es war schon okay, ich habe mich darum gekümmert.«
»Das weiß ich.« Sasha verdrehte die Augen. »Du kümmerst dich um alles, Masha, du bist schlimmer als Mama. Aber wie lief es? Warst du nicht mal mit einem der Brüder befreundet?« Sie überlegte stirnrunzelnd. »Dima, oder?«
»Dimitri«, verbesserte Marya sie. »Ich kannte ihn vor langer Zeit mal, bevor Koschei und Mama ihre kleine Auseinandersetzung hatten. Wir waren damals Teenager, eigentlich eher Kinder. Und du warst auch noch ganz klein.« Einen Augenblick lang schwieg sie und lief so lange gedankenversunken weiter, bis Luka ihr wieder fest an den Haaren zog. »Wie auch immer, du musst dir keine Sorgen machen, Sasha. Die Fedorovs werden uns nicht mehr belästigen.«
»Aber was genau ist passiert?« Am Abend zuvor hatte ihr der von der Zimmertür gedämpfte Streit zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester einen Schauer über den Rücken gejagt. Die Fedorovs waren immer ein heikles Thema, doch Baba Yagas Zorn kochte selten so hoch. »Mama schien echt wütend …«
»Es ist nichts, Sashenka. Rein gar nichts, okay?«, unterbrach Marya sie, und widerwillig gab Sasha auf. Diesen Ton schlug ihre Schwester nur an, wenn sie wirklich genug hatte. »Lass mich ihr erzählen, dass du heute Abend nicht da bist«, fügte Marya vorsichtig hinzu. »Das nimmt Mama bestimmt nicht gut auf.«
Das verriet Sasha, dass das Treffen nicht gut gelaufen war und dass sie auf keinen Fall nach Details fragen sollte.
»Okay«, sagte sie. »Aber geht’s dir gut?«
»Mir?« Marya schien überrascht. »Es ist nichts, versprochen. Nur Geschäftliches. Und auch wenn du diejenige bist, die auf eine teure Schule geht«, fügte sie neckend hinzu, »kann ich durchaus mit etwas Widerspruch umgehen.«
Das war eine Untertreibung. Selbst mit einem Baby auf der Hüfte war Marya Antonova eine beeindruckende Erscheinung. Ihre Magie und ihre Begabung zur Konfliktlösung gingen weit über Haushaltszauber hinaus. Die Details ihrer Arbeit behielt sie sorgsam für sich, doch man konnte leicht erraten, womit sie täglich beschäftigt war. Für Sasha war Marya Antonova aber immer Masha – die Frau, die spielerisch in die Wange ihres Neffen biss – und niemals die Hexe, deren Name nur im Flüsterton gesprochen wurde.
Schon seit ihrer Kindheit wusste Sasha zwei Dinge ganz genau: Monster waren real, und Masha war diejenige, die sie alle vor ihnen beschützte.
»Okay«, sagte Sasha erneut und hielt Luka die Hand hin, der seine kleine Faust um ihre magisch gewärmten Finger schloss.
I. 3(Leben unter den Todlosen.)
»Immerhin lebt er.« Roman musterte den bewusstlosen Dimitri, den sie im Lager ihres Vaters behelfsweise auf eine Matratze gebettet hatten. »Liegt nur im Koma.« Er massierte sich die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wir haben Glück gehabt. Es hätte viel schlimmer kommen können.«
»Wir müssen doch noch etwas tun können«, widersprach Lev frustriert, weil sein Bruder das völlig Inakzeptable einfach so hinzunehmen schien. »Nur im Koma? Im Krankenhaus sollte er liegen, Roma! Nicht hier.« Er deutete auf das Lager. »Wir können ihn nicht wie eines von Papas Sammlerstücken hier verstecken, wo er fast schon in einer Kiste liegt …«
»Hier ist er am sichersten.« Romans Miene ließ keinerlei Widerrede zu. »Papas Verzauberungen halten hier besser als in jedem Krankenhaus. Wenn Marya Antonova oder sogar Baba Yaga die Sache zu Ende bringen wollen …«
»Zu Ende bringen?«, wiederholte Lev verstimmt. »Warum das denn?«
»Du hast Marya doch gehört. Dima hat sie verarscht und ihre Drogen zu einem höheren Preis weiterverkauft«, sagte Roman. »Aber trotzdem, das hier ist barbarisch. Es ist grausam, genau wie diese Antonova-Schlampen selbst. Vermutlich sollten wir uns geschmeichelt fühlen, dass sie Marya persönlich geschickt haben und keine der Jüngeren, die Yagas Drecksarbeit erledigen.«
»Ich verstehe es einfach nicht. Hat Dima Geld gebraucht?«, fragte Lev, der Romans verbittertem Sermon kaum zuhörte und nur das friedvolle Gesicht des schlafenden großen Bruders betrachtete. »Ich kapiere einfach nicht, warum er das getan hat, das sieht ihm gar nicht ähnlich. Papas Geschäfte liefen in letzter Zeit schleppend, ja, aber das hier …«
»Wir müssen das wieder hinbiegen«, unterbrach Roman ihn abrupt und warf Lev einen finsteren Blick zu. »Baba Yaga und ihre Töchter dürfen damit nicht durchkommen. Wir müssen zurückschlagen, Lev, und sie dort treffen, wo es wehtut. Wir müssen ihnen genau das antun, was sie uns angetan haben.«
»Klar, weil ›Auge um Auge‹ sich in solchen Situationen ja auch total bewährt hat«, sagte Lev tonlos. Erst dann ging ihm auf, dass es Roman offenbar ernst war. »Was, echt? Du willst dir Marya holen?«, fragte er verblüfft. Als Roman nicht antwortete, überlegte Lev, ob er lachen oder seinen Bruder auf Kopfverletzungen untersuchen sollte. »Aber … Roma, sie ist eine mächtige Hexe, niemals ungeschützt …«
»Nein, nicht ihre Erbin. Im Gegensatz zu ihnen sind wir keine Monster. Wir holen uns ihr Geld«, sagte Roman – nach Levs Geschmack etwas spät, aber immerhin wies diese Unterhaltung doch noch einen kleinen Funken Vernunft auf. »Du hast es selbst gesagt. Papas Geschäfte laufen schleppend. Je mehr Yaga und ihre Sippe scheffeln, desto gefährlicher können sie Papa werden. Desto gefährlicher können sie uns werden. Desto mehr haben sie das Gefühl, unserer Familie schaden zu können, in unser Gebiet vordringen zu dürfen.« Unheilschwanger legte Roman Lev eine Hand auf die Schulter. »Wir müssen etwas tun, Leva. Yaga muss dafür bezahlen.«
»Ich weiß ja nicht«, sagte Lev besorgt. »Ich weiß ja nicht. Noch mehr Blutvergießen? Bist du sicher …?« Als Romans Blick sich verfinsterte, unterbrach Lev sich.
»Schön.« Er seufzte resigniert. Sein Bruder wollte offenbar nicht hören, was er zu sagen hatte. »Dann reden wir mal mit Papa.«
I. 4(Die erste Runde.)
»Alles klar«, sagte Eric und winkte Sasha auf den Platz neben sich. »Was willst du trinken?«
Was soll das heißen, Sasha geht aus?
Sasha erinnerte sich daran, wie ihre Mutter geklungen hatte, während sie selbst stumm vor der Zimmertür auf und ab gegangen war und wie ein ungezogenes Kind auf ihre Erlaubnis gewartet hatte.
Wo geht sie hin?
Mama, Sasha ist eine erwachsene Frau, hatte Marya protestiert. Wenn sie ausgehen will, dann darf sie das. Du weißt, wie hart sie arbeitet.
Ich weiß, Marya. Ich werde ja wohl meine eigene Tochter kennen.
»Welches Getränk?«, fragte Eric erwartungsvoll. »Bier, Wein, Vodka Tonic mit etwas Limette?«
»Ähm … Bier ist gut«, erwiderte Sasha, die in ihrem ganzen Leben maximal zwei Biere getrunken hatte. Weder Baba Yaga noch ihre Töchter neigten zum Alkoholkonsum. »Ich hol uns …«
»Quatsch, die erste Runde zahle ich«, sagte Eric und schob sich an ihr vorbei, als Nirav sich gerade setzte, John im Schlepptau.
»Die erste Runde?« Sasha stöhnte, als Eric weg war.
Nirav lachte leise und klopfte ihr auf die Schulter. »Komm schon, wir müssen das üben, wenn wir je erfolgreiche Geschäftsleute werden wollen«, sagte er. »Netzwerken ist ein wichtiger Skill, habe ich mir sagen lassen.«
Oh bitte. »Wir netzwerken hier nicht. Wir arbeiten nur an einem Gruppenprojekt.«
»Aber es ist auch Donnerstagabend, und die Woche war lang.« John lehnte sich zurück und rieb sich die Augen. »Und trinken ist auf jeden Fall ein Skill.«
»Aber keiner, den wir für Unternehmensfinanzierung brauchen«, grummelte Sasha, doch als Eric mit dem Bier zurückkam, musste sie sich geschlagen geben.
»Ihr könnt mir euren Anteil über Venmo schicken«, sagte er zu John und Nirav. »Du nicht«, fügte er hinzu, als er Sasha zwinkernd ein goldgelbes Bier mit Schaumkrone überreichte. »Ich bin ein Gentleman.«
»Ich kann meine Getränke selbst bezahlen, vielen Dank auch«, erwiderte Sasha trocken und nahm das Glas entgegen. »Wie teuer war das?«
»Sag ich nicht.« Eric hielt sein Glas hoch. »Prost, Team. Auf das beste Gruppenprojekt, das Professor Steinert je gesehen hat«, sagte er, und Sasha stieß widerstrebend mit ihm an. Das versprach ein langer, unangenehmer Abend zu werden.
I. 5(Schattenwesen.)
Koschei zu finden war meistens recht einfach – im Gegensatz zu der Kreatur aus der slawischen Mythologie, deren Namen er trug. Mit ihm zu sprechen war bedeutend schwieriger, denn das hing davon ab, wer ihn denn suchte und wer die Tür bewachte.
Koschei hatte verschiedene Berufe: Am bekanntesten war er dafür, seltene gefährliche Magieobjekte zu beschaffen, doch er war auch Vermieter, Geldverleiher, Schmuggler und knausriger Tröster der Unglücklichen. Eine Hexe, die Fürsprache bei einem mächtigen Gegner brauchte, kam zu Koschei. Wurde man von einem gefährlichen Widersacher bedroht, kam man zu Koschei. Das Aufkommen des Online-Handels hatte dem Imperium des Alten einen ziemlichen Dämpfer verpasst – es war einfacher, jemanden für eine Aufgabe zu bezahlen, als einem Mann einen Gefallen zu schulden, den noch keine Ratshexe geschnappt hatte –, dennoch galt sein Schuldennetzwerk aus gutem Grund als undurchdringlich.
Wer etwas Illegales, Unmoralisches oder auch nur Ungehöriges brauchte, kam zu Koschei und konnte sicher sein, keine unangenehmen Fragen beantworten zu müssen. Koscheis Dienste hatten natürlich ihren Preis, doch mit den schwierigsten Problemen landete man früher oder später unweigerlich in seinem Keller, wo der Todlose, umgeben von seinen Unwesen, auf seinem üblichen Stuhl saß.
Für die meisten war ein Besuch in Koscheis Keller ein seltenes Privileg. Für die Söhne Fedorov war es nur eines von vielen.
Einige Leute würden mit ihrem Leben für den Zugang zu diesem Keller bezahlen, doch architektonisch war er eher unbedeutsam. In der Mitte war vor Kurzem ein Boxring errichtet worden, darum die üblichen verstreuten Kisten und darauf Koscheis grunzender innerer Kreis. Unter einem schmalen Fenster stand ein einziger Tisch. Das Licht der Straßenlaternen wurde von einem notdürftigen Vorhang zurückgehalten.
»Papa«, begann Roman und setzte sich auf den Stuhl rechts von seinem Vater, während Lev stumm hinter ihm Position bezog. »Wir müssen über Yaga sprechen.«
Koschei, ein abgebrühter Mann in den Sechzigern, der schon lange nicht mehr Lazar Fedorov genannt wurde, hob die Hand, um seinem Sohn Schweigen zu gebieten.
»Siehst du das?«, fragte er leise und deutete auf etwas, das Lev für verschwommene Schatten im Ring hielt. Durch eins der Fenster gegenüber fiel Licht herein, und ein Mondstrahl, den eine kleine Wolke zu verdecken suchte, hob die Silhouette eines Mannes hervor, wann immer er ins rechte Licht glitt.
»Schattenwesen«, erklärte Koschei, als Lev in die Dunkelheit des Kellers blinzelte. »Die Inuit nennen sie Taqriaqsuit. Schattenmenschen, die in einer Parallelwelt leben. Wenn man Schritte hört, obwohl man allein ist, dann ist angeblich eine dieser Kreaturen in der Nähe. Höchst interessant, nicht wahr?« Koschei löste den Blick nicht von den Schatten.
Lev fragte nicht, wer sie gekauft hatte, wie Koschei sie gefunden hatte, ob sie, wie die anderen Unwesen, die sein Vater aufstöberte, jetzt zu seiner Unterhaltung kämpfen sollten. Schon seit er klein war, wusste Lev, dass man einige Fragen besser nicht stellte.
»Wie auch immer, du wolltest etwas sagen, Romik?«
Roman nickte und wandte sich ihm zu.
»Vergeltung«, sagte er schlicht, und Koschei nickte; Lev war schon immer der Meinung gewesen, dass nur die beiden ältesten Söhne ihren Vater verstanden und umgekehrt. Soweit Lev erkennen konnte, war für Koschei keine weitere Erklärung nötig, doch Roman fuhr fort. »Ich habe gehört, dass Yaga ihren Kundenstamm vergrößern will.«
Das war Lev neu, doch er wusste, dass Yagas Geschäfte florierten, während Koscheis welkten. Yagas Betätigungsfelder waren genauso zwielichtig – die Ratshexen verbaten den Verkauf der meisten Rauschmittel und stuften sie als Gifte ein –, doch sie verstand es besser, sich das bisschen Licht zunutze zu machen. Ihre Drogerie, der legitime Teil ihrer Geschäfte, war tadellos. Man würde nie vermuten, dass der Mord an Dimitri Fedorov von der puttengleichen Geschäftsführerin eines Ladens für überteuerte Seifen in Auftrag gegeben worden war.
»Wenn ich raten müsste, würde ich behaupten, Yaga will die offensichtlichste nichtmagische Konsumentengruppe ins Auge fassen«, fuhr Roman fort.
Koschei zog erwartungsvoll eine Augenbraue hoch. »Für ihre Halluzinogene, meinst du?«
»Studenten«, erklärte Roman, und Koschei nickte, verzog anerkennend den Mund. »Laut einer meiner Quellen will sie mit einem Dealer ins Geschäft kommen. Wenn wir in den Verkauf eingreifen, sie vielleicht sogar dem Hexenrat melden, dann …«
Er beendete den Satz bewusst nicht und deutete stattdessen mit der Hand einen vermuteten Pfad der unausweichlichen Zerstörung an.
»Deine Quelle?«, fragte Koschei.
»Einer von Yagas Dealern.«
Lev blinzelte überrascht, doch Koschei nickte. »Ein Hexer?«
»Natürlich«, antwortete Roman, und Lev runzelte die Stirn. Das kam ihm wie eine Lüge vor, doch sicher konnte er sich nicht sein.
»Gut.« Koschei fuhr sich mit der Hand über den Mund. Seine Wangen waren glatt rasiert. »Mach keine Fehler, Roma. Schickst du Lev?«
»Ja, Papa, ich …«
»Was?«, unterbrach Lev erschrocken. »Wohin?«
»Stell keine Fragen«, fuhr Roman ihn an, doch Koschei hielt wieder eine Hand hoch.
»Lass ihn fragen, Romik.« Langsam drehte er sich um und bedachte Lev mit einem langen, berechnenden Blick aus den dunklen Augen, denen die Romans so sehr ähnelten. »Du kannst dir keine Fehler erlauben, Lyovushka. Yaga ist eine unheimlich schlaue Frau, und sie wird dir zweifelsohne Fallen stellen. Du musst Zeit und Ort exakt herausfinden, genau wie die Identität ihres Partners. Du fällst weniger auf als Roma.« Er deutete auf seinen zweitältesten Sohn, der noch nie in seinem Leben einen unauffälligen Auftritt hingelegt hatte. »Du hast das richtige Alter. Du siehst jung aus, ungefährlich. Du passt gut rein.«
»Ich passe gut rein?«, fragte Lev mit gerunzelter Stirn. »Wo passe ich gut rein?«
Doch dafür hatte Koschei keine Geduld. Er drehte sich wieder um und setzte seine Unterhaltung mit Roma fort. »Ist es bald schon so weit?«, fragte Koschei leise, und Roman nickte.
»Da bin ich mir sicher. Wir können sie zu Fall bringen, Papa. Sie muss bezahlen.«
Koschei nickte. Die Schatten im Ring verschwammen, einer stieß mit dem anderen zusammen.
»Fang heute Nacht an«, sagte Koschei nur, und Roman stand auf und schob Lev wortlos zur Tür.
I. 6(Wachsamkeit.)
»Masha, geht es dir gut?«, fragte Stas und legte Marya vorsichtig die Hand auf die Schulter.
Marya blinzelte, um Dimitris blutiges Gesicht aus ihren Gedanken zu vertreiben, räusperte sich und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem Abwasch.
»Sie werden sich an uns rächen«, sagte sie und überprüfte kurz eine verzauberte Pfanne. Als ihr Ehemann ihr wissend die Schulter drückte, stellte sie sie seufzend ab und blickte ihn unsicher an. »Ich weiß nicht, ob ich richtig gehandelt habe, Stas.«
Er zuckte mit den Schultern, hielt wie immer voll zu ihr. »Du hast deinen Auftrag erfüllt. Deine Mutter ist viel zu skrupellos, um eine solche Beleidigung einfach auf sich sitzen zu lassen«, sagte er, als wäre dieser Gedanke irgendwie beruhigend. »Außerdem will sie Koschei bestimmt ein für alle Mal loswerden. Bald ist alles vorbei.«
Marya blickte ihn an, legte ihm die nassen Hände auf die Hüften und lehnte die Stirn an seine Schulter. »Wir sollten gar nicht darüber sprechen«, sagte sie leise, schmiegte das Gesicht an den vertrauten Körper, in den weichen Stoff seines Pullovers, in seine beruhigende Gegenwart. »Ich mag es gar nicht, dich in eine so schwierige Lage zu bringen.«
Stas nickte langsam und schloss sie in die Arme. Er war ein Ratshexer, und seine Aufgaben ähnelten denen eines Politikers. Dinge glaubhaft abstreiten zu können war eine Kernkompetenz für seinen Job, besonders angesichts seiner Beziehung zu Marya. In dieser Ehe waren Geheimnisse ein Zeichen von Respekt.
Der Hexenrat stellte das Regierungsorgan des magischen New York dar und deshalb das unabhängige Regierungsorgan. Es war eigentlich ganz einfach: Magische Bezirke wurden durch dieselben Grenzen eingeteilt wie nichtmagische, und die Anzahl von Ratshexern hing von der Bevölkerungsdichte ab. Zu ihren Aufgaben zählten die Abstimmung über öffentliche Angelegenheiten, Mandate, Rechtssprüche und Tribunale. Außerdem verabschiedeten sie Gesetze und verhandelten dementsprechend auch über Verbrechen und entschieden deren Bestrafung. Theoretisch hätte Stas als Ratshexer das Ass im Ärmel der Familie Antonova sein sollen. Praktisch war das zumindest für Marya kaum der Fall. Es schränkte sie empfindlich ein.
Gab es Meetings hinter verschlossenen Türen? Natürlich. Es war kein Elitismus, nicht ganz. Kein richtiger jedenfalls. Nicht für hauptsächlich Reiche, hauptsächlich Männer, denen die Geschicke einer ganzen Gemeinschaft unterlagen, und die ganz einfach eine exorbitante Magie-Steuer einführen oder jeden auf die schwarze Liste setzen konnten, der ihres Erachtens querschoss. In der Vergangenheit hatte die magische Gemeinschaft ohne Gesetze gelebt, und es hatte sie fast in den Ruin gestürzt, also war diese augenscheinliche Ordnung eine hochheilige Errungenschaft. Die Magie einer Hexe war das eine – unvorhersehbar, unberechenbar und einfach angeboren, ohne eigenen Verdienst –, doch ihre Macht war etwas ganz anderes.
Stas war ein Ratshexer, doch kein Ältester. Er konnte sich an den Machtkämpfen beteiligen, wenn er wollte, doch er war nicht sonderlich ehrgeizig. Vermutlich würde er wie sein Vater sein Leben lang stilles Mitglied des Rates bleiben. Reichtum, Status, Einfluss … damit sollten sich andere herumschlagen. Stas Maksimov wollte ein ruhiges Leben und eine liebevolle Ehefrau, und soweit er wusste, hatte er beides bereits. Marya hingegen beschützte Stas sehr wohl.
Sie musste alle beschützen.
»Hast du es Sasha schon gesagt?«, fragte Stas und strich ihr liebevoll übers Haar.
Marya schloss die Augen.
»Nein«, gestand sie seinem Kaschmirpullover beschämt.
»Masha …«
»Sie sollte dieses Leben nicht führen müssen, Stas.« Immer wieder dieselbe Leier.
»Das weiß ich, Masha. Ich weiß. Aber sie ist genauso die Tochter deiner Mutter wie du. Sie ist kein Baby mehr und muss genau wie du ihre Familie beschützen.«
»Ich weiß, aber ich …« Masha seufzte. »Ich will ihr das ersparen. Sie will mehr, Stas. Sie will so viel mehr von diesem Leben, und ich …«
»Jetzt ist sie an der Reihe. Du hast deine Wahl vor vielen Jahren getroffen«, erinnerte Stas sie. »Du hast deine Wahl getroffen, und jetzt wird sie ihre treffen.«
Marya schluckte die vielen Dinge hinunter, die sie nicht aussprechen konnte, und blickte stattdessen hoch zu ihrem Ehemann.
»Und wer weiß. Vielleicht musst du nicht mehr so viel für deine Mutter arbeiten, wenn Sasha hilft«, sagte er sanft. »Vielleicht können wir dann eine eigene Familie gründen, hm?« Er lächelte sie an, warm und beruhigend, und kurz durchzuckte sie ein Schmerz. »Eine kleine Mashenka? Eine Cousine für Luka?«
Stas war hingerissen von dem Gedanken. Marya nicht so sehr.
»Ich halte das nicht für klug, Stas.« Sie fragte sich, wie oft sie dieselbe Konversation mit unterschiedlichen Worten noch führen mussten. »Wir sind nicht in Sicherheit. Ich werde uns niemals Sicherheit garantieren können. Selbst jetzt haben die Fedorovs es auf mich abgesehen, auf meine Schwestern … Wie soll ich … wie könnte ich je …?«
Sie unterbrach sich, schluckte das Unvorstellbare herunter.
»Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, unser Kind in Gefahr zu bringen«, sagte sie bedrückt, und Stas nickte langsam, widerwillig, aber mitfühlend.
»Ich liebe dich, Marya Antonova«, versicherte Stas ihr. »Wenn die Zeit reif ist, werden wir unsere Familie gemeinsam beschützen. Das schwöre ich dir.«
Sie nickte. Darauf einigten sie sich normalerweise: eines Tages.
Nicht heute, aber eines Tages.
»Ich liebe dich«, sagte sie, als Stas sie fester umarmte, doch dieses Mal schloss sie die Augen nicht. Sie hielt sie wachsam offen. Sie würde ihrem Ehemann den Rücken freihalten, und sie dachte an die Zukunft ihrer Schwester.
Marya Antonova zwang sich, alles auszustrahlen, was sie im Inneren nicht spürte, und blinzelte erneut, um das Gesicht von Dimitri Fedorov aus ihren Gedanken zu verscheuchen. Sie sah ihn, wie er die Sonne genoss, ihr leise ins Ohr flüsterte; dann sah sie ihn auf dem blutigen Boden, wie er sie stumm anflehte: Masha, Masha, Masha.
I. 7(Nicht dein Problem.)
»Was genau soll ich denn tun?«, fauchte Lev seinen Bruder an. Sie standen vor einem unauffälligen Pub, das exakt so aussah, wie Pubs eben aussahen. Für einen Donnerstagabend war ganz schön viel los, denn der Türsteher nahm es mit den Ausweisen nicht so genau. »Einfach auf gut Glück versuchen, irgendwelchen Studis Drogen abzukaufen? Das ist echt nicht so mein Ding.« Im selben Moment fiel ihm auf, dass der Name der Bar – The Misfit – fast schmerzhaft ironisch seinen Auftritt als völliger Außenseiter vorwegnahm. »Und nur, weil ich zufällig im richtigen Alter bin …«
»Hör mal, unser Bruder liegt wegen Yaga und ihren Töchtern halb tot auf einer Matratze im Lager«, unterbrach Roman ihn wütend und funkelte seinen jüngeren Bruder an, als hätte Lev vergessen, warum sie hier waren. »Ist es wirklich zu viel verlangt, dass du dir für ihn ein bisschen Mühe gibst? Damit wir …« Roman verstummte, als jemand aus der Bar stolperte und Lev beinahe auf die Füße trat. »Damit wir sicher sind?«, fuhr Roman leise fort, bevor zwei Mädchen aus einer Studentinnenverbindung das Pub betraten. Die eine bedachte Roman mit einem verächtlichen Blick, die andere betrachtete Lev neugierig.
»Roma, das ist doch bescheuert«, murmelte Lev und wich dem Blick der jungen Frau mit einem gen Himmel gerichteten Seufzer aus. Für Dimitri würde Lev alles tun, ja. Schlimmeres und Gefährlicheres als diese Aktion, aber er konnte sich nur schwer vorstellen, dass ausgleichende Gerechtigkeit ein besseres Heilmittel für seinen Bruder sein sollte als die moderne Medizin. Allerdings war Dimas Zustand nicht gerade gewöhnlicher Natur, und Marya Antonovas beiläufige Grausamkeit hatte den Blutdurst in ihnen entfacht. Sogar in Lev, der gegen seine mildere – Koschei würde sagen, seine schwächere – Natur ankämpfte. »Es muss doch einen anderen Weg geben«, sagte er verzweifelt.
»Gibt es nicht.« Roman versetzte ihm einen Schubs. »Probiers bei der«, sagte er mit Blick auf die Verbindungsschwester, die gerade in der Bar verschwand. Lev verzog das Gesicht. »Meine Quelle sagt, wir sollen uns an diesen Block halten. Aber pass auf, Yagas Informanten treiben sich hier überall rum. Fall nicht auf, Leva. Bleib in den Schatten und halt die Ohren offen.«
»Klasse«, murmelte Lev. »Nicht auffallen, aber Details in Erfahrung bringen. Was für eine wunderbar schwammige Aufgabe.«
»Komm mir nicht so«, sagte Roman warnend und schob ihn erneut zur Tür. »Trink was. Quatsch ein paar Mädels an … oder ein paar Typen, wenn dir eher danach ist.« Er grinste. »Das solltest du ja wohl hinkriegen.«
»Schön«, grummelte Lev und betrat das Pub mit einem finsteren Blick über die Schulter. Drinnen war es unangenehm voll und laut. Es war noch nicht mal zehn – spät genug für dichtes Gedränge, aber zu früh für heilloses Chaos –, und Lev blickte abschätzig in die Runde. Hoffentlich sah man ihm seinen Widerwillen nicht an.
»Hey«, begrüßte er den Barkeeper mit einem verstohlenen Wink, der einen kurzen Aufmerksamkeitszauber wirkte. »Einen doppelten Bourbon, bitte.«
Er stellte sich neben eine junge Frau, die Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten. Der Barkeeper nickte. Lev seufzte, wartete auf den Drink und blickte sich dann erneut um. Von links rempelte ihn jemand mit dem Ellenbogen an.
»Hoppla, du bist echt schon ein bisschen drüber, Mädel …«
»Lass mich los«, erklang eine laute, definitiv wütende Frauenstimme. »Eric, zum letzten Mal, ich will kein Bier mehr …«
Lev blinzelte überrascht, als das Mädchen zu ihm herumwirbelte. Ihr dunkles, fast hüftlanges Haar flog durch die Luft. Bei Levs Anblick kniff sie die graublauen Augen zusammen. Der Ellbogenknuff tat ihr offensichtlich kein bisschen leid, sie war nur wütend auf den blonden Kerl, der ihr den Arm locker um die Hüfte gelegt hatte.
»Sorry«, sagte der Kerl namens Eric in seine Richtung und zuckte verschwörerisch mit den Schultern. »Alles unter Kontrolle.«
Nicht auffallen, dachte Lev, als der Barkeeper ihm den Bourbon zuschob. So schwer konnte das doch nicht sein. Lev sah sich nach Roman um, der zum Glück nicht mehr draußen vor der Bar herumstand, und sagte sich, dass er das nur für Dimitri tat, als die junge Frau wieder sprach.
»Seit einer Stunde will ich dich dazu kriegen, dich auf dieses Projekt zu konzentrieren«, fauchte sie, riss sich von dem Typen (Eric) los und vernichtete ihn mit einem Blick allgemeiner Verachtung. »Ich will kein Bier, ich will hier weg, und zwar jetzt, also wenn es dir nichts ausmacht …«
»Sasha, komm schon.« Eric schlug einen harmlosen Tonfall an, griff aber zeitgleich nach ihrer Hand. Lev versuchte, es zu ignorieren. »Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen …«
Nicht auffallen, dachte Lev. Du tust das für Dimitri.
Einfach nicht auffallen.
Einfach …
»Hey«, unterbrach er den Kerl, als er den Klammergriff an ihrem Handgelenk nicht länger ausblenden konnte. »Sie hat gesagt, sie will gehen. Lass sie los.« Na also, heute Nacht würde er ruhig schlafen können.
Sofort fuhren beide zu ihm herum. So viel dazu, nicht aufzufallen.
»Hey, Kollege, halt dich da raus …«
»Ich brauche deine Hilfe nicht.« Das Mädchen (Sasha) funkelte Lev an. »Ich kann gut auf mich selbst aufpassen.«