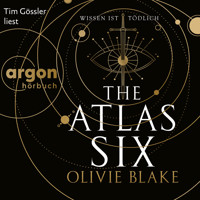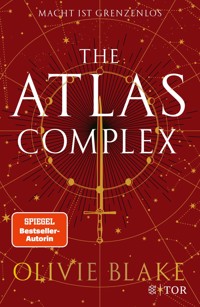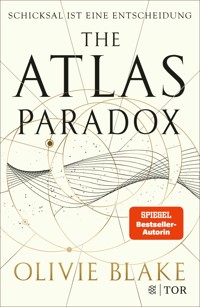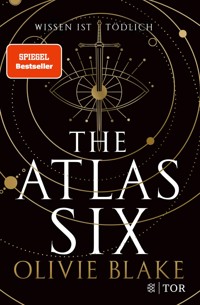
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlas Serie
- Sprache: Deutsch
Geheimnisse, Verrat, Verführung - und jede Menge Magie. Von der TikTok-Sensation zum Fantasy-Bestseller: Der Auftaktband zu Olivie Blakes spektakulärer Dark-Academia-Trilogie. Die Bibliothek von Alexandria ist nicht untergegangen, sie verwahrt im Verborgenen seit Tausenden von Jahren die dunkelsten Geheimnisse. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten Magier*innen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren: Jene, die die Initiation überstehen, erwartet ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben. Dieses Mal sind mit dabei: Libby Rhodes und Nico de Varona, zwei begnadete Magier von der New York School of Magic, die sich gegenseitig nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Caine, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann und Reina Mori, eine mysteriöse Elementarmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Für Leser*innen von Leigh Bardugo, Cassandra Clare oder Sarah J. Maas »The Atlas Six versetzt sechs ebenso gerissene wie begabte Charaktere in eine magische Bibliothek und lässt sie gegeneinander antreten. Was folgt, ist ein wunderbarer Wettstreit des Intellekts, der Leidenschaften und der Magie – halb Krimi, halb Fantasymysterium und von Anfang bis Ende eine wahre Freude.« (Holly Black)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Olivie Blake
The Atlas Six
Wissen ist tödlich
Über dieses Buch
Die Bibliothek von Alexandria ist nicht untergegangen, sie verwahrt im Verborgenen seit Tausenden von Jahren die dunkelsten Geheimnisse. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten Magier*innen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren: Jene, die die Initiation überstehen, erwartet ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben.
Dieses Mal sind mit dabei: Libby Rhodes und Nico de Varona, zwei begnadete Magier von der New York School of Magic, die sich gegenseitig nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nove, beide Meister der Manipulation. Tristan Caine, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann und Reina Mora, eine mysteriöse Elementarmagierin aus Japan.
Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olivie Blake liebt und schreibt Geschichten - die meisten davon fantastisch. Besonders fasziniert ist sie dabei von der endlosen Komplexität des Lebens und der Liebe. Sie arbeitet in Los Angeles, wo sie die meiste Zeit über von ihrem Lieblings-Pitbull gnädig toleriert wird. Ihr selbst publiziertes Buch „The Atlas Six“ wurde auf TikTok zur Sensation, bevor es von Tor Books erneut veröffentlicht und in über zwanzig Sprachen übersetzt wurde.
Inhalt
[Widmung]
Anfang
I Waffen
Libby
Reina
Tristan
Callum
Parisa
II Wahrheit
Nico
Tristan
Parisa
Libby
III Kampf
Callum
Reina
Nico
Tristan
IV Raum
Libby
Callum
Nico
Reina
Parisa
V Zeit
Tristan
Nico
Parisa
Reina
VI Denken
Libby
Callum
Tristan
Nico
VII Absicht
Reina
Tristan
Libby
Parisa
Intermezzo
Callum
VIII Tod
Libby
Tristan
Nico
Parisa
Reina
Ezra
Ende
Danksagung
Für meinen Physiker und meine Optimistin,
und für Lord Oliver – danke für den Schlagabtausch.
Anfang
Womöglich wurde schon zu viel über die Große Bibliothek von Alexandria geschrieben. Im Lauf der Geschichte hat sie sich als unendlich faszinierendes Objekt entpuppt. Vielleicht, weil die Phantasie allein ihren möglichen Inhalten Grenzen setzt oder weil das kollektive Sehnen der Menschheit stets die größte Macht entfaltet. Menschen lieben alles, was verboten ist, und in den meisten Fällen ist Wissen ganz genau das: verboten. Verlorenes Wissen umso mehr. Ob nun zu viel über sie geschrieben wurde oder nicht, in der Erzählung um die Bibliothek von Alexandria findet jeder etwas, nach dem er sich sehnt, und wir als Spezies waren schon immer anfällig für den Ruf des Unbekannten, der uns aus der Ferne entgegenhallt.
Man sagt, dass vor ihrer Zerstörung über vierhunderttausend Papyrusrollen zu Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Magie in der Bibliothek aufbewahrt wurden. Viele Menschen stellen sich Zeit wie eine gleichmäßig ansteigende Linie vor, wie einen gleichmäßigen Bogen des Wachstums, des Fortschritts. Dieser Eindruck entsteht schnell, wenn Geschichte nur von Siegern geschrieben wird. In Wahrheit hat die Zeit, wie wir sie kennen, Gezeiten. Sie ist eher zyklisch, nicht linear. Gesellschaftliche Vorlieben und Feindbilder verändern sich, und es geht nicht immer vorwärts. Mit der Magie verhält es sich genauso.
Die kaum bekannte Wahrheit ist, dass die Bibliothek von Alexandria niederbrannte, um sich selbst zu retten. Sie starb, um wieder aufzuerstehen – nicht wie der metaphorische Phönix aus der Asche, sondern eher aus sherlockisch-strategischen Gründen. Als Julius Caesar an die Macht kam, wurde den alten Kuratoren klar, dass ein Reich auf drei Säulen stehen muss: Unterdrückung, Verzweiflung und Ignoranz. Sie wussten ebenfalls, dass die Welt auf ewig von ähnlicher Tyrannei heimgesucht werden würde, und kamen zu dem Schluss, dass ein Archiv von solchem Wert sorgfältig versteckt werden müsse, wenn es überleben sollte.
An sich war der Trick so alt wie die Zeit selbst: Die Bibliothek täuschte ihren eigenen Tod vor und verschwand, um einen Neuanfang zu wagen. Der Erfolg dessen hing gänzlich davon ab, wie gut sie ihr eigenes Geheimnis zu bewahren vermochte. Die Medäer, die Bildungselite der magischen Bevölkerung, hatten Zugriff auf dieses verborgene Wissen, solange sie sich seinem Schutz verschrieben. Aus den Trümmern der Bibliothek entstand eine Geheimgesellschaft, deren Privilegien ebenso weitreichend waren wie ihre Verantwortung. Sie konnte das gesamte Wissen der Menschheit nutzen und musste im Gegenzug nichts weiter tun, als es zu pflegen und es zu vermehren.
Je größer die bekannte Welt wurde, je mehr das Wissen über die Bibliotheken von Babylon, Karthago, Konstantinopel hinaus und um die islamischen und asiatischen Bibliotheken anwuchs, die dem Kolonialismus und seinem Imperium zum Opfer fielen, desto größer wurde auch das alexandrinische Archiv. Je größer der Einfluss der Medäer wurde, desto größer wurde auch die Geheimgesellschaft selbst.
Alle zehn Jahre wurde eine neue Klasse möglicher Kandidaten ausgewählt. Sie durchliefen eine einjährige Ausbildung, in der sie alles über die Bibliothek und die Aufgaben lernten, denen sie ihr Leben lang nachgehen sollten. In vielerlei Hinsicht ähnelte das Programm einer Doktorandenstelle oder einem Stipendium. Ein Jahr lang lebten die Kandidaten in den Archiven, atmeten, aßen und schliefen zwischen Folianten unendlichen Wissens. Nach Ablauf des Jahres wurden fünf der sechs Kandidaten in die Gesellschaft eingeführt. Danach setzten die Auserwählten das intensive Studium in einer von ihnen gewählten Fachrichtung ein weiteres Jahr lang fort, bevor sie entschieden, ob sie weiterhin in der Forschung arbeiten wollten, oder, was wahrscheinlicher war, ob sie eine neue Stelle annahmen. Die Alexandriner wurden zumeist Politikerinnen, Wohltäter, Geschäftsführerinnen und preisgekrönte Wissenschaftler. Was sie erwartete, waren Reichtum, Macht, Ansehen und Wissen jenseits ihrer wildesten Träume – für die Initiation ausgewählt zu werden, war der Beginn eines Weges unendlicher Möglichkeiten.
Das waren jedenfalls die Worte, die Dalton Ellery an die neueste Gruppe von Kandidatinnen und Kandidaten richtete, von denen keiner wusste, wo er war oder worum es hier ging. Sie hatten noch nicht verstanden, dass Dalton Ellery nur deshalb hier vor ihnen stand, weil er selbst ein außergewöhnlich fähiger Medäer war, wie es ihn nur alle paar Generationen gab. Sie wussten nicht, dass er diesen Lebensweg vielen anderen vorgezogen hatte, die sich ihm eröffnet hatten. Wie auch sie hatte er sich gegen den Menschen entschieden, der er hätte sein können, gegen das vergleichsweise gewöhnliche Leben, das er vermutlich hätte führen können. Er hätte sich in der nichtmagischen Wirtschaft nützlich machen können und dafür all das ziehen lassen, was er nach seiner Aufnahme hier erlebt hatte. Vielleicht hätte er dennoch außergewöhnliche Magie gewirkt, doch er wäre nie ganz der Durchschnittlichkeit entronnen. Er wäre der Profanität anheimgefallen, der Mühsal der Langeweile, wie es allen Menschen früher oder später erging. Doch mit seiner Entscheidung hatte er sein Schicksal gewendet. Er würde nie das graue Einerlei einer bedeutungslosen Existenz kennenlernen, weil er sich vor zehn Jahren für dieses Leben entschieden hatte.
Er sah die Kandidaten vor sich an und stellte sich das Leben, das er hätte haben können, erneut vor. Die Leben, die sie alle hätten haben können, wenn ihnen solch … Reichtum nie angeboten worden wäre. Ewiger Ruhm. Unerreichte Weisheit. Hier würden sie die Geheimnisse entdecken, die die Welt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vor sich selbst verbarg. Sie würden Dinge sehen, die gewöhnliche Menschen nie zu Gesicht bekamen. Dinge, die gewöhnliche Menschen mit ihrem stumpfen Verstand nicht einmal erfassen konnten.
Hier würden ihre Leben sich ändern. Ihr altes Ich würde wie die Bibliothek selbst zerstört werden, um dann neu errichtet und in den Schatten verborgen zu werden. Niemand außer den Kuratoren, den anderen Alexandrinern und dem geisterhaften Hauch ungelebter Leben und unbeschrittener Wege würde wissen, wer sie einst gewesen waren.
Allerdings verschwieg Dalton ihnen, dass Größe nie leicht zu ertragen war. Auch sagte er ihnen nicht, dass sie nur denjenigen angeboten wurde, die diese Last auch stemmen konnten. Er sprach nur von der Bibliothek, der Initiation und davon, was zum Greifen nah war, wenn sie den Mut aufbrachten, die Hand danach auszustrecken.
Wie zu erwarten, waren sie hingerissen. Dalton hatte die Gabe, Konzepten, Gedanken und Objekten Leben einzuhauchen. Eine unauffällige Fähigkeit. So unauffällig, dass man sie nicht für Magie hielt. Deshalb war er ein außergewöhnlicher Gelehrter. Diese Fähigkeit machte ihn zum perfekten Mentor für diese Klasse neuer Alexandriner.
Noch bevor er zu sprechen begonnen hatte, wusste er, dass sie alle das Angebot annehmen würden. Es handelte sich letztendlich um eine Formalität. Niemand lehnte ein Angebot der Alexandrinischen Gesellschaft ab. Sogar diejenigen, die Desinteresse heuchelten, würden nicht widerstehen können. Sie würden mit allen Mitteln kämpfen, das wusste er, um das folgende Jahr zu überleben. Und wenn sie so unerschrocken und talentiert waren, wie die Gesellschaft glaubte, dann würden sie auch überleben.
Die meisten von ihnen jedenfalls.
Die Moral der Geschichte lautet:
Hüte dich vor dem Mann, der dir unbewaffnet gegenübertritt.
Bist du nicht sein Ziel, wird er dich zu seiner Waffe machen.
IWaffen
Libby
Fünf Stunden zuvor
Am selben Tag, an dem Libby Rhodes Nicolás Ferrer de Varona kennenlernte, stellte sie fest, dass nur das Wort wutentbrannt, für das sie bisher keinerlei Verwendung gehabt hatte, ihre Gefühle beschrieb, wenn er in der Nähe war. Libby hatte an diesem Tag versehentlich die jahrhundertealten Vorhänge im Büro der Dekanin Professor Breckenridge angezündet, so dass ihre Zeit an der New York University of Magical Arts gleichzeitig mit ihrem unsterblichen Hass auf Nico begann. Seitdem hatte sie jeden Tag vergeblich versucht, sich in Zurückhaltung zu üben.
Doch der heutige Tag würde trotz ihrer Zündkraft anders laufen, denn es war ihr letzter Tag an der Uni. Abgesehen von unabsichtlichen Begegnungen, bei denen sie einander sicherlich mit aller Macht ignorieren würden, würden Nico und sie endlich getrennte Wege gehen. Manhattan war groß und voller Menschen, die sich aus dem Weg gingen. Sie würde nie wieder mit Nico de Varona zusammenarbeiten müssen. An diesem Morgen hätte sie vor Freude fast angefangen zu singen, was ihr Freund Ezra auf näherliegende Gründe zurückgeführt hatte: Sie würde als Jahrgangsbeste ihren Abschluss machen (sie und Nico waren gleichauf, aber es war sinnlos, daran zu denken) und die NYUMA-Abschiedsrede halten. Beides ohne Frage große Ereignisse, doch noch verlockender war der neue Lebensabschnitt, der danach kam.
Nach diesem Tag würde sie Nico de Varona nie wieder sehen müssen, und nichts machte sie so glücklich wie die Aussicht auf ein nicofreies Leben.
»Hi, Rhodes«, sagte Nico, als er seinen Platz neben ihr auf der Bühne einnahm. Ihr Nachname perlte von seiner Zunge, bevor er, süffisant wie immer, die Nase hob und schnüffelte. Manchen reichten wohl seine sonnengebräunten Grübchen und seine genau richtig gebrochene Nase, um über seine geringe Größe und seine zahlreichen Charakterschwächen hinwegzusehen. Für Libby hatte Nico de Varona einfach nur gute Gene und mehr Selbstbewusstsein, als ein Mensch haben sollte. »Hm. Merkwürdig. Riecht es hier nach Rauch, Rhodes?«
Sehr witzig. Zum Schreien.
»Pass bloß auf, Varona. Dir ist klar, dass das Auditorium genau über einer Verwerfungslinie erbaut ist, ja?«
»Logisch. Immerhin werde ich das gesamte nächste Jahr daran arbeiten«, konterte er. »Übrigens echt schade, dass du das Stipendium nicht bekommen hast.«
Weil er ihr mit dieser Bemerkung offensichtlich nur auf die Nerven gehen wollte, ließ Libby den Blick über die Menge wandern und ignorierte ihn. Das Auditorium war voller, als sie es je erlebt hatte. Absolventen und ihre Familien belegten jeden einzelnen Platz bis hoch auf die Empore und quollen bis in den Vorraum hinaus.
Sogar aus der Ferne konnte Libby ihren Vater sehen, der seinen einzigen guten Blazer trug. Er hatte ihn vor zwanzig Jahren für eine Hochzeit gekauft und trug ihn seither zu jeder auch nur annähernd feierlichen Veranstaltung. Er saß neben Libbys Mutter, fast genau in der Mitte des Saales. Während sie die beiden beobachtete, überkam Libby plötzlich eine heftige Zuneigung. Sie hatte ihnen natürlich gesagt, dass sie nicht kommen mussten. Umstände und so weiter. Aber ihr Vater war in seinen Blazer geschlüpft, ihre Mutter hatte Lippenstift aufgetragen, und auf dem Stuhl neben ihnen …
War nichts. Libby fiel der leere Platz gerade in dem Augenblick auf, als sich eine Jugendliche in High Tops durch die Reihe schlängelte, der gehstockbewehrten Großmutter eines Absolventen auswich und der Menge eine Grimasse schnitt, die deutlich machte, was sie von den Leuten hier hielt. Die Szene war in ihren Gegensätzen fast schon unheimlich: die vertraute Miene jugendlichen Überdrusses (der in dem zu den Sneakern kombinierten trägerlosen Kleid zwiespältigen Ausdruck fand) und der sehr reale leere Stuhl neben Libbys Eltern. Ihr Blick verschwamm, und einen Moment lang war sie unsicher, ob sie mit akuter Erblindung oder einem drohenden Tränenausbruch geschlagen war.
Zum Glück blieb sie von beidem verschont. Wenn Katherine noch leben würde, wäre sie keine sechzehn mehr. Irgendwie war Libby älter geworden, als ihre große Schwester je gewesen war. Und auch wenn sie diese Logik bis heute nicht begriff, war die Wunde mittlerweile alt. Nicht mehr lebensbedrohlich. Wie mit einer Kruste überzogen, an der Libby manchmal knibbelte.
Bevor ihre Gedanken noch düsterer werden konnten, nahm sie eine andere Bewegung im Gang wahr. Unzähmbare schwarze Locken wippten auf und ab, und schon war der Platz neben ihren Eltern besetzt. Ezra, der den einzigen Pullover trug, den Libby nicht in die falsche Wäsche gesteckt hatte, füllte die Leere aus, die Katherine hinterlassen hatte. Er beugte sich vor, um Libbys Vater das Programmheft und ihrer Mutter ein Taschentuch zu reichen. Sie unterhielten sich höflich miteinander, dann blickte er auf. Als er Libby auf der Bühne ausmachte, leuchteten seine Augen auf. Er bewegte den Mund: Hi.
Der alte Schmerz, den Katherines Fehlen hervorrief, verwandelte sich in Erleichterung. Ihre Schwester hätte diese Veranstaltung gehasst. Sie hätte Libbys Kleid gehasst und ihre Frisur wahrscheinlich auch.
Hi, sagte Libby ebenso lautlos wie er und wurde mit Ezras so vertrautem schiefen Lächeln belohnt. Er war schmal, fast schon mager, obwohl er pausenlos etwas aß, und größer, als man zunächst dachte. Seine Bewegungen hatten eine katzengleiche Eleganz, und diese Eleganz gefiel ihr. Er strahlte eine Ruhe aus, die sie angenehm fand.
Weniger angenehm fand sie das Lächeln, das Nicos Lippen umspielte. Er war ihrem Blick offenbar gefolgt. »Ah, Fowler ist auch hier, wie ich sehe.«
Libby, die für ein paar glückselige Augenblicke vergessen hatte, dass Nico überhaupt da war, gefiel der Tonfall nicht. »Warum denn auch nicht?«
»Och, nur so. Ich hätte gedacht, dass du mittlerweile eine bessere Partie gemacht hättest, Rhodes.«
Geh nicht drauf ein, geh nicht drauf ein, geh nicht drauf ein …
»Ezra hat eine neue Stelle bekommen«, sagte sie kühl.
»Steht hinter der Null jetzt ein Komma?«
»Nein, er ist …« Libby hielt inne, ballte eine Hand zur Faust und zählte leise bis drei. »Er ist jetzt Projektmanager.«
»Meine Güte«, sagte Nico trocken. »Wie beeindruckend.«
Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu, und er lächelte.
»Deine Krawatte sitzt schief«, bemerkte sie betont gleichgültig, und seine Hand schoss sofort hoch, um die Krawatte zu richten. »Hat Gideon sie dir nicht eben erst gebunden?«
»Doch, hat er, aber …« Als er erkannte, dass er ihr auf den Leim gegangen war, brach er ab. Libby beglückwünschte sich im Stillen zu ihrem Triumph. »Sehr witzig, Rhodes.«
»Was denn?«
»Gideon ist mein Kindermädchen, sehr witzig. Das ist ja mal ein ganz neuer Spruch.«
»Und über Ezra herzuziehen ist auf einmal revolutionär?«
»Nicht meine Schuld, dass Fowlers Fehler unerschöpflich sind«, erwiderte Nico, und wenn ihre Professoren, Klassenkameraden und deren Familien nicht im Raum gewesen wären, hätte Libby nicht tief durchgeatmet, sondern ihrer Magie einfach freien Lauf gelassen.
Leider galt es als unerwünschtes Verhalten, Nico de Varonas Unterhose in Brand zu setzen.
Der letzte Tag, rief Libby sich in Erinnerung. Der letzte Tag, an dem ich Nico sehen muss.
Dann konnte er sagen, was er wollte, und ihr konnte es egal sein.
»Hast du deine Rede fertig?«, fragte Nico, und sie verdrehte die Augen.
»Als ob ich die mit dir besprechen würde.«
»Warum in aller Welt denn nicht? Ich weiß doch, dass du Lampenfieber bekommst.«
»Ich bekomme kein …« Tief durchatmen. Und noch mal, doppelt hält besser. »Ich bekomme kein Lampenfieber«, brachte sie gefasst heraus. »Und selbst wenn, wie würdest du mir helfen können?«
»Oh, du hast gedacht, ich würde dir helfen wollen?«, fragte Nico. »Entschuldige, so war das nicht gemeint.«
»Hast du immer noch nicht verkraftet, dass nicht du gewählt wurdest, um die Rede zu halten?«
»Bitte.« Nico schnaubte leise. »Wir wissen doch beide, dass niemand Zeit darauf verschwendet hat, für so etwas Albernes wie eine Abschlussrede abzustimmen. Die Hälfte der Leute hier sind doch ohnehin schon betrunken.«
Obwohl Libby wusste, dass er recht hatte, würde sie das nie zugeben. Sie wusste auch, dass Nico auf das Thema empfindlich reagierte. Er konnte noch so gleichgültig tun; er sah sie nicht gern gewinnen, egal, wie unwichtig ihm selbst der Sieg wäre.
Das wusste sie so genau, weil es ihr an seiner Stelle nicht anders ergangen wäre.
»Oh?«, machte sie amüsiert. »Wie hab ich denn dann gewonnen, wenn niemand Zeit darauf verschwendet hat?«
»Weil du als Einzige abgestimmt hast, Rhodes. Man könnte meinen, du hörst mir gar nicht zu …«
»Rhodes«, sagte Dekanin Breckenridge warnend, als sie durch den Trubel um sie herum an ihnen vorbeieilte. »Varona. Ist es zu viel verlangt, dass Sie sich eine Stunde lang zivilisiert verhalten?«
»Professor«, begrüßten Nico und Libby sie im Chor, zwangen sich zu einem Lächeln, und Nicos Hand schnellte wieder zu seiner Krawatte.
»Kein Problem«, versicherte Libby der Dekanin. Sogar Nico wäre nicht so blöd, ihr jetzt zu widersprechen. »Hier ist alles in Ordnung.«
Breckenridge zog eine Augenbraue hoch. »Der Vormittag läuft also nach Plan?«
»Wie am Schnürchen«, sagte Nico und schenkte ihr ein charmantes Lächeln. Das war das Schlimmste an ihm: Solange man nicht Libby war, verhielt er sich völlig normal. Nico de Varona war der Liebling eines jeden Lehrers. Ihre Mitschüler wollten entweder so sein wie er, mit ihm ausgehen oder wenigstens mit ihm befreundet sein.
Mit viel Phantasie, wenn sie sich wirklich anstrengte, erschien das selbst Libby nicht so abwegig. Nico war so unheimlich sympathisch, dass es an Gemeinheit grenzte, und obwohl Libby nicht auf den Kopf gefallen war und ein natürliches Talent für Magie besaß, bevorzugten die Lehrer stets Nico. Wie auch immer er das genau anstellte, er schien Midas’ Gabe zu haben. Er konnte völligen Blödsinn logisch klingen lassen; mehr aus Reflex als eventuell vorhandener Fachkenntnis. Libby war eine begabte Akademikerin, hatte sich aber diese Strategie nie aneignen können. Nicos gottgegebenen Charme konnte man nicht kopieren, er schien einfach aus ihm herauszufließen.
Außerdem konnte er Leute problemlos davon überzeugen, dass er wusste, wovon er sprach – auch wenn er keinen blassen Schimmer hatte. Meistens jedenfalls nicht.
Noch fataler als Nicos Schwächen war der einzige große Vorteil, den er Libby gegenüber hatte: den Job, den sie unbedingt wollte. Das würde sie natürlich auch nie zugeben. Klar, ihre Stelle bei der besten magischen Risikokapitalgesellschaft in Manhattan war nicht zu verachten. Libby würde die Finanzierung innovativer Medäer-Technologien sichern und sich aus einem Portfolio aufregender Ideen mit viel Potenzial für Wachstum und Sozialkapital ihren Liebling aussuchen. Schließlich war es allerhöchste Zeit zu handeln. Die Erde litt unter Überbevölkerung, ihre Ressourcen neigten sich dem Ende zu, wurden aber weiterhin ausgebeutet, und alternative Energiequellen waren wichtiger als je zuvor. Mit der Stelle könnte sie die Struktur medäischer Forschungsentwicklung steuern – könnte sich ein Start-up aussuchen, das die Richtung der gesamten Weltwirtschaft veränderte –, und sie würde gut dafür bezahlt. Doch wirklich gewollt hatte sie das Forschungsstipendium der NYUMA, und natürlich hatte Nico es ohne nennenswerte Anstrengung bekommen.
Breckenridge setzte sich, Nico tat so, als wäre er ein vernunftbegabtes Wesen, und Libby malte sich ihre rosige Zukunft aus, sobald sie sich nicht mehr gegen Varona durchsetzen musste. Vier Jahre lang war er ein unvermeidlicher Teil ihres Lebens gewesen, wie ein lästiges, verkümmertes Organ. Physiomagische Medäer, die die Elemente so tiefgehend beherrschten wie sie, waren selten. So selten sogar, dass Libby und Nico die beiden Einzigen in ihrem Jahrgang waren. Vier endlose, qualvolle Jahre lang hatten sie ausnahmslos jeden Kurs zusammen besucht, und das Einzige, was sich mit ihren Kräften messen konnte, war ihr gegenseitiger Hass.
Für Nico, der immer ohne große Hürden durchs Leben glitt, war Libby einfach nur ein lästiger Störfaktor. Seit ihrer allerersten Begegnung hatte sie ihn für überheblich und arrogant gehalten, und nichts verabscheute Nico de Varona mehr als jemanden, der ihn nicht auf Anhieb vergötterte. Libbys ausbleibende Verehrung war vermutlich das erste Trauma, das er je erlitten hatte. Bestimmt raubte ihm der Gedanke, dass es eine Frau gab, die ihm nicht zu Füßen lag, Nacht für Nacht den Schlaf.
Für Libby war die Sache komplizierter. Wegen ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten gerieten sie oft aneinander, aber vor allem war Nico ein unerträglicher Oberschichtenarsch, der Libby immer wieder an das erinnerte, was sie entbehrte.
Nico stammte aus einer Familie bekannter Medäer und hatte, wie sie vermutete, schon seit frühester Kindheit in seinem weitläufigen Palast in Havanna Magie praktiziert. Libby, deren Familie in der Vorstadt von Pittsburgh lebte und bisher keine Medäer oder auch nur Hexer hervorgebracht hatte, hatte an der Columbia studieren wollen, bis die NYUMA in Form von Dekanin Breckenridge dazwischengekommen war. Libby hatte nicht einmal die grundlegendsten medäischen Prinzipien gekannt, hatte in allen Fächern der Magietheorie aufholen müssen und doppelt so schwer gearbeitet wie alle anderen … nur um sich dann anzuhören: »Ja, sehr schön, Libby … Nico, warum zeigst du uns nicht mal, wie das geht?«
Nico de Varona wird nie wissen, wie sich das anfühlt, dachte Libby zum wiederholten Mal. Nico war gut aussehend, clever, charmant und reich. Libbys magische Macht stand seiner zwar in nichts nach, und weil ihre Selbstdisziplin seine um Längen übertraf, würde sie ihn vermutlich irgendwann übertrumpfen. Doch nach vier Jahren, in denen sie sich mit Nico de Varona hatte messen müssen, fühlte Libby sich unfair behandelt. Wäre er nicht gewesen, hätte sie ihr Studium mit links geschafft. Vielleicht wäre ihr sogar langweilig geworden. Sie hätte keinen Rivalen gehabt und keinen Ebenbürtigen. Wer hätte ihr schon das Wasser reichen können, wenn Nico nicht gewesen wäre?
Niemand. Sie hatte nie jemanden getroffen, der auch nur annähernd so viel Talent für Physiomagie besaß wie Nico und sie. Die kleinen Erdbeben, die er verursachte, wenn ihn jemand auf die Palme brachte, würden einen weniger begabten Medäer vier Stunden und immense Anstrengungen kosten. Ein Funke von Libby hatte gereicht, um ihr das Stipendium der NYUMA und anschließend eine lukrative Vollzeitstelle zu sichern. Einzeln wären ihre Fähigkeiten gelobt, ja sogar bewundert worden – und genau das würde nun geschehen. Wenn sie nicht mehr mit Nico verglichen wurde, konnte Libby endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen, ohne sich für jedes bisschen Anerkennung halb zu Tode zu schuften.
Eine merkwürdige Vorstellung. Merkwürdig einsam. Und doch jagte ihr ein Schauer freudiger Erwartung über den Rücken.
Der Boden zu ihren Füßen erzitterte, und sie sah zu Nico hinüber, der gedankenverloren vor sich hin starrte.
»Hey.« Sie stupste ihn mit dem Ellenbogen an. »Lass das.«
Er blickte sie gelangweilt an. »Ich bin nicht für jedes Erdbeben verantwortlich, Rhodes. Ich gebe dir ja auch nicht die Schuld für jeden Waldbrand.«
Sie verdrehte die Augen. »Ich erkenne durchaus den Unterschied zwischen einem Erdbeben und einem Varona-Ausraster.«
»Pass auf«, sagte er warnend und ließ den Blick zu Ezra schnellen. »Fowler soll uns doch nicht schon wieder streiten sehen, oder? Sonst bekommt er noch einen falschen Eindruck.«
Nicht das schon wieder. »Weißt du eigentlich, wie kindisch deine Besessenheit von meinem Freund ist, Varona? Das hast du echt nicht nötig.«
»Du weißt doch gar nicht, was ich nötig habe«, erwiderte Nico beiläufig.
Von der anderen Seite der Bühne warf Breckenridge ihnen einen warnenden Blick zu.
»Stell dich nicht so an«, murmelte Libby.
Nico und Ezra hatten sich die zwei Jahre gehasst, die sie alle gemeinsam an der NYUMA verbracht hatten. Dann hatte Ezra seinen Abschluss gemacht, was aber nichts an Nicos Abneigung gegenüber Libby geändert hatte. Nico hatte in seinem ganzen Leben keinen einzigen Rückschlag erleiden müssen, also war es ihm einerlei, wie viel Ezra einstecken konnte. Libby und Ezra hatten beide Verluste erlitten; Ezras Mutter war gestorben, als er noch ein Kind gewesen war, und hatte ihn zu einem obdachlosen Waisen gemacht. Nico hatte vermutlich noch nicht einmal eine Scheibe Brot zu lange im Toaster gelassen. »Nur falls du’s vergessen hast: Du musst Ezra nie wieder sehen. Wir«, fügte sie hinzu, »müssen einander nie wieder sehen.«
»Mach es mal nicht tragischer, als es ist, Rhodes.«
Sie warf ihm einen finsteren Blick zu, und er grinste sie an.
»Wo Rauch ist …«, murmelte er, und erneut flackerte der Ärger in Libby hoch.
»Varona, kannst du nicht einfach …«
»… freue ich mich, Ihnen Elizabeth Rhodes vorzustellen!«, wurde Libby angekündigt.
Sie sah auf und stellte fest, dass alle Augen im Publikum erwartungsvoll auf sie gerichtet waren. Und Ezras Blick besagte eindeutig, dass er ihre Kabbelei mit Nico mitbekommen hatte.
Sie zwang sich zu einem Lächeln, stand auf und erwischte auf dem Weg zum Rednerpult noch Nicos Zehen mit dem Schuh. Ups.
»Und lass die Finger aus den Haaren«, gab der ihr leise mit auf den Weg.
Nach diesem Kommentar war sie sich natürlich nur umso deutlicher bewusst, dass ihr Pony ihr die gesamte zweiminütige Rede lang in die Augen zu fallen drohte. Kein magisches, aber doch ein mysteriöses Talent, wie der Kerl sie immer wieder aus dem Gleichgewicht brachte. Die Rede selbst lief gut (fand sie), doch als sie wieder zu ihrem Platz ging, hätte sie Nico am liebsten noch einmal schwungvoll getreten. Stattdessen setzte sie sich still und dachte daran, wie wunderbar das Leben in etwa zwanzig Minuten sein würde, wenn sie Nico für immer los war.
»Gut gemacht, ihr zwei«, sagte Dekanin Breckenridge trocken und schüttelte den Kopf, als die beiden von der Bühne stiegen. »Eine ganze Abschlussfeier ohne einen Zwischenfall. Wirklich beeindruckend.«
»O ja, wir sind ziemlich beeindruckend«, erwiderte Nico in einem Ton, für den Libby ihm eine Ohrfeige verpasst hätte. Breckenridge hingegen kicherte amüsiert, schüttelte gutmütig den Kopf und wandte sich einer Kollegin zu, während Libby und Nico in den Saal traten.
Als sie bei den anderen Absolventen und deren Gästen ankamen, hielt Libby für eine letzte Bemerkung inne. Sie wollte etwas sagen, das Nico für den Rest seines Lebens verfolgte, während sie für immer daraus verschwand.
Doch dann beschloss sie stattdessen, ihm einfach nur die Hand hinzustrecken und sich wie eine Erwachsene zu benehmen.
Zivilisiert.
Und so weiter.
»Na dann, schönes Leben dir«, sagte sie, und Nico beäugte ihre Hand argwöhnisch.
»Mit dem Spruch willst du dich verabschieden, Rhodes?« Er schürzte die Lippen. »Komm schon, das kannst du besser. Du hast doch bestimmt unter der Dusche geübt.«
Er machte sie absolut wahnsinnig. »Vergiss es«, sagte sie, zog die Hand zurück und wandte sich zum Ausgang. »Auf Nimmerwiedersehen, Varona.«
»Schon besser«, rief er ihr nach und applaudierte herablassend langsam. »Wirklich gut, Elizabeth …«
Mit geballter Faust wirbelte sie herum. »Was hast du dir denn als Verabschiedung ausgedacht?«
»Warum sollte ich dir das jetzt noch sagen?«, fragte er mit einem selbstgefälligen Grinsen. »Vielleicht lasse ich dich einfach grübeln. Weißt du«, er machte einen Schritt auf sie zu, »nur so für den Fall, dass du während deines sterbenslangweiligen Lebens mit Fowler deinen Geist etwas beschäftigen möchtest.«
»Du bist echt unglaublich, weißt du das?«, fauchte sie. »Dieser Kindergartenkram ist so gar nicht sexy, das ist dir schon klar? In zehn Jahren wirst du genauso allein sein wie jetzt, und Gideon wird dir immer noch deine Krawatten aussuchen. Glaub mir, dann werde ich nicht einen Gedanken an dich verschwenden.«
»In zehn Jahren wirst du dich mit drei Fowler-Babys herumschlagen«, erwiderte Nico, »und dich fragen, wo zur Hölle deine Karriere hin ist, während dein Durchschnittsmann wissen will, wo das Abendessen bleibt.«
Da war das Gefühl wieder.
Wutentbrannt.
»Egal, wann wir uns noch mal sehen sollten, Varona«, zischte Libby. »Egal wann, es wird trotzdem zu früh sein …«
»Entschuldigung«, erklang eine Männerstimme neben ihnen. Nico und Libby fuhren beide herum.
»Was?«, fragten sie im Chor, und der Unbekannte lächelte.
Er hatte dunkle Haut, sein Kopf war kahl rasiert und schimmerte im Licht. Er mochte um die vierzig sein. Wegen seiner auffälligen Körpergröße, seiner offensichtlich britischen Manieren und seiner ebenso britischen Kleidung (Tweed; viel Tweed mit etwas Schottenmuster) stach er zwischen den anderen Besuchern hervor.
Und er kam gänzlich ungelegen.
»Nicolás Ferrer de Varona und Elizabeth Rhodes?«, fragte er. »Ich würde Ihnen gern ein Angebot unterbreiten.«
»Wir sind nicht auf der Suche nach einem Job«, entgegnete Libby gereizt, bevor Nico etwas Versnobtes loswerden konnte. »Und außerdem sind wir gerade beschäftigt.«
»Ja, das habe ich bemerkt«, erwiderte der Mann amüsiert. »Allerdings habe ich einen vollen Terminplan, und für mein Angebot kommen wirklich nur die Besten in Frage.«
»Und wen von uns beiden meinen Sie damit?«, fragte Nico, erwiderte Libbys vernichtenden Blick einen Moment lang voller Verachtung und wandte sich dann dem wartenden Mann zu, der seinen Schirm am Arm baumeln ließ. »Es sei denn natürlich, Sie meinen …«
»Ich meine Sie beide«, bestätigte der Mann, und Libby und Nico wechselten einen Blick aus der Kategorie Was auch sonst?. »Oder vielleicht auch nur einen von Ihnen.« Er zuckte mit den Schultern, und Libby runzelte leicht die Stirn, obwohl die Sache sie überhaupt nicht interessierte. »Wer von Ihnen Erfolg hat, liegt ganz bei Ihnen, nicht bei mir.«
»Erfolg?«, fragte sie. Die Worte kamen ihr über die Lippen, obwohl sie gar nicht vorgehabt hatte, etwas zu sagen. »Was bedeutet das?«
»Es gibt nur Platz für fünf Kandidatinnen und Kandidaten«, sagte der Mann. »Sechs werden ausgewählt. Die Besten der Welt«, fügte er hinzu.
»Die Besten der Welt?«, wiederholte Libby zweifelnd. »Klingt übertrieben.«
Der Mann neigte den Kopf. »Ich kann Ihnen die Zahlen gern einmal darlegen. Momentan gibt es etwa zehn Milliarden Menschen auf der Welt, richtig?«, fragte er, und Nico und Libby nickten misstrauisch. »Neuneinhalb Milliarden, wenn man genau sein möchte, von denen nur ein Bruchteil magisches Blut hat. Etwa fünf Millionen können als Magier eingestuft werden. Sechs Prozent haben Medäerpotenzial und können an einer der Universitäten studieren. Nur zehn Prozent davon qualifizieren sich für eine der besten Universitäten, wie beispielsweise diese«, sagte er und deutete auf die NYUMA-Banner. »Ein Bruchteil dieser Studentinnen und Studenten – ein Prozent oder weniger – wird von meinem Auswahlgremium in Betracht gezogen. Von diesen dreihundert Absolventen haben weitere zehn Prozent vielleicht die nötigen Qualifikationen: das richtige Fachgebiet, akademische Leistungen, Charaktermerkmale und so weiter.«
Dreißig Menschen. Nico warf Libby einen selbstgefälligen Blick zu, ganz so, als wüsste er, dass sie im Kopf mitrechnete. Sie legte all ihre Verachtung in ihren Blick, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie ganz genau wusste, dass er nicht mitrechnete.
»Dann geht der Spaß erst richtig los, denn dann kommt die eigentliche Auslese«, fuhr der Mann fort, dessen maßgeschneiderter Tweedanzug darauf schließen ließ, dass er gut bezahlt wurde. »Welche Studenten beherrschen die seltenste Magie? Welche sind neugierig? Die meisten eurer talentiertesten Kommilitonen werden der magischen Wirtschaft als Buchhalterinnen, Investorinnen oder Anwälte dienen. Einige wenige werden es vielleicht zu etwas Großem bringen. Aber nur dreißig Menschen sind gut genug, um als außergewöhnlich zu gelten, und von denen sind nur sechs ungewöhnlich genug, um durch unsere Tür zu treten.« Der Mann lächelte sanft. »Nach Ablauf eines Jahres kommen allerdings nur fünf wieder heraus. Aber darüber brauchen Sie sich noch keine Gedanken zu machen.«
Libby, die von den Auswahlkriterien immer noch verblüfft war, überließ Nico das Wort.
»Sie glauben, dass es vier Menschen gibt, die besser als Rhodes und ich sind?«
»Ich glaube, dass es sechs gleichermaßen talentierte Menschen gibt«, berichtigte der Mann und stützte sich auf seinen Schirm. Er schien sich nicht gern zu wiederholen. »Zu denen Sie zählen mögen … oder auch nicht.«
»Also sollen wir gegeneinander antreten«, stellte Libby fest und warf Nico einen Blick zu. »Schon wieder.«
»Gegeneinander und gegen vier andere«, bestätigte der Mann und hielt ihnen je eine Visitenkarte hin. »Atlas Blakely«, stellte er sich vor, als Libby auf die Karte in ihrer Hand blickte. Atlas Blakely. Kurator. »Wie schon gesagt, möchte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten.«
»Wofür sind Sie Kurator?«, fragte Nico, und der Mann, Atlas, lächelte ihn freundlich an.
»Das möchte ich Ihnen allen lieber gleichzeitig mitteilen«, sagte er. »Ich bitte um Verzeihung, aber meine Stellenbeschreibung ist recht ausschweifend, und das Angebot läuft in wenigen Stunden ab.«
Libby, die nur selten impulsiv war, blieb misstrauisch.
»Sie werden uns nicht einmal sagen, woraus Ihr Angebot besteht?«, fragte sie. Seine Anwerbetaktiken kamen ihr unnötig geheimnisvoll vor. »Warum in aller Welt sollten wir dann zusagen?«
»Nun, die Antwort kennen wohl Sie allein, nicht wahr?«, bemerkte Atlas und hängte sich den Regenschirm am Griff an den Arm. Hinter ihm verließen die letzten Nachzügler ihre Plätze. »Wie gesagt habe ich einen recht straffen Zeitplan. Zeitzonen sind eine kniffelige Angelegenheit. Wen von Ihnen darf ich erwarten?«, fragte er und blickte bedeutungsschwer von Libby zu Nico und wieder zurück.
Libby runzelte die Stirn. »Ich dachte, die Entscheidung läge bei uns?«
»Oh, das tut sie.« Atlas nickte. »Sie beide scheinen allerdings so versessen darauf, getrennte Wege zu gehen, dass ich davon ausging, nur einer von Ihnen würde mein Angebot annehmen.«
Libby fing Nicos Blick auf. Beiden stand die Konkurrenz ins Gesicht geschrieben.
»Na, Rhodes?«, sagte Nico mit leisem Spott in der Stimme. »Willst du ihm sagen, dass ich besser bin als du? Oder soll ich das übernehmen?«
»Libs«, erklang Ezras Stimme von hinten. Sobald sie sein schwarzes Haar sah, setzte sie schnell eine Miene auf, als hätte Nico sie dieses Mal nicht zur Weißglut gebracht. »Bist du so weit? Deine Mom warte drau…«
»Oh, hallo, Fowler«, sagte Nico und drehte sich mit einem herablassenden Lächeln zu Ezra um. »Projektmanager, was?«
Libby zuckte innerlich zusammen. Aus seinem Mund klang das wie eine Beleidigung. Jeder Medäer konnte sich glücklich schätzen, eine solche Stelle zu bekommen. Doch für Nico galten andere Maßstäbe. Er würde irgendetwas Großartiges machen, etwas … Fulminantes.
Er war einer der besten sechs auf der Welt.
Auf der ganzen Welt.
Und sie auch.
Aber wofür?
Libby blinzelte, tauchte aus ihren Gedanken auf und stellte fest, dass Nico immer noch sprach.
»… gerade noch was klären, Fowler. Gönn uns doch einen Augenblick unsere Privatsphäre, ja?«
Ezra sah Libby mit gerunzelter Stirn an. »Geht es dir …?«
»Alles in Ordnung«, versicherte sie ihm. »Aber … gib uns bitte einen Moment, ja? Nur eine Sekunde«, sagte sie und wandte sich wieder Atlas zu, bevor ihr mit einiger Verspätung auffiel, dass Ezra den Fremden anscheinend gar nicht zur Kenntnis genommen hatte.
»Also, Nicolás?«, fragte Atlas erwartungsvoll.
»Oh, bitte, nennen Sie mich Nico.« Nico blickte Libby höchst zufrieden an, als er seine Hand ausstreckte. »Wann kann ich anfangen, Mr. Blakely?«
O nein.
O nein.
»Nennen Sie mich Atlas. Mit meiner Visitenkarte können Sie heute Nachmittag anreisen«, erwiderte er und drehte sich zu Libby um. »Ich muss doch sagen, Miss Rhodes, ich bin enttäuscht.« In Libby regte sich Protest. »Aber es war mir so oder so eine Freu…«
»Ich bin dabei«, platzte sie heraus.
Nicos Mundwinkel zuckten belustigt. Er schien nicht im mindesten überrascht von ihrer Entscheidung.
»Es ist nur ein Angebot, oder?«, fragte sie halb an Nico, halb an Atlas gewandt, um ihre Zweifel auszuräumen. »Ich kann es annehmen oder ablehnen, sobald ich weiß, worum es geht, richtig?«
»Natürlich.« Atlas neigte den Kopf. »Dann sehe ich Sie beide heute Nachmittag.«
»Eine Sache noch«, sagte Libby mit einem Seitenblick auf Ezra, der sie mit gerunzelter Stirn beobachtete. Seine Haare waren ein noch größeres Chaos als sonst, als hätte er frustriert darin herumgewühlt. »Mein Freund kann Sie nicht sehen, oder?« Als Atlas den Kopf schüttelte, fragte sie: »Was denkt er dann, was ich hier tue?«
»Oh, er wird sich vermutlich eine logische Erklärung zurechtlegen«, sagte Atlas, und Libby wurde blass bei dem Gedanken, was Ezra sich wohl gerade zusammenreimte. »Dann bis heute Nachmittag«, fügte er hinzu, bevor er verschwand und Libby mit dem sich vor Lachen schüttelnden Nico allein ließ.
»Was ist denn so witzig?«, fauchte sie und funkelte ihn an.
Er sammelte sich und deutete mit einem Blick auf Ezra. »Schätze, das wirst du noch rausfinden. Bis später, Rhodes.«
Er verabschiedete sich mit einer demonstrativen Verbeugung, während Libby sich fragte, ob es hier nach Rauch roch.
Reina
Vier Stunden zuvor
Als Reina Mori geboren wurde, wütete ganz in der Nähe ein Brand. Für solch eine urbane Gegend war dies ein sehr ungewöhnliches Ereignis, das an jenem Tag allen Einwohnern die eigene Sterblichkeit drastisch vor Augen führte. Feuer war ein so primitives, ein so archaisches Problem; und dass Tokyo, Epizentrum des Fortschritts sowohl magischer als auch nichtmagischer Technologie, eine derart hinterwäldlerische, unkultivierte Katastrophe erleiden musste, erschütterte viele in den Grundfesten ihrer Weltvorstellung. Manchmal, wenn Reina schlief, kroch ihr der Brandgeruch wieder in die Nase, und sie wachte hustend auf, beugte sich über die Bettkante und würgte, bis sich die rauchige Erinnerung aus ihrer Lunge verzogen hatte.
Den Ärzten war sofort klar, dass Reina über Kräfte der höchsten medäischen Kategorie verfügte, die die ohnehin seltenen Spielereien normaler Hexerei übertrafen. In dem vielgeschossigen Krankenhaus fand sich nicht sonderlich viel Natur, aber das bisschen floraler Existenz – die Zierpflanzen in den Ecken, Schnittblumen von mitfühlenden Besuchern – war wie ein Haufen ängstlicher kleiner Kinder auf sie zugekrochen, nervös und sehnsüchtig und voller Todesangst.
Reinas Großmutter bezeichnete ihre Geburt als Wunder. Sie sagte, bei Reinas erstem Atemzug habe die Welt erleichtert aufgeseufzt und sich an die Lebensfülle geklammert, die Reina ihr schenkte. Reina dagegen betrachtete ihren ersten Atemzug als den Beginn lebenslanger Verpflichtungen.
Eigentlich hätte ihre Klassifizierung als Naturmagierin sie gar nicht so sehr belasten sollen. Schließlich ließen sich medäische Naturmagier, viele davon aus ländlichen Gebieten, typischerweise von großen Landwirtschaftsunternehmen anwerben; dort verdienten sie hübsche Summen, wenn sie die Sojabohnenproduktion ankurbelten oder bei der Wasseraufbereitung halfen. Reina als eine aus diesen Reihen zu betrachten oder überhaupt als Naturalistin zu klassifizieren, traf jedoch nicht den Kern der Sache. Bei anderen Medäern lief es so: Sie baten die Natur um einen Gefallen, und wenn sie nur freundlich oder ehrfurchtsvoll oder machtvoll genug fragten, gab die Natur, was sie hatte. In Reinas Fall verhielt sich die Natur eher wie ein nerviges Geschwisterkind, oder ein hoffnungslos Süchtiger, der leider zur Verwandtschaft gehörte und immer wieder auftauchte, um völlig überzogene Forderungen zu stellen. Reina, die ohnehin nicht viel von Familienbanden hielt, legte keinen Wert auf diese Kontaktaufnahmen und ignorierte sie meistens.
Ein Gutes hatte das Dasein als uneheliches Kind – man lernte schnell, die eigene Geschichte umzuschreiben, die eigene Bedeutung herunterzuspielen. Reina kam schon mit dem Wissen auf die Welt, wie man Umstände ausblendete.
Tatsächlich sprach nichts für ein Studium in Osaka, außer dass sie dafür Tokyo verlassen konnte. Tokyos magische Universität war völlig in Ordnung, vielleicht sogar etwas besser, doch die Aussicht, bis in alle Ewigkeit am selben Ort festzuhängen, weckte keine große Begeisterung in Reina. Wieder und wieder hatte sie nach Erfahrungen gesucht, die ihrer glichen – die weniger nach Wow, du große Retterin klangen und mehr nach Wow, es ist echt anstrengend, ständig die Verantwortung tragen zu müssen –, und hatte die meisten davon in antiker Mythologie gefunden. Dort ertrugen Hexen, oder Götter, die als Hexen wahrgenommen wurden, ganz ähnliche Schicksale, die in manchen Fällen sogar erstrebenswerte Wendungen nahmen: Exil auf einer Insel. Ein halbes Jahr in der Unterwelt. Das Verwandeln der persönlichen Feinde in Dinge, die nicht sprechen konnten. Reinas Lehrer ermutigten sie, ihre naturalistischen Fähigkeiten zu trainieren, Botanik und Kräuterkunde zu belegen und sich in ihren Studien auf die Feinheiten der Pflanzenwelt zu konzentrieren. Doch Reina wollte die Klassiker. Sie wollte sich mit Literatur beschäftigen, mit Dingen, die sie nicht mit plattem chlorophyllischem Verlangen anstarrten. Als die Uni Tokyo ihr ein Stipendium aufdrängen wollte, damit sie bei deren führenden Naturmagiern studierte, nahm sie stattdessen das Angebot der Uni Osaka mit der Aussicht auf einen freieren Stundenplan an.
Eine kleine Flucht nur, aber immerhin.
Sie machte ihren Abschluss am Osaka Institut für Magie und bekam einen Job als Kellnerin in einem Kaffee- und Teehaus nahe des magischen Stadtzentrums. Der große Vorteil am Kellnern, wenn die Magie die ganze Lauferei erledigte? Viel Zeit zum Lesen. Und Schreiben. Direkt nach ihrem Abschluss waren unzählige Agrarfirmen über sie hergefallen (darunter viele Konkurrenten aus China und den Vereinigten Staaten, aber auch aus Japan), und Reina hatte ihr Bestmögliches getan, um nicht auf einer riesigen Plantage zu landen, wo sowohl die Erde als auch ihre Bewohner sie für ihre Zwecke aussaugen würden. Im Café gab es keine einzige Pflanze. Auch wenn sich die hölzerne Einrichtung ab und an unter ihren Händen wölbte und sich sogar erdreistete, sehnsuchtsvoll ihren Namen in der Maserung zu buchstabieren, konnte sie das einigermaßen ignorieren.
Was nicht bedeutete, dass hier niemand nach ihr suchte. Heute war es ein großer, dunkelhäutiger Mann in einem Burberry-Trenchcoat.
Immerhin sah er nicht nach Kapitalistenschwein aus – eher nach Sherlock Holmes. Er kam herein, setzte sich an einen Tisch und legte drei kleine Samenkerne darauf. Dann wartete er, bis Reina seufzend aufgestanden war.
Außer ihm befand sich niemand im Café; vermutlich hatte er dafür gesorgt.
»Bringen Sie sie zum Wachsen«, forderte er sie ohne jede Vorrede auf.
Er sprach mit schwachem Tokyoter Einschlag statt im typischen Osaka-Dialekt, woraus Reina zwei Dinge schloss: Erstens wusste er genau, wer sie war, oder zumindest, woher sie kam. Zweitens war Japanisch ganz offensichtlich nicht seine Muttersprache.
Reina warf ihm einen gelangweilten Blick zu. »Ich bringe sie nicht zum Wachsen«, antwortete sie auf Englisch. »Das machen sie von selbst.«
Sein selbstzufriedener, unbeeindruckter Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass er mit diesem Einwand gerechnet hatte. Als er ebenfalls auf Englisch antwortete, fiel ihr sein starker, arroganter britischer Dialekt auf. »Und das hat rein gar nichts mit Ihnen zu tun?«
Sie wusste, was er von ihr hören wollte. Weder heute noch an irgendeinem anderen Tag würde sie ihm den Gefallen tun.
»Sie wollen etwas von mir«, stellte Reina ungerührt fest. »Alle wollen etwas von mir.«
»Stimmt«, bestätigte er. »Ich hätte gern einen Kaffee, bitte.«
»Schön.« Sie winkte über die Schulter hinweg nach hinten. »Ist in zwei Minuten fertig. Sonst noch etwas?«
»Ja«, sagte er. »Funktioniert es besser, wenn Sie wütend sind? Wenn Sie traurig sind?«
Der Kaffee war es also nicht. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«
»Es gibt genug andere Naturmagier.« Er musterte sie mit einem langen, scharfen Blick. »Warum sollte ich Sie auswählen?«
»Sollten Sie nicht«, sagte sie. »Ich bin Kellnerin, keine Naturalistin.«
Einer der Samen brach auf und schlug seine Wurzeln in die hölzerne Tischplatte.
»Manche Menschen haben einzigartige Gaben, andere haben ausbaufähige Talente«, sagte der Mann. »Wofür halten Sie das hier?«
»Weder noch.« Der zweite Same keimte. »Einen Fluch vielleicht.«
»Hm.« Der Mann sah auf die Samen hinunter, dann hoch zu Reina. »Was lesen Sie?«
Das Buch unter ihrem Arm hatte sie völlig vergessen. »Die Übersetzung einer Handschrift von Circe, der griechischen Hexe.«
Seine Mundwinkel zuckten. »Die Handschrift ist doch seit langem verschollen, oder?«
»Davor wurde sie allerdings gelesen«, sagte Reina. »Und von diesen Leuten noch einmal aufgeschrieben.«
»Also ungefähr so zuverlässig wie das Neue Testament«, sagte der Mann.
Reina zuckte mit den Schultern. »Ich arbeite mit dem, was mir zur Verfügung steht.«
»Und wenn ich Ihnen sage, dass Sie das Original haben könnten?«
Der dritte Samen schoss an die Decke hinauf, prallte von dort ab und grub sich schließlich in die Holzfasern des Fußbodens.
Ein paar Sekunden lang rührte sich keiner von ihnen.
»Das Original existiert nicht mehr.« Reina räusperte sich. »Haben Sie gerade selbst gesagt.«
»Nein, ich sagte, es ist verschollen.« Der Mann beobachtete, wie sich winzige Risse auf der Samenhülle zu seinen Füßen ausbreiteten. »Nicht jeder bekommt es zu sehen.«
Reina machte einen schmalen Mund. Eine seltsame Bestechung, doch nicht die erste dieser Art. Alles hatte seinen Preis. »Und was müsste ich dafür tun?«, fragte sie entnervt. »Ihnen als Gegenleistung acht gute Erntejahre versprechen? Einen bestimmten Prozentsatz Ihres Jahresgewinns einbringen? Nein danke.«
Sie wandte sich ab, und unter ihren Füßen knackte es. Kleine grüne Wurzeln schossen aus dem Boden und schlängelten sich wie Tentakel hervor, griffen nach ihren Knöcheln, pochten an ihre Schuhsohlen.
»Wie wäre es«, entgegnete der Mann ungerührt, »mit drei Antworten als Gegenleistung?«
Reina fuhr herum, und der Mann zögerte keine Sekunde. Ganz offenbar besaß er einige Übung darin, Menschen unter Druck zu setzen.
»Wie funktioniert Ihre Magie?« Seine erste Frage, und ganz sicher nicht diejenige, für die Reina sich entschieden hätte, wenn es denn ihre Entscheidung gewesen wäre.
»Ich weiß es nicht.« Er hob eine Augenbraue, wartete ab, und sie seufzte. »Na schön, sie … benutzt mich. Benutzt meine Energie, meine Gedanken, meine Gefühle. Je mehr Energie vorhanden ist, desto mehr nimmt sie sich. Meistens wehre ich mich dagegen, aber wenn ich meine Gedanken frei laufen lasse …«
»Was passiert in dem Moment mit Ihnen? Nein, warten Sie, das formuliere ich präziser.« Anscheinend wollte er seine drei Fragen bestmöglich einsetzen. »Raubt Ihnen dieser Vorgang Kraft?«
Sie biss die Zähne zusammen. »Manchmal bekomme ich ein bisschen was zurück. Aber normalerweise schon, ja.«
»Verstehe. Letzte Frage«, sagte er. »Was passiert, wenn Sie versuchen, Ihre Magie selbst zu benutzen?«
»Habe ich Ihnen doch gesagt«, erwiderte sie. »Ich benutze sie nicht.«
Er lehnte sich zurück und deutete auf die zwei Samen, die noch auf dem Tisch lagen. Der eine schlug halbherzig Wurzeln, der andere lag aufgeplatzt da.
Die Geste war eindeutig: Versuchen Sie es doch mal.
Sie wog die Konsequenzen ab, rechnete alles durch.
»Wer sind Sie?« Reina löste den Blick von den Samen.
»Atlas Blakely, Kurator«, antwortete der Mann.
»Und was kuratieren Sie?«
»Das würde ich Ihnen gern erzählen«, sagte er, »doch die Information ist leider vertraulich. Offiziell darf ich Ihnen noch keine Einladung aussprechen, da die Entscheidung, ob der sechste Platz auf unserer Liste an Sie oder jemand anders geht, noch aussteht.«
Sie runzelte die Stirn. »Was bedeutet das?«
»Das bedeutet, dass nur sechs Personen eine Einladung erhalten«, antwortete Atlas schlicht. »Ihre Professoren am Osaka-Institut gehen anscheinend davon aus, dass Sie mein Angebot ablehnen werden, daher ist Ihr Platz nicht unbedingt …« Er verstummte. »Nun, ich will offen mit Ihnen sein. Es herrscht Uneinigkeit, Miss Mori. Ich habe exakt zwanzig Minuten, um den Rest des Rates davon zu überzeugen, dass wir Sie zur Sechsten im Bunde machen sollten.«
»Wer behauptet, dass ich Teil irgendeines Bundes sein möchte?«
»Möchten Sie vielleicht nicht«, räumte er ein. »In dem Fall benachrichtige ich den anderen Kandidaten, dass der Platz ihm gehört. Ein Reisender. Junger Mann, sehr intelligent, gut ausgebildet. Möglicherweise besser als Sie.« Pause, damit die Botschaft bei ihr ankam. »Eine sehr seltene Gabe, die er da hat, aber in meinen Augen weit weniger nützlich als die Ihre.«
Sie sagte nichts. Die Pflanze, die ihren Knöchel umschlungen hielt, seufzte unzufrieden und welkte angesichts Reinas Unbehagens ein wenig dahin.
»Also gut.« Atlas erhob sich, und Reina zuckte zusammen.
»Warten Sie.« Sie schluckte. »Zeigen Sie mir die Handschrift.«
Atlas wölbte eine Augenbraue.
»Sie haben gesagt, ich müsste nur drei Fragen beantworten«, rief Reina ihm in Erinnerung, und er lächelte wohlwollend.
»Richtig, das sagte ich.«
Mit einer knappen Bewegung förderte er ein handgebundenes Buch zutage und ließ es zwischen ihnen in der Luft schweben. Sachte schlug sich der Einband von selbst auf und offenbarte eine winzige Kritzelschrift, die nach einer Mischung aus Altgriechisch und pseudohieroglyphischen Runen aussah.
»Bei welchem Zauberspruch waren Sie gerade?«, fragte er, als Reina schon die Hand ausstreckte. »Bedaure.« Atlas winkte das Buch ein paar Zentimeter zu sich zurück, »berühren dürfen Sie es leider nicht. Eigentlich sollte es das Archiv überhaupt gar nicht verlassen, aber wie gesagt hoffe ich, Sie erweisen sich meiner Mühen wert. Welchen Zauberspruch haben Sie vorhin gelesen?«
»Ich, ähm … den Tarnzauber.« Reina starrte auf die Buchseiten und begriff nur ungefähr die Hälfte dessen, was sie las. Die Runenkurse in Osaka waren eher grundlegender Natur; in Tokyo hätte sie mehr gelernt, aber eben nicht ohne Haken. »Mit dem sie die Gestalt der Insel verschleiert.«
Atlas nickte, das Buch blätterte selbständig weiter, und da, auf der rechten Seite, prangte eine schmucklose Zeichnung der Insel Aiaia, die Tinte halb vergilbt. Es war ein plumper, unvollendeter Illusionszauber. Mit solchen Dingen hatte Reina sich über die grundlegende medäische Theorie hinaus überhaupt nicht beschäftigt. Die Illusionskurse am Osaka-Institut waren den Illusionisten vorbehalten, und zu denen gehörte sie nicht.
»Oh«, sagte sie.
Atlas lächelte.
»Ihnen bleiben noch fünfzehn Minuten«, rief er ihr in Erinnerung, und dann ließ er das Buch verschwinden.
Auch hier gab es also ganz offensichtlich einen Haken. Diese Art der Überredungskunst hatte Reina nie gemocht, doch rein rational war ihr klar, dass der Strom der Interessenten nie abreißen würde. Sie war ein Quell der Macht, ein Tresor mit einer schweren Tür, und entweder fanden sie irgendwann einen Einstieg, oder Reina müsste schlicht und ergreifend irgendjemandem Zutritt gewähren. Und zwar einem möglichst würdigen Käufer.
Sie schloss die Augen.
Dürfen wir?, fragten die Samen in ihrer simplen Samensprache, die sich wie winzige Nadelstiche auf ihrer Haut anfühlte. Wie Kinderstimmchen, bittebittebitte Mutter, können wir?
Sie seufzte.
Wachst, sagte sie zu ihnen in ihrer Sprache. Sie hatte keine Ahnung, wie sich das für die Samen anfühlte, aber offenbar verstanden sie sie gut. Nehmt euch, was ihr haben wollt, fügte sie mürrisch hinzu, macht’s einfach.
Die Erleichterung durchfloss ihren ganzen Körper: Jaaaaaaaaaa.
Als sie die Augen wieder öffnete, waren von dem Samen am Boden lauter schmale Zweige ausgeschlagen, die sich von ihren Füßen bis hinauf zur Decke streckten, darunter entlangkrochen und sich ungehemmt ausbreiteten. Der Samen, der im Tisch Halt gefunden hatte, spaltete das Holz entzwei und wucherte wie Moos an einem kargen Baumstamm. Der letzte, der aufgeplatzte Samen, erzitterte, brach in einen bunten Strauß aus und formte sich zu Ästen und Zweigen, an denen plötzlich Früchte wuchsen, die unter ihren Blicken in astronomischem Tempo reiften.
Als die Äpfel rund und schwer und verführerisch zwischen ihnen hingen, atmete Reina aus, löste die verspannten Schultern und sah ihren Besucher erwartungsvoll an.
»Ah ja«, sagte Atlas und verändert seine Sitzposition. Die Pflanzen ließen ihm kaum noch Raum. Zwischen dem dichten Blätterdach über sich und den verstrickten Wurzeln unter sich fand er weder für seinen Kopf noch für seine Beine ausreichend Platz. »Also ist es sowohl Gabe als auch Talent.«
Reina kannte ihren eigenen Wert gut genug, um das unkommentiert zu lassen. »Was für Bücher haben Sie noch?«
»Ich habe Ihnen noch kein Angebot gemacht, Miss Mori«, erwiderte Atlas.
»Sie wollen mich«, sagte sie und reckte das Kinn. »Niemand sonst kann das, was ich kann.«
»Das mag zutreffen, aber Sie kennen die anderen Kandidaten auf der Liste nicht«, gab er zu bedenken. »Wir haben zwei der besten Physiomagier, die die Welt seit Generationen gesehen hat, einen einmalig begabten Illusionisten, eine Telepathin mit unvergleichlichen Fähigkeiten, einen Empathen, dessen Überzeugungskraft Tausende von …«
»Es spielt keine Rolle, wen Sie noch haben.« Reina schob den Unterkiefer vor. »Sie wollen trotzdem mich.«
Atlas musterte sie einen Moment lang.
»Ja«, sagte er. »Ja, das stimmt wohl.«
Hahaha, lachten die Pflanzen. Haha, Mutter gewinnt, wir gewinnen.
»Lasst das«, flüsterte Reina den Zweigen zu, die sich herabbogen und ihr wohlwollend über den Kopf strichen, und Atlas stand mit einem leisen Lachen auf. Dann hielt er ihr ein kleines Kärtchen hin.
»Nehmen Sie die«, sagte er, »und in ungefähr vier Stunden werden Sie zur Einführung transportiert.«
»Zur was?«, fragte Reina, und er zuckte mit den Schultern.
»Ich wiederhole mich ungern«, erwiderte er. »Viel Glück, Reina Mori. Das war nicht Ihr letzter Test.«
Dann war er verschwunden, und Reina zog eine finstere Miene.
Ein Café voller Pflanzen war das Letzte, was sie brauchen konnte, und sein Kaffee stand unangetastet und mittlerweile kalt auf dem Tresen.
Tristan
Drei Stunden zuvor
»Nein«, sagte Tristan, als die Tür aufging. »Nicht schon wieder. Nicht jetzt.«
»Mensch, Tristan«, stöhnte Rupesh, »du hockst hier schon seit Ewigkeiten drin.«
»Ja«, erwiderte Tristan. »Und mache meinen Job. Unglaublich, oder?«
»Nicht besonders«, brummte Rupesh und ließ sich auf den leeren Sessel vor Tristans Schreibtisch fallen. »Du bist der zukünftige Schwiegersohn und Thronfolger, Tris. Die ganze Plackerei ist total sinnlos, weil du sowieso alles irgendwann erben wirst.«
»Erstens, dieses Unternehmen ist nicht das Königshaus«, murmelte Tristan, ohne den Blick von den Zahlen zu heben, an denen er arbeitete. Mit einer Handbewegung sortierte er sie um. Seine eigene Bewertung wich ganz leicht ab, daher passte er den Abzinsungssatz an, denn er wusste, dass das risikoscheue Investorengremium ein breites Prozentspektrum bevorzugte. »Und selbst wenn, bin ich nicht der Thronfolger, ich bin lediglich …«
»Lediglich mit der Tochter des Chefs verlobt«, ergänzte Rupesh und hob eine Augenbraue. »Du solltest endlich mal ein Datum festlegen, weißt du. Das geht jetzt schon mehrere Monate, oder? Eden wird sicher langsam ungeduldig.«
Allerdings, und das ließ sie ihn von Tag zu Tag deutlicher spüren. »Ich hatte viel um die Ohren«, sagte Tristan steif. »Und außerdem habe ich für solchen Kram jetzt wirklich keine Zeit. Also, raus.« Er deutete zur Tür. »Ich muss noch mindestens drei Bewertungen fertig kriegen, bevor ich hier gehen kann.«
Der alljährliche Urlaub der Familie Wessex stand an, und Tristan fuhr wie üblich als Edens Begleitung mit. Das war Tristans viertes Jahr als Anhängsel der ältesten Wessex-Tochter, und diese Reise gehörte – überflüssig zu erwähnen – nicht gerade zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Jeden Fußtritt, jede Silbe sorgsam abwägen, bloß nicht die Maske der Makellosigkeit verrutschen lassen, das war anstrengend – dennoch lohnte sich die endlose Heuchelei, wenn er dafür Zugang zum unvergleichlichen Wessex-Idyll erhielt. Sein tadelloser Auftritt enttäuschte allerdings Eden, die mit größtem Vergnügen ein Familiendinner schon bei der kleinsten Anspielung auf Tristans unstandesgemäßen Hintergrund in ein Desaster verwandelte. Für Tristan wiederum rechnete sich jede hochnäsige Mikroaggression, und war sie noch so dreist, wenn er dafür dabei sein durfte und von jemand anderem als seinem biologischen Vater als Erbe betrachtet wurde.
Tristan überlegte, ob er Eden davon überzeugen konnte, dass er ihren Namen annahm; vorausgesetzt er konnte sich irgendwann dazu durchringen, sein Schicksal endgültig zu besiegeln.
»Du fährst mit ihnen in den Urlaub«, gab Rupesh zu bedenken und hob eine dunkle Braue. »Du gehörst doch quasi schon zur Familie.«
»Nein, gehöre ich nicht.« Noch nicht. Tristan rieb sich die Schläfe und betrachtete wieder seine Zahlen. Das Grundkapital, das dieser Deal erforderte, war gesalzen, und obendrein baute er auf einer höchst problematischen magischen Infrastruktur auf. Dennoch bot dieses Portfolio ein größeres Umsatzpotenzial als die dreizehn anderen medäischen Projekte, die er heute bewertet hatte. Auch wenn es den restlichen Investoren nicht gefallen würde – dass der Name von James Wessex am Gebäude stand, hatte seinen Grund, und ihm würde das Risiko nichts ausmachen.
Tristan legte das Projekt auf den Vielleicht-Stapel. »Ich werde dieses Unternehmen nicht einfach erben, Rup. Wenn ich das wirklich will, muss ich dafür arbeiten. Könntest du auch mal in Erwägung ziehen.«
Rupesh verdrehte die Augen. »Werd halt möglichst schnell fertig. Eden postet schon seit heute Vormittag Bilder von ihren Reisevorbereitungen.«
Eden Wessex, Tochter des milliardenschweren Investors James Wessex, war als hübsche Erbin ein marktfähiges Fertigprodukt, das aus immateriellen Werten wie Schönheit und Einfluss Kapital schlug. Seit Tristan dem Wessex-Vorstand zur Investition in Lightning geraten hatte, der magischen Version einer bekannten Social-Media-App, war Eden das Gesicht der Firma.
»Besten Dank für diesen wertvollen Hinweis.« Tristan räusperte sich. Wahrscheinlich verpasste er genau in diesem Moment schon mehrere Nachrichten von Eden. »Ich bin gleich durch. Ist das alles?«
»Du weißt, dass ich erst gehen kann, wenn du gehst, Kumpel.« Rupesh zwinkerte ihm zu. »Ich kann ja schlecht früher Feierabend machen als der Goldjunge, oder?«
»Okay, schön, dann tust du dir aber gerade wirklich keinen Gefallen«, sagte Tristan und wedelte mit der Hand Richtung Tür. Noch zwei Angebote, dachte er und warf einen Blick auf seine Unterlagen. Na gut, eins. Das andere taugte ganz offensichtlich nichts. »Geh schon, Rup. Und unternimm was gegen diesen Kaffeefleck.«
»Was?« Rupesh sah an sich herunter, und Tristan hob den Blick.
»Du solltest deine Illusionen öfter mal auffrischen«, bemerkte er und zeigte auf die Spitze von Rupeshs Krawatte. »Du kannst nicht fünfhundert Kröten für einen Designergürtel ausgeben und dann deinen Fleckenzauber aus dem Mülleimer vorkramen.« Noch während er es aussprach, begriff Tristan, wie typisch aber genau dieses Verhalten für Rupesh war. Manche Menschen kümmerte lediglich das, was andere an ihnen sahen, und insbesondere Rupesh war nicht bewusst, wie kristallklar Tristan diese Fassade durchschaute.
»Gott, du nervst, weißt du das?« Rupesh verdrehte die Augen. »Kein Mensch achtet darauf, ob meine Zaubersprüche abgenutzt sind oder nicht.«
»Soweit du weißt.« Kaum etwas anderes verdiente überhaupt seine Beachtung, fand Tristan. Rupesh Abkari: mit Silberlöffel im Mund geboren, würde vermutlich ebenso sterben.
Wie schön für ihn.
»Ein Grund mehr, dich zu hassen, Kumpel«, sagte Rupesh grinsend. »Wie auch immer, komm zu Potte, Tris. Tu uns allen den Gefallen und verkrümel dich endlich in dein Urlaubsparadies, damit wir anderen uns ein paar Tage Entspannung gönnen können, okay?«
»Ich gebe mir Mühe«, versicherte Tristan ihm, dann schloss sich die Tür, und er war endlich allein.
Er schob den untauglichen Pitch beiseite und nahm den vielversprechenderen hoch. Die Zahlen sahen solide aus. Kein immenses Startkapital erforderlich, das hieß …
Die Tür ging auf, und Tristan stöhnte.
»Zum letzten Mal, Rupesh …«
»Kein Rupesh hier«, erwiderte eine tiefe Stimme.
Tristan sah von seinem Bildschirm auf und betrachtete den Fremden. Er war groß und dunkelhäutig, trug einen unauffälligen Tweedanzug und ließ den Blick über die gewölbte Decke von Tristans Büro wandern.
»Tja«, bemerkte der Mann, trat ein und schloss die Tür hinter sich. »Bedenkt man Ihre Startposition, haben Sie es ganz schön weit gebracht, nicht wahr?«
Ohne Frage. Sein Eckbüro, dessen Fenster Richtung Norden sogar einen schmalen Streifen vom strahlenden Londoner Himmel zeigten, repräsentierte seine jüngste Beförderung.
Doch jeder, der Tristans Startposition kannte, verhieß Schwierigkeiten, und mit wachsendem Ärger machte er sich auf den Knall gefasst, wenn die Bombe platzte.
»Falls Sie ein …«, er verbiss sich das Wort Freund, »ein Geschäftspartner meines Vaters sind …«
»Nicht ganz«, versicherte ihm der Mann. »Obwohl wir Adrian Caine alle auf die ein oder andere Art kennen, oder?«
Wir. Tristan verkniff sich eine Grimasse.
»Hier bin ich kein Caine«, sagte er. Ja, der Name stand immer noch auf seinem Schreibtischschildchen, doch die korrekte Verbindung stellte hier aller Wahrscheinlichkeit nach niemand her. Die Reichen scherten sich kaum um den Dreck unter ihren Füßen, solange er hin und wieder aufgekehrt und außer Sichtweite abgeladen wurde. »Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen.«
»Darum bitte ich auch gar nicht«, sagte der Mann, hielt inne und warf einen erwartungsvollen Blick auf den leeren Besuchersessel. (Tristan bot ihm den Platz nicht an.) »Wobei ich mich schon frage«, fuhr er fort, »wie es Sie auf diesen Pfad verschlagen hat. Schließlich hätten Sie ein ganz eigenes Imperium erben können, stimmt’s?« Tristan schwieg. »Mir ist nicht klar, wie der einzige Stammhalter der Familie Caine dazu kommt, um das Vermögen der Wessex zu buhlen.«
Zwar ging das niemanden etwas an, doch Tristan und sein Vater hatten auf halbem Wege durch sein Studium alle Verbindungen gekappt, als deutlich wurde, dass Adrian Caine in ihm wenig mehr sah als eine nutzlose Marionette der Oberschicht – bestenfalls ein Schoßhündchen für ihre Unterhaltung, schlimmstenfalls ein Gläubiger am Altar ihrer Sünden. Das entsprach zwar irgendwie der Wahrheit, doch im Gegensatz zu seinem Vater sah Tristan trotz all der Bäume noch den Wald. Adrian Caine war eine widerwärtige Gestalt, gierig und geltungssüchtig. James Wessex war vom selben Schlag, doch Tristan hatte begriffen, welchem der beiden Männer das Schicksal nichts anhaben konnte.
»Nicht immer geht es um Geld«, log Tristan. Es ging immer und überall um Geld. Stand einem allerdings ausreichend davon zur Verfügung, konnte man das irgendwann vergessen. Und genau das plante Tristan für sein eigenes Leben. »Und wenn Sie nun die Güte hätten …«
»Worum geht es denn stattdessen?«, fragte der Mann, und Tristan seufzte laut.
»Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie hereingelassen hat, aber …«
»Mit diesem Job sind Sie völlig unterfordert.« Der Mann musterte ihn mit einem ernsten Blick. »Sie und ich wissen beide, dass das hier Sie nicht ewig zufriedenstellen wird.«
Falsch, dachte Tristan. Geld war tatsächlich sehr zufriedenstellend, vor allem wenn es den Allerreichsten abgeknöpft wurde. »Sie wissen überhaupt nichts über mich«, stellte Tristan fest. »Mein Nachname ist nur ein sehr kleiner Aspekt meiner Persönlichkeit, und noch dazu kein sehr entscheidender.«
»Ich weiß, dass Ihnen nicht einmal ansatzweise klar ist, was für eine Ausnahmeerscheinung Sie sind«, konterte der Mann. »Ihr Vater hält Ihre Gaben vielleicht für Verschwendung, aber ich weiß es besser. Illusionisten findet man überall. Diebe gibt es an jeder Straßenecke. Auch einen zweiten Adrian Caine würde ich wohl finden.« Er machte einen schmalen Mund. »Was Sie haben, hat niemand sonst.«
»Was genau habe ich denn?«, fragte Tristan lapidar. »Und sagen Sie jetzt nicht: Potenzial.«
»Potenzial? Wohl kaum. Jedenfalls nicht hier.« Der Mann deutete auf das feudale Büro. »Ein sehr hübscher Käfig, aber dennoch ein Käfig.«