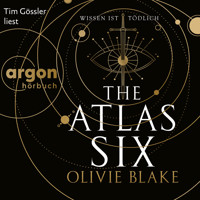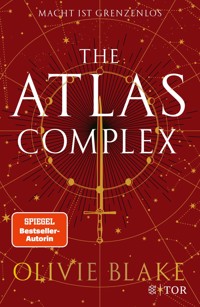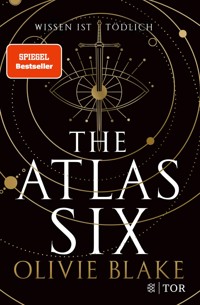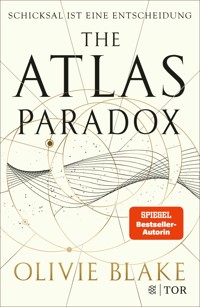
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlas-Serie
- Sprache: Deutsch
Der internationale Fantasy-Bestseller und TikTok-Erfolg. Dark Academia meets Fantasy. »The Atlas Paradox« ist die Fortsetzung des Bestsellers »The Atlas Six«, in dem sich sechs talentierte Magier*innen den tödlichen Prüfungen der Alexandrinischen Gesellschaft stellen. Mehr Geheimnisse. Verrat. Verführung. Herzen werden gebrochen, Allianzen geschmiedet und wieder zerbrochen, und die Alexandrinische Gesellschaft wird als das enthüllt, was sie ist: eine mächtige Organisation, die von einem Mann geführt wird, der unsere Welt revolutionieren möchte. Doch die Gesellschaft verfügt auch über mächtige Feinde, die von sich behaupten, eine bessere Alternative zu sein. Die Magier*innen werden sich für eine der beiden Seiten entscheiden müssen. Und allen ist klar: Von dieser Entscheidung hängt nicht nur ihr eigenes Schicksal ab. Für Leser*innen von Sarah J. Maas, Leigh Bardugo und V. E. Schwab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Olivie Blake
The Atlas Paradox
Schicksal ist eine Entscheidung
Über dieses Buch
Willkommen in der Alexandrinischen Gesellschaft
Während die fünf Auserwählten die Initiation der Alexandrinischen Gesellschaft durchlaufen und ihre Studienprojekte für das zweite Jahr festlegen, bleibt Libby Rhodes verschwunden. Es ist Nicos Freund Gideon, der sich im Traumreich auf ihre Spur setzt - und schon bald ein erstes Lebenszeichen von ihr erhält …
Reina Mori versucht, die Geheimnisse der Bibliothek zu entschlüsseln, was bedeutend schneller gehen würde, wenn ihr jemand dabei helfen würde. Doch Parisa ist noch immer damit beschäftigt, die Psyche ihres Betreuers Dalton Ellery und die zwielichtigen Motive von Atlas Blakeley zu erforschen, und auch Callum scheint gänzlich andere Pläne zu haben. Zumindest wenn er ausnahmsweise nüchtern ist.
Tristan weiß, dass er über verborgene Kräfte verfügt, die erst aktiviert werden, wenn er sich in Lebensgefahr begibt. Er entschließt sich deshalb zu einer ausgesprochen großen Dummheit. Er bittet Nico, ihn umzubringen.
Unterdessen wartet das Forum darauf, die Alexandrinische Gesellschaft ein für allemal zu Fall zu bringen. Und irgendwann ist allen klar: Die Figuren stehen auf dem Brett - das große Spiel kann beginnen.
»The Atlas Paradox« ist der zweite Band der »Atlas-Trilogie«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olivie Blake liebt und schreibt Geschichten - die meisten davon fantastisch. Besonders fasziniert ist sie dabei von der endlosen Komplexität des Lebens und der Liebe. Sie arbeitet in Los Angeles, wo sie die meiste Zeit über von ihrem Lieblings-Pitbull gnädig toleriert wird. Ihr selbst publiziertes Buch „The Atlas Six“ wurde auf TikTok zur Sensation, bevor es von Tor Books erneut veröffentlicht und in über zwanzig Sprachen übersetzt wurde.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Inhalt
Gesuchte Personen
Weiterführende Hinweise
Die Alexandrinische Gesellschaft
Anfang
Das Paradoxon
I Verwirrung
Libby
Ezra
II Die Auserwählten
Reina
Tristan
Parisa
Callum
III Ursprünge
Nico
Reina
Tristan
Parisa
Libby
IV Entropie
Libby
Callum
Nico
Ezra
Parisa
V Dualität
Libby
Tristan
Reina
Parisa
Intermezzo
VI Ego
Nico
Libby
Callum
Ezra
VII Seele
Tristan
Nico
Reina
Parisa
Libby
VIII Schicksal
Callum
Reina
Tristan
Libby
IX Olymp
Belen
Nico
Callum
Parisa
Ezra
Ende?
Danksagung
Für meinen Talisman, Henry Atlas
Inhalt
Anfang
I Verwirrung
II Die Auserwählten
III Ursprünge
IV Entropie
V Dualität
Intermezzo
VI Ego
VII Seele
VIII Schicksal
IX Olymp
Ende?
Gesuchte Personen
Caine, Tristan
Tristan Caine ist der Sohn von Adrian Caine, dem Kopf eines magischen Verbrechersyndikats. Tristan würde es stören, mit Bezug auf seinen Vater vorgestellt zu werden, doch Tristan stören die meisten Dinge. Geboren in London (Vereinigtes Königreich), Studium an der London School of Magic. Ehemaliger Risikokapitalgeber bei der Wessex Corporation sowie ehemaliger Verlobter von Eden Wessex, Verhältnis zerrüttet. Tristan studierte an der Fakultät für Illusion. Sein exaktes Fachgebiet ist unbekannt, wenngleich er Illusionen durchschauen kann (siehe auch: Quantentheorie; Zeit; Illusionen → Illusionen durchschauen; Bestandteile → magische Bestandteile). Gemäß den Bedingungen zur Aussortierung, die die Alexandrinische Gesellschaft aufstellt, kam Tristan die Aufgabe zu, Callum Nova zu töten. Tristan scheiterte, offenbar aus Gewissensgründen.
Ferrer de Varona, Nicolás (auch de Varona, Nicolás oder de Varona, Nico)
Nicolás Ferrer de Varona, genannt Nico, wurde in Havanna (Kuba) geboren und in jungen Jahren in die Vereinigten Staaten geschickt, wo er ein Studium an der renommierten New York University of Magical Arts abschloss. Nico ist ein außergewöhnlich begabter Physiomagier und besitzt mehrere zusätzliche Fähigkeiten außerhalb seines Fachgebiets (siehe auch: lithosphärische Besonderheiten; Seismologie → Tektonik; Gestaltwandeln → Mensch zu Tier; Alchemie; Tränke → alchemistisch). Nico pflegt enge Freundschaften zu den NYUMA-Absolventen Gideon Drake und Maximilian Wolfe und hatte, trotz jahrelanger Feindschaft, ein Bündnis mit Elizabeth »Libby« Rhodes. Obwohl Nico über ausgezeichnete Nahkampftechniken verfügt, konnte er den Verlust seiner Verbündeten nicht verhindern.
Kamali, Parisa
Über Parisa Kamalis frühe Jahre oder ihre wahre Identität liegen wenige Informationen vor, die über bloße Spekulation hinausgehen (siehe auch: Schönheit, Fluch der → Callum Nova). Parisa wurde in Teheran (Iran) geboren und besuchte die École Magique de Paris. Sie ist eine äußerst fähige Telepathin, unterhält verschiedenste Bekanntschaften (Tristan Caine; Libby Rhodes) und führt Experimente durch (Zeit → mentale Chronometrie; Unterbewusstsein → Träume; Dalton Ellery). Vertrauen in Parisa Kamali ist keinesfalls ratsam, doch kaum zu verhindern.
Mori, Reina
Über Reina Mori ist noch weniger bekannt als über Parisa Kamali. Wäre dies ein Wettbewerb – was es nicht ist –, würde Reina gewinnen. Geboren in Tokyo (Japan) und ausgestattet mit erstaunlichen naturmagischen Fähigkeiten. Allerdings studierte Reina Antike Literatur mit dem Schwerpunkt Mythologie am Osaka Institut für Magie. Reina allein bietet die Erde höchstselbst ihre Früchte an, und zu ihr allein spricht die Natur. Bemerkenswerterweise jedoch sieht Reina selbst ihre Talente woanders (siehe auch: Verstärkung → Energie; Kampferfahrung → Nico de Varona).
Nova, Callum
Callum Nova, Angehöriger des südafrikanischen Medienkonzerns Nova, ist Illusionist der Manipulationsklasse, dessen Kräfte bis ins Metaphysische reichen – in anderen Worten: ein Empath. Geboren in Kapstadt (Südafrika). Callum studierte recht bequem an der Hellenistischen Universität in Athen, bevor er ins Familienunternehmen einstieg und sich dem lukrativen Geschäft mit medäischen Schönheitsprodukten und -illusionen verschrieb. Nur ein einziger Mensch auf Erden weiß, wie Callum tatsächlich aussieht. Zu seinem Leidwesen wollte genau dieser Mensch ihn töten. Zu Tristans Leidwesen war sein Wille nicht stark genug (siehe auch: Verrat, nichts ist so endgültig wie).
Rhodes, Elizabeth (auch Rhodes, Libby)
Elizabeth »Libby« Rhodes ist eine begabte Physiomagierin. Gebürtig aus Pittsburgh in Pennsylvania (Vereinigte Staaten von Amerika). Libbys Kindheit wurde stark vom Verlust ihrer älteren Schwester Katherine geprägt. Libby besuchte die New York University of Magical Arts, wo sie ihren Rivalen und späteren Verbündeten Nicolás »Nico« de Varona sowie ihren Ex-Freund Ezra Fowler kennenlernte. Als Kandidatin der Geheimgesellschaft war Libby an mehreren bemerkenswerten Experimenten (siehe auch: Zeit → vierte Dimension; Quantentheorie → Zeit; Tristan Caine) und moralischen Dilemmata (Parisa Kamali; Tristan Caine) führend beteiligt, bevor sie spurlos verschwand, was die verbliebenen Kandidaten der Gruppe zunächst zu der Annahme verleitete, sie sei verstorben. Libbys derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt (siehe auch: Ezra Fowler).
Weiterführende Hinweise
Alexandrinische Gesellschaft, die
Archiv → verlorenes Wissen
Bibliothek (siehe auch: Alexandria; Babylon; Karthago; antike Bibliotheken → Islam; antike Bibliotheken → Asien)
Rituale → Initiation (siehe auch: Magie → Opfer; Magie → Tod)
Blakely, Atlas
Alexandrinische Gesellschaft, die (siehe auch: Alexandrinische Gesellschaft → Kandidaten; Alexandrinische Gesellschaft → Kuratoren)
Kindheit und Jugend → London, England
Telepathie
Drake, Gideon
Fähigkeiten → unbekannt (siehe auch: menschlicher Verstand → Unterbewusstsein)
Wesen → Subspezies (siehe auch: Systematik → Wesen; Spezies → unbekannt)
Kriminelle Verbindungen (siehe auch: Eilif)
Kindheit und Jugend → Kap-Breton-Insel, Nova Scotia, Kanada
Studium → New York University of Magical Arts
Fachgebiet → Reisender (siehe auch: Traumreiche → Navigation)
Eilif
Verbindungen → unbekannt
Kinder (siehe auch: Gideon Drake)
Wesen → Wasserwesen (siehe auch: Systematik → Wesen; Wasserwesen → Meerjungfrau)
Ellery, Dalton
Alexandrinische Gesellschaft, die (siehe auch: Alexandrinische Gesellschaft → Kandidaten; Alexandrinische Gesellschaft → Forscher)
Animation
Bekannte Verbindungen (siehe auch: Parisa Kamali)
Fowler, Ezra
Fähigkeiten (siehe auch: Reisen → vierte Dimension; Physiomagie → Quantum)
Alexandrinische Gesellschaft, die (siehe auch: Alexandrinische Gesellschaft → nicht initiiert; Alexandrinische Gesellschaft → Aussortierung)
Kindheit und Jugend → Los Angeles, Kalifornien, USA
Studium → New York University of Magical Arts
Bekannte Verbindungen (siehe auch: Atlas Blakely)
Frühere Anstellung (siehe auch: NYUMA→ Studienberater)
Persönliche Beziehungen (siehe auch: Libby Rhodes)
Fachgebiet → Reisender (siehe auch: Zeit)
Prinz, der
Animatur → allgemein
Identität (siehe auch: Identität → unbekannt)
Bekannte Verbindungen (siehe auch: Ezra Fowler, Eilif)
Die Alexandrinische Gesellschaft
Studienplan des Forschungsstipendiums
Erstes Jahr
Richtlinien:
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Initiation in die Alexandrinische Gesellschaft tragen nach größtem Bemühen neue und innovative Forschungsergebnisse zum Wissensarchiv bei. Außerdem schützen und bewahren sie während ihres gesamten Forschungsaufenthalts das Archiv, bis die Initiationsbedingungen vollständig erfüllt sind.
Basislehrplan:
Raum
Zeit
Denken
Absicht
Weitere Studieninhalte folgen gemäß den Initiationsbedingungen.
Die Module des ersten Studienjahres und die Erfüllung der Voraussetzungen zur Initiation müssen bis zum 1. Juni abgeschlossen sein.
Zweites Jahr
Die Kandidatinnen und Kandidaten tragen jeweils eine wissenschaftlich relevante Abhandlung, deren Thema ihnen freisteht, zum Archiv bei.
Antrag auf ein individuelles Forschungsprojekt:
*Pflichtangaben
Forschungsthema: ________________
Forschungsziele: _______________
Methodologie (relevante Literatur): _________________
Zeitplan:
Der vollständige Antrag umfasst den angestrebten zeitlichen Rahmen für eventuelle Datenerhebungen, Lektürephasen und/oder Analysearbeiten. Abgabe bis spätestens 1. Juni.
Unterschrift Kandidatin/Kandidat:
Genehmigt von:
Atlas Blakely
Anfang
Gideon Drake schirmte mit der Hand die Augen vor der rot glühenden Sonne ab und ließ den Blick über die verbrannten schwarzen Hügel wandern. Hitze flimmerte in der Luft und Rußpartikel tanzten im Wind. Mottenflügelgleich schwebten verbrannte Fetzen an ihm vorbei. Der Rauch war dicht, kreidetrocken und setzte sich in seiner Kehle fest. Wäre irgendetwas an diesem Szenario real, wäre er sofort zu einem medizinischen Notfall geworden.
Aber es war nicht real, also war er keiner.
Gideon blickte hinunter zu dem schwarzen Labrador neben ihm, runzelte nachdenklich die Stirn, wandte sich dann wieder der unbekannten Szenerie vor ihm zu und zog sich das T-Shirt über den Mund, um zumindest halbwegs atmen zu können.
»Das ist sehr interessant«, murmelte er.
Von Zeit zu Zeit wüteten solche Brände durch die Traumreiche. Gideon nannte sie »Erosionen«, obwohl es ihn nicht überraschen würde, sollte er einen weiteren seiner Art treffen, der ihm erklärte, dass das Phänomen schon einen Namen hatte. Erosionen waren recht häufig, aber nur selten so … entzündlich.
Wenn Gideon ein Motto hatte, dann lautete es: Verzweifeln ist sinnlos.
Für Gideon Drake war es unmöglich, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden.
Das, was er als verbrannte Ödnis wahrnahm, sah für den Träumenden möglicherweise völlig anders aus. Die Brände erinnerten Gideon an etwas, das er bereits vor langer Zeit gelernt hatte: Wenn man nach Verderben sucht, findet man es überall.
»Na dann komm, Max«, sagte Gideon zu dem Hund, der ganz nebenbei auch sein Mitbewohner war. Max schnüffelte und winselte, um seinen Unwillen deutlich zu machen, als sie gen Westen aufbrachen. Doch sie beide verstanden, dass Träume Gideons Reich waren und er deshalb auch über ihre Route entschied.
Für Magier waren die Traumreiche ein kollektives Unterbewusstsein. Jeder Mensch hatte Zugriff auf einen kleinen Teil der Reiche, doch nur wenige konnten sie so durchstreifen, wie es Gideon möglich war.
Es brauchte besondere Fähigkeiten, um zu erkennen, wo das Unterbewusstsein einer Person endete und das einer anderen begann. Gideon, der die verschiedenen Rhythmen der Reiche lesen konnte wie ein Matrose den Wellengang der See, hatte diese Fähigkeiten jetzt, da er die Traumreiche kaum noch verließ, weiter verfeinert.
Für die Außenwelt sah Gideon wie ein ziemlich normaler Mensch mit Narkolepsie aus. Doch seine Magie zu verstehen war ganz und gar nicht einfach. Soweit er wusste, war die Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein für ihn sehr dünn. Innerhalb der Traumreiche konnte er Zeit und Ort bestimmen, doch weil die reale Welt und die Traumwelt für ihn so nah beieinanderlagen, schaffte er es nicht immer durchs Frühstück, ohne einzuschlafen. Manchmal schien es, als gehörte er mehr in die Traumreiche als in die wache Welt. Doch Gideons traumwandlerische Veranlagung bedeutete auch, dass er mehr Möglichkeiten hatte als die meisten. Ein normaler Mensch konnte im Traum zum Beispiel fliegen, wusste aber, dass es sich um einen Traum handelte und er im echten Leben nicht fliegen konnte. Gideon Drake jedoch konnte fliegen. Immer. Er war sich nur nie sicher, ob er wach war oder schlief.
Theoretisch war Gideon im Traum nicht mächtiger als alle anderen Träumer. Seine physischen Grenzen ähnelten denen eines Telepathen – keine Magie, die in den Traumreichen gewirkt wurde, konnte ihm dauerhaft schaden. Es sei denn, sein Körper erlitt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. In den Traumreichen empfand Gideon Schmerzen wie alle anderen auch; es war ein imaginärer Schmerz, der verschwand, nachdem er aufgewacht war – falls er nicht außergewöhnlich gestresst war und sein Körper mit Organversagen darauf reagierte … doch darüber machte er sich nie Gedanken. Das tat nur Nico.
Bei dem Gedanken an Nico spürte Gideon wie gewöhnlich ein Stechen, als ob er einen Stein im Schuh hätte und damit weiterhumpeln müsste. Im letzten Jahr hatte er sich (je nach Tagesform mit wechselndem Erfolg) antrainiert, die Abwesenheit seines Mitbewohners nicht mehr akribisch zu katalogisieren. Anfangs war es schwierig gewesen; reflexartig dachte er immer wieder an Nico und wurde in dem gestört, was er eigentlich vorhatte. Manchmal, wenn seine Gedanken zu Nico wanderten, wanderte auch Gideon selbst zu ihm.
Schlussendlich ereilte dieses Schicksal jeden, der Nico de Varona kannte: Weder vergaß man ihn noch verließ man ihn. Von ihm getrennt zu sein war, als fehlte einem ein Arm. Man war nicht ganz vollständig, nie ganz, doch von Zeit zu Zeit lieferte der Phantomschmerz hilfreiche Informationen.
Gideon erlaubte sich, die Dinge zu spüren, die er sich (unter anderen Umständen) versagte, und als täten sie einen Seufzer der Erleichterung, erbebten die Traumreiche unter seinen Füßen. Der Albtraum verschwand langsam und gab Gideons eigene Träume frei, so dass er dem Pfad folgen konnte, der ihm der intuitivste war: seinem eigenen.
Der Rauch des Traums verzog sich, als Gideons Gedanken zu wandern begannen, und so fanden er und Max sich in der bewussten Wahrnehmung von Raum und Zeit wieder. Anstelle des Geruchs verbrannter Erde hing nun der Duft nach Mikrowellenpopcorn und Waschmittel in der Luft – die vorherrschenden Noten in einem NYUMA-Wohnheim.
Und dieser Geruch beschwor das Gesicht eines Teenagers herauf, den Gideon einst gekannt hatte.
»Ich bin Nico«, sagte der Junge mit dem wachen Blick und den verwuschelten Haaren, dessen T-Shirt vom Schultergurt seiner Reisetasche zusammengeknautscht wurde. »Du bist Gideon? Siehst ziemlich fertig aus«, fügte er hinzu, schob die Tasche unter das zweite Bett und sah sich im Raum um. »Wir hätten viel mehr Platz, wenn das ein Hochbett wäre.«
Handelte es sich um eine Erinnerung oder um einen Traum? Gideon Drake konnte es nicht sagen.
Er konnte auch nicht sagen, was Nico damals unbewusst mit der Luft in ihrem Zimmer gemacht hatte.
»Ich glaube nicht, dass wir die Möbel verrücken dürfen«, brachte Gideon leicht klaustrophobisch hervor. »Vielleicht können wir fragen?«
»Können wir, aber wenn wir fragen, sagen sie eventuell nein.« Nico hielt inne und warf ihm einen Blick zu. »Was ist das eigentlich für ein Akzent? Französisch?«
»So in die Richtung. Akadisch.«
»Also bist du aus Quebec?«
»Fast.«
Nicos Grinsen wurde noch breiter. »Super«, sagte er. »Ich wollte meinen linguistischen Horizont ohnehin erweitern. Ich denke zu viel auf Englisch, ich brauche Abwechslung. Traue niemals einer Dichotomie, sage ich immer. Aber, um beim Thema zu bleiben: Liegst du lieber oben oder unten?«
Gideon blinzelte. »Such du dir was aus«, murmelte er.
Nico fuhr mit der Hand durch die Luft und räumte das Zimmer in nur einem Atemzug so mühelos um, dass Gideon eine Sekunde später schon vergessen hatte, wie der Raum vorher ausgesehen hatte.
Im echten Leben hatte Gideon schnell gelernt, dass Nico dort Raum schaffte, wo es keinen gab. Wenn zu lange Stillstand herrschte, brachte Nico Bewegung in die Angelegenheit. Die Verwaltung der NYUMA hatte lediglich benötigt behindertengerechte Unterstützung in Gideons Akte vermerkt und es dabei belassen, doch so, wie Gideon seinen neuen Mitbewohner schon nach den ersten Augenblicken einschätzte, würde Nico wohl innerhalb kürzester Zeit die Wahrheit herausfinden.
»Wohin gehst du?«, hatte Nico gefragt und Gideons Befürchtungen damit bestätigt. »Wenn du schläfst, meine ich?«
Das war in der zweiten Unterrichtswoche, und Nico war aus dem oberen Bett herausgeklettert und hatte sich neben Gideon gestellt, der aus dem Schlaf hochschreckte. Gideon hatte nicht mal gemerkt, dass er eingeschlafen war.
»Ich habe Narkolepsie«, sagte er angespannt.
»Bullshit«, erwiderte Nico.
Gideon starrte ihn an und dachte: Ich kann es dir nicht sagen. Nicht, dass er davon ausging, dass Nico sich als Jäger herausstellte oder von Gideons Mutter ins Wohnheim eingeschleust worden war (obwohl beides durchaus im Bereich des Möglichen lag), doch sobald sie die Wahrheit kannten, behandelten die Leute ihn anders. Gideon hasste diesen Augenblick. Diesen Augenblick, in dem die anderen etwas herausfanden, das ihre Vermutung bestätigte, dass Gideon irgendwie abstoßend war. Es war Instinkt; Beute, die auf eine Bedrohung reagierte, Kampf oder Flucht.
Ich kann es niemandem sagen, hatte Gideon gedacht, aber dir schon gar nicht.
»Irgendwas an dir ist komisch«, fuhr Nico nüchtern fort. »Nicht schlecht-komisch, sondern nur … merkwürdig.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und dachte nach. »Was steckt dahinter?«
»Ich hab’s dir doch gesagt. Narkolepsie.«
Nico verdrehte die Augen. »Menteur.«
Lügner. Also wollte er wirklich Französisch lernen.
»Wie sagt man ’Halt die Klappe’ auf Spanisch?«, hatte Gideon gefragt, und Nico hatte ihn auf eine Art angelächelt, von der Gideon nun wusste, dass sie außergewöhnlich gefährlich war.
»Raus aus den Federn, Sandmann«, hatte Nico gesagt und Gideons Decke zurückgeschlagen. »Wir gehen aus.«
In der Gegenwart stupste Max mit seiner Schnauze gerade heftig genug gegen Gideons Knie, dass dieser vorwärtsstolperte. »Danke«, sagte er und schüttelte die Erinnerung ab. Das Zimmer verschwamm mit den in der Ferne brennenden Hügeln, und Max fixierte ihn erwartungsvoll.
»Nico ist in diese Richtung«, sagte Gideon und deutete auf eine Ansammlung rauchender Nadelbäume.
Sein vierbeiniger Begleiter sah ihn zweifelnd an.
Gideon seufzte. »Schön«, sagte er, beschwor einen Ball herauf und warf ihn in den Wald. »Such!«
Der Ball leuchtete auf, als er durch die Luft zischte, und tauchte die Bäume in ein schwaches, beruhigendes Licht. Max sah Gideon erneut genervt an, lief aber los und folgte dem Weg, den Gideons Magie geschaffen hatte.
In Träumen war jeder magisch begabt. Hier setzte nicht die Physik die Grenzen, sondern der Träumende. Gideon, ein Wesen, das dauernd zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein schwankte, vergaß, welche Grenzen in der Wirklichkeit für ihn galten. (Wenn einem nicht klar ist, wo das Unmögliche beginnt und wo es endet, dann kann es einen auch nicht beeinflussen.)
Ob Gideon einfach Magie hatte oder selbst Magie war, stand auf ewig zur Diskussion. Nico war sich sicher, dass Ersteres zutraf. Gideon selbst war nicht überzeugt. Im Unterricht konnte er kaum auch nur die einfachsten Zauber wirken, weshalb er sich hauptsächlich auf theoretische Studien zu Existenz und Anwendung von Magie beschränkte. Weil Nico ein Physiomagier war, sah er die Welt als eine pseudoanatomische Konstruktion, während Gideon sie eher als eine Datencloud verstand. Mehr waren die Traumreiche gar nicht, wenn man es runterbrach. Ein kollektiver Ort für die Erlebnisse der Menschheit.
Sie waren dem echten Nico jetzt näher gekommen, der brennende Wald blieb hinter ihnen zurück, und vor ihnen erstreckte sich ein schmaler, leerer Strand. Gideon beugte sich hinab, um mit den Fingern über den Sand zu fahren, und steckte dann probehalber einen Arm hinein. Hier brannte nichts, aber sein Arm verschwand sofort bis zur Schulter im Boden. Max stieß ein tiefes, warnendes Knurren aus.
Gideon zog den Arm aus dem Sand und kraulte den Labrador beruhigend am Kinn.
»Warum bleibst du nicht hier?«, schlug er vor. »Ich komm so in einer Stunde und hole dich ab.«
Max winselte leise.
»Jaja, ich pass schon auf. Du klingst mittlerweile echt wie Nico, weißt du?«
Max bellte.
»Okay, schon gut. Ich nehm’s zurück.«
Gideon verdrehte die Augen, kniete sich hin und steckte den Arm erneut in den Boden, lehnte sich vor, bis er nach vorn kippte, im Sand versank und auf die andere Seite glitt. Der Luftdruck änderte sich sofort, von niedrig zu hoch, und Gideon stolperte kopfüber in noch mehr Sand, fiel vom Himmel auf die weitläufigen Dünen einer Wüste.
Verstimmt spuckte er einen Mund voll Sand aus. Man konnte Gideon wohl kaum als Naturliebhaber bezeichnen; dafür hatte er zu viel von ihren weniger schönen Seiten gesehen. Gab es Schlimmeres als Sand? Auf jeden Fall. Aber dennoch; Gideon hielt es nicht für unangebracht, sich über Sand aufzuregen. Er spürte ihn überall, in den Ohren, zwischen den Zähnen, in den Haaren. Nicht ideal – doch auch kein Grund zur Verzweiflung.
Gideon wuchtete sich hoch und versuchte, knietief im Sand stehend das Gleichgewicht zu halten. Er ließ den Blick über die Dünen schweifen, kniff die Augen gegen den Wind zusammen, machte sich bereit. Wofür, wusste er nicht. Es war jedes Mal etwas anderes.
Ein Summen drang an sein rechtes Ohr, er wirbelte mit einem Schrei herum (oder versuchte es zumindest) und schlug blindlings in die Luft. Alles, nur keine Mücken!, dachte er – für Insekten hatte Gideon nichts übrig. Es summte erneut, er schlug wieder danach und spürte ein Piksen im Unterarm. Als er hinschaute, sah er, dass sich bereits eine Schwellung bildete und ein dicker Tropfen Blut aus der Einstichstelle quoll. Er hob den Arm, um besser sehen zu können, und als er darüberstrich, fegte er Bruchstücke einer Kugel und etwas Schießpulver von seiner Haut.
Also waren es keine Insekten.
Zu wissen, was ihm als Nächstes bevorstand, war meistens eine zweifelhafte Erleichterung, denn nun konnte und musste Gideon seine Verteidigung planen. Manchmal musste er rein taktisch vorgehen, um sich Zugang zu diesem bestimmten Unterbewusstsein zu verschaffen. Manchmal erwartete ihn ein Gefecht, manchmal ein Labyrinth. Gelegentlich musste er sich aus Räumen herausarbeiten, vor etwas fliehen oder gegen etwas kämpfen. Das war ihm lieber, denn er war (bisher) allgemein recht gut darin, dem Tod und seinen Reitern aus dem Weg zu gehen. Dann wieder ging es nur um schweißtreibende Anstrengung, um simples, aber auslaugendes Durchhalten. In Träumen konnte Gideon nicht sterben – das konnte niemand –, doch leiden konnte er. Er spürte Angst und Schmerz. Manchmal ging es bei diesem Test nur darum, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten.
Und dieser Traum gehörte leider in die Kategorie.
Welche Projektile auch immer auf Gideon abgefeuert wurden, sie waren zu klein, um ihnen auszuweichen, und zu schnell, um sie zu bekämpfen – vermutlich handelte es sich nicht um irdische Waffen, die von Menschen bedient werden konnten. Gideon nahm die Schüsse wie unvermeidliche Stiche hin und stürzte sich mit gegen den Sand geschlossenen Augen in den Wind. Die Körner drangen in seine offenen Wunden ein, und Blut lief ihm die Arme hinunter. Durch zusammengekniffene Augen sah er verschwommen die grellroten Spuren, die es hinterließ. Harmlos, aber nicht schön. Wie die Tränenspuren auf den Steingesichtern von Märtyrer- oder Heiligenstatuen.
Welcher Telepath auch immer diese Schutzzauber hochgezogen hatte, war zweifelsohne ein Sadist der übelsten, unangenehmsten Sorte.
Etwas stach Gideon in den Hals, drang in seine Kehle ein, und sofort bekam er Atemnot. Um Luft ringend presste er sich die Hand auf die Wunde und spornte seine Selbstheilungskräfte an. Träume waren nicht real, seine Verletzung war nicht real – nur seine Not war real, das würde er jederzeit zugeben. Das würde er immer zugeben, immer, denn tief in seinem Innersten wusste er, dass sie gerechtfertigt war. Dass sie nicht nur gerecht, sondern verdient war.
Der Wind frischte auf, und Sand blieb an seinen Wimpern und Lippen kleben, legte sich auf den Schweiß, der seinen Nacken hinabrann, und Gideon entwich vor Schmerz ein wilder Schrei, ein Schrei des Nachgebens, des Loslassens. Er schrie und schrie und suchte irgendwo in seinem Schmerz nach der Kapitulation, nach dem Passwort. Der richtigen Botschaft. Etwas in Richtung: Eher sterbe ich, als dass ich aufgebe, aber alles innerhalb deiner Schutzzauber ist vor mir sicher.
Ich bin nur ein Mann mit Schmerzen. Ein Sterblicher mit einer Botschaft.
Es musste funktioniert haben, denn als Gideon die Luft ausging, als seine Lungen vor Anstrengung und Flehen ihren Dienst versagten, brach der Boden unter ihm weg. Mit einem schmatzenden Sauggeräusch fand er sich plötzlich in einem glücklicherweise leeren Raum wieder.
»Oh, gut, da bist du ja«, sagte Nico mit spürbarer Erleichterung, richtete sich auf und trat an das Gitter der telepathischen Schutzzauber, die sie voneinander trennten. »Ich glaube, ich hab von einem Strand oder so geträumt.«
Instinktiv blickte Gideon hinunter zu seinen Armen, suchte nach Spuren von Blut oder Sand, holte prüfend Luft. Alles schien in Ordnung zu sein, also hatte er es zum einhundertundachtzehnten Mal durch die Schutzzauber der Alexandrinischen Gesellschaft geschafft.
Jedes Mal war schlimmer als das Mal zuvor. Und doch war es die Mühen jedes Mal wert.
Nico lächelte, als er sich mit seiner üblichen Überheblichkeit gegen die Gitterstäbe lehnte. »Du siehst gut aus«, bemerkte er spielerisch. »Wie immer gut ausgeruht.«
Gideon verdrehte die Augen.
»Da bin ich«, erwiderte er. Und dann, weil er deswegen hergekommen war, sagte er: »Und ich glaube, ich habe Libby schon fast gefunden.«
Das Paradoxon
Wenn man Macht haben kann, muss man sie auch besitzen können. Macht hat weder eine bestimmte Größe noch ein exaktes Gewicht. Macht geht gegen unendlich. Sie verhält sich wie eine Parabel. Gehen wir mal davon aus, dass man Macht erhält. Dadurch steigt die Fähigkeit, mehr Macht anzusammeln. Die Kapazität für Macht steigt exponentiell zu der Macht, die man bereits hat. Deshalb bedeutet wachsende Macht gleichzeitig wachsende Machtlosigkeit gegenüber dieser Macht.
Wenn man umso weniger Macht hat, je mehr man davon hat, besitzt man dann die Macht, oder wird man von ihr besessen?
IVerwirrung
Libby
In dem Moment, in dem Ezra sie zurückließ, wurden ihr zwei Dinge klar.
Erstens: Das Zimmer mit dem schmalen, ordentlich gemachten Bett, der akkurat gefalteten Kleidung und dem Vorrat an abgepacktem Essen war dafür gedacht, dass jemand Monate oder sogar Jahre darin verbrachte.
Zweitens: Libby Rhodes selbst sollte die Bewohnerin dieses Zimmers sein.
Ezra
Sie würde ihm vergeben, dachte Ezra.
Und selbst wenn nicht, war die Alternative immer noch Atlas Blakelys herbeigeführter Weltuntergang.
Also bat er am besten gar nicht erst um Vergebung.
IIDie Auserwählten
Reina
Gestern
Vor fast exakt einem Jahr hatten die sechs das Herrenhaus der Alexandrinischen Gesellschaft erstmals betreten. Macht war ihnen versprochen worden, nicht mehr und nicht weniger. Das gesamte Wissen der Welt unter einem Dach. Zugang zu den größten Geheimnissen des Universums. Und zur Krönung des Ganzen: ein Leben voller Ruhm.
Dafür mussten sie nichts weiter tun, als ein einziges Jahr zu überleben, bis zu ihrer Initiation.
All das vereinte sie – genau wie das zurückliegende Jahr, das sie alle grundlegend verändert hatte –, und so stand dort, wo einst sechs gestanden hatten, jetzt unwiederbringlich einer.
Oder irgendwie so.
Reina warf einen Blick in die Runde und fragte sich, wie lange diese Einheit wohl währen würde. Wahrscheinlich nicht mal eine Stunde. Schon jetzt veränderte sich die Energie im Raum, als Atlas Blakely, ihr sogenannter Kurator, leise in den Freskensaal trat und sie schweigend betrachtete.
Neben Reina zappelte Nico wie üblich herum, ließ den Blick zu Atlas und wieder weg huschen. Schräg hinter ihnen stand Tristan Caine in grüblerischem Schweigen. Parisa Kamalis Gesichtszüge blieben beim Anblick des Kurators unbeweglich, während Callum Nova hinter Parisa den Neuankömmling völlig ignorierte. Callum stand ein wenig entfernt von der Gruppe und zog eine gedankenverlorene Miene.
»Betrachten Sie das, was jetzt auf Sie zukommt, als eine Art Spiel«, schlug Dalton Ellery ihnen vor. Der bebrillte Forscher machte den Hauptansager des Initiationsrituals. Nach einem kurzen Begrüßungsnicken Richtung Atlas sprach er weiter zu den fünfen. Erwartungsvoll standen sie vor dem riesigen Bücherregal, während Dalton ihre Aufmerksamkeit in die Mitte des Raumes lenkte.
Abgesehen von dem Regal und einigen Stühlen waren die Möbel aus dem Freskensaal geräumt worden. Die fünf Stühle, jeweils einige Meter voneinander entfernt, bildeten einen großzügigen Kreis.
Inzwischen war der Verlust ihrer sechsten Kommilitonin nicht mehr frisch; bemerkbar machte er sich dennoch. Wie eine alte Narbe, die sie bei Regen plagte, schien das nervöse Grundrauschen von Libby Rhodes in den Lücken zwischen den fünf Kandidaten umherzugeistern, unausgesprochen, greifbar nur in den Versprechen, die sie einander gegeben hatten. Irgendwo unter den Bodendielen schwelte Libbys Abwesenheit.
»Bis hierher sind Sie gekommen«, fuhr Dalton fort und trat in den leeren Stuhlkreis, »und von nun an werden Sie nicht mehr auf die Probe gestellt. Hier gibt es kein Bestehen oder Durchfallen. Dennoch fühlen wir uns moralisch zu der Warnung verpflichtet, dass Sie im Laufe dieser Zeremonie zwar keinerlei körperliche Schäden erleiden, dennoch aber durchaus unangenehmen Situationen ausgesetzt sein können. Sterben werden Sie nicht«, schloss er. »Doch davon abgesehen ist der Ausgang völlig ungewiss.«
Neben Reina lehnte Nico sich misstrauisch gegen das Regal. Tristan kreuzte die Arme fester vor der Brust, und Parisa warf einen Seitenblick zu Atlas, der immer noch an der Tür stand. Sein Gesichtsausdruck verriet nichts.
Oder vielleicht doch. Eventuell bildete Reina es sich nur ein, aber sein üblicher Ausdruck gleichgültiger Wachsamkeit wirkte noch marmorner als sonst. Versteinert, als behielte er sich sorgsam im Griff.
»Völlig ungewiss?« Callum, wer sonst, sprach als Einziger die Skepsis laut aus, die sie alle verspürten. »Wir werden also nicht sterben, könnten aber möglicherweise als ungeheure Kakerlake aufwachen?«
(»Ungeziefer«, murmelte Reina, was Callum ignorierte.)
»Bisher ist das nicht vorgekommen«, sagte Dalton, »aber technisch unmöglich ist es auch nicht.«
Unter den Kandidaten rumorte es leicht. Nico, der den drohenden Streit spürte, warf Reina einen kurzen Blick zu. »Nach der Initiation erweitert sich unser Zugang zum Archiv, stimmt’s? Und ganz offensichtlich haben wir alle schon so einige Entscheidungen getroffen, um bis hierher zu kommen.« Behutsam richtete Nico seine Äußerungen an den unbestimmten Raum statt an irgendjemanden im Besonderen, wandte sich dann allerdings kurz Atlas zu und schließlich Dalton. »Die Einschüchterungstaktik muss jetzt wirklich nicht mehr sein, oder?«
»Es ist eigentlich eher eine Art Haftungsausschluss«, sagte Dalton. »Haben Sie noch weitere Fragen?«
Allerdings, so einige – doch Dalton gehörte nicht zur mitteilsamen Sorte. Reina blickte kurz zu Parisa, die als Einzige wissen würde, ob Misstrauen angebracht war. Sie wirkte nicht besorgt. Reina war zwar selbst von Natur aus nicht ängstlich, wollte sich aber auch nicht unnütz mit Bedenken herumschlagen, solange Parisa keinen Grund zur Sorge sah.
»Um an der Initiationszeremonie teilzunehmen, müssen Sie diese Ebene verlassen«, fuhr Dalton fort. »Die Rahmenbedingungen für Ihren Übergang schaffen wir.«
»Das passiert alles in unseren Köpfen?«, fragte Tristan schroff.
Ein Hauch von Unbehagen zeigte sich auf Nicos Gesicht; nachdem sie Parisa von Callums Hand hatten sterben sehen, versetzte die Aussicht auf telepathische Fälschungen sie alle – außer Parisa, ironischerweise – in Unruhe.
Dalton hielt inne. »Nein«, sagte er, »und ja, definitiv.«
»Ach, super«, raunte Nico in Reinas Richtung. »Der Kerl ist so hilfreich wie ein Löffel bei ’ner Messerstecherei.«
Bevor Reina zu einer Erwiderung ansetzen konnte, sagte Parisa misstrauisch: »Was genau machen wir denn dann auf der Astralebene der Geheimgesellschaft? Und nein, das verschafft mir keinerlei Vorteil.« Sie blickte ungeduldig in die Runde. »Wenn es Rahmenbedingungen gibt, dann bin auch ich daran gebunden«, sagte sie schließlich zu Reina, der bestimmt nicht als Einziger dieser Verdacht gekommen war. »Nur weil sich das Ganze auf meinem Fachgebiet abspielt, habe ich noch lange keinen nennenswerten Vorsprung.«
Reina wandte den Blick ab. Empfindlich heute, dachte sie in Parisas Richtung.
Parisa nahm eine steife Haltung an. Ich habe eben keine Lust auf Unterstellungen.
Seit wann kümmert es dich, was ich denke?
Parisa reagierte nicht. Am anderen Ende des Raumes fing ein kleiner Feigenbaum an zu kichern.
Dalton räusperte sich. »Der Ablauf Ihrer Initiation ist kein Geheimnis …«
»Wie reizend«, brummte Tristan. »Mal was Neues.«
»… es handelt sich ganz einfach um eine Simulation«, beendete Dalton seinen Satz. »Innerhalb dieser Simulation werden Sie dem projizierten Abbild eines anderen Mitglieds Ihrer Klasse begegnen. Nicht in dessen wahrer Natur, sondern so, wie Sie es wahrnehmen.«
Er betrachtete ihre Gesichter. Ihre Mienen reichten von betonter Gleichgültigkeit (Callum) zu resignierter Ratlosigkeit (Nico). Falls irgendwer sich in die Ecke gedrängt fühlte, ließ er oder sie es sich nicht anmerken. Atlas an der Tür kratzte sich kurz am Kinn. Und – über die folgende Beobachtung wunderte Reina sich selbst – sein Anzug wirkte noch makelloser als sonst. Fast zu Tode gebügelt, als hätte Atlas geahnt, dass man darauf achten würde. Vielleicht wirkte es auch nur so.
»Dies wird kein Test Ihrer bisherigen Lernerfolge«, fuhr Dalton fort. »Es ist überhaupt kein Test – nur eine reine Formalität. Im letzten Jahr haben Sie sich mit den Themen beschäftigt, die wir Ihnen vorgegeben haben. Bald haben Sie die Erlaubnis, das Archiv eigenverantwortlich zu befragen, wohin auch immer Ihre Studien Sie führen.« Reina lief ein Schauer der Vorfreude über den Rücken. »Als initiierte Mitglieder der Geheimgesellschaft stehen Ihnen die Inhalte des Archivs nach Belieben zur Verfügung. Ebenso dürfen Sie nach eigenem Ermessen zum Archiv beitragen, bis Ihre Verpflichtungen erfüllt sind und Ihre Zeit hier endet. Sie haben sich Ihren Platz in diesem Haus verdient, aber jede Brücke hat zwei Seiten. Überschreiten Sie sie.«
Er zog eine Mappe aus der leeren Luft, als hätte sie ihm jemand zugeworfen.
»Wir fangen beim Jüngsten an. Mr. de Varona beginnt also.« Dalton hob den Blick, und Nico nickte. Klar, dass Nico am liebsten der Erste war. So tickte er eben, immer kopfüber hinein. Ohne Libby als Gegengewicht glich nichts seinen Leichtsinn mehr aus. Der Anker fehlte.
Doch Nico war nicht als Einziger leicht aus der Spur geraten. Ohne Libby Rhodes waren sie alle nicht mehr dieselben. Ohne dass die anderen es merkten, hatte Libby sich als »Aber« ihres kollektiven Gewissens etabliert, als moralischer Kompass. Aber was, wenn dies oder jenes passiert; was, wenn etwas schiefgeht; was, wenn jemand verletzt wird? Dass sie aus der Struktur der Gruppe entfernt worden war, veränderte die gesamte Zusammensetzung, wie eine unbemerkte Infektion. Natürlich konnten sie ohne Libby weitermachen, doch ihr Verlust würde mit der Zeit immer schwerere Folgen zeitigen. Innere Blutungen, eine vergiftete Niere. Ein winziges Loch in einer ansonsten völlig intakten Lunge.
Ein geplagter Farn seufzte UnheilUnheilUnheil, nur für Reinas Ohren. Offen gestanden legte sie keinen Wert auf diesen Exklusiv-Kommentar.
»Na schön.« Nico trat einen Schritt auf Dalton zu. »Wo muss ich hin?«
»Nirgends. Setzen Sie sich.« Dalton deutete auf den Stuhl, der ungefähr bei zwölf Uhr stand. »Sie alle«, erklärte Dalton, »setzen sich dem Alter nach hin.«
Sie nahmen Platz. Rechts neben Reina saß Tristan, dann Callum, dann Parisa. Nico schloss den Kreis zu Reinas Linken.
Einen kurzen Moment lang herrschte Stille, als rechneten sie mit allem Möglichen – dass gleich etwas von der Decke krachte oder vom Boden heraufschwebte. Nichts dergleichen geschah. Die Pflanzen in ihren Töpfen raschelten und gähnten, Atlas setzte sich in den Schatten des Bücherregals, wo Reina ihn nicht mehr sah, und Dalton stellte sich hinter Nico, in der Hand ein Klemmbrett.
Nico, der mal wieder nicht still sitzen konnte, sah erst zu Reina, dann kurz über die Schulter nach hinten. »Was genau soll ich …«
»Los«, sagte Dalton.
Nicos Kopf fuhr wieder herum – als hätte er einen Schlag erhalten, oder als wäre ein Schalter umgelegt worden –, und sein Bewusstsein glitt aus ihm heraus. Ein statisches Knistern lag in der Luft, Magie vielleicht oder pures Leben oder eine von Nicos eigenen Wellen. Die unheimliche Energie verpasste allen eine Gänsehaut, stellte ihnen die Härchen an Armen und im Nacken auf.
Innerhalb weniger Sekunden ließ das Gefühl ungebändigter Elektrizität nach und kondensierte erst zu einem dünnen Nebel, dann zu einer Wolke. Und dann, mit einem Peitschenknall, stieg ein geisterhaftes Ebenbild von Nico in der Kreismitte auf. Seine eigene Version des Freskensaals überdeckte den realen Raum, er stand inmitten einer Projektion der üblichen Einrichtung: der Tisch neben dem Bücherregal, das Sofa vor dem Kamin. Er schien die anderen, die um ihn herum saßen, nicht sehen zu können. In seiner Projektion war es Mittag, die Sonne knallte durch die Fenster herein. Die Vorhänge waren beiseite gezogen, der Himmel klar, ein heller Kontrast zu der feuchten Sommerschwüle ihrer Realität.
Aus dem Augenwinkel sah Reina, wie Tristan die Ellenbogen auf die Knien stützte und ein Gesicht zog, als widere ihn das alles an. »Wir sollen uns gegenseitig bei unserem Ritual zusehen?«
»Ja«, sagte Dalton, und in dem Moment materialisierte sich eine geisterhafte Reina vor dem projizierten Nico. Der grinste.
»Hervorragend.« Mit einer Handbewegung wedelte er das Mobiliar des irrealen Freskensaals beiseite. Wie immer, wenn Nico Magie wirkte, waren die Einzelheiten kaum zu erkennen. Von einem Moment auf den nächsten standen die Möbel einfach aufgereiht an der Wand. Als hätten sie sich schon immer dort befunden.
Das magische Hologramm von Nico streckte der falschen Reina die Faust hin. Der übliche Auftakt eines Trainingskampfes. Selbst jetzt noch, nach einem Jahr der Hobbyprügeleien, begannen sie jedes Match mit diesem Ritual.
Hinter den durchscheinenden Wänden der Freskensaal-Projektion verdrehte Parisa die Augen.
Was?, fragte Reina.
Parisas Blick glitt zu ihr. Würde ich mir euren Kinderkram unbedingt ansehen wollen, hätte ich das schon längst erledigt.
Doch noch bevor Parisa ihren Gedanken beendet hatte, machte die falsche Reina einen Satz. Im letzten Moment legte Nico den Kopf schräg, drehte sich zur Seite und ließ eine Gerade fliegen, um seine Reichweite zu testen. Die echte Reina hätte das kommen sehen (und vermutlich dasselbe getan), aber die falsche wich dem Hieb aus, als läge echte Wucht dahinter. Sie ließ ihre Deckung tief genug sinken, dass Nico ihr einen kleinen Klaps auf die Wange geben konnte; eine Mahnung, leichtfüßig zu bleiben.
Holo-Reina ließ ein paar kurze Gerade hageln; eins, zwei, dann drei, dann vier, die Nico mit der Rechten abwehrte; dann fing er ihren Unterarm ein. Reina fiel einen Schritt nach vorn, verlor das Gleichgewicht, und Nico nutzte ihre niedrigere Position, um mit einem Haken auf ihre Schläfe zu zielen. Sie blockte schnell mit dem Unterarm, statt darunter wegzutauchen – keine gute Entscheidung, dachte Reina und verzog das Gesicht. Ihr falsches Ich konnte den Großteil des Schlags abwehren, doch es lag immer noch genug Kraft darin.
Der falsche Nico und die falsche Reina umkreisten einander, testeten aus, wie sicher sie standen. Nico arbeitete sich in ihre Reichweite hinein, dann wirbelte er aus ihrem kurzen Haken heraus, als Holo-Reina den Köder schluckte. Als Nächstes versetzte er ihr einen kleinen Hieb in die Nierengegend und glitt geschickt wieder zurück. Sie antwortete mit einem blinden Schwinger zu seinem Kopf und erwischte ihn gerade so am Ohr. Er lachte. Die falsche Reina lachte nicht.
Plötzlich setzte Parisa sich auf und runzelte die Stirn.
Jetzt interessierst du dich auf einmal für Nahkampfstrategien?, höhnte Reina in ihre Richtung. Von ihrem Sitzplatz aus konnte sie Atlas zwar nicht sehen, doch sie hatte das Gefühl, dass auch ihm Parisas Reaktion aufgefallen war.
Parisa warf ihr einen genervten Blick zu. Ich bitte dich. Nahkampf ist hier überhaupt nicht das Thema. Wie immer entgeht dir der eigentliche Punkt.
Welcher Punkt? Die ganze Angelegenheit war so überaus witzlos. Exakt dasselbe Szenario konnte Reina sich jederzeit im wahren Leben angucken – worauf sie allerdings lieber verzichtete. Es war unangenehm, sich selbst beim Kämpfen zu beobachten und ihre ganze Unzulänglichkeit mitansehen zu müssen. Als Zuschauerin erschienen ihre Fehler ihr noch deutlicher. Nico bewegte sich flüssig, ganz natürlich. Sein Rhythmus, seine Bewegungen im Raum waren immer federleicht, kein bisschen steif. Er befand sich nie lange an derselben Stelle. Reina dagegen wirkte schwerfällig und unbeweglich, ein Felsbrocken, der von Nicos steten Angriffswellen unaufhaltsam abgetragen wurde. Immer wieder wandte die echte Reina sich von der Projektion ab – und bemerkte, dass Parisas Blick umso gebannter an ihrer falschen Gestalt hing.
Was genau interessiert dich daran so?, fragte Reina mürrisch, und Parisa sah sie mindestens ebenso genervt durch die Simulation hindurch an.
Kapierst du’s nicht? Diese Projektion zeigt dir, wie er dich sieht, sagte Parisa in Reinas Kopf.
Sie schien einen Blick zu Atlas zu werfen, kurz und nichtssagend. Doch Parisas Hauptaugenmerk galt der falschen Reina, nicht Atlas – und das war eigentlich das Besorgniserregendste im ganzen Freskensaal. In Parisas Fokus zu stehen verhieß nichts Gutes. (Der Feigenbaum war auch dieser Ansicht.)
Na und?, dachte Reina.
Und erstens, niemand hat uns verboten, Magie zu wirken, aber Nico macht’s nicht – genauso wenig wie seine Version von dir. Ein kleines Lächeln auf Parisas Lippen. Und zweitens, vielleicht hast du es ja selbst schon gemerkt, aber er scheint dich nicht im Mindesten gefährlich zu finden, oder?
Wieder: Na und?
Ein Jahr lang hatten wir alle den Auftrag, jemanden umzubringen. Erst vor kurzem haben wir festgelegt, wer das sein könnte. Parisa deutete mit einem Blick auf Nicos tänzelnden Klon. Sieht der vielleicht aus, als hätte er auch nur ansatzweise Angst vor dir?
Die falsche Reina geriet ins Straucheln und tappte in eine von Nicos üblichen Fallen: eine Gerade, die sie ablenkte, so dass sie den Haken von außen übersah. Dann ließ er einen harten rechten Cross und einen Aufwärtshaken kommen. Letzteren schaffte sie nicht mehr zu blocken. Lauter Fehler, lauter Reina-Fehler. Sie unterliefen ihr nicht zum ersten Mal.
Ah, jetzt siehst du’s selbst, stellte Parisa mit irritierender Befriedigung fest, und obwohl Reina sich gegen die Kommentare in ihrem Gehirn verschloss, drang Parisas Häme hindurch wie weißes Rauschen.
Er hält dich für wehrlos.
Und dann, noch verächtlicher …
Er hält dich für schwach.
Verärgert wischte Reina jeglichen Gedanken beiseite und spulte stattdessen zur Strafe den Ohrwurm einer Zahnpasta-Werbung aus ihrer Kindheit ab. Parisas Lächeln verzog sich zu einer Grimasse – Punkt für dich, blöde Kuh – dann wandte sie sich ab, um irgendwen anders einer Psychoanalyse zu unterziehen. Die falsche Reina bekam einen rechten Cross von Nico ab und verpasste ihm im Gegenzug einen gesalzenen Doppeljab, den er allerdings mit einer Kombination aus Hieben konterte, die sie nicht schnell genug abwehren konnte. Reina – die echte Reina, die immer schlechtere Laune bekam – verzog keine Miene, denn Parisa war nicht die Einzige, die sie beobachtete. Auch Callums Blick glitt immer wieder herüber und ruhte einen verstörenden Moment lang auf ihr.
Reina spürte ihren Gefühlen nach. Normalerweise befasste sie sich nicht mit solchen Dingen. Sie hielt sich für eine Person, die nicht besonders viel empfand. (Genervt, gereizt, ungeduldig – das zählte nicht. Das waren Mückensticke auf der emotionalen Richterskala.) Trotzdem spürte selbst sie, wenn auch nur vage, dass sie mit irgendeiner Empfindung kämpfte. Es war nicht Angst oder Furcht … und ganz sicher nicht Verrat, denn auch wenn Parisa glaubte, die gesamte Menschheit bis ins Detail zu durchschauen, lag sie damit definitiv falsch.
Allerdings, typisch Parisa, lag sie nicht falsch genug. Reina, die im Gegensatz zu gewissen Personen (Libby) nicht jedem Windhauch ihrer eigenen Unsicherheiten ausgeliefert war, wusste ja, dass Nico sie nicht wirklich für schwach hielt. In Nicos Vorstellung – ein bekanntermaßen gesetzloser und unaufgeräumter Ort – gab es keinen einzigen Menschen, der sich ihm entgegenstellen und ihn aktiv vernichten wollte. Das war sowohl das Charmante als auch das Bescheuerte an ihm: Selbstvertrauen traf auf Arroganz. Wer ihm das zum Vorwurf machte, hatte sein Wesen nicht begriffen. Wenn Reina sich seine Arroganz zu Herzen nahm, machte sie sich nur emotional verletzlich. Zeitverschwendung für alle beide.
Dennoch – durch Nicos Augen betrachtet wirkte Reina … berechenbar. Knapp unterlegen. Gut, aber nicht gut genug. Zugegeben, in gewissen Bereichen traf das durchaus zu, sowohl im Nahkampf als auch in der Magie. Etwas anderes hatte Reina nie behauptet. Bei der Geheimgesellschaft war es ihr immer um Zugangschancen gegangen, nicht um Stärke.
Hatte sie bedacht, dass die anderen sie wegen ihrer Halbherzigkeit für unfähig halten könnten? Ja, hatte sie. Aber bei Tristan, Callum oder Parisa wäre ihr das egal. Vor denen hatte Reina ihr Innenleben erfolgreich verborgen. Auch Nico hatte sie nichts von sich offenbart – nicht so richtig –, doch er hatte sehr viel mehr Zeit mit ihr verbracht als die anderen. Hatte er denn gar nicht aufgepasst?
In dem Moment spie Reinas Verstand ungebeten eine alte Erinnerung aus. Tee mit ihrer Großmutter, nach einem besonders frustrierenden Abendessen bei ihrer Mutter. Eines Tages werden sie es sehen, hatte Baba mit ihrer sanften Milde gesagt, aus der bald Vergesslichkeit geworden war, und dann eine geistesabwesende Wolkigkeit, die manchmal in Kontakt mit der Realität stand, manchmal nicht. Eines Tages werden sie dich angucken und alles sehen, was ich sehe.
MutterMutter?, fragte der Farn in der Ecke zweifelnd.
Unwillig bejahte Reina die Frage.
Reinas Mutter, an die Reina so gut wie nie dachte und von der sie erst recht nie sprach, war die mittlere von drei Töchtern und zwei Söhnen gewesen. (Ein richtiges Rabaukenkind, hatte Reinas Großmutter immer liebevoll gesagt, als würde sie auf ein unterhaltsames, aber unrealistisches Drama blicken und nicht auf das Leben ihrer eigenen Tochter.) Baba, eine exzentrische Frau mit übertriebenem Hang zur Güte, hatte nicht gewollt, dass ein einzelner Fehltritt das gesamte Leben ihrer Tochter zerstörte. Also hatte sie Reina großzügig bei sich aufgenommen. Innerhalb von ein oder zwei Jahren wurde Reinas Mutter erfolgreich an einen nichtmagischen Geschäftsmann verheiratet, dessen Familie von dem Elektronikboom kurz vor dem medäischen Technomagie-Zeitalter profitiert hatte. Er war nicht Reinas Vater, sondern der Mann, der nach ihrer Geburt ihre Mutter geheiratet hatte. Dass Reina im Haus seiner Schwiegermutter lebte, wusste er nur, weil er viele Fragen über sie stellte. Zunächst hatte er geglaubt, sie wäre das Kind einer Angestellten, vielleicht der Haushälterin, und damit letztlich seiner Macht unterworfen. Reina fragte sich oft, wie viele Gespräche ihre Mutter deswegen wohl hatte führen müssen. (Oder vielleicht waren gar keine Worte gefallen. Reinas Mutter redete nicht viel. Sie machte den Anschein, als habe sie viel im Leben gesehen und irgendwann einfach die Augen davor verschlossen.)
Jedenfalls konnte der Geschäftsmann nicht über Reinas wahre Herkunft unterrichtet worden sein, denn er zitierte sie jeden Monat zum Abendessen heran. Inzwischen gab es andere Kinder am Tisch – seine eigenen –, die genau wie ihr Vater über keinerlei magischen Mächte verfügten. Er war nicht unfreundlich. Zwar hing er beim Abendessen ständig am Handy, aber er schrie nicht herum. Er war bloß sehr, sehr durchschaubar. Während er bei diesen Mahlzeiten Reinas elegante Kanji oder ihre guten Schulnoten lobte, bevor er zum Thema Naturmagie überging, schob Reinas Mutter das Essen auf ihrem Teller umher und sagte wie üblich gar nichts.
Dann starb Reinas Mutter, zwei Jahre vor ihrer Großmutter, als Reina vierzehn war. Bei ihrer Beerdigung wurde sie als pflichtgetreue Ehefrau und Mutter beschrieben. (Nicht als Reinas Mutter, versteht sich. Reina saß unauffällig in der letzten Reihe, und niemand fragte, zu wem sie gehörte.) Reina hatte ihre Mutter nicht sehr gut gekannt, doch in ihren Ohren klang diese Grabrede nach einem sehr traurigen Ende der Geschichte – offenbar konnte über das unscheinbare Leben ihrer Mutter nicht mehr gesagt werden, als dass sie ihre zwei Verpflichtungen vorbildlich ausgeführt hatte. Keine Bemerkung darüber, ob sie schief unter der Dusche gesungen oder Angst vor Schlangen hatte, oder über sonst irgendetwas, das ihr Kontur verliehen hätte.
Wenige Monate nach ihrem Tod verheiratete sich der Geschäftsmann erneut. Das Leben ging weiter wie gewohnt.
Diese Erinnerungen fühlten sich an wie Treibsand. Sie führten tiefer und tiefer, ohne Ausweg. Schon hing Reina in der nächsten unerfreulichen Szene fest, und ein Schauder des Widerwillens überlief sie.
Kurz vor Atlas Blakelys Stippvisite war der Geschäftsmann zufällig in Reinas Café vorbeigekommen. Er ärgerte sich gerade über irgendetwas, motzte ins Telefon. War so abgelenkt, dass er Reina einfach nicht erkannte. Zugegeben, sie hatten einander über zehn Jahre lang nicht gesehen, doch die Ironie daran entging ihr nicht. Über Jahre hinweg hatte er ihr einmal im Monat am Tisch ihrer Mutter gegenübergesessen und höchstes Interesse an ihr geheuchelt; vor nur wenigen Wochen hatte er ihre frühere Mitbewohnerin aufgespürt und nach Reinas Telefonnummer gefragt, die die Mitbewohnerin eine Stunde und ein neues Handy später gar nicht mehr besaß. Doch nun war er zu sehr damit beschäftigt, über irgendwen zu schimpfen, einen Ausländer, dessen Name ihm nur mühsam von der Zunge rollte. »Er hat es schon einmal getan, er kann es wieder tun!«, rief der Geschäftsmann und sah einfach durch Reina hindurch, die ihm gerade seinen Kaffee reichte. In diesem Moment war sie mehr als unsichtbar. Nämlich handlungsfähig, aber durchsichtig. Ein bitterer Triumph, eine unschöne Bestätigung dessen, was sie schon immer vermutet hatte.
Reina hatte gewusst, dass sein Interesse an ihr einem Hintergedanken entsprang. Mit Sicherheit vermisste er nicht ihr freundliches Wesen oder ihre hübsche Handschrift. Deswegen hatten auch die Lilien auf dem Tisch ihrer Mutter sich immer von ihm abgewendet, während er aß. Früher war Reina davon ausgegangen, dass die Pflanzen nur Reinas eigene Abneigung ihm gegenüber spiegelten, doch an diesem Tag im Café hatte er etwas an sich, das sie nachdenklich machte.
Es klebte richtiggehend an ihm.
Zerstörung. Im Rückblick war es ganz eindeutig, wie ein dünner Film auf der Linse, durch die sie ihre Kindheitserinnerungen betrachtete. Ein offensichtlicher Sepia-Ton, feine Sprenkel auf seinen Schultern, wie Schuppen oder Fussel. Sie wusste, dass er üblere Geschäfte führte als die gesteigerten Ernteerträge, derentwegen andere Leute es auf Reina abgesehen hatten. Reichtum wie seiner kam schließlich nicht von ungefähr. Das zerstörerische Wesen seiner Geschäfte umgab ihn wie ein schlechtes Parfüm.
Mit einem Schütteln befreite sie sich von der Spirale aus Scham, in die ihre Erinnerungen sie jedes Mal unweigerlich hinabsogen. Ihre Großmutter hatte ja gesagt, dass jemand Reina eines Tages sehen würde, und das stimmte wohl irgendwie, wenn es auch anders gemeint gewesen war. Irgendwann sahen die Leute hin. Der Geschäftsmann war lediglich der Erste. Im Grunde war die Aufmerksamkeit unvermeidlich, weil Reina – oder Reinas Gabe – ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr ignoriert werden konnte, ob die Leute nun bewusst hinschauten oder nicht. Aber inzwischen wollte Reina gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Ihre Magie war nicht einfach nur sehr stark für eine Naturalistin – Reina war die Naturmagie in Person. Allein das machte sie wertvoll, oder zumindest nützlich. Aber warum musste sie überhaupt erst irgendwen von ihrem Nutzen überzeugen? Sie hatte nicht darum gebeten, unter diesen Umständen auf die Welt zu kommen. Sie hatte auch nicht um ihre magischen Kräfte gebeten. Wenn ihre sogenannte Familie sie nicht akzeptieren, geschweige denn lieben wollte, dann durfte sie auch nicht die Früchte von Reinas Wesen ernten. Das hatte Reina sich zumindest jeden Monat gesagt, wenn sie dem Geschäftsmann beim Abendessen gegenübersaß.
Mit der Zeit fiel es ihr leichter, Distanz zu anderen Menschen zu wahren, ihren Blicken auszuweichen. Sie entwickelte ein besonderes Geschick dafür, sich abzukapseln. Sie musste ihre Fähigkeiten nicht zur Schau stellen, musste ihren Wert nicht unter Beweis stellen. Sie wusste genau, dass ihre Großmutter recht behalten würde: Die anderen würden sie sehen. Genauer gesagt: Sie würden die Macht sehen. Die Möglichkeiten. Ungezügelte Naturmagie, von nie dagewesener Wucht. Sobald Reina sich selbst als Objekt wahrnahm – ein Werkzeug, mit dem andere ihre Profite steigern wollten –, achtete sie sorgfältig darauf, sich abzugrenzen, zu verstecken, zu schützen. Sie blieb nie lange da, wo andere sie sehen konnten, weil es immer darin endete, dass sie aus Gier zum Objekt gemacht wurde.
Außer bei Nico. Nico, mit dem Reina so viel Zeit verbrachte wie mit niemandem sonst, von dem sie glaubte, dass er nichts von ihr wollte. Wie ungewohnt! Wie angenehm. Aber jetzt, während er mit ihrer ziemlich willensschwachen Projektion trainierte, leugnete seine Arroganz eine von Reinas fundamentalen Gewissheiten: dass es doch etwas an ihr zu sehen gab.
Aus Selbstschutz war sie allem und jedem aus dem Weg gegangen, nur Nico hatte sie ein Fenster geöffnet, sei es nun absichtlich oder nicht.
Er hatte ihre Schwächen gesehen, ihre Steifheit, ihre Verteidigungsmechanismen und ihre Fehler. Die hatte er sich gemerkt. Er hatte sie sich zunutze gemacht, diese wohl gehüteten Details, und zwar nicht einmal besonders raffiniert. Seine Wahrnehmung von ihr war ausgesprochen mittelmäßig. Er besaß keinerlei Ehrgeiz, sie zu irgendeinem Zweck zu benutzen. Alles, was er über ihr Wesen gelernt hatte, verwendete er allein darauf, sein eigenes Ego zu erhalten, seine eigenen Stärken zu bedienen.
Reina rutschte auf dem Stuhl herum.
Ah. Enttäuschung war es also, was sie empfand.
In Nicos Simulation hatten sie ihr Kampfkunst-Repertoire inzwischen erweitert. Sie waren von Blöcken und Hieben zu Tritten und Grifftechniken übergegangen. Die falsche Reina erhöhte den Einsatz, wählte anspruchsvollere Manöver, eventuell weil Nico ihr Unzulänglichkeit vermittelte. (Hm, oder projizierte sie das jetzt nur hinein? Reina suchte mit einem kurzen Blick nach Bestätigung von Parisa, wandte sich aber schnell wieder ab, wütend über sich selbst.) Nico packte sie, täuschte einen Kniestoß zum Gesicht der falschen Reina an, und während sie sich aus seinem Griff befreite, brachte er sie aus dem Gleichgewicht und kickte ihr hart gegen den Schwachpunkt am Oberschenkel. Kurz: Die falsche Reina war Nico wieder auf den Leim gegangen, und die echte Reina, die innerlich schäumte, spürte Ärger in sich. Etwas Zartes, Hartnäckiges, wie eine Ranke oder eine Rebe.
(Worin lag denn für Nico bitte überhaupt der Unterschied zwischen Reina und seinem Freund, dem Träumer? Wie konnte ihm entgehen, dass Reina – genau wie der Freund, den er mit allen Mitteln beschützen wollte – auch nur ein Werkzeug war, das allerseits Begehrlichkeiten weckte? Natürlich spielte das eigentlich keine Rolle. Natürlich musste weder er noch sonst irgendwer ihr einen Wert zuschreiben. Natürlich war sie kein bisschen sauer.)
Ganz offensichtlich sollte dieses Initiationsritual einzig und allein die Person bestrafen, die dorthinein projiziert wurde, nicht die, die die Szene selbst projizierte. Dalton hatte es gesagt: Es gab keine Regeln. Holo-Reina hätte also genauso gut in einem Lieferwagen vorfahren und Nico entführen können. Sie hätte ihn mit Magie bekämpfen, ihm einen Blitz durch die Brust jagen können. Sie hätte ihn mit einer Pflanze erwürgen können, das lag zumindest im Bereich des Möglichen. Was hätte sie außerhalb des Möglichen alles bewerkstelligen können, in einer magischen Projektion in einer magischen Bibliothek, wo die Grenzen der Realität überschritten wurden?
Doch nichts davon hatte Nico in Betracht gezogen. Offenbar war ihm nie der Gedanke gekommen, dass Reina ihn besiegen oder überraschen könnte. Und so litt nun Reina, nicht Nico.
Sie ballte die Hand zur Faust, und der Farn in der Ecke entfaltete sich mit einem Peitschenknall. Die Zweige fuhren aus wie Tentakel. Etwas wuchs in ihr, wucherte. Etwas Weiches, wie Verrat, aber moderiger, wie ein durchscheinender Schimmelflaum. Vielleicht war sie genervt von Nico. Ein penetrantes Gefühl, wie ein kratziger Waschzettel oder eine Mücke im nächtlichen Zimmer. Vielleicht ärgerte sie die Feststellung, dass Nico de Varona offenbar nichts Bedeutsames an ihr entdeckt hatte.
In der Simulation arbeitete Nico sich wieder dichter an die falsche Reina heran. Sie rangen kurz miteinander, bis Reina ihn von sich stieß und Nico mit seinem üblichen schelmischen Augenfunkeln außer Reichweite tänzelte.
Reina war ganz sicher nicht darauf angewiesen, dass Nico sie auf irgendeine bestimmte Art betrachtete. Sie waren Freunde – oder vielleicht Kollegen, mehr nicht. Nie hatte Reina ihn als romantische und schon gar nicht als sexuelle Option betrachtet. Sie sah nie jemanden als sexuelle Option. Dass sie überhaupt Geschlechtsorgane besaß, interessierte sie so wenig wie jedes andere Gewächs mit vegetativer Fortpflanzung. Und natürlich konnte Nico sie betrachten, wie er wollte, abgesehen von der Tatsache, dass sie fast ihre gesamte Freizeit miteinander verbracht hatten und er ganz offensichtlich dabei nur gelernt hatte, wie oft sie auf genau dieselbe Technik hereinfiel.
Tja. Reina verzog das Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust. Bestimmt hatte Parisa ihr diesen Gedanken irgendwie eingepflanzt. Von allein wäre Reina jedenfalls nicht darauf gekommen. Ihr war es völlig schnuppe, was andere über sie dachten, und Nicos Interesse oder Wohlwollen brauchte sie schon gar nicht. Ja, sie hatte ihm mehr vertraut als irgendwem sonst im Haus, und ja, sie hatte nie hinterfragt, ob sie sich wirklich auf ihn verlassen konnte. Er hatte ihr als Erste von der Bedingung der Initiation erzählt, oder vielleicht nicht? Von dem kleinen Killerspiel, das sich in den Fußnoten verbarg? Und sie hatte gewusst, dass er sie nicht töten würde, und er hatte sie nie gefragt, ob sie ihn jemals töten wollte, aber …
Nico verpasste Holo-Reina einen derart heftigen Schlag, dass sie blinzelnd zurückstolperte.
Er hatte sie nicht gefragt, begriff Reina. Natürlich nicht. Weil er die Antwort schon kannte.
Vielleicht hielt er sie gar nicht unbedingt für schwach, doch genau wie beim restlichen Personal in seinem Leben war Nico de Varona sich ihrer Loyalität sicher.
(Er wusste, dass sie ihn nicht verraten würde, aber war es umgekehrt genauso?)
Wieder rutschte sie auf ihrem Stuhl umher, verunsichert und misstrauisch angesichts ihres eigenen Misstrauens. Was genau war noch mal der Zweck dieses Rituals? Dalton hatte gesagt, es sei kein Test, also wozu das Ganze? Sollten sie irgendwelche Erkenntnisse gewinnen – irgendeine bedeutsame Einsicht in ihr wahres Wesen – oder war es eine Falle?
Und wer saß dann fest, Reina oder Nico?
Die falsche Reina taumelte sichtlich erschöpft nach hinten, und Nico hielt sofort inne. »Alles in Ordnung?«, fragte er. Vergessen war die Lektion, die sie ihm vorhin erteilt hatte – dass sie nicht auf ein Startsignal wartete, jederzeit das Tempo anziehen konnte. Er ließ jede Vorsicht vor Vergeltung außer Acht und zeigte pure Fürsorge, als stellte sie keinerlei Bedrohung für ihn dar. »Reina, ist alles okay?«
Reina ging nicht zum Angriff über. Sie richtete sich auf und sah ihm in die Augen.
»Alles okay«, sagte sie tonlos. Mechanisch.
(Klang sie in seinen Ohren wirklich so?)
»Wir müssen nicht weitermachen«, versicherte Nico ihr, sein Dackelblick triefte vor Mitgefühl. »Ich weiß zwar nicht, was genau wir hier eigentlich treiben, aber ich will dir nicht wehtun.«
Ihr wehtun? Als wäre sie ihm hilflos ausgeliefert? Als hätten sie nicht genau das hier fast ein ganzes Jahr lang getrieben? Ging er davon aus, dass sie einfach auf die Seite rollte und starb, wenn er ihr nicht gnädigerweise Anweisungen erteilte?
Natürlich war sie kein bisschen wütend.
Vom Halbkreis gegenüber schenkte Parisa ihr ein grausames Lächeln.
»Du kannst mir nicht wehtun«, sagte Holo-Reina. Immerhin. (Aber klang das nicht irgendwie seltsam, »Du kannst mir nicht wehtun«, irgendwie falsch und fast schon wahnhaft, als müsste es mit medizinischem Personal besprochen werden, während »Du wirst mir nicht wehtun« zumindest impliziert hätte, dass sie selbst den Schmerz verhinderte?)
(Inzwischen lachte Parisa hinter vorgehaltener Hand.)
»Ich weiß«, beharrte Nico. »Aber das mache ich trotzdem nicht.«
Das ganze Bild verzerrte sich plötzlich und löste sich dann ganz auf. Nico erwachte nach Luft schnappend in seinem eigenen Körper, sein Bewusstsein ergoss sich in ihn wie Wasser in die Lunge.
Zum ersten Mal heute ließ Atlas sich vernehmen. »In sechzig Sekunden machen wir weiter mit Miss Mori.«
Dalton nickte und sah auf die Uhr.
Reina wandte sich an Nico und versuchte, möglichst leise über sein Keuchen hinwegzuflüstern. (Anscheinend verlagerte sich die physische Anstrengung der Simulation in seinen echten Körper. Wenigstens hatte Reinas völlige Demütigung ihn etwas ins Schwitzen gebracht.)
»Wusstest du, dass du mir begegnen würdest?«, fragte sie ihn. »Ich meine, hast du vorher irgendwie an mich gedacht oder …«
»Ihr konntet das Ganze sehen?« Nico klang verwirrt, aber nicht im Mindesten schuldbewusst. Also kein bisschen Schamgefühl. Wenig überraschend – Reina kannte ihn ja –, aber so langsam wurmte es sie doch. »Nein, ich habe nicht direkt an dich gedacht. Eigentlich habe ich an …«
Doch das sollte Reina nie erfahren. Dalton stand inzwischen hinter ihrem Stuhl, und dann – fast als fiele sie in den Schlaf – spürte Reina, wie sich etwas in ihr löste. Eben noch hatte sie Nico angeguckt, der mit seinem Atem und seinem Satz rang, und im nächsten Moment blickte sie in einen endlosen Abgrund, der gleich darauf zum Freskensaal wurde.
Ihr Ritual fand nachts statt, die Vorhänge waren dicht zugezogen, im Kamin loderte ein Feuer. Die Luft war schwer und feucht von Hitze.
Dann trat eine Gestalt in einem leuchtend weißen Kleid aus der höhlenartigen Dunkelheit.
»Hallo, Reina«, säuselte Parisa leise.
Fuck, dachte Reina, und die falsche Parisa lächelte schmallippig und ließ das weiße Kleid niedergleiten.
Tristan
»Interessant«, bemerkte Callum neben ihm unspezifisch und betrachtete Parisas Umrisse. Die Projektion, die Reina heraufbeschworen hatte, war vollkommen nackt aus ihrem Kleid gestiegen. Sie war komplett entblößt, was offenbar innerhalb des Rahmens von »Sterben werden Sie nicht« blieb, weswegen weder Dalton noch Atlas, aalglatt und selbstgewiss wie immer, sich zum Eingreifen genötigt sahen.
Tristan, der jeden Kommentar verweigerte, wandte sich von Callum ab und landete damit unfreiwillig bei Nico, der ihn direkt ansah. Auf seinem angespanntem Gesicht spiegelte sich ein Konflikt – ihm schien etwas auf der Zunge zu liegen –, bis Tristan den Blickkontakt abbrach. Was immer Nico wollte, es konnte warten.
Die echte Parisa musterte Reinas Simulation, dann zuckte sie mit den Schultern.
»Sie hat meine Brüste nicht richtig hingekriegt«, sagte sie.
»Stimmt«, sagte Callum. »Und wenn ich mich nicht irre, gibt es noch mehr abweichende Details.« Er warf ihr einen Blick von der Seite zu. »Hast du nicht eine Narbe ganz oben am Schenkel?«
Ja, dachte Tristan. In Form einer kleinen, krausen, strahlenden Sonne. Unwillkürlich dachte er daran, wie er darübergefahren war, mit dem Daumen ganz leicht über die ausgefransten Ränder gestrichen hatte.
»Eine Brandnarbe. Und du bist widerlich«, gab Parisa ohne jede Gefühlsregung zurück.
Grinsend rutschte Callum tiefer auf dem Stuhl. »Soll ich meine Beobachtungsgabe künstlich zurückhalten? Du gibst dir ja nicht gerade Mühe, deine Narbe zu verstecken.«