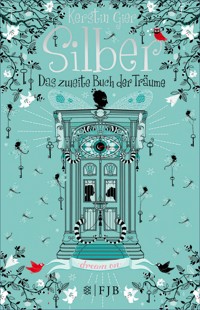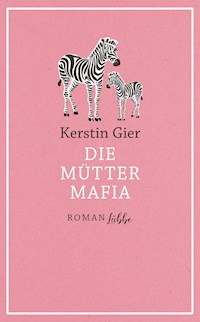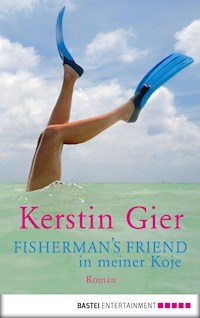9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerri schreibt Abschiedsbriefe an alle, die sie kennt, und sie geht nicht gerade zimperlich mit der Wahrheit um. Nur dummerweise klappt es dann nicht mit den Schlaftabletten und dem Wodka und Gerris Leben wird von einem Tag auf den anderen so richtig spannend. Denn es ist nicht einfach, mit seinen Mitmenschen klarzukommen, wenn sie wissen, was man wirklich von ihnen hält ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Einleitendes Zitat
An die BILD-Zeitung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Nachwort
Über die Autorin
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von Bergisch Gladbach. Sie schreibt mit sensationellem Erfolg Romane. FÜR JEDE LÖSUNG EIN PROBLEM und ihre MÜTTER-MAFIA-Romane wurden durch Mundpropaganda Bestseller und mit enthusiastischen Kritiken bedacht. Durch ihre Jugendbücher RUBINROT, SAPHIRBLAU und SMARAGDGRÜN ist ihre Fangemeinde noch größer geworden.
KERSTIN GIER
Für jede Lösungein Problem
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
Titelabbildung: Brand X Pictures
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0069-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Renate und Biggi und unsere großen Pläne
Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.
Johann Wolfgang von Goethe
An die BILD-Zeitung
Sehr geehrte Damen und Herren Redakteure!
Mir ist gerade eingefallen, dass Sie vermutlich über meinen Selbstmord berichten, dabei meine wahren Motive außer Acht lassen und eigene erfinden werden: JEDEN MONAT SCHRIEB SIE ÜBER DIE GROSSE LIEBE. DOCH SIE SELBER DURFTE SIE NICHT ERLEBEN … WARUM IMMER MEHR GUTAUSSEHENDE SINGLES IN DEUTSCHLAND SELBSTMORD BEGEHEN.
Ein Körnchen Wahrheit ist da sogar dran. Außerdem gilt es, das Sommerloch zu füllen. Also schreiben Sie ruhig, was Sie wollen, nur zitieren Sie nicht meine Mutter. Egal, was sie auch sagt, es liegt nicht an der Haarfarbe! Brünette haben genauso viel Spaß im Leben wie Blondinen.
Nur eben ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Gerri T., die geheimnisvolle Tote aus der Luxussuite.
P. S. Falls Sie Nacktfotos von mir benötigen, um die Story auf Seite 1 zu bringen, empfehle ich Ihnen eine Fotomontage mit meinem Gesicht (s. beiliegende Fotos) und dem Körper von Giselle Bündchen. Die Nacktfotos, die Sie möglicherweise von einem gewissen Ulrich M. angeboten bekommen werden, sind gefälscht und ein armseliger Versuch, sich selber in den Mittelpunkt zu spielen.
Eins
»Gib mir bitte mal die kleine Wunderschüssel aus dem Schrank, Lu … Ti … Ri«, sagte meine Mutter. Vom Mittagessen waren eine Kartoffel, eine hauchdünne Scheibe Braten und ein Esslöffel Rotkohl übrig geblieben, zu schade zum Wegwerfen, wie meine Mutter fand. »Genau die richtige Portion für einen allein«, sagte sie.
Ich heiße natürlich nicht Lutiri.
Ich habe noch drei ältere Schwestern, und meine Mutter hatte schon immer ein Problem, unsere Namen auf Anhieb richtig zuzuordnen. Wir heißen Tine, Lulu, Rika und Gerri, aber meine Mutter nannte uns eben Lutiri, Geluti, Riluge und so weiter, da gibt es mathematisch ja unendliche Möglichkeiten, auch im viersilbigen Bereich. Ich bin Gerri, die Jüngste. Und die Einzige, die allein lebte und von der daher erwartet wurde, von einer winzigen Kartoffel, einer mickrigen Scheibe Fleisch und einem Löffelchen Rotkohl satt zu werden. Als ob man als Single automatisch weniger Appetit hätte.
»Das ist nicht die Wunderschüssel, das ist Flexi-Twin«, sagte meine Mutter. Ich stellte die Plastikschüssel zurück in den Schrank und reichte ihr eine andere.
Um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen, war ich zum sonntäglichen Mittagessen bei meinen Eltern erschienen. Mein Plan war jedoch, dass dies die letzte gemeinsame Mahlzeit sein sollte.
»Das ist Prima Klima Frische Kick eins Komma sechs«, sagte meine Mutter und sah mich genervt an. »Viel zu groß. Jetzt stell dich doch nicht dümmer an, als du bist.«
Und die nächste bitte.
Meine Mutter seufzte. »Das ist Clarissa, aber die tut es auch, gib schon her.«
Es war schon komisch, dass meine Mutter ihre Kinder nicht beim richtigen Namen nennen konnte, aber bei Tupperschüsseln so überhaupt kein Problem damit hatte. Mal ganz abgesehen davon, dass ich viel, viel lieber Clarissa geheißen hätte als Gerda. Aber so ist das: Nicht nur nahezu alle anderen Menschen, nein, auch die Haushaltsgeräte hatten schönere Namen als ich.
Meine Schwestern allerdings waren mit ähnlich unattraktiven Namen behaftet wie ich. Das lag daran, dass wir alle Jungs hatten werden sollen: Tine ein Martin, Rika ein Erik, Lulu ein Ludwig und ich ein Gerd. Der Einfachheit halber hatten meine Eltern nach der Geburt immer nur ein A hinten an den Jungennamen gehängt.
Tine hatte noch am wenigsten über ihren Namen zu meckern, sie bemängelte nur, dass »Martina« so häufig vorkäme. Zu allem Überfluss hatte sie einen Mann namens Frank Meier geheiratet, der ebenfalls mit der Häufigkeit seines Namens unzufrieden war. Die Kinder der beiden hatten daher Namen, die sonst niemand hatte (und wohl auch nicht haben wollte, wenn Sie mich fragen). Sie hießen Chisola, Arsenius und Habakuk.
Chisola, Arsenius und Habakuk Meier.
Chisola war zwölf und sprach nicht viel, was Tine auf Chisolas Zahnspange, ich aber auf Chisolas vier Jahre jüngere Brüder schob. Die beiden waren Zwillinge und machten ununterbrochen Krach und Dreck.
So wie vorhin beim Essen.
Ich hätte mir keine Sorgen darüber machen müssen, ob jemandem auffallen könnte, dass mit mir was nicht stimmte. Die ganze Aufmerksamkeit galt wie immer den Zwillingen. Selbst wenn ich meinen Kopf unter dem Arm getragen hätte, wäre es niemandem aufgefallen.
Habakuk matschte den Rotkohl unter die Kartoffeln und versuchte, den Brei bei geschlossenem Kiefer durch seine Zahnlücke einzusaugen. Arsenius schlug das Besteck auf den Tellerrand und brüllte im Takt »Habakuk! Spuck! Spuck! Spuck!« dazu. Und das tat Habakuk dann auch nach einer Weile: Er spuckte seinen Brei mit würgenden Lauten wieder zurück auf den Teller.
»Habi!«, sagte meine Mutter leise tadelnd. »Was soll denn der Patrick von uns denken?«
»Mir doch egal, was der denkt«, sagte Habakuk und kratzte sich ein Stückchen Rotkohl aus den Zähnen.
Patrick war der neue Freund meiner Schwester Lulu. Als Lulu ihn das erste Mal mitgebracht hatte, war ich aus allen Wolken gefallen: Patrick sah nämlich haargenau aus wie jemand, den ich kannte.
Na ja, kennen wäre vielleicht zu viel gesagt. Er sah aus wie der Typ aus dating-café.de, mit dem ich mich einmal getroffen hatte, hammerhart31. Ich hatte keine besonders gute Erinnerung an dieses Treffen, deshalb hatte ich Patrick zunächst auch ziemlich entgeistert angestarrt. Aber Patrick hatte keinerlei Zeichen eines Erkennens von sich gegeben. Er war auch nicht zusammengezuckt, als Lulu mich vorstellte und ich ihm mit den Worten »Das ist wirklich hammerhart, dich kennen zu lernen« die Hand schüttelte. Obwohl ich eigentlich ein gutes Gedächtnis für Menschen und ihre Gesichter habe, war ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich irren musste. Patrick sah hammerhart31 einfach nur zum Verwechseln ähnlich. Bis auf das kleine, spitze Ziegenbärtchen sah er gut aus, und – im Gegensatz zu hammerhart31 – wirkte er einigermaßen normal. Allerdings machte er ein ziemliches Geheimnis um seinen Job.
»Was machen Sie beruflich?«, hatte mein Vater gefragt, und Patrick hatte lässig geantwortet: »IT.«
Er war jetzt das dritte Mal zu Gast bei meinen Eltern, und sie trauten sich auch diesmal nicht zu fragen, was »IT« denn für ein Beruf war. Ich hatte aber wohl mitbekommen, wie meine Mutter Lulu vorhin beiseite genommen hatte.
»Was genau macht der Patrick noch mal beruflich, Schätzchen?«
Und Lulu hatte geantwortet: »IT, Mama, das hat er doch das letzte Mal schon gesagt.«
Jetzt war meine Mutter so klug wie zuvor. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie ihren Freundinnen erzählte, dass der neue Freund meiner Schwester »ein ganz Netter« sei und als »Eiti« viel Geld verdiente. Und dass es diesmal hoffentlich was Ernstes war.
Es war schwer zu raten, was Patrick von uns dachte. Er hatte einen ziemlich neutralen Gesichtsausdruck aufgesetzt.
»Patrick wird schon wissen, dass Jungs manchmal ein bisschen wild sind«, sagte Tine. »Er war schließlich selber mal so ein kleiner Racker.«
»Bevor er IT wurde«, sagte ich.
»Aber ein gut erzogener kleiner Racker«, sagte meine Schwester Lulu und tätschelte Patricks Arm.
»Allerdings«, sagte Patrick. »Mein Vater hat großen Wert auf Tischmanieren gelegt.«
»Willst du damit andeuten, unsere Kinder wären nicht gut erzogen?«, fragte Tine und tauschte einen erbosten Blick mit Frank, ihrem Mann.
»Kann ich noch was Apfelsaft?«, fragte Arsenius.
»Haben«, ergänzte meine Mutter. »Es heißt: Kann ich noch was Apfelsaft haben.«
»Und bitte«, sagte ich. »Kann ich bitte auch was Apfelsaft haben?«
»Ich will jetzt Apfelsaft!«, sagte Arsenius. »Um den fiesen Geschmack runterzuspülen.«
»Ich will bitte auch Saft haben«, flüsterte Chisola.
»Gar nicht erzogen wäre wohl treffender«, sagte Lulu.
»Krieg du erst mal selber Kinder, dann kannst du vielleicht mitreden«, sagte Tine.
»Ich bin promovierte Pädagogin«, sagte Lulu. »Seit über sechs Jahren arbeite ich mit Kindern. Ich denke, zum Thema Erziehung kann ich durchaus jetzt schon mitreden.«
»Mädels!« Meine Mutter goss Arsenius und Habakuk Apfelsaft ein und stellte die Flasche wieder auf das Sideboard. »Nicht jeden Sonntag das gleiche Thema. Was soll denn der Patrick von uns denken?«
Patrick hatte immer noch diesen neutralen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Er kaute an einem Stück Schweinebraten, während sein Blick auf dem lebensgroßen Porzellanleoparden ruhte, der auf der extra tiefen Marmorfensterbank zwischen Yuccapalmen in gold-weißen Übertöpfen stand. Eingerahmt wurde dieses Ensemble von glänzenden gold-weiß gemusterten Vorhangschals, die von zwei adipösen Engelchen zur Seite gerafft wurden. Wenn Patrick überhaupt etwas dachte, dann wohl: »Das ist die geschmackloseste Esszimmereinrichtung, die mir jemals untergekommen ist.«
Und damit hatte er sicher Recht.
Überall im Raum waren die Vorlieben meiner Mutter für dicke Engelchen und die Farben Weiß und Gold zu erkennen. Und für Leoparden. Diese Raubkatzen hatten es meiner Mutter ganz besonders angetan. Ihr Lieblingsstück war eine Stehlampe, deren Fuß die Gestalt eines Leoparden aufzuweisen hatte.
»Sieht er nicht aus wie echt?«, pflegte sie zu fragen, und sie hatte Recht: Wenn der Leopard keinen gold-weißen Lampenschirm auf den Kopf geschraubt gehabt hätte, wäre man durchaus geneigt gewesen, ihn für echt zu halten, denn er hatte ein richtiges Fell und Schnurrhaare.
Unsere Familie traf sich jeden Sonntag in diesem Raubtierkäfig zum Mittagessen. Nur Rika, meine zweitälteste Schwester, war nicht dabei, sie lebte mit Mann und Tochter in Venezuela. Selbst meine Mutter, die in Geografie eine absolute Niete war, hatte mittlerweile begriffen, dass man von Venezuela nicht mal eben zum Mittagessen zu den Eltern nach Köln-Dellbrück kommen konnte.
»Das Venezuela in Südamerika«, erklärte sie Bekannten gelegentlich. »Nicht das in Italien.«
Wie gesagt, in Geografie war sie eine absolute Niete. Aber ihr Schweinebraten war exzellent. Ich aß drei Scheiben davon, Habakuk sogar vier. Seinen Rotkohl-Kartoffelbrei rührte er nicht mehr an. Aber Tine tauschte wie immer am Schluss den leer gegessenen Teller von Frank mit den Tellern der Kinder, und Frank aß ohne mit der Wimper zu zucken alle Reste auf, auch die, die schon mal gekaut worden waren. Einmal im letzten Jahr hatte Arsenius fürchterlich zu schreien angefangen, weil Frank bei dieser Aktion einen Milchzahn mitgegessen hatte, den Arsenius verloren und auf den Tellerrand gelegt hatte. Mir wurde heute noch schlecht, wenn ich daran dachte.
Die Diskussion um Kindererziehung war verebbt.
»Ist doch wahr«, sagte Tine nur noch. »Haben selber keine Kinder, aber wollen ständig an meinen herumerziehen!«
Ich goss Chisola und mir Apfelsaft ein.
»Danke«, flüsterte Chisola.
»Oma, die Gerri trinkt uns den ganzen Saft weg«, schrie Habakuk.
»Opa holt neuen Saft aus dem Keller«, sagte meine Mutter, bedachte mich aber mit einem bösen Blick. Mein Vater stand auf und verschwand im Keller.
Als er mit dem Apfelsaft wiederkam, reichte er mir einen Briefumschlag. »Post für dich, Gerri«, sagte er und streichelte dabei leicht über meine Wange. »Du siehst heute irgendwie blass aus.«
»Weil sie nie an der frischen Luft ist«, sagte meine Mutter sofort.
»Seit wann bekommt denn ihr meine Post?«, fragte ich. Und geöffnet war der Umschlag zuvorkommenderweise auch schon. Ich sah auf den Absender. »K. Köhler-Koslowski. Kenne ich nicht.«
»Natürlich kennst du den Klaus!«, sagte meine Mutter ärgerlich. »Klaus Köhler. Er möchte dich zum Klassentreffen einladen.«
»Hat der tatsächlich einen Doppelnamen?«
»Das machen moderne Männer eben so«, sagte meine Mutter.
»Aber doch nicht, wenn die Frau Kotzlöffel heißt«, sagte ich.
Arsenius und Habakuk spuckten vor Lachen ihren Apfelsaft auf die Tischdecke.
»Wenn du damals mit ihm zum Abschlussball gegangen wärst, dann hieß der Klaus jetzt Köhler-Thaler«, sagte meine Mutter versonnen. Das war eine ihrer Lieblingsfantasien.
»Nein, ich wette, der wollte bloß drei K als Initialen«, sagte Tine. »Was macht er beruflich? Königlich-Kaiserlicher Küchenchef?«
»Korinthen kackender Kraftfahrer«, schlug ich vor. »Das würde passen.«
Die Zwillinge krähten begeistert und steuerten »Komischer Kröten-Kotzer« und »Kleiner Kacke-Kanalreiniger« bei.
»Der Klaus hat einen ganz tollen Posten«, sagte meine Mutter. »Das habe ich euch doch schon oft erzählt. Verdient sich dumm und dämlich. Die Hanna muss nicht arbeiten gehen, die kann zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Die Annemarie ist sehr glücklich mit ihrer Schwiegertochter und den Enkelchen.«
Hanna Koslowski, genannt Kotzlöffel, war auch in unserer Stufe gewesen. Aus Motiven, die mir wohl für immer und ewig unerklärlich bleiben würden, hatte sie nicht nur mit Klaus getanzt, sondern sich auch mit ihm fortgepflanzt.
»Und – gehst du zum Klassentreffen?«, fragte Lulu.
Ich zuckte mit den Schultern. »Mal schauen.« In Wirklichkeit war ich fest entschlossen, auf keinen Fall dort aufzutauchen, es sei denn als Amokläufer. Ich wusste schon seit ein paar Wochen, dass das Klassentreffen stattfinden sollte, weil meine Freundin Charly eine E-Mail von Britt Emke an mich weitergeleitet hatte. Hallo, liebe ehemalige Mitstreiter! Wie ihr vielleicht wisst, ist es bereits im letzten Jahr zehn Jahre her gewesen, dass wir unser Abitur gemacht haben. Nun haben Klaus Köhler (LK Mathe/Physik) und ich (LK Erziehungswissenschaften/Biologie) als ehemalige Stufensprecher überlegt, dass es doch nett wäre, wenn wir uns zum Elfjährigen alle einmal wiedersehen und über unseren bisherigen Werdegang und alte Zeiten klönen könnten …
Was denn, mit Britt Emke über alte Zeiten klönen? Weißt du noch, Britt, wie du dich damals im Geschichtsunterricht gemeldet hast? »Herr Müller, wenn Sie der Gerri eine Drei geben, dann ist das aber der Kathrin gegenüber nicht fair. Die Gerri hat doch kaum was gesagt in diesem Halbjahr, und sie hat auch nie was mitgeschrieben, sondern immer nur von der Charlotte die Chemie-Hausaufgaben abgeschrieben oder Schiffe versenken gespielt.«
Ihren »Werdegang« hatte Petze Britt auch schon kurz umrissen, nur für den Fall, dass es jemanden interessierte. »Nach meinem Sozialpädagogik-Studium habe ich ein Jahr lang mit behinderten Kindern gearbeitet, bevor ich mit meinem Mann, Ferdinand Freiherr von Falkenhain, auf einen großen Gutshof in Niedersachsen zog. Unsere Tochter Luise geht bereits in den Kindergarten, im vergangenen Jahr wurde unser Stammhalter Friedrich geboren. Wir führen ein sehr glückliches Leben. Liebe Grüße an alle, eure Britt Freifrau von Falkenhain.«
Britts Werdegang, so märchenhaft er auch klingen mochte, war der traurige Beweis dafür, dass wir nicht mehr in den alten Zeiten lebten, wo das Wünschen noch geholfen hatte. Denn wenn es nach meinen und Charlys Wünschen gegangen wäre, würde Britt heute bei Schlecker an der Kasse sitzen und mit einem arbeitslosen Alkoholiker und einem blasenschwachen Kampfhund in einer verschimmelten Souterrain-Sozialwohnung hausen.
Und ich wäre mit Ferdinand Freiherr von Falkenhain verheiratet, wer immer das auch war.
»Ich würde an deiner Stelle nicht hingehen«, sagte Lulu. »Die geben da alle nur an mit ihren tollen Männern, ihren Häusern, ihren Kindern, ihren Super-Jobs, ihren teuren Autos, ihren Reisen und ihren Doktortiteln. Du wirst dich schrecklich fühlen. Du hast ja nicht mal einen Freund!«
»Oh, vielen Dank für den Hinweis«, sagte ich.
»Und zugenommen hast du seit dem Abi auch«, sagte Tine.
»Zwei Kilo«, sagte ich. Höchstens fünf.
»Und blass sieht sie aus«, sagte mein Vater wieder. Ich warf ihm einen erstaunten Blick zu. Sollte hier vielleicht doch jemand merken, dass mit mir was nicht stimmte?
»Das sieht doch keiner«, sagte meine Mutter. »Und alle sind noch nicht verheiratet. Vor allem die Männer sind ja auch jetzt erst im richtigen Alter, sich für immer zu binden. Ti … Lu … Gerri könnte ja einfach sagen, dass sie Redakteurin ist. Oder Buchhändlerin.«
»Warum sollte ich das tun?«, fragte ich. »Ich muss mich doch für meinen Job nicht schämen. Im Gegenteil, viele Menschen beneiden mich darum.«
»Was macht sie noch mal beruflich?«, erkundigte sich Patrick bei Lulu.
»Ich bin Schrift …«
»Sie schreibt Groschenromane«, sagte Lulu. »Ärzteromane und Liebesschnulzen, so billige Heftchen halt.«
»Ah! Meine Oma hat die immer gelesen«, sagte Patrick. »Und davon kann man leben?«
»Sicher«, sagte ich. »Im üb…«
»Mehr schlecht als recht«, sagte mein Vater.
»Ich habe mein Auskommen«, sagte ich. Jedenfalls noch bis vor drei Tagen. »Und au…«
»Aber keine vernünftige Altersvorsorge und keinen Mann, der das mal ausgleichen wird«, fiel mir mein Vater wieder ins Wort. Dabei wollte ich dem blöden Patrick nur erklären, dass durchaus auch junge Frauen meine Romane lasen. »Und jetzt bist du auch schon dreißig!«
Warum mussten immer alle auf dieser Zahl herumhacken?
»Dreißig ist doch noch kein Alter«, sagte Lulu. »Ich habe Patrick ja auch erst mit zweiunddreißig kennen gelernt.« Das war vor zwei Monaten gewesen. Ich hatte bisher gar nicht gefragt, wo sie sich kennen gelernt hatten. Aber sicher nicht im Internet, denn als ich Lulu damals von dating-café.de erzählt hatte, hatte sie nur verächtlich die Nase gerümpft und gesagt: »Da treiben sich doch nur Spinner rum, die im wirklichen Leben keinen abkriegen.«
Auf hammerhart31 dürfte das zugetroffen haben.
»Bei dir ist das was anderes«, sagte mein Vater zu Lulu. »Du bist im Schuldienst und hervorragend fürs Alter abgesichert. Du kannst es dir leisten, mit dem Heiraten noch ein bisschen zu warten.«
»Außerdem bist du blond«, sagte meine Mutter. »Aber wie soll Tiluri mit den Haaren jemals jemanden kennen lernen, wenn sie zu allem Überfluss auch noch die ganze Zeit in ihrer Wohnung hockt und schreibt?«
»Mama, ich …«
»Sie sollte auf jeden Fall zu dem Klassentreffen gehen, das ist eine gute Gelegenheit, zu sehen, was aus den Männern von damals geworden ist«, sagte meine Mutter und setzte bekümmert hinzu: »Sonst bleibt ihr ja nur noch eine Kontaktanzeige.«
»Das hat sie doch schon längst versucht«, sagte Tine. Sie hatte ihren Frank in einem Supermarkt kennen gelernt.
»Was?« Meine Mutter sah ehrlich schockiert aus. »So weit ist es also schon gekommen! Meine Tochter hat eine Kontaktanzeige aufgegeben! Wehe, du verlierst darüber auch nur ein Wort bei Alexas Silberhochzeit! Ich würde vor Scham im Boden versinken.«
»Keine Sorge«, sagte ich. Bei der Silberhochzeit meiner Tante Alexa würde ich genauso wenig auftauchen wie bei dem Klassentreffen.
Netterweise kippte Chisola in diesem Augenblick ihr Apfelsaftglas um und machte dem Gespräch ein Ende. Habakuk bekam vom Saft nasse Hosenbeine und stimmte ein mörderisches Geschrei an, das erst aufhörte, als meine Mutter den Nachtisch servierte.
***
Nach dem Essen verabschiedeten sich alle, nur ich musste länger bleiben, um die Reste mitzunehmen.
Meine Mutter drückte mir die Schüssel namens Clarissa in die Hand. »Und sei so gut und bring das hier die Tage mal für mich zur Apotheke«, sagte sie und setzte noch einen Schuhkarton obenauf.
»Schuhe? In die Apotheke?«
»Blödsinn«, sagte meine Mutter. »Das sind alte Medikamente, und dein Vater erlaubt mir nicht, sie in den Müll zu werfen. Er sagt, das sei Sondermüll. In der Apotheke sammeln die doch immer für die armen Menschen in der Dritten Welt. Hast du wirklich eine Kontaktanzeige aufgegeben?«
»Nein. Aber ich habe auf eine geantwortet.« Ich lüftete vorsichtig den Deckel des Schuhkartons. »In der Dritten Welt brauchen die doch keine Nasentropfen, haltbar bis Juli 2004.«
»Es sind ja auch noch andere Sachen dabei«, sagte meine Mutter. »Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die freuen sich in der Apotheke.« Sie seufzte. »Das hätte ich nie gedacht, dass es eine meiner Töchter mal nötig haben würde, auf eine Kontaktanzeige zu antworten. Aber du warst ja immer schon mein Sorgenkind.«
Ich hatte schon die nächste Schachtel in der Hand. »Dalmadorm. Das sind doch Schlaftabletten.« Jetzt war ich ehrlich verblüfft. Das konnte doch kein Zufall sein. Mein Puls beschleunigte sich ein wenig.
»Die lasse ich mir grundsätzlich in der Vorweihnachtszeit verschreiben«, sagte meine Mutter. »Aber als dein Vater in den Ruhestand ging, da brauchte ich auch ganzjährig welche, für ihn gleich mit.« Sie rollte mit den Augen bei der Erinnerung daran.
»Die Schachtel ist noch zu«, sagte ich. Meine Hände hatten zu zittern begonnen, aber das merkte meine Mutter nicht.
»Natürlich«, sagte sie streng. »Hast du mal gelesen, was solche Mittel für Nebenwirkungen haben? Man kann ganz schnell davon abhängig werden. Ich würde so was niemals nehmen, und dein Vater auch nicht.«
»Aber warum habt ihr sie euch dann verschreiben lassen?«, fragte ich.
»Wie meinst du das?«, fragte meine Mutter zurück. »Ich habe es dir doch gerade erklärt: Wir konnten nicht schlafen! Jahrelang konnten wir kein Auge zutun! Die Arbeit, die Kinder, die Rente … Das ist doch kein Zustand. Schlaf ist lebenswichtig, das darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.«
»Aber gerade hast du doch gesagt, du würdest so etwas nie nehmen«, sagte ich. O Gott, das waren ja Dutzende von Schachteln, alle noch originalverpackt.
»Man muss ja auch nicht immer alles mit Medikamenten regeln«, sagte meine Mutter. »Und wenn es unbedingt sein muss, dann gibt es immer noch das gute alte Baldrian, da schwöre ich ja drauf.«
»Ja, aber …«, begann ich.
»Warum fängt eigentlich jeder deiner Sätze mit einem aber an«, sagte meine Mutter. »Du warst immer schon so, nichts als Widersprüche. Das ist auch der Grund für deine Probleme mit Männern. Machst du dich nun nützlich und bringst du das Zeug zur Apotheke oder nicht?«
Ich gab es auf, das Paradoxon lösen zu wollen. »Von mir aus«, sagte ich. »Aber ich glaube nicht, dass sie in der Dritten Welt scharf auf Schlaftabletten sind.«
»Schon wieder ein aber«, seufzte meine Mutter und drückte mir einen Kuss auf die Wange, während sie mich zur Haustür dirigierte. »Ich wünschte wirklich, du würdest anfangen, ein bisschen positiver zu denken.« Sie fuhr mir mit der Hand durch die Haare. »Vor Alexas Silberhochzeit gehst du aber noch mal zum Friseur, ja? Ein paar Strähnchen würden dir sicher gut stehen. Sag Tirilu auf Wiedersehen, Schatz«, schrie sie über ihre Schulter.
»Wiedersehen, Gerri«, schrie mein Vater aus dem Wohnzimmer.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, murmelte ich, aber meine Mutter hatte die Tür schon wieder hinter mir geschlossen.
Ich nahm den Schuhkarton mit nach Hause. Mir hätte niemand verboten, das Zeug in der Mülltonne zu entsorgen, nicht mal mein schlechtes Gewissen. Eine Kontaminierung der Müllkippe durch Nasentropfen und Schlaftabletten – was war das schon gegen Gorleben?
Aber ich hatte ja gar nicht vor, die Tabletten zu entsorgen. Sie waren die Antwort auf alle Fragen, die mich in den letzten beiden Tagen bewegt hatten. Es war eine Schicksalsfügung, dass ich diesen Schuhkarton ausgerechnet jetzt in die Finger bekam, wo ich ihn am besten gebrauchen konnte.
Es war so ähnlich wie damals, als ich mir das Notebook kaufen wollte und auf dem Flohmarkt eine signierte Erstausgabe von Thomas Manns »Buddenbrooks« gefunden hatte, für 50 Cents, »weil die Schrift kann ja kein Schwein lesen«, hatte der Verkäufer gesagt. »Und reingekrickelt hat da auch noch wer.«
Ich war nicht besonders scharf auf Thomas Mann, und seitenlange Schachtelsätze in Sütterlin-Schrift las ich nur, wenn es unbedingt sein musste, daher hatte ich das Buch bei eBay eingestellt, und ein Antiquar aus Hamburg hatte es für zweitausendfünfhundert Euro ersteigert. Dem Kauf eines Notebooks hatte nun nichts mehr im Weg gestanden.
Normalerweise habe ich nicht so viel Glück.
Eigentlich nie.
Ich sah Schachtel für Schachtel sorgfältig durch und hatte am Ende nicht weniger als dreizehn zur Seite gelegt. Dreizehn unangetastete Packungen voller Schlaftabletten. Ich stapelte sie zu immer neuen Formationen auf meinem Küchentisch und konnte meinen Blick kaum von ihnen wenden. Sie trugen hübsche Namen wie Noctamid, Remestan, Rohypnol und Lendormin. Von einigen war noch nicht mal das Haltbarkeitsdatum überschritten.
Es waren so viele Tabletten, dass die einzige Schwierigkeit darin liegen würde, die letzten zu schlucken, bevor die erste wirkte. Aber das traute ich mir durchaus zu: Schnell essen war noch nie ein Problem für mich gewesen, ja, ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass »schnell essen« eine meiner herausragenden Fähigkeiten ist.
Ich merkte, dass ich unter dem Anstarren der Schachteln eine wohlige Gänsehaut bekommen hatte.
Alles hatte ich in den letzten beiden Tagen in Gedanken schon einmal durchgespielt und als unpassend befunden: Das meiste schied schon deshalb aus, weil dafür gewisse logistische und technische Voraussetzungen erforderlich waren – und die fehlten mir. Die Sache mit den Pulsadern kam nicht infrage, weil ich kein Blut sehen konnte und die Pulsadern für Anfänger auch gar nicht so einfach zu finden sind.
Aber das mit den Schlaftabletten würde ich hinkriegen. Das würde ein Kinderspiel werden.
Liebe Mama!
Vielen Dank für die hervorragend sortierte Schlaftablettensammlung, du hast mir damit wirklich viel lästige und möglicherweise illegale Arbeit erspart.
Natürlich hast du völlig Recht: Man muss nicht immer alles mit Medikamenten regeln. Aber es wäre doch zu schade, sie verkommen zu lassen. Es ist auch genau die richtige Portion für einen allein.
Nein, Scherz beiseite: Ich entschuldige mich hiermit für den Ärger, den ich dir mit den Tabletten bereite, aber bevor du deswegen sauer wirst, denk bitte auch an die vielen künftigen Enttäuschungen, die ich dir auf diese Weise erspare.
Es tut mir ja auch ehrlich leid, dass ich dich bis jetzt immer nur enttäuscht habe. Schon bei meiner Geburt, als du merktest, dass ich kein Gerd, sondern eine Gerda war. Und dann, weil ich brünett statt blond war. Aber glaub mir, ich habe mindestens so sehr wie du darunter gelitten, dass Tante Alexa nur blonde Blumenmädchen bei ihrer Hochzeit wollte und dass alle meine Schwestern und Cousinen Blumen streuen durften, nur ich nicht. Ich habe die ganze Feier praktisch unter dem Tisch verbracht. Gut, vielleicht hätte ich die Schnürsenkel von Opa Rodenkirchen nicht an Waldis Halsband festknoten sollen, aber ich konnte doch nicht ahnen, dass ein kleiner Dackel solch eine Zugkraft hat und Opa Rodenkirchen die Tischdecken samt Torten und Oma Rodenkirchens Meißner Porzellan herunterreißen würde.
Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich geweigert habe, mit Klaus Köhler auf den Abschlussball zu gehen, obwohl er der Sohn deiner lieben Freundin Annemarie ist und du mir versichert hast, dass Pickel, Schweißgeruch und großkotziges Gehabe ganz normale Pubertätserscheinungen seien, die von allein wieder weggingen. Bis heute vergeht ja kaum ein Tag, an dem du mir nicht sagst, was für ein erfolgreicher, gut aussehender Mann aus Klaus geworden ist und wie glücklich Hanna Koslowski sich schätzen darf, dass sie damals an meiner Stelle mit ihm zum Abschlussball gegangen ist.
Glaub mir, es hat tatsächlich schon Tage gegeben, an denen ich meine Weigerung selber bereut habe. Aber ich konnte doch mit fünfzehn nicht ahnen, dass ich mit dreißig mal froh wäre, jemanden wie Klaus abzukriegen. Denn dann hätte ich ganz sicher damals schon angefangen, Schlaftabletten zu sammeln.
Deine Gerri
P. S. Auch wenn ich nicht Lehrerin geworden bin, gibt es keinen Grund, Freunden und Verwandten zu verschweigen, womit ich mein Geld verdiene. Ich habe daher gerade vierzehn Mal »Nachtschwester Claudia unter Verdacht« zusammen mit einem netten Brief an alle geschickt, denen du seit Jahren »Unsere Jüngste hat ein kleines Schreibbüro« erzählst, wenn sie nach meinem Beruf fragen. Auch Klaus’ Eltern und Erbtante Hulda haben ein Exemplar bekommen.
P. P. S In Italien gibt es Verona und Venedig, Venezuela ist ein Staat im Norden von Südamerika. Aber weil du mir wahrscheinlich nicht glaubst, vererbe ich dir hiermit meinen Schulatlas, um das alles zu überprüfen.
Zwei
Mein Sternzeichen ist Jungfrau, und wir Jungfrauen sind pragmatische, ordentliche und zuverlässige Menschen. Wenn wir Probleme haben, behalten wir einen kühlen Kopf und gehen die Lösung systematisch an. In der Regel haben wir daher unser Leben viel besser im Griff als sensible Fische, vorsichtige Krebse oder unentschlossene Waagen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Bevor wir Jungfrauen also »Selbstmord« als die beste Lösung eines Problems ansehen, muss wirklich eine Menge schief laufen in unserem Leben. Damit will ich nur klarstellen, dass wir nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit die Flinte ins Korn schmeißen.
Ich hatte meine Probleme, ordentlich wie ich war, in drei übergeordnete Bereiche unterteilt.
1. Liebesleben
2. Arbeitsleben
3. Sonstiges Leben
Mein Liebesleben war lausig. Genauer gesagt: Es war überhaupt nicht vorhanden. Seit meiner letzten Beziehung waren viereinhalb Jahre vergangen, und obwohl diese Beziehung ein ziemliches Desaster gewesen war – ich hatte mir am Ende angewöhnt, mit Geschirr und anderen Gegenständen um mich zu werfen –, hatte ich keinesfalls vorgehabt, länger als ein paar Monate Single zu bleiben. Deshalb hatte ich mich nach einem Jahr ganz systematisch auf Partnersuche begeben und dabei so gut wie nichts ausgelassen. Ich hatte mich in Flirtlines registrieren lassen, auf Kontaktanzeigen geantwortet und mich mit dem Schulfreund des Mannes einer Freundin verkuppeln lassen. Auf diese Weise habe ich wirklich viele Männer kennen gelernt: Männer wie hammerhart31, meisenfreund007 und Max, 29, 1,89, NR, schüchtern, aber für jeden Spaß zu haben.
Insgesamt traf ich mich mit vierundzwanzig Männern. Das war eine ziemlich mickrige Ausbeute, wenn man bedenkt, dass ich über die Flirtlines mit Hunderten von Männern Mails austauschte und mit mindestens drei Dutzend in telefonischen Kontakt trat. Aber es gab wirklich nicht mehr als vierundzwanzig Männer, die unter vierzig, keine Dachdecker, nicht verheiratet und an einer Frau wie mir – über fünfundzwanzig, nicht blond, Körbchengröße A – interessiert waren. Und die der deutschen Sprache einigermaßen mächtig waren und keine Mails schrieben wie: »Bitte schick mögligst balt ein Ganskörperfoto von dir.«
Was aber – wie man merkt, wenn man sich im wirklichen Leben begegnet – nicht die einzigen Kriterien sein sollten, nach denen man sich einen Mann aussucht.
Nehmen wir zum Beispiel hammerhart31, den, der ausgesehen hatte wie der neue Freund meiner Schwester. hammerhart31 wollte mir eigentlich nur so schnell wie möglich zeigen, warum er sich hammerhart31 genannt hatte. Am liebsten gleich in dem Café, in dem wir saßen, am helllichten Tag. Während ich versuchte herauszufinden, was er von alten Katharine-Hepburn-Filmen hielt und wie er zu Kindern und Haustieren stand, versuchte er, meine Hand zu nehmen und in seinen Schoß zu legen.
»31 ist nicht mein Alter«, raunte er. »Wenn du verstehst, was ich meine.«
»Dann vielleicht deine Hausnummer?« Ich versuchte mich dumm zu stellen, während ich meine Hände so weit wie möglich von ihm fern hielt. Am besten über dem Kopf. Die Kellnerin dachte, ich winke ihr und rief: »Ich komme gleich.«
»Kennst du African Queen?«, stotterte ich.
»Mein Hammer«, sagte hammerhart31. »Mein Hammer ist genau 31 Zentimeter lang. Du darfst ruhig mal fühlen.«
»Ach nein«, sagte ich, inzwischen feuerrot angelaufen. »Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich bin an Werkzeug, egal wie hart oder lang, leider überhaupt nicht interessiert.«
hammerhart31 ließ zischend seine Atemluft entweichen. »Das habe ich mir gleich gedacht, als du hier reinkamst. Frigide Kuh! Die anderen haben sich jedenfalls nicht beschwert. Du weißt ja gar nicht, was du verpasst.« Und dann stand er auf und verließ das Café, ohne seinen Cappuccino zu bezahlen.
»Was darf ’s denn sein?«, fragte die Kellnerin. Meine Hände fuchtelten nämlich immer noch hilflos in der Luft herum.
»Die Rechnung bitte«, seufzte ich.
Nach dieser Erfahrung war ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich wählte ein Café mit einer Hintertür aus, durch die ich verschwinden konnte, bevor die Rechnung an mich ging. Wir Jungfrauen sind nämlich auch sparsame Naturen und halten unser Geld gern zusammen. Beim Treffen mit meisenfreund007 verdrückte ich mich, als ich merkte, dass er unter einem rätselhaften Zwangsverhalten litt. Offenbar musste er mit Zucker Muster auf die Tischdecke gießen, um sie dann mit angefeuchteter Fingerspitze aufzutupfen und abzulecken. Nachdem ich mir das eine Viertelstunde lang angeschaut hatte, wusste ich, dass meisenfreund007 an seine eigene Meise gedacht hatte, als er sich diesen nick gegeben hatte.
Leider war auch Max, 29, 1,89, NR, schüchtern, aber für jeden Spaß zu haben, ein absoluter Reinfall. In Wirklichkeit hieß er nämlich Dietmar, war 39 statt 29 und genauso groß wie ich, was bedeutete, er war recht klein. Außerdem war er kein bisschen schüchtern. Er erklärte mir bei unserem ersten Treffen, er habe sich Max genannt, zehn Jahre jünger und zwanzig Zentimeter größer gemacht, weil seiner Erfahrung nach sonst nicht die richtigen Frauen auf seine Anzeige geantwortet hätten. Da hatte er natürlich Recht, ich war das beste Beispiel dafür. Für diesen Spaß war ich aber absolut nicht zu haben und verschwand durch die bereits erprobte Hintertür.
Und in dem Stil ging es jahrelang weiter.
Am nettesten war noch Ole gewesen, mit dem meine Freunde Caroline und Bert mich hatten verkuppeln wollen. Auch wenn ich hellhörig hätte werden sollen, als sie mir sagten, er sei frisch von seiner langjährigen Freundin getrennt. An Ole stimmte auf den ersten Blick einfach alles: Er hatte ein sehr nettes Lachen, helle Haare, die ihm ständig in die Stirn fielen, und keine erkennbare Neurose. Außerdem mochte er dieselben Dinge wie ich: alte Katharine-Hepburn-Filme, italienisches Essen und Tom Waits. Ole war Zahnarzt und gerade dabei, seine erste eigene Praxis in der Stadt zu eröffnen. Wir gingen ein paar Mal zusammen weg, und mit jedem Treffen gefiel er mir besser. Aber gerade als ich begann, mir das einzugestehen, tauchte seine Ex-Freundin wieder auf, und acht Wochen später waren die beiden verheiratet. Ich tat so, als würde ich mich für Ole freuen, aber in Wirklichkeit freute ich mich natürlich kein bisschen.
Ich hatte überhaupt mehr und mehr Probleme damit, mich für andere zu freuen, was mich fast übergangslos zu 3. Sonstiges Leben führt.
Ich hatte nie vorgehabt, mit dreißig noch Single zu sein. Eigentlich hatte ich das ganz anders geplant: Mit spätestens achtundzwanzig wollte ich mit dem Mann meiner Träume verheiratet sein, mit neunundzwanzig das erste Kind bekommen und mindestens einen Apfelbaum gepflanzt haben.
Stattdessen heirateten fast alle meine Schwestern, Cousins, Cousinen und Freunde. Sogar Klaus Köhler und Britt Emke. Sie bekamen Kinder, bauten Häuser und pflanzten Apfelbäume, während ich in Cafés durch Hintertüren verschwand. Tine und Frank, Rika und Claudius, Caroline und Bert, Marta und Marius, Charly und Ulrich, Volker und Hilla, Ole und Mia, Lulu und Patrick – wo man hinsah, nur glückliche Paare.
Das so genannte »sonstige Leben« sah als Single unter lauter Paaren ziemlich trostlos aus. Erst recht, seit meine Freunde angefangen hatten, Kinder zu bekommen. Wenn sie überhaupt mal Zeit hatten, dann schliefen sie im Kino ein, rochen nach saurer Milch und redeten nur über Probleme, einen Kindergartenplatz zu ergattern oder eine Schultüte zu basteln.
Trotzdem hätte ich nichts dagegen gehabt, auch so ein Langeweiler zu werden. Mit dem richtigen Mann, natürlich.
»Du bist viel zu anspruchsvoll«, sagte Ulrich immer. »Das ist dein Problem: Du suchst nach einem Mann, den es überhaupt nicht gibt.«
Ulrich war mein Exfreund, der, wegen dem ich unter anderem das Milchkännchen von Oma Thaler an die Badezimmertür gepfeffert hatte. Das einzige Stück, das den familiären Meißner-Porzellan-Super-GAU auf der Hochzeit meiner Tante Alexa überlebt hatte. Es war nicht unbedingt meine Altersversorgung, dieses Milchkännchen, aber ich hätte es niemals durch die Gegend geworfen, wenn ich nicht so wütend gewesen wäre. Ulrich schaffte es immer, mich auf die Palme zu bringen, schon durch seine ganz spezielle Art, einfach nichts zu tun.
Während unserer dreijährigen Beziehung hatte Ulrich eigentlich immer nur herumgelegen, auf dem Teppich, auf dem Sofa, in der Badewanne, im Bett. Und alles, was Ulrich gehörte oder was er benutzte, lag ebenfalls herum. Klamotten, Socken, Unterwäsche, Teller, Besteck, Pizzakartons, Bierflaschen, Hanteln, Papiere, Bücher und Müll. Meine Wohnung war klein, und deshalb störte es mich sehr, auf Schritt und Tritt über Ulrich und seine Sachen zu stolpern. Aber Ulrich meinte, weil er die Hälfte der Miete zahlte, dürfe er auch »er selbst sein«, wie er es nannte. Dazu gehörte, dass er Heilerde-Meersalz-Bäder nahm und danach nie die braune Kruste aus der Wanne entfernte. Dass er alle Jogurts aß, aber niemals neue kaufte. Dass er die Milch aus dem Kühlschrank nahm, sie aber nie zurückstellte. Dass er Bonbons aß und die Verpackung einfach auf den Boden fallen ließ.
Obwohl Ulrich sehr viel Wert auf Körperhygiene legte und selber peinlich sauber und gepflegt war, fing die Wohnung an zu stinken. Nach Ulrichs Socken, seinen Turnschuhen und den Essensresten, die er überall vergammeln ließ. Egal, was ich auch versuchte und wie ich auch argumentierte, Ulrich wollte »er selbst« bleiben und weiter rumliegen und rumliegen lassen.
»Wenn es dich stört, dann räum es halt selber weg«, war seine Standard-Antwort, und so fing ich an, mit Gegenständen nach ihm zu werfen, bevorzugt mit Turnschuhen, Jogurtbechern und Wirtschaftsrecht-Büchern. Das Milchkännchen war ein reines Versehen gewesen.
Irgendwann liebte ich Ulrich nicht mehr, in dem ganzen Chaos waren seine guten Eigenschaften völlig verloren gegangen. Als ich endlich Schluss machte und meine Wohnung wieder für mich hatte, war ich wochenlang einfach nur sehr erleichtert. Ulrich und ich schafften es sogar, Freunde zu bleiben. Es war wieder richtig schön, sich mit ihm zu treffen, ohne ihn anzuschreien oder mit Sachen zu bewerfen. Beinahe hätte ich mich von neuem in ihn verliebt, aber da fing er was mit meiner besten und ältesten Freundin Charly an und zog bei ihr ein.
Es tat schon ein bisschen weh, dass Ulrich nun in Charlys Wohnung herumlag, und ich musste öfter schlucken, wenn Charly bei mir über seine Socken auf dem Couchtisch, die krustigen Heilerde-Meersalz-Ränder in der Badewanne und die leergefutterten Jogurtbecher hinterm Sofa stöhnte. Richtig weh tat es allerdings erst, als Ulrich sein Jura-Studium beendet hatte (im Liegen, herzlichen Glückwunsch!) und schlagartig aufhörte, »er selbst« zu sein. Sein neues Selbst trug einen Anzug und verließ jeden Morgen pünktlich um acht Uhr die Wohnung, um massenhaft Kohle zu scheffeln. Von dieser Kohle bezahlte Ulrich – und das war die Krönung! – eine Putzfrau, die zweimal in der Woche kam. Ab und zu ließ er sicher noch ein Bonbonpapierchen auf den Boden segeln, aber alles in allem war er nicht wiederzuerkennen. Die Wohnung auch nicht. Im letzten Jahr haben Ulrich und Charly geheiratet, und ich war einer der Trauzeugen und musste so tun, als ob ich mich für die beiden freuen würde.
Natürlich habe ich mich schon selber gefragt, ob ich wirklich zu anspruchsvoll bei der Partnersuche war, aber was konnte ich dafür, dass meine Hormone keinen Freudentanz aufführten, wenn sie hammerhart31 gegenübersaßen?
Es war eine harte Lektion, aber allmählich begriff ich, dass es Dinge gibt, die sich, egal, wie systematisch man das auch angeht, einfach nicht planen lassen.
Letzte Woche, genau drei Tage, bevor meine Mutter mir die Schlaftabletten übergab, rief Charly an, um mir mitzuteilen, dass ich Patentante werden würde. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich verstand, was sie meinte.
»Du bist schwanger!«, rief ich dann aus.
»Jaaaa«, jubelte Charly. »Verdammte Scheiße, ist das nicht wunderbar?«
Tja, was für eine Frage! Es war ohne Zweifel wunderbar. Für Charly und für Ulrich. Für mich war es ziemlich furchtbar, ich war selber überrascht, wie furchtbar es für mich war.
Ich schaffte es gerade noch, mir einen Glückwunsch abzuringen, bevor ich behauptete, die Milch koche über, und schnell auflegte.
Dann brach ich weinend über dem Küchentisch zusammen und verstand die Welt nicht mehr. Was war aus mir geworden? Ein neidisches, missgünstiges Monster, dass sich noch nicht mal über die schönste Sache der Welt freuen konnte: Meine beste Freundin bekam ein Kind, und ich, ich wollte am liebsten sterben.
Ja wirklich. Am liebsten wäre ich tot gewesen.
Als mir das klar wurde, hörte ich vor Schreck auf zu weinen und überlegte – typisch Jungfrau eben –, was ich dagegen tun konnte. Zuerst schaute ich im Internet unter »Selbstmordgedanken« nach und diagnostizierte mir selber Depressionen.
Es gab massenhaft Websites zu diesem Thema. Und offenbar haufenweise Menschen, die Depressionen hatten. Da musste ich mir gar nicht so seltsam vorkommen. Wir Depressiven bildeten die Basis für einen sehr lukrativen Wirtschaftszweig.
Man unterschied zwei Gruppen, nämlich endogene und reaktive Depressionen. Endogen Depressive waren von innen heraus schwermütig, reaktiv Depressive reagierten auf äußere Umstände. Ein wenig erleichtert, dass ich nicht völlig grundlos verrückt geworden war, teilte ich mich der zweiten Gruppe zu.
Auf einer anderen Seite fand ich eine Unterteilung der Depressionen in neurotische, psychotische, somatogene und zyklothyme Störungen, und nach gründlichem Studium der Symptome entschied ich mich – wenn auch schweren Herzens – für die neurotischen Depressionen.
Ich war, das muss ich wohl nicht noch extra betonen, alles andere als glücklich mit dieser Diagnose. Das würde doch die Partnersuche noch um einiges erschweren.
»Hallo, mein Name ist Gerri Thaler, und ich bin neurotisch. Reaktiv neurotisch depressiv.«
Erst wenn man sich entschlossen hat, die Konsequenzen aus der Neurose zu ziehen, kann es einem egal sein, was die Leute von einem denken. Aber so weit war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Noch war ich fest entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Systematisch.
Als das Telefon klingelte, zuckte ich zusammen. Sicher war das wieder Charly, die sich wunderte, dass ich nicht zurückrief, nachdem ich meine erfundene Milch gerettet hatte.
Aber es war eine fremde Frauenstimme. »Spreche ich mit Gerda Thaler?«
»Ja«, sagte ich zögerlich. Fast erwartete ich, dass die fremde Frau sagen würde: »Schämen Sie sich denn gar nicht, wegen der Schwangerschaft Ihrer besten Freundin Depressionen zu bekommen?«
Aber sie sagte etwas ganz anderes. Sie sagte: »Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen.«
Ich seufzte erleichtert auf. Noch vor kurzem musste ich zu zeitaufwändigen Methoden greifen, um diese »Sie haben gewonnen«-Leute wieder loszuwerden. Keine Ahnung, wo die immer meine Telefonnummer herhatten, aber es rief fast jede Woche jemand an, der behauptete, dass ich gewonnen hätte, na ja, jedenfalls beinahe und so gut wie gewonnen. Man musste nur noch ein Dauerlos für irgendeine Lotterie kaufen, und schon war man Millionär, jedenfalls beinahe und so gut wie. Wenn man nicht mitmachen wollte, dann fragten sie immer das Gleiche: »Was? Wollen Sie denn nicht Millionär werden?« Wahrscheinlich hatten sie alle dasselbe Telefonmarketing-Seminar besucht, bei dem man vor allem eins lernte: Lassen Sie sich nicht abwimmeln, nicht mal, wenn bei Ihrem Gesprächspartner gerade die Milch überkocht.
Charly legte deshalb bei solchen Anrufen immer gleich auf. Manchmal, wenn sie eigentlich einen anderen Anruf erwartet hatte, sagte sie auch noch etwas Gemeines, bevor sie auflegte: »Such dir einen neuen Job, du Armleuchter!« oder »Fick dich ins Knie!!« (Charly hatte überhaupt keine Manieren.)
Ich nahm mir jedes Mal vor, das – bis auf die unflätigen Ausdrücke – genauso zu machen, aber ich schaffte es einfach nicht. Mir schien das diesen armen, freundlichen Menschen gegenüber nicht fair zu sein, einfach den Hörer aufzuknallen, ohne die Höflichkeit zu besitzen, sich ihr Anliegen anzuhören. Nicht jeder konnte sich schließlich seinen Job aussuchen. Obwohl ich bereits einmal ein Los gekauft hatte und weder die versprochene Mikrowelle erhalten noch Millionär geworden war, hatte ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich kein Los kaufte. Um das Auflegen des Hörers vor mir selber zu rechtfertigen, musste ich einen triftigen Grund finden, sonst ging es mir den ganzen Tag schlecht.
Bodenlose Enttäuschung war zum Beispiel ein triftiger Grund. Das ging dann in etwa so:
»Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen, Frau Thaler! Sie sind in der Endauslosung um einen wunderschönen Beetle, Frau Thaler, und Sie …«
»Was, echt?«, hier unterbrach ich die freundliche Frau oder den freundlichen Mann begeistert. »Ein Beatle? Welcher ist es denn? Paul McCartney? Oder Ringo Star? Na ja, wunderschön ist vielleicht was anderes, aber – egal! Für wie lange darf ich den denn behalten? Und meinen Sie, der macht auch Hausarbeit?«
»Hahaha, ich spreche natürlich von dem Auto! Einem wunderschönen Beetle-Cabrio. Das wäre doch was für den Sommer, oder etwa nicht, Frau Thaler? Und Sie sind ja nicht nur bald stolze Besitzerin des Beetles, sondern mit ein bisschen Glück auch Millionärin! Denn wir haben das Vorzugslos für Sie reserviert. Wenn Sie sich jetzt entscheiden, ein Los zu kaufen, dann haben Sie die Chance auf 2,5 Millionen Euro Gewinn! Na, ist das nichts? Und das für nur sechs Euro in der Woche!«
So, und damit hatte ich ja einen Grund. Bodenlose Enttäuschung eben.
»Also, das finde ich jetzt nicht nett von Ihnen«, konnte ich dann sagen, bevor ich energisch die Aus-Taste drückte. »Erst machen Sie mir den Mund mit Paul McCartney wässrig, und jetzt wollen Sie mich so billig abspeisen. Wie soll mir denn ein Auto bitteschön im Haushalt helfen, hm? Und dann auch noch ein Cabrio! Wo ich doch so empfindlich gegen Zugluft bin! Rufen Sie hier nie wieder an! Let it be!«
Damit war ich den Anrufer zwar los, hatte aber trotzdem ein schlechtes Gewissen. Weil ich ja schon wieder kein Dauerlos gekauft hatte.
Aber das Problem hatte ich heute, dank meiner Eigendiagnose im Internet, nicht. Sie glauben ja gar nicht, wie schnell selbst hervorragend geschulte Telefonmarketing-Profis den Hörer auflegen, wenn man ihnen erzählt, dass man unter neurotischen Depressionen leidet. Spätestens, wenn man versucht, den Unterschied zwischen neurotischen und psychotischen Verstimmungen zu erklären. Und man braucht absolut kein schlechtes Gewissen mehr zu haben!
***
Nachdem ich die Frau so überraschend einfach losgeworden war, klebte ich mich wieder vor den Bildschirm, um mehr über mich und meine Depressionen zu erfahren. Es war eine wirklich deprimierende Lektüre. Immerhin, las ich, waren die Beschwerden von uns neurotisch Depressiven im Gegensatz zu den psychotisch Depressiven auf Grund einer wie auch immer gearteten Konfliktlage verständlich und einigermaßen nachvollziehbar.
Ach ja?
Aber wer machte sich schon die Mühe, zu verstehen, dass man sich überhaupt in einer Konfliktlage befand? Möglicherweise wäre ich mit meiner depressiven Verstimmung dann auf Verständnis gestoßen, wenn meine ganze Familie gerade von einer Lawine verschüttet worden wäre, aber sicher verstand niemand, warum ich am liebsten sterben wollte, weil meine beste Freundin ein Kind erwartete.
Ich verstand es ja selber nicht.
»Hör auf zu jammern und fang an, positiv zu denken« – schon als Kind habe ich diesen Satz gehasst. Meine Mutter hat ihn beinahe an jedem Tag meines Lebens zu mir gesagt.
Jahrelang habe ich mit mir selbst gehadert, weil ich es einfach nicht schaffte, positiv zu denken. Über Klaus Köhler zum Beispiel. Oder über meisenfreund007. Hätte ich positiv über Menschen gedacht, die in Restaurants Zucker von der Tischdecke lecken, hätte ich nie die Hintertür benutzen müssen. Positivdenken ist, so betrachtet, eine absolut idiotensichere Methode der Problemlösung. Selbst dann, wenn es den Gesetzen der Logik zur Folge eigentlich gar keine Lösung gibt, so unlogisch das auch klingen mag.
Es war schrecklich für einen analytischen Menschen wie mich, die Lösung eines Problems direkt vor Augen zu haben, aber trotzdem nicht nutzen zu können. Jetzt, wo ich mich im Internet schlau machte, wusste ich endlich, warum: »Positives Denken« gehört definitiv nicht zum Repertoire eines Menschen mit neurotischen Depressionen.
Ich musste diese Neigung wohl schon als Kind gehabt haben, denn mir fiel beim Lesen sofort die Sache mit dem Schokoladenosterhasen ein. Ich war acht Jahre alt gewesen und hatte ihn sehr in mein Herz geschlossen, diesen Osterhasen, so sehr, dass ich beschlossen hatte, ihn nicht zu essen, sondern mit ihm zusammen alt zu werden.
Aber meine verfressene Schwester Lulu hatte bereits alle ihre Süßigkeiten aufgefuttert, und jetzt war sie scharf auf Ralf.
Damals war meine Mutter gerade auf einem Gesundheits- und Reformhaustrip, und Süßigkeiten waren in unserem Haushalt sehr rar gesät. Es gab sie nur zu Weihnachten und zu Ostern. Wenn Besuch kam, der uns Schokolade oder Smarties mitbrachte, wurden die Sachen von meiner Mutter konfisziert und nur smartieweise wieder herausgegeben. Manchmal kauften wir Süßigkeiten von unserem Taschengeld, aber das war streng verboten, und die Sachen mussten daher außerhalb des Hauses unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verschlungen werden, was wenig befriedigend war. Wir beneideten alle Kinder, in deren Haushalt es eine frei zugängliche Nasch-Schublade gab, und wir neigten dazu, uns mit diesen Kindern enger zu befreunden als mit anderen. Charly war wahrscheinlich nur deshalb meine beste Freundin geworden, weil sie so viel Kinderschokolade essen durfte, wie sie wollte, und deshalb keine Probleme hatte, mir welche abzugeben.
»Ihr werdet es mir noch mal danken«, sagte meine Mutter immer, wenn wir uns beschwerten, dass das einzig Süße, das wir am Tag bekamen, die Rosinen im Müsli waren. Soviel ich weiß, hat sich bis heute noch niemand von uns bei ihr bedankt.
Lulu litt von uns allen am meisten unter dem akuten Schokoladendefizit, und sie suchte überall nach Ralf. Sie bot mir sogar an, in ihrem Tagebuch zu lesen, wenn ich ihn freiwillig rausrückte. Aber ich stand zu Ralf.
Nach ein paar Tagen fand Lulu ihn schließlich im Schuhkarton oben auf dem Kleiderschrank, wo ich ihn unter einer Lage Barbiekleider in Sicherheit gewähnt hatte. Ich stimmte ein mörderisches Gebrüll an, als ich nach Hause kam und sah, dass nur noch das Glöckchen von Ralf übrig war.