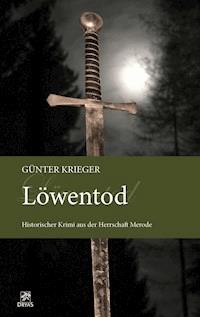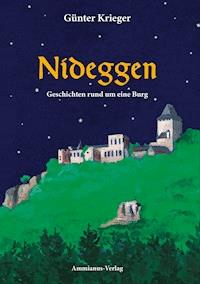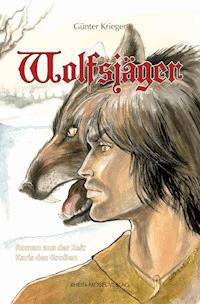8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende des 9. Jahrhunderts fallen die Wikinger mordend und plündernd in das marode Karolingerreich ein. Vor allem das Rheinland und die Eifel werden aufs Fürchterlichste verwüstet. Der Adel hält sich mit Hilfe von Schutzgeldzahlungen schadlos und rührt kaum einen Finger, dem blutigen Treiben Einhalt zu gebieten. Leidtragende sind die Bauern. Vielerorts beginnen sie, sich zu bewaffnen, um sich ihrem Schicksal nicht kampflos zu ergeben. Auch Uta, eine junge Frau mit seherischen Gaben, befindet sich auf der Flucht vor den Wikingern. Begleitet wird sie von ihrem kränkelnden Bruder Hugo und dem Knecht Arbo. Zuflucht erhoffen sie sich in der Bischofsstadt Mainz. Doch der Weg dorthin gerät zu einer Odyssee voller Gefahren. Uta geht es nicht nur um den Schutz hinter den wehrhaften Stadtmauern. In Mainz hält sich der Mörder ihres Vaters auf, der seiner Strafe nicht entgehen darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Günter Krieger
Furor Normannicus
Ein Eifelroman aus der Wikingerzeit
Ein Eifelroman aus der WikingerzeitEifeler Literaturverlag 2022
Furor
Normannicus
Günter Krieger
1. Auflage 2002
© GrenzEcho Verlag
erschienen unter dem Titel »Drachensturm«
2., komplett überarbeitete Auflage 2022
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Umschlaggestaltung: Dietrich Betcher
Abbildungsnachweis: © Iobard – stock.adobe.com
Druckbuch:ISBN-10: 3-96123-036-6
ISBN-13: 978-3-96123-036-5E-Book:ISBN-10: 33-96123-056-0
ISBN-13: 978-3-96123-056-3
»Lass deine Begierde, so findest du Ruhe.«
Thomas von Kempen
Erster Teil
Die Gabe
1
Fünfzig Jahre!
Bei allen Engeln des Himmels, fast fünfzig Jahre sind vergangen seit den Tagen der Dunkelheit – ein ganzes Menschenalter. Fünfzig Jahre, und der Allmächtige gewährt mir immer noch die Gnade, auf dieser Welt zu weilen, die Er in nur sechs Tagen schuf. Fünfzig Jahre, in der die Welt sich gewandelt hat und nichts mehr ist, wie es war. Die Reiterhorden der Ungarn, die heute das Reich bedrohen und plündernd und mordend durch das Land ziehen – was sind diese Wilden im Vergleich zu den schrecklichen Nordmännern, die uns vor einem halben Jahrhundert glauben ließen, unser Ende stünde bevor?
»A furore Normannorum libera nos, Domine!«1
Noch heute höre ich die inbrünstig gesprochenen Worte des Abtes, widerhallend von den kalten Mauern der Kapelle von Stablo. Obschon die Gefahr durch die Nordmänner längst gebannt und andere Heiden unseren Frieden bedrohen, ertappe ich mich manchmal, wie ich jenes Stoßgebet gen Himmel schicke. Hunderttausend wilde Ungarn wären nicht in der Lage, den Schrecken der Nordmänner zu verbreiten.
Doch vielleicht trügt mich die Erinnerung. Welches Recht habe ich, den heute lebenden Menschen zu erklären, dass die Angst, die sie empfinden, nichts im Vergleich ist zu der, die uns Menschen damals beherrschte? Habe ich ein Recht, derartige Vergleiche zu ziehen, ich, der ich hinter sicheren Klostermauern lebe und darauf vertraue, dass unser König Heinrich Herr über diese ungarische Plage wird? Alt und gebeugt bin ich geworden, die Furcht vor dem Sterben ist mir schon seit langem abhandengekommen, denn ich freue mich auf das ewige Paradies, das meiner harrt. Damals aber war ich jung, wollte leben, wollte dem Herrgott ein Leben lang wohlgefällig sein, um mir den Platz im Paradies zu sichern. Was Wunder, dass ich mich fürchtete, die Nordmänner könnten dieses fromme, aber auch eigennützige Vorhaben vereiteln. Deshalb muss ich mir die Frage gefallen lassen, ob es gerecht ist, die Furcht meiner Zeitgenossen von heute zu belächeln. Ich habe mein Leben gelebt. Es war reich und erfüllt. Ich habe nichts mehr zu erwarten, außer den Tod. Aber diese Menschen wollen weiterleben. Weshalb sollte ihre Furcht vor den plündernden und mordenden ungarischen Scharen also nicht berechtigt sein?
Und doch: Die Heutigen, die in diesem neuen Reich leben, dürfen behaupten, einen starken König über sich zu wissen, der entschlossen ist, sich der drohenden Gefahr mit Heeresmacht entgegenzustellen. Erst vor wenigen Wochen ist es in Thüringen so geschehen.2 Im zerfallenden Reich der Karolinger jedoch waren wir den Nordmännern schutzlos ausgeliefert. Heere, die sich ihnen in den Weg stellten, gab es zunächst nicht. Heute stelle ich mir die Frage, ob die schwachen Herrscher damals willens waren, der Not ein Ende zu bereiten. Was scherte sie das Schicksal der leidenden Bevölkerung? Die letzten Karolinger waren damit beschäftigt, sich gegenseitig das Leben schwerzumachen. Seit Jahrzehnten tobten Bruderkriege. Immer wieder wurde das einst so mächtige Reich des großen Karls neu aufgeteilt. »Wie Hyänen, die sich um ein Stück Aas balgen«, pflegte der Bruder Abt – Gott habe ihn selig – stets verächtlich zu sagen.
Schon damals war das Frankenreich Karls des Großen zu einem Mythos geworden. Kaum jemand lebte noch, der sich an diese Zeit erinnern konnte. Manche behaupten heute, es sei eine glorreiche Zeit gewesen. Ob sie es wirklich war, will ich nicht beurteilen. Als ich geboren wurde, ruhte der große Karl schon seit fünfzig Jahren in seiner kühlen Gruft unter der Aachener Pfalzkapelle. Legenden rankten sich schon damals um ihn. Sieben Jahrzehnte auf dieser Erdenscheibe haben mich gelehrt, wie gefährlich es ist, dem Überlieferten uneingeschränkt Glauben zu schenken. Nur eines ist unbestritten wahr: Niemals gelang es den Nordmännern zu Karls Lebzeiten, plündernd in sein Reich einzufallen, obgleich sie es nicht unversucht ließen. Im Norden hatte der Kaiser Küstenwachen eingerichtet und befestigte Stützpunkte angelegt. Noch blieb die Bevölkerung verschont vor der Mordlust und Beutegier der Nordmänner, die in anderen Teilen der Welt umso mehr wüteten. Doch schon während der Regierungszeit des frommen Ludwigs, des glücklosen Sohnes des großen Karolingers, häuften sich die Überfälle der gottlosen Heiden. Niemals, so erscheint es mir, ist der ernsthafte Versuch gemacht worden, diese höllische Plage mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Frage, ob dieses Versagen mit fehlendem Gottvertrauen oder mit der Unvernunft der Herrschenden zu erklären ist, möchte ich nicht beantworten. Städte wie Paris, Nantes und Hamburg3 waren längst normannischen Feuersbrünsten zum Opfer gefallen, als ich in Kornelimünster, unweit der Aachener Pfalz, das Licht der Welt erblickte. Die Feuer der Hölle sollten künftig nicht nur in fernen Städten wüten, sondern auch unsere Heimat in Schutt und Asche legen, ihr Tod und Verwüstung bringen. Im Rheinland sollte die Sangesfreude für lange Zeit verstummen.
Da meine Sinne nun von Tag zu Tag schwächer werden und mein Leben sich allmählich dem Ende zuneigt, habe ich beschlossen, die Ereignisse niederzuschreiben. Ich tue dies nicht zuletzt deshalb, weil man mich schon oft dazu aufgefordert hat. Ich tue, damit nachfolgende Generationen daraus Kraft schöpfen mögen. Denn obschon ich von Not und Leid, von Krieg und Tod berichten werde, soll der Leser sich stets vor Augen halten, dass alles Unglück nicht das Ende der Welt bedeutet. Denn die Stunde des Weltenendes kennt nur unser Heiland, dessen Gnade unermesslich ist.
Meine Geburt fiel auf den Tag des Heiligen Johannes. Als zehntes Kind und sechster Sohn eines freien Bauern kam ich in den frühen Morgenstunden zur Welt. Meine Mutter starb kurz nach meiner Geburt an einer Blutung; sie war bereits meines Vaters zweite Ehefrau gewesen. Seiner ersten Frau war das gleiche Schicksal widerfahren, sie starb bei der Geburt einer meiner Schwestern.
Jahre später heiratete mein Vater ein drittes Mal. Mit Hilmintrud, die ihm bis dahin als Magd gedient hatte, zeugte er keine Kinder. Hilmintrud, die um einiges jünger war als mein Vater und kaum älter als ich selbst, überlebte ihren Gatten schließlich um zwei Jahrzehnte. Als der Vater das Zeitliche segnete, weilte ich, Theodorus, bereits als Novize bei den Benediktinern von Stablo4.
Sommer 875 A. D.
Das warnende Gezeter des Eichelhähers musste meilenweit zu hören gewesen sein. Die von dem aufmerksamen Waldwächter proklamierte Gefahr bestand aus zwei etwa zwölfjährigen Mädchen, die Hand in Hand durch den sommertrockenen Wald streiften und in regelmäßigen Abständen laut kicherten.
»Bist du sicher, dass er schon Haare auf der Brust hat?«
»Todsicher! Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen.«
Die andere blieb stehen. Braune Haarsträhnen klebten in ihrem hübschen sommersprossigen Gesicht, wo sich ihr Mund zu einem ungläubigen Lächeln verzog. »Gesehen? Rotrud! Hast du etwa ... hast du mit ihm –?«
»Nein, natürlich nicht. Wo denkst du hin, Uta?« Abermals kicherten beide.
»Woher weißt du es dann?«
»Weil ich ihn beobachtete, als er mit ein paar Männern am Wassergraben der Burganlage arbeitete. Er trug nur eine Hose.«
»Du bist verliebt in ihn, nicht wahr?«
Rotrud mied Utas Blick und setzte ihren Weg fort. Mit hüpfenden Schritten folgte ihr Uta.
»Gib’s ruhig zu.«
»Ach, Uta ...«
»Aber wie steht’s mit ihm? Mag Grifo dich auch?«
»Ich glaube schon. Jedenfalls hat er mir gewunken, als er mich sah.«
»Und was geschah dann?«
»Nichts. Mein Vater hatte inzwischen seine Angelegenheiten geregelt. Wir sind dann wieder nach Hause gegangen.«
»Weiß Grifo, dass du kommst?«
»Wie hätte ich ihm das denn mitteilen sollen?«
»Warum hast du mich gebeten, dich zu begleiten? Du willst doch bestimmt alleine mit ihm sein. Was ich gut verstehen könnte.«
Diesmal war es Rotrud, die im Gehen verharrte und ihrer Freundin ergeben in die Augen sah. »Ach, weißt du, Uta, es ist so: Ich bin doch so schüchtern. Aber wenn du bei mir bist, ist alles anders. Dann habe ich den Mut, den ich sonst nicht hätte.«
Uta streichelte der Freundin lachend durchs blonde Haar. »Also schön, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Trotzdem wirst du irgendwann ohne mich auskommen müssen, wenn du Grifo für dich alleine haben willst. Komm jetzt! Sonst sind wir morgen noch nicht bei der Burg.«
»Einen Augenblick!«
»Nun?«
»Uta! Du bist meine beste Freundin. Ich will, dass du es immer bleibst.«
»Immer und ewig. Was sollte uns denn entzweien?«
Es war ein brütend heißer Sonntagnachmittag im August. Die Mädchen genossen den Schatten, den die Bäume spendeten. Eine ganze Weile schwiegen sie, versunken in ihre Gedanken. Zu ihrer Rechten, wo der Wald sich lichtete, flimmerten die uralten Römermauern Jülichs am Horizont. Doch die Stadt war nicht ihr Ziel. Als sie den Waldrand erreichten, lag die Burg plötzlich vor ihnen. Die von einer Palisade umgebene Behausung des Gaugrafen auf der Spitze des Hügels war der prallen Sonne schutzlos ausgeliefert. Am Fuß standen die hölzernen Hütten der ebenfalls umzäunten Vorburg, wo Rotrud ihren Liebsten wähnte. Ein breiter Wassergraben, der sich aus der nahen Rur speiste, legte sich schützend um die gesamte Anlage, in der sich nichts zu regen schien.
»Wie ausgestorben«, murmelte Rotrud. Nachdenklich rieb sie sich das Kinn und stutzte dann. »Die Nordmänner! Vielleicht waren sie hier und haben alle umgebracht.«
»Unsinn!« Uta schüttelte den Kopf. »Hätten die Nordmänner hier gewütet, dann sähe es wohl anders aus. Bedenke, heute ist Sonntag. Und an dem sollte man ruhen, sagen die Priester. Im Gegensatz zu uns haben sich die Leute das hier wohl zu Herzen genommen.«
Rotrud, immer noch skeptisch, blinzelte. Erst als hinter dem Zaun das Geschrei zweier spielender Kinder und das Gebell eines Hundes zu hören waren, legte sich ihr Misstrauen. »Und wie bekomme ich jetzt Grifo zu Gesicht?«
»Ganz einfach: Du spazierst über diese Holzbrücke dort, klopfst ans Tor und fragst nach ihm.«
»Ich soll ...? Nein, das kann ich nicht.«
»Nein?«
Rotrud fuchtelte verzweifelt mit ihren Fingern. »Was ist, wenn seine Eltern mich sehen? Und überhaupt: Ich käme mir töricht vor.« Über ihr Gesicht huschte ein trotziger Schatten. »Außerdem ist es Sache des Mannes, um eine Frau zu freien. Nicht umgekehrt.«
»Das wird nicht einfach mit dir«, seufzte Uta.
»Du musst mir helfen«, bettelte die Freundin.
»Gewiss. Verschwinde ins Gebüsch und warte, bis ich mit Grifo zurückkomme.«
Rotrud riss Uta an sich und küsste stürmisch ihre Wange. »Das werde ich dir niemals vergessen.«
»Nicht der Rede wert. Und jetzt mach dich dünn.«
Uta schritt über die knarrende Brücke. Im Wasser trieben drei träge Enten. Das Hundegebell hinter der Umzäunung wurde lauter. Es roch nach Fisch und brackigem Wasser. Als Uta das Tor erreichte, ließ sie ihre Faust mehrmals gegen das Holz krachen.
»Heda!«, rief sie, als nach einer Weile noch niemand geöffnet hatte. »Besitzt jemand die Güte, nach meinem Begehr zu fragen?«
Endlich wurde von innen ein Riegel beiseitegeschoben. Hinter dem sich öffnenden Spalt erschien das übellaunige, stoppelige Gesicht eines gedrungenen Mannes. Fliegen umkreisten seinen Kopf, in dem zwei reizbare Augen blitzten.
»Was willst du?«
»Den Grifo sprechen.«
»Dumme Göre, es ist Sonntag. Verschwinde!« Er machte Anstalten, das Tor wieder zu schließen. Uta stemmte sich mit aller Gewalt dagegen. »Den Grifo möchte ich sprechen«, beharrte sie.
»He, bist du übergeschnappt? Weg mit dir, bevor ich dir den Hintern versohle.«
»Niemand versohlt mir den Hintern. Du erst recht nicht, Meister Ricbald.«
Der andere gab dem Druck des Tores nach. Auge in Auge standen sie sich gegenüber. Trotzig blickte Uta zu ihm empor. Den Stallknecht kannte sie aus den Erzählungen ihres Vaters. Ricbalds Kinnlade zuckte verunsichert. Da war etwas in den Augen des Mädchens, das ihm Unbehagen bereitete.
»Zum Teufel, was willst du?«
»Wie oft muss ich es wohl noch sagen: Wo ist Grifo?«
Der Stallknecht atmete tief durch. Es durfte doch nicht sein, dass er sich von einer Göre kommandieren ließ.
»Jetzt will ich dir mal was sagen, Mädchen: Der Gaugraf mag es nicht, wenn man hier herumlungert. Erst recht nicht am Tag des Herrn.« Drohend hob er den Zeigefinger, unter dessen Nagel sich der Schmutz der letzten zehn Jahre befand. »Also pack deine Beine und verschwinde endlich. Und zwar auf der Stelle!«
»Wenn du mir nicht den Grifo holst«, erwiderte Uta ungerührt, »werde ich dafür sorgen, dass der Gaugraf ein paar Dinge über dich erfährt, die er besser nicht wüsste.«
Ricbald lachte rau. »So? Und um welche Dinge handelt es sich dabei, he?«
»Wirst schon sehen.« Sie blickte ihm weiter frech in die Augen.
»Ich habe vor dem Gaugrafen nichts zu verbergen.«
»Tatsächlich nicht? Na schön.« Uta zuckte mit den Schultern und machte kehrt. »Dann wirst du dich bald sehr wundern. Hast es nicht anders gewollt.«
Mit offenem Mund starrte Ricbald ihr hinterher.
»Warte!«, krächzte er, als sie schon das Ende der Brücke erreicht hatte.
Uta blieb stehen, ohne sich umzuwenden. Erst als er sie mit gedämpfter Stimme dazu aufforderte, kehrte sie mit einem Grinsen zu ihm zurück.
»Glaub nur nicht, dass ich mich von dir einschüchtern lasse«, brummte Ricbald, als das trotzige Mädchen wieder vor ihm stand. »Ich bin ein rechtschaffener Mann. Einen Gefallen tue ich dir nur deshalb, weil heute Sonntag ist und ich ein so gutes Herz habe.«
»Aber gewiss doch.«
»Wie hieß doch gleich der Bursche, den du treffen willst? Grifo?«
»Korrekt. Der Sohn des Ledermachers.«
»Warte hier. Und rühr’ dich nicht von der Stelle!«
Er schloss das Tor. Uta grinste immer noch. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, ob der Stallknecht sich etwas hatte zuschulden kommen lassen, doch offenbar war sein Gewissen so rein wie seine Fingernägel.
Nach einer Weile kam ein kräftiger, vielleicht fünfzehnjähriger Bursche am Tor zum Vorschein. Sein Mund stand weit offen, denn vor ihm schien das Mädchen seiner Träume zu stehen. Grifo blickte in das schönste Gesicht, das er jemals gesehen hatte.
»Grifo?«
»Ja?«
»Mein Name ist Uta.«
»Uta«, echote der Bursche leise.
»Ich habe eine Überraschung für dich, Grifo.«
»Für ... mich?«
Sie forderte ihn mit einer Geste auf, ihr zu folgen. Sie ließen die Burganlage hinter sich und erreichten den Waldrand. Uta spähte ins Gebüsch.
»Rotrud! Wo steckst du denn?«
Irgendwo raschelte es, dann kam die Freundin zum Vorschein. Blonde Haarsträhnen verdeckten ihr Gesicht fast ganz, als wollte sie so ihre Verlegenheit verbergen. Uta packte ihre Hand und zog sie heran.
»Das ist meine Freundin Rotrud«, erklärte sie dem irritierten Grifo. »Ich glaube, du kennst sie, nicht wahr?«
»Wie? Kann schon sein.«
»Prima. Dann werde ich euch jetzt mal alleine lassen.«
»Alleine lassen?«, fragten Grifo und Rotrud im Chor.
»Alleine«, bestätigte Uta.
»Aber ...« Rotrud wischte ihr Gesicht frei. »Was soll ich denn nun tun?«, flüsterte sie flehentlich.
»Was schon? Unterhaltet euch.« Uta lächelte beiden zu.
»Und du? Du ... du könntest bei uns bleiben«, stammelte Grifo.
»Wozu? Ich werde in der Zwischenzeit ein wenig im Wald spazieren.«
»In den Wald?«, japste Grifo.
»Wann kommst du denn zurück?«, wollte Rotrud wissen.
»Wer weiß?« Lachend ließ Uta sie stehen.
Bald umgab sie wieder die wohltuende Kühle des Waldes, durch den das wilde Pochen eines Spechts schallte. Ihre Mission war erfüllt. Vorläufig. Blieb zu hoffen, dass die Freundin sich nicht allzu dumm anstellte.
Ein Findling am Wegrand lud Uta zum Sitzen ein. Hier, in der grünen Einsamkeit, hätte sie die Sorgen des Alltags am liebsten verdrängt. Doch Sorgen, das hatte sie längst erfahren, ließen sich nicht einfach beiseiteschieben. Wie beispielsweise die um den Vater, der sich stolz rühmte, ein freier Mann zu sein. Doch diese Freiheit schien ihn und die Familie zu erdrücken. Oder die Sorge um Mutter und Hugo, ihren jüngeren Bruder: Die beiden kränkelten seit einigen Jahren um die Wette. Früher war Mutter eine robuste Person gewesen, kräftig und unverwüstlich. Aber die Last der Arbeit auf Hof und Feldern hatte sie ausgezehrt, die einst so frischroten Wangen waren fahl und bleich geworden, sie redete nur noch, wenn es nötig war. Abends, wenn alle um das Herdfeuer versammelt saßen, herrschte lastendes Schweigen, nur das ständige Husten des kleinen Hugo brach dann die Stille.
Wieder der krächzende Eichelhäher. Uta horchte auf. Dumpfes Hufgetrampel. Sie erhob sich und spähte in die Richtung, aus der sich ein Reiter näherte.
Roland, der Sohn des Gaugrafen, zügelte seinen rabenschwarzen Hengst und widmete seine volle Aufmerksamkeit dem Mädchen, das da vor ihm stand.
»Sei gegrüßt, süße Waldfee!«
Er mochte um die zwanzig sein, sein Haar war kurz geschnitten und dunkel wie das seines Hengstes. Die übergroßen Augen, die tief in ihren Höhlen lagen, verliehen ihm etwas Unheimliches.
Uta wusste, wen sie da vor sich hatte. Oft genug waren Roland und der Gaugraf am Hof erschienen und hatten auf Vater eingeredet.
»Willst du meinen Gruß nicht erwidern?« Rolands Mundwinkel umspielte ein kaltes Lächeln.
»Wenn Euch so viel dran liegt: Seid mir ebenfalls gegrüßt, Herr Roland von Altenburg.«
Uta, die Arme vor ihrer Brust verschränkt, dachte nicht daran, seinem Blick auszuweichen.
»Ich weiß, wer du bist«, sagte Roland nach einer Weile.
»Dann bleibt es mir wohl erspart, mich Euch vorzustellen.«
»Du bist die Tochter des Bauern Wernar, der sich seit Jahren beharrlich weigert, meinem Vater seinen Hof zu verkaufen.«
»Genau die«, bestätigte Uta nickend.
»Du bist ganz schön keck.«
»Wenn Ihr das sagt.«
»Dein Vater ist nicht besonders klug.«
»Weil er sich nicht zu Eurem Sklaven machen lässt?«
»Es würde ihm viele Sorgen nehmen.«
»Ja, und vor allem die Freiheit.«
»Seine Freiheit!« Roland warf lachend den Kopf in den Nacken. »Wisst ihr Bauern denn überhaupt, was das ist: Freiheit?«
»Gewiss. Man ist niemandem hörig.«
»Es hat wohl wenig Sinn, mit dir über diese Frage zu streiten.«
»Ich habe Euch nicht um dieses Gespräch gebeten, Herr.«
Roland schob die Unterlippe vor. Einen Augenblick sah es so aus, als wollte er wenden und weiterreiten. Dann aber sprang er behände aus dem Sattel und trat Uta direkt entgegen. Uta wich einen kleinen Schritt vor ihm zurück.
»Gewachsen bist du«, stellte er fest. Sein Blick streifte ihre entblößten Füße, wanderte hoch über ihren grauen Trägerrock aus grobem Wollstoff, verharrte einen Augenblick an der Stelle, wo sich ihre Brüste abzeichneten, und blieb zuletzt in ihrem sommersprossigen, von kastanienbraunem Haar umrahmten Gesicht haften.
»Fast schon erwachsen. Und keineswegs hässlich.« Dass Uta es immer noch wagte, ihm offen in die Augen zu sehen, erweckte eine seltsame Art von Begierde in ihm. Er hob seine rechte Hand und legte sie auf die Wange des Mädchens. Mit dem Daumen streichelte er ihre Haut.
»Sind die Sommersprossen echt? Oder hast du die nur aufgemalt?«
»Sie sind echt. Und ich mag es nicht, wenn man mir ins Gesicht fasst.«
»Oh!« In gespielter Überraschung zog Roland seine Hand zurück. »Sie mag es nicht.« Er schielte auf ihre Brüste. »Vielleicht willst du lieber, dass ich woanders hinfasse.«
»Da muss ich Euch enttäuschen.«
»Du solltest es ruhig drauf ankommen lassen. Du wärst die Erste, der es nicht gefallen würde. Außerdem: Mein Wohlwollen kann dein Schaden nicht sein.« Grinsend hob er die Hand. Aber bevor er Uta von neuem berühren konnte, traf ihn eine schallende Ohrfeige.
»Du wagst es?«, brachte er mühsam hervor.
»An Eurem Wohlwollen liegt mir nichts!« Uta schickte sich an zu gehen.
»Bleib stehen!«
Unbeirrt ging sie weiter. Rasch hatte Roland sie wieder eingeholt und versperrte ihr den Weg, wagte aber nicht, sie nochmals anzufassen. Die Blicke der beiden bohrten sich ineinander.
»Das wirst du noch bereuen«, flüsterte Roland. Seine schwarzen Augen verströmten etwas Maliziöses, Fremdes. Und plötzlich verspürte die sonst so unerschrockene Uta eine Furcht, die ihr beinahe die Beine versagen ließ. Immerhin brachte sie es fertig, sich an ihm vorbeizuzwängen und dem Ort dieser merkwürdigen Zusammenkunft den Rücken zu kehren.
Diesmal verfolgte Roland sie nicht. Doch sie spürte förmlich seinen finsteren Blick in ihrem Rücken.
Sie schien die Stimme, die nach ihr rief, nicht wahrzunehmen. Uta kauerte auf dem morschen Stamm einer entwurzelten Eiche und starrte ins Leere. Sie hatte den Sohn des Gaugrafen geohrfeigt.
Allmählich wurde ihr bewusst, was sie da getan hatte. Ihre Tat konnte für sie und ihre Familie, die unter den Repressalien des Altenburgers schon genug litt, ein übles Nachspiel haben. Roland würde die Kränkung nicht auf sich sitzen lassen.
»Uta! Wo steckst du denn? So antworte doch!«
Erst jetzt vernahm sie Rotruds Stimme. »Ich bin hier!«
Wenige Augenblicke später erschien Rotrud neben ihr. Uta lächelte matt. »Ist euer Stelldichein schon beendet?«
»Soll ich dir was verraten?«
»Nur zu.«
Schnaufend setzte sich Rotrud neben die Freundin, die auf ihre Füße starrte.
»Der Grifo scheint verknallt zu sein, aber ordentlich.«
»Wirklich? Das freut mich für dich.«
»Muss es nicht. Er ist nicht in mich verknallt.«
»So? Dieser Blindfisch! Wer ist denn seine Auserwählte?«
»Du!« Rotruds Stimme hatte etwas Säuerliches.
»Aber ... ich will doch gar nichts von ihm.«
»Dafür will er umso mehr von dir. Schon als wir uns trennten, hat er dir hinterher gestarrt, als wärest du die Jungfrau Maria.«
»Die bin ich aber nicht. Burschen starren oft und viel, wenn der Tag lang ist.«
»Aber er hat sich ständig nach dir erkundigt. Wollte wissen, wo euer Hof liegt, ob du verlobt bist.« Ihre Stimme drohte sich zu überschlagen. »Das muss man sich mal vorstellen. Da stehe ich genau vor ihm und mache ihm schöne Augen. Und der Kerl? Interessiert sich nur für meine beste Freundin.«
Uta schüttelte seufzend den Kopf. »Du kannst völlig beruhigt sein. Ich will ihn nicht. Du kannst ihn ganz für dich haben.«
»Ganz für mich, wie? Offenbar hast du nicht begriffen, dass er mich nicht will.«
»Und sonst? Ich meine, habt ihr denn über nichts anderes gesprochen?«
»Nein. Das einzige Thema war die unglaubliche Uta!«
Uta griff nach Rotruds Hand, um sie zu drücken. »Beruhige dich, meine Liebe. Noch ist nicht aller Tage Abend.«
»Für mich schon.«
»Unsinn. Du darfst nicht aufgeben. Niemals. Ganz bestimmt gibt es noch Möglichkeiten, Grifos Herz zu erobern.«
»Ja, leih mir deine Gestalt.«
»Genug. Du redest daher, als wärst du eine hässliche Jungfer. Du wirst um Grifo kämpfen, wenn du ihn unbedingt haben willst. Hast du mich verstanden?«
»Aber ...«
»Kein Wort mehr. Nichts ist verloren.«
Rotrud schluckte, ließ es aber bleiben, ihr Leid weiter in die Welt hinauszuposaunen. »Warum bist du so blass?«, fragte sie stattdessen.
»Bin ich das?«
»Wie eine Leiche.«
»Das ... hat seinen Grund.«
»Vielleicht kannst du dich ja durchringen, ihn mir zu nennen, beste Freundin.«
Uta kaute auf einem Mundwinkel. »Ich habe im Wald den Sohn des Gaugrafen getroffen«, gab sie schließlich zu.
»Was? Diesen aufgeblasenen Roland?«
Uta nickte knapp.
»Und?«
»Er wollte mir an die Wäsche.«
»Jesses! Willst du etwa der ganzen Männerwelt den Kopf verdrehen?«
»Was kann ich denn dafür, dass der Kerl glaubt, er könne tun und lassen, wonach ihm gerade der Sinn steht?«
»Aber das kann er.«
»Da bin ich aber anderer Meinung, Rotrud.«
»Was ist geschehen?«
»Er hat von mir fünf Finger an die Backe bekommen.«
»Du hast ihn – geohrfeigt?«
»So nennt man das wohl.«
»Uff!« Rotrud wedelte mit beiden Händen.
»Wie du siehst, bist du nicht die Einzige, die über den Verlauf der letzten Stunde unglücklich ist.«
»Du musst dich bei ihm entschuldigen.«
»Eher verfaule ich bei lebendigem Leib.«
»Aber er wird es dich und deine Familie spüren lassen. Und eines Tages wird er selbst Gaugraf sein.«
»Selbst ein Gaugraf darf mich nicht anrühren, wenn ich das nicht will.«
Diesmal war es Rotrud, die nach der Hand der Freundin tastete und sie fest drückte. »Ach, hätte ich nur ein wenig von dir, Uta.«
»Dann wärst du nicht Rotrud. Und das wäre schade.« Uta blickte ihr tief in die Augen und erschrak fast zu Tode. Denn was sie darin sah, war noch Unheimlicher als Rolands bedrohlicher Blick.
»Was hast du denn?«, fragte Rotrud, der die plötzliche Veränderung in Utas Wesen nicht entging.
Uta antwortete nicht.
»Was starrst du mich so an? Du machst mir Angst!«
Es kostete Uta gewaltige Anstrengung, ihren Blick von Rotrud zu lösen. »Es tut mir leid«, stammelte sie.
»Was tut dir leid? So rede doch endlich. Was ist plötzlich los mit dir?«
»Lass uns nach Hause gehen«, erwiderte Uta heiser. Sie stand auf und schritt zügig voran. Rotrud folgte ihr und fasste sie von hinten an der Schulter.
»Bleib stehen. Du schuldest mir eine Antwort.«
»Ich ... kann nicht darüber sprechen.«
»Warum nicht? Ich bin deine Freundin.«
»Genau deshalb.« Immer noch mied sie Rotruds Blick.
»Uta! Beim Leib des Erlösers, verrate mir endlich, was mit dir geschehen ist.«
Uta holte tief Luft. Widerstrebend wandte sie sich der Freundin zu, die sie erwartungsvoll anstarrte. »Es sind deine Augen, Rotrud«, brachte sie mühsam hervor.
»Was ist damit?«
»Ich ... ich kann in ihnen etwas erkennen!«
»So? Und was, bitte, erkennst du in meinen Augen?«
Utas Lippen bebten. Rotrud rüttelte an ihren Schultern.
»Verflucht, so rede doch endlich. Was siehst du in meinen Augen?«
»Ich sehe«, antwortete Uta mit heiserer Stimme, »dass du bald sterben wirst.«
Rotrud ließ die Freundin los und starrte sie entgeistert an. »Was redest du nur für einen Unsinn?« Ein dumpfes Lachen kam aus ihrer Kehle. »Sterben? Hältst du dich für den Allmächtigen?«
Als Uta nicht antwortete, sondern betreten auf ihre Füße schaute, verwandelte sich Rotruds Lachen in ein erregtes Kreischen. »Du bist völlig verrückt! Was bezweckst du mit dieser boshaften Lüge?«
»Rotrud, ich ...«
»Du willst mir Angst machen. Ich weiß auch genau, warum. Du willst, dass ich Grifo vergesse. Damit du ihn für dich haben kannst.«
Uta schüttelte traurig den Kopf.
»Natürlich, das ist es«, schrie Rotrud. »Aber deshalb hättest du unsere Freundschaft nicht opfern müssen. Ich hätte ihn dir auch so überlassen. Sowieso hat er nur dich im Kopf.«
»Es hat nichts mit Grifo zu tun«, wehrte sich Uta verzweifelt, doch abermals schnitt Rotrud ihr das Wort ab.
»Hoffentlich wirst du glücklich mit ihm. Ich jedenfalls werde nicht auf deiner Hochzeit erscheinen. Ich habe nämlich keine Freundin mehr, die den Namen Uta trägt.«
Ihre Augen schossen noch einen Blitz ab; dann verschwand sie im Wald. Wie gelähmt sah Uta ihr hinterher.
Der Sommer schien sich vorläufig verabschiedet zu haben. Ein Gewitter hatte am Morgen getobt, seitdem hingen schwere Wolken am Himmel. Es hatte sich merklich abgekühlt.
Ein etwa siebenjähriger Knabe, sommersprossig wie seine Schwester und mit dem gleichen kastanienbraunen Haar auf dem Kopf, betrat die Scheune und spähte in das Halbdunkel.
»Uta? Bist du hier?«
»Ja, Bruderherzchen. Hier, hinter dem Karren.«
Der Knabe kam näher. »Vater sucht nach dir«, erklärte er.
»Lass ihn suchen. Setz dich zu mir.«
Der Bruder gehorchte, schüttelte aber missbilligend den Kopf. »Die Eltern werden wütend sein, wenn du ihnen nicht bei der Arbeit hilfst.«
»Ich muss zuerst ein wenig mit mir und meinen Gedanken alleine sein. Trotzdem darfst du gerne bei mir bleiben, Hugo.« Sie schlang die Arme um den Bruder und hielt ihn fest. Schweigend genoss Hugo ihre Umarmung.
»Warum hast du sie beschimpft, die Rotrud?«, fragte er nach einer Weile.
»Ich habe sie nicht beschimpft, Hugo.«
»Nein. Nur den Tod hast du ihr an den Hals gewünscht. Warum?«
»Ach, Hugo. Nicht einmal du wirst mich verstehen. Ich habe ihr nicht den Tod gewünscht. Ich habe nur erkannt, dass sie bald sterben muss. Es stand in ihren Augen geschrieben.«
»Aber … ist das möglich? Das wusste ich nicht.«
»Ich auch nicht.«
Plötzlich überkam Hugo ein Hustenanfall. Uta streichelte über seinen zitternden Rücken, so, wie sie es immer tat, wenn er hustete. Denn das beruhigte den Bruder.
»Bestimmt hast du dich geirrt«, griff er den Faden ihres Gespräches wieder auf.
»Das wünschte ich mir auch.«
Hugo fröstelte. »Auf jeden Fall hört sich das unheimlich an.«
»Ja«, murmelte Uta. »Das ist es.«
»Im Dorf sprechen sie über dich.«
»Wirklich? Was sagen sie denn?«
»Dass du verrückt bist.«
»Hältst auch du mich für verrückt?«
»Natürlich nicht«, kam es empört zurück. »Aber Rotruds Vater war vorhin bei unserem Vater. Er war ziemlich außer sich. Hat dich eine Zauberin genannt.«
»Der arme Vater. Das habe ich nicht gewollt. Wie hat er reagiert?«
»Er versuchte ihn zu besänftigen. Doch Rotruds Vater bekam sich gar nicht mehr ein, sagte was von Gotteslästerung. Und hat darauf bestanden, dass man dich gehörig verprügelt.«
»Wird Vater es tun?«
»Was tun?«
»Mich verprügeln.«
Die Geschwister lächelten sich an.
»Wenn er es tut, dann werde ich dir die Hand halten, versprochen.«
Ein paar Hühner hatten sich ins Innere der Scheune verirrt und gackerten. In der Ferne war immer noch Gewittergrollen zu hören. Hugo war eingeschlafen. In seiner Brust rasselte der Atem. Uta strich sanft über sein Haar. Von draußen näherten sich Schritte. Dann fiel Licht durch den Spalt des sich öffnenden Tores. Uta erkannte ihren Vater. Er war ein groß gewachsener, schwarzbärtiger Mann mit breiten Schultern. Unter dichten Brauen leuchteten eisblaue Augen, die in der Dunkelheit nach der Tochter suchten.
»Uta, wo steckst du?« Seine Stimme war laut und durchdringend, doch überraschenderweise lag nichts Bedrohliches in ihr, so wie früher, wenn sie etwas ausgefressen hatte.
»Ich bin hier, Vater.«
Hugo war aufgewacht und hustete sich erst einmal den Schlummer aus dem Leib. Erschrocken sah er zum Vater hoch, dessen Aufmerksamkeit jedoch allein der Tochter galt.
»Was machst du hier?«
»Ich brauchte etwas Ruhe, bitte sieh es mir nach. Natürlich werde ich dir und Mutter jetzt bei der Arbeit helfen.« Sie wollte sich erheben, doch die Hand des Vaters, der neben ihr in die Knie gegangen war, hielt sie unten.
»Bleib«, bestimmte er ruhig. Und an Hugo gewandt: »Lass mich mit deiner Schwester allein.«
Der Knabe verließ flugs die Scheune.
»Ich muss mit dir reden, Uta.«
Sie machte einen schweren Atemzug. »Vater, ich weiß, dass Rotrud und ihre Eltern sehr verärgert über mich sind, aber ...«
»Still. Es geht nicht darum, dass sie verärgert wären.«
Einen Augenblick lang schoss Uta der Gedanke durch den Kopf, der Sohn des Gaugrafen könne der wahre Grund für die offenkundige Besorgnis des Vaters sein. Zwei Tage waren seit jener unheilvollen Ohrfeige vergangen. Hatte Roland inzwischen für weitere Repressalien gegen ihren Vater gesorgt?
»Worum geht es dann, Vater?«
Er setzte sich zu ihr und drehte einen Strohhalm zwischen seinen Fingern. »Du behauptest, in Rotruds Augen gesehen zu haben, dass sie bald sterben muss, nicht wahr?«
»Ja, Vater.«
»Was genau konntest du denn sehen?«
Uta schluckte mühsam und suchte nach Worten, die dann heiser über ihre Lippen kamen. »Ich sah einfach nur – den Tod! Einen Totenschädel ohne Haut und Haar.«
»Wenn du wirklich diesen Schädel gesehen hast – wie kannst du wissen, ob er nicht nur Einbildung war? Und wieso deutest du ihn als Vorboten des Todes?«
»Vater, ich ...« Uta presste beide Hände an ihre Schläfen. »Ich kann dir diese Fragen nicht beantworten. Ich weiß nur, dass ich mir plötzlich völlig sicher war, dass Rotrud bald sterben wird. Vater, es war wie eine absolute Gewissheit – woher auch immer sie kam!«
»Und jetzt? Bist du immer noch überzeugt, dass deine Freundin sterben muss?«
Über Utas Wange kullerte eine Träne. »Bitte frag mich nicht warum, aber ich weiß es.«
»Sie ist tot«, bemerkte der Vater nach einer Weile.
Uta saß reglos da. Fast schien es, als sei ihr eine große Last von der Seele genommen. »Wann ist sie gestorben?«, fragte sie matt.
»Heute Morgen, bei dem Gewitter. Der Blitz hat sie erschlagen, auf dem Feld. Ein Knecht fand ihre Leiche. Das ganze Dorf weiß es bereits.«
Uta hatte die Augen fest verschlossen. »Ich hoffe nur«, sagte sie, »dass die Priester Recht haben. Dass Rotrud nun in Gottes Hand ist.«
»Wie es scheint, besitzt du eine seltene Gabe«, sagte der Vater nachdenklich.
Schluchzend warf sie sich ihm an die Brust. »Vater! Ich will diese Gabe nicht besitzen. Sie macht mir Angst.«
Hilflos strich er ihr übers Haar. »Mein Kind, es wird schon alles gut werden.« Sein Blick verlor sich in der Dunkelheit der Scheune.
Draußen, wo vor Stunden die Sonne hinter den Wäldern des Rurtals versunken war, tobte ein Hagelsturm. Seit dreißig Sommern – so wusste es der Knecht Arbo – hatte es im Erntemonat nicht mehr gehagelt. Damals hatte Arbo etwa elf Lenze gezählt. Das Unwetter hatte sich seiner Erinnerung nicht entzogen, denn an jenem Tag war sein Hund Loki gestorben. Loki hatte sich mit einem streunenden alten Wolf angelegt und den grimmig geführten Kampf nur um wenige Stunden überlebt. Dann war er seinen Wunden erlegen, trotz der aufopfernden Pflege, die Arbo ihm zukommen ließ. Und draußen hatte das Unwetter gewütet. Arbo erinnerte sich genau, es war der Erntemonat gewesen. Denn sein um die Ernte besorgter Vater hatte den Tod des treuen Hundes herzlos zur Kenntnis genommen.
Hagel im Sommer, das war kein gutes Omen! Damals war der Hagelsturm der Auftakt von drei miserablen Sommerernten in Folge gewesen. Not und Elend hatten sich des Landes bemächtigt. Zwei von Arbos vier Geschwistern waren entkräftet gestorben, die Mutter fast dem Wahnsinn verfallen.