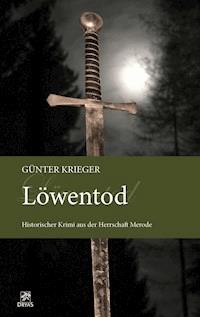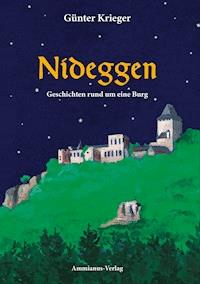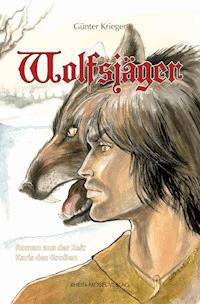Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Merode-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Kloster Schwarzenbroich, im Herbst 1349: Eher zufällig entdeckt Dorfherr Mathäus von Merode, dass es beim Ableben eines betagten Klosterbruders nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Als bald darauf weitere Mönche auf seltsame Weise ums Leben kommen, machen sich Mathäus und sein Freund Heinrich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. "Mönchsgesang" ist der zweite Band der Merode-Triologie, Band 1 "Teufelswerk" und Band 3 "Löwentod" sind als E-Book Edition im Dryas Verlag erhältlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im April des Jahres 1294 beschließen die Herren von Merode eine folgenschwere Erbteilung. Zwei Linien der Familie, die der„Scheiffarts“und die der„Werners“, residieren fortan gemeinsam auf der Burg, teilen sich Besitz und Herrschaft ihrer Ländereien für über sechs Jahrzehnte. Was nicht immer dem Frieden und der Eintracht zwischen den blaublütigen Vettern förderlich ist. Und auch den verunsicherten Bauern und Bürgern der„Herrschaft“macht dieser Zustand mitunter schwer zu schaffen ...
Media vita in morte sumus.
Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.
Notker von St. Gallen, 9. Jahrhundert
Prolog
Oktober 1347
Nur mühsam durchdrangen die Strahlen der aufgehenden Sonne den morgendlichen Nebeldunst, zwängten sich durch die Wipfel der kahl werdenden Bäume. Der herbe Duft von Herbst und faulem Laub erfüllte die Luft, und es war nicht das geringsteWindchen auszumachen, dasZirkulation in diese riesige Küche aus Tau und Nebel gebracht hätte. Irgendwo begannen ein paar Krähenzu zetern, als hielte der Teufel selbst sie in seinen grausigen Krallen gefangen.
Der Kaiser zügelte sein Pferd und horchte auf. Auch seine beiden Hunde spitzten die Ohren, blickten ihren Herrn erwartungsvoll an. Der verharrte eine Weile reglos im Sattel und stierte in die schemenhaften Umrisse des Waldes.
„Krähen, die sich um ein Stück Aas balgen“, bemerkte er nach einer Weile und sah zu seinen Hunden hinab.„Kein Bär!“Es klang fast wie eine Entschuldigung.„Noch nicht“, fügte er hinzu, bevor er sein Pferd weitertraben ließ.
Der Mann im Sattel hatte bereits mehr als sechs Lebensjahrzehnte hinter sich gebracht, und obwohl seine Statur auch die eines Dreißigjährigen hätte sein können, so sah man seinem durchaus edlen Gesicht die Last eines langen Lebens an. Die Last eines Lebens, an dessen Horizont die Wolken sich immer mehr verdüsterten. Die Last eines Lebens voller Konflikte, Auseinandersetzungen und Kämpfe. Wie oft schon hatte er seine Macht verflucht und wie ofthatte er sie wieder lieben gelernt. Und seine Gegner–er hatte sie fast alle überlebt. Große Fürsten und kleine, Bischöfe, Kardinäle und Päpste–ein Leben lang hatte er ihnen getrotzt, er, der „gewaltige Adler“, der Kaiser der Deutschen. Immer wieder hatte er Siege davongetragen, sodass sich mancher zeitgenössische Träumer in die Tage der glorreichen Salier und Staufer zurückversetzt fühlte. Doch es war wie beim Haupt der Hydra: Schlug man einen ihrer Köpfe ab, so entwuchsen dem riesigem Leib sogleich ein paar neue. Manchmal verglich der Kaiser sich mit Sisyphos, jener griechischen Sagengestalt, die für ihre Verschlagenheit gegenüber den Göttern im Hades einen Felsblock auf einen Fels rollen muss, der kurz vor dem Gipfel immer wieder herunterrollt. Und was die Hydra betraf: Ihr war in der Gestalt des jungen Böhmen Karl ein mächtiger Kopf entwachsen, so mächtig wie selten ein Kopf zuvor. Im vergangenen Jahr hatten ein paar deutsche Fürsten ihn zum König erkoren. Die Welt befand sich im Zwiespalt, die mühsam errichtete Ordnung in Auflösung. Ein blutiger Krieg stand unmittelbar bevor, und es mehrten sich die Stimmen, die das unmittelbare Ende der Welt ankündigten.
Der Kaiser sog die milde Luft in seine Lungen und unterdrückte ein Seufzen. Noch am gestrigen Abend, während des Banketts, war ihm der Gedanke der Abdankung durch den Kopf geschwirrt, hatte sich der Wunsch nach Frieden und Anonymität seiner Seele bemächtigt. Gräfin Agnes, die Witwe seines langjährigen Weggefährten Berthold, hatte ihn auf seinem Münchner Hof besucht. Und wie immer, wenn er Agnes in seiner Nähe wusste, die trotz harter Schicksalsschläge nur wenig von ihrer Fröhlichkeit eingebüßt hatte, beseelte ihn dieses herrliche Gefühl von Leichtigkeit, dieser brennende Wunsch, nicht mehr kämpfen zu müssen. Diese selig machende Müdigkeit war wie ein Rausch. Doch wie jeder Rausch pflegte auch dieser stets zu vergehen ...
So auch gestern Abend. Nach dem Mahl hatte den Kaiser plötzlich ein heftiges Unwohlsein befallen. Schweren Herzens hatte er sich deshalb frühzeitig von der Gräfin verabschiedet und sich in seine Gemächer zurückgezogen, wo ihn sein Medicus aufsuchte und ihm ein Brechmittel verordnete. Die halbe Nacht hatte der Kaiser über einem bereitgestellten Bottich verbracht; irgendwann hatte ihn endlich eine tiefe Müdigkeit heimgesucht. Erschöpft und ausgelaugt war er eingeschlafen.
Noch vor Sonnenaufgang war er wieder aufgewacht. Verwundert, aber beglückt stellte er fest, dass jegliches Unwohlsein sich verflüchtigt hatte, ja dass sogar eine seit Jahren nicht mehr erlebte Vitalität durch seine Adern pulsierte. Wie weggeblasen waren mit einem Male seine fatalistischen Gedanken, wie ausradiert das Gefühl der Resignation. Er berauschte sich an dieser wunderbaren Tatkraft. Noch einmal würde der „gewaltige Adler“ seine Flügel schwingen und seine Feinde erbeben lassen. Krieg? Wenn Karl einen Krieg wollte, so sollte er ihn haben. Er, der Kaiser, würde die göttliche Ordnung wiederherstellen, wie so oft schon. Und dass der Allmächtige auf seiner Seite stand, daran zweifelte der Kaiser keinen Augenblick, selbst wenn die Päpste in Avignon ihn noch tausend Mal bannten.
Der Kaiser hatte feststellen müssen, dass sein Hof sich in diesen frühen Morgenstunden noch im Tiefschlaf befand. Selbst seine sonst so aufmerksamen Diener hatten das Aufstehen ihres Herrn nicht bemerkt. So kam es, dass zwei seiner Ritter aus dem Schlaf gerüttelt wurden, verwundert, ihren Herrn und Kaiser höchstselbst neben ihrem Feldbett stehen zu sehen, der sie höflich bat, ihn zur Bärenjagd zu begleiten.
Einer der Jagdaufseher hatte beim gestrigen Bankett von einem großen Bären berichtet, der in der Nähe des Klosters Fürstenfeld sein Unwesen trieb. Und der Kaiser hatte den unwiderruflichen Entschluss gefasst, ihm den Garaus zu machen. Wenn dieser Bär erlegt war – er spürte es ganz deutlich – würde er auch die anderen Herausforderungen bewältigen. Der Bär war ein Omen, von Gott geschickt.
Der Kaiser warf einen Blick zurück. Er wollte mit der Flut seiner Gedanken alleine sein, deshalb hatte er seinen Begleitern befohlen, vorerst hinter ihm zurückzubleiben. Im Frühdunst konnte er die Gestalten der Reiter gerade noch erkennen. Zufrieden setzte er seinen Ritt fort.
Die Krähen zeterten immer noch. Ein junger Fuchs huschte vor ihm in ein Gestrüpp.
„Hiergeblieben!“, herrschte der Kaiser seine Hunde an, die den roten Jäger augenblicklich verfolgen wollten. „Heute gilt es, größeres Wild zu erlegen.“ Seine Mundwinkel umspielte ein feines Lächeln. „Was schert uns ein Fuchs?“, murmelte er zu sich selbst.
Plötzlich empfand er eine merkwürdige Wärme. Er nahm seinen Umhang ab und legte ihn vor sich auf den Sattelknauf. Sorgfältig zupfte er an seinem mit glänzenden Nieten besetzten Wams, das nun zum Vorschein kam. Dann widmete er sich wieder den Stimmen des Waldes.
Da! War da nicht aus weiter Ferne ein Brüllen zu hören? Das Brüllen eines Bären? Der Kaiser warf einen Blick auf seine Hunde, doch die schienen keine Witterung aufgenommen zu haben.
„Auf, Kerle, seid ihr denn taub? Hört ihr nicht das Brüllen des Räubers?“ Er tastete nach seinem Langbogen. Sie befanden sich in der Nähe des Klosters. Aus dieser Richtung glaubte der Kaiser das Brüllen vernommen zu haben. Mein Gott, schoss es ihm durch den Kopf, es wird dem Braunen doch wohl nicht einfallen, sich an den Viehherden der Mönche zu laben? Er trieb sein Pferd zum Galopp und erreichte bald eine große Lichtung. Hier brachte er sein schnaubendes Pferd zum Stehen und erkannte im sich lichtenden Nebel die Umrisse des Klosters Fürstenfeld. Auf einem sumpfigen Weg, der sich zum Kloster schlängelte, sah er einen Bauern, der einen klapprigen Karren hinter sich herzog. Ansonsten war es ruhig. Von einem Bären keine Spur ...
Der Kaiser trieb sein Pferd erneut an und stand bald vor dem Bauern, der den Reiter und seine beiden furchterregenden schwarzen Hunde ängstlich anstarrte.
„Ich wünsche dir einen guten Morgen“, sagte der Kaiser mit sanfter Stimme, denn er hatte die Angst in den Augen des anderen bemerkt. Dieser war ein alter zahnloser Mann mit zerfurchtem Gesicht und gichtigen Fingern. Aus seinen Mundwinkeln träufelte Speichel. Der Handkarren war beladen mit welkem Gemüse und von Würmern durchlöchertem Obst. Nur zu gut konnte der Kaiser sich die Beanstandungen ausmalen, welche die strengen Mönche mit mahnendem Zeigefinger vorbringen würden. Gerne hätte er dem Alten eine Münze zugeworfen, freilich trug er zur Jagd keinen Geldbeutel bei sich.
„Du bist sehr mutig, dich allein in eine Gegend zu begeben, wo ein Bär sein Unwesen treibt“, meinte der Kaiser.
„Leider stellt mir keiner eine Eskorte, Herr, und solch prächtige Hunde wie Ihr besitz’ ich leider auch nicht“, lispelte der Alte und wischte sich mit einem verdreckten Ärmel den Speichel vom Mund.
Der Kaiser lächelte. „Ist der Bär dir etwa begegnet?“
„Gott behüte! Und wenn er mir begegnet, dann ...“ Der Alte unterbrach sich abrupt, als er sah, wie der vornehme Herr vor ihm auf seinem Pferd plötzlich zu wanken begann. Das Gesicht des Kaisers war kreidebleich geworden, er griff sich an die Brust.
„Herr, was ist mit Euch?“
Der Kaiser schnappte nach Luft. Sein Blick richtete sich zum Himmel, als er seitlich aus dem Sattel kippte und unsanft im Gras landete. Er bemühte sich, wieder aufzustehen, doch der Druck in seiner Brust wurde unerträglich, sodass er sich stöhnend auf den Rücken rollte. „Maria, süße Königin, stehe mir bei“, flüsterte er.
Der alte Bauer schaute sich Hilfe suchend um und zupfte nervös an seinem Wams. „Herr? Bitte, Ihr müsst aufstehen“, stammelte er. Dann erst bemerkte er die drei Reiter, die sich ihm rasch näherten.
Zwei Ritter schwangen sich aus dem Sattel und stießen den Alten unsanft beiseite. Auch die beiden Hunde, die winselnd an ihrem Herrn schnupperten, wurden verscheucht.
„Majestät!“ Einer der Ritter beugte sich schwer atmend über ihn und suchte seinen Leib nach Lebenszeichen ab.
„Majestät ...?“, traute sich der Bauer leise zu fragen.
„Was ist mit ihm?“, schrie der zweite Ritter.
Sein Gefährte sah ihn fassungslos an. „Er stirbt“, sagte er heiser. Mit einer fahrigen Bewegung winkte er den Knappen herbei, der immer noch auf seinem Pferd saß und das Drama mit offenem Mund verfolgte.
„Auf, reite zum Kloster! Sie sollen sofort einen Heilkundigen herschicken. Sag ihnen, es handelt sich um den Kaiser! Vorwärts!“
Und während im fernen Avignon der Bannspruch gegen Ludovicus bavarus erneuert wurde, hatte die Seele des Kaisers ihren langen Weg zum allmächtigen Schöpfer angetreten.
1
Ende September 1349
Die milchigtrüben Augen des alten Mönches stierten auf die weißgekalkten Wände seiner Zelle. Seit Stunden wälzte er sich auf seiner Pritsche, den greisen Kopf voller Gedanken, voller Stimmen, die ihm mal dies, mal jenes einhauchten. Die Dämonen der Nacht umschwirrten ihn wie lästige Fliegen. Eine brennende Talgkerze auf einem wackligen Holztisch in der Mitte der Zelle ließ die Schatten des spärlichen Mobiliars gespenstisch tanzen.
Der Alte achtete nicht auf die tanzenden Schatten. Selbst wenn ein plötzlicher Luftzug die Flamme der Kerze gelöscht hätte – er hätte es nicht bemerkt. Und das nicht wegen seiner nachlassenden Sehkraft, nein, seine Gedanken kreisten beharrlich um die Geschehnisse der letzten Tage, jene Ereignisse, von denen nur er selbst und die betroffenen Sünder wussten. Schlaf? Daran war nicht zu denken. Sein alternder Körper brauchte ohnehin kaum noch Schlaf. Vielmehr zermarterte er sein Hirn über die Frage, ob er seine Beobachtungen dem Prior mitteilen sollte. Aber stand ihm das zu? War es richtig, ein Mitglied der Klostergemeinschaft zu denunzieren, bevor dieses seine Taten als Sünde erkannt und Buße getan hatte? Sollte er sich nicht zuerst den Sünder noch einmal selbst vornehmen und ihn von der Notwendigkeit der Sühne überzeugen?
Er faltete die runzligen Hände über seiner Brust zusammen und stöhnte leise. Gewiss, er hatte dem anderen mit unzweideutigen Bemerkungen zu verstehen gegeben, dass er über die Sache Bescheid wusste. Doch der Törichte hatte sich dumm gestellt, hatte gesagt, er wisse nicht, wovon der Alte spreche. Keine Miene hatte er verzogen, kein verräterisches Zucken in seinem Gesicht hatte auf bestehende Seelenqualen schließen lassen, seine Augen waren kalt geblieben wie das Meer. Dann hatte er den Mahnenden einfach stehen lassen, als sei dieser nicht ganz bei Sinnen.
Weisheit! Der Alte hatte geglaubt, in seinem Alter an unendlicher Weisheit gewonnen zu haben und musste nun feststellen, dass es mit dieser Weisheit nicht weit her war. Er zerbrach sich den Kopf über das Seelenheil der anderen. Und obwohl er wusste, dass es dem Allmächtigen wohl gefallen würde, sich um das Heil der Mitmenschen zu sorgen, so war er dennoch unschlüssig, welchen Weg er einschlagen sollte.
Mühsam richtete er sich auf, setzte sich auf den Rand seiner Pritsche, denn sein Rücken schmerzte unerträglich. Langsam begann er, seine Umgebung wieder wahrzunehmen. Das Holzkreuz über der Tür seiner Zelle warf einen zitternden Schatten. Das Zeichen von Golgatha war dem Mönch ein Relikt des Trostes und des Friedens. Bei seinem Anblick schöpfte er wieder Kraft und glaubte, die Weisheit seines Geistes erneut zu verspüren.
Ach, Weisheit! Fast ein ganzes Leben hatte er sich mit Büchern beschäftigt. Bis man ihn im vergangenen Jahr seines Amtes als Bibliothekar enthoben und einen jungen Mitbruder zu seinem Nachfolger bestimmt hatte.
„Dein Augenlicht wird schlechter und schlechter“, hatte der Prior zu ihm gesagt, „ich kann es nicht länger gutheißen, dass deine Sehkraft ein Opfer der Bücher wird!“
Stattdessen hatte man ihn zum Sakristan ernannt. Da er dem Orden schon vor langer Zeit Gehorsam gelobt hatte, versuchte er, die Entscheidung des Priors hinzunehmen. Auch versuchte er, seinem Mitbruder und Nachfolger in der Bibliothek nicht zu zürnen, allerdings wollte ihm dies nicht so recht gelingen. Auch jetzt, in dieser ruhelosen Nacht, bemerkte der Mönch erschrocken, wie seine Fäuste sich ballten, sobald das Bild des Mitbruders vor seinem geistigen Auge auftauchte.
„Ich muss beten“, sagte er hastig zu sich selber, erhob sich von seiner Schlafstätte und schlüpfte in seine Sandalen. Er schritt zur hölzernen Truhe, auf der er vor einigen Stunden seine Kutte abgelegt hatte. Nahm das sorgsam gefaltete Kleidungsstück, breitete es mit rituellen Bewegungen aus und stülpte es über seinen Kopf. Andächtig zupfte er die Falten heraus, schnürte die Kordel vor seinem Bauch, strich dann liebevoll über das eingenähte Zeichen auf seiner Brust, jenem Kreuz mit rotem Stamm und weißem Querbalken. Es machte ihn immer noch stolz, ein Kreuzbruder zu sein, ein Streiter Christi auf Erden.
Er nahm die Kerze, griff nach dem Schlüsselbund, der an einem Nagel neben der Tür baumelte, und verließ leise seine Zelle.
Das Licht der Kerze vermochte den kahlen Flur kaum zu erhellen, doch der alte Mönch hätte den Weg auch blind gefunden. Hinter der Zellentür eines Mitbruders war ein lautes Schnarchen zu vernehmen, ansonsten war es totenstill. „Wie könnt ihr bloß schlafen, Brüder“, murmelte der Alte still vor sich hin. „Wie könnt ihr schlafen, während der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und suchet, welchen er verschlinge.“
„Ist alles in Ordnung, Bruder?“
Der Alte zuckte zusammen und fuhr herum.
„Alles in Ordnung?“, wiederholte sein Mitbruder und warf ihm einen besorgten Blick zu.
„Sicher!“
„Die Nacht ist lang, und unsere Träume kurz, nicht wahr, Bruder in Christo? Leidest du manchmal auch unter Schlafstörungen?“
„Unsinn!“ Der Alte ärgerte sich über die vorwitzige Neugierde des anderen. „Ich muss zur Latrine, das ist alles. Erreich‘ du erst mein Alter, Bruder Naseweis.“
Er ließ den Verdutzten stehen und stieg eine Wendeltreppe hinab. Die herben Düfte des umliegenden Waldes krochen in seine Nase, als er den Kreuzgang erreichte. Auch der schale Geruch kühler Asche und verbrannten Holzes lag noch in der Luft, obwohl seit dem unheilvollen Brand bereits drei Tage verstrichen waren. Irgendwo schrie ein Kauz.
Der Alte grunzte verärgert. Zur Latrine! Warum hatte er dem jüngeren Mitbruder nicht die Wahrheit gesagt? Er wollte doch nur beten. Beten für das Heil aller Mönche in diesem Konvent, beten für alle Menschen auf dieser elenden Welt. Warum also hatte er gelogen? Wie sollte er die angestrebte Weisheit erlangen, wenn er die Latrine zur Wahrheit und das Gebet zur Lüge machte?
„Satans Wirken“, fluchte er leise. „Ich muss beten!“
Er hatte die Seitentür der Klosterkirche erreicht. Mit zitternden Händen zückte er den Schlüssel und trat leise in das Gotteshaus. Wie lauernde Dämonen wirkten die Figuren einiger Heiliger im fahlen Licht der Kerze, doch der Alte vertrieb solche Gedanken. Es sind Heilige, sagte er sich, Menschen, die Gott näher waren, als ich es jemals sein werde! Obwohl er hier Trost und Zuflucht gesucht hatte, merkte er, dass das Gefühl von Angst und Hilflosigkeit in ihm immer größer wurde. Vergeblich suchte er das Kreuz des Erlösers im Schatten der Apsis hinter dem Altar, doch das Kerzenlicht war zu schwach. Hastig schlug er ein Kreuzzeichen und näherte sich mit weichen Knien seinem Betstuhl.
„... und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“, intonierte er immer wieder.
Mit etwas Wachs befestigte er die Kerze am Vordergestell seines Betstuhls. Noch einmal suchte er vergeblich das Kreuz hinter dem Altar, bevor er sich schwerfällig niederkniete. Jetzt erst merkte er, dass dort etwas vor ihm lag. Seine milchigen Augen blinzelten verwirrt. Mit einer vorsichtigen Bewegung tastete er nach dem Gegenstand.
Plötzlich zuckte seine Hand zurück, als hätte sie in einen brennenden Herd gefasst. Er wollte schreien, doch er konnte nicht. Eine siedendheiße Welle rollte durch seinen Körper, er spürte, wie seine Nackenhaare sich sträubten wie die einer Katze. Vor ihm lag eine welke weiße Lilie. „Die Botschaft aus dem Jenseits“, stammelte er fassungslos. Mit einemMal fielen ihm die Geschichten ein, die man ihm vor langer Zeit, als er noch ein junger Novize gewesen war, erzählt hatte. Die weiße Lilie– eine Todesbotin! Derjenige, dem sie zuteilwird, muss in drei Tagen sterben ...
Für einen Augenblick schoss dem Alten der Gedanke durch den Kopf, die Lilie einfach auf den Platz seines Nachbarn zu legen. Doch dann hielt er inne. Wie konnte er sich nur einreden, das Schicksal betrügen zu können?
Er zwang sich, tief und ruhig zu atmen. Und allmählich merkte er, wie das Angstgefühl ihn verließ. Sterben? Warum eigentlich nicht? Er hatte ein sehr hohes Alter erreicht. War es nicht sogar erstrebenswert, endlich von den Mühen und Qualen des irdischen Lebens entbunden zu sein und die Ewigkeit in der Nähe Gottes zu verbringen?
Die Maske der Angst wich einem seligen Lächeln. „Wenn es denn sein muss, so komme ich mit Freuden, Herr“, sagte der alte Mönch in das Halbdunkel der Klosterkirche, erleichtert über die Weisheit, die ihn endlich erreicht hatte.
2
Im „Carolus Magnus“, der Meroder Dorfschenke, hätte an diesem Sonntagabend nicht einmal mehr eine Maus einen Platz gefunden. Selbst viele der Bäuerinnen aus dem Ober- und dem Unterdorf hatten es sich – zum verhohlenen Ärger ihrer Ehemänner – nicht nehmen lassen, den Versen des Spielmannes zu lauschen, der nun bereits den dritten Abend in Folge sein Epos vortrug. Und heute – das hatte er versprochen – würde endlich das von allen mit Spannung erwartete furiose Finale folgen. Viele der Bauern hatten untereinander sogar Wetten abgeschlossen: Würde sich Krimhild, die verbitterte Königin der Hunnen, an ihrem grimmigen Oheim Hagen, dem Mörder ihres geliebten Siegfried, rächen können? Würde es zum Kampf der Burgunden gegen die Truppen König Etzels kommen? Und würden die Burgunden – oder Nibelungen, wie der Spielmann sie zu nennen pflegte – ihre Heimat in Worms jemals wiedersehen?
Ach, was waren die Nerven der Zuhörer an den vergangenen drei Tagen strapaziert worden: grausiges Schaudern, als Siegfried mit dem Drachen kämpfte. Unendliche Bewunderung, als der Drachentöter das Heer der Dänen fast im Alleingang besiegte. Rührend die tragische Liebe der Kriemhild zu dem Recken. Und all die bösen Intrigen am Hofe König Gunthers! Man konnte es fast schon erahnen: Siegfried, diesem wackeren Helden, würde bald ein gewaltsamer Tod ereilen. Warum wäre ihm wohl sonst beim Bad im Drachenblut ein Lindenblatt auf die Schulter gefallen? Und doch, als es soweit war, als der Speer des Hagen den Helden durchbohrte, traute sich keiner der Zuhörer zu atmen. In den kleinen Sprechpausen, die der Spielmann immer wieder einlegte, hätte man eine Nadel fallen hören. Nur die Töne seiner Laute hallten noch lange nach.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!