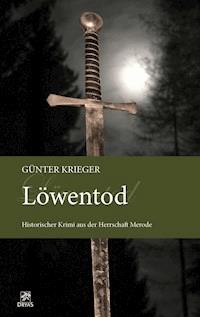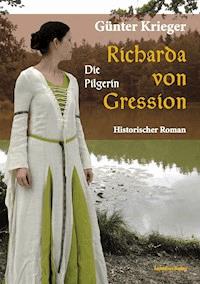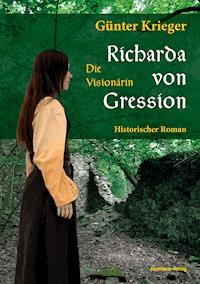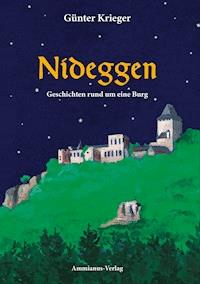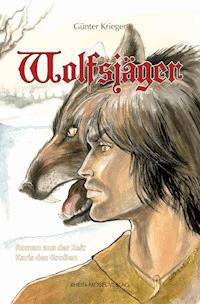Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die byzantinische Prinzessin Theophanu im Jahr 972 nach Rom reist, um Otto II. zu heiraten, beginnt für sie fern der Heimat ein neues Leben. Am Kaiserhof herrschen raue Sitten. Theophanu muss sich behaupten, um den zahllosen politischen Ränkespielen nicht zum Opfer zu fallen. Im Sommer 980 bringt sie endlich den lang ersehnten Thronfolger zur Welt. Zufällig wird das Bauernmädchen Jutta Zeugin dieses bedeutenden Ereignisses und macht es sich zum Lebensziel, Theophanus Zofe zu werden. Doch bis dahin muss die junge Kaiserin für sich und ihren Sohn kämpfen … Eine der großen Frauengestalten des Mittelalters: Theophanu, deutsche Kaiserin aus Byzanz und Gemahlin Ottos II., ihrer großen Liebe. Glanz und Glück, aber auch Tragik und Tod sind die Wegbegleiter Theophanus, der selbst kein langes Leben beschieden war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Krieger
Rosen für Theophanu
Braut Ottos II. – Kaiserin des Abendlandes
Historischer Roman
Krieger, Günter : Rosen für Theophanu. Braut Ottos II. – Kaiserin des Abendlandes. Hamburg, acabus Verlag 2018
Überarbeitete Neuausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-559-2
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-558-5
Print: ISBN 978-3-86282-557-8
Lektorat: Sophia Nosthoff, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © https://pixabay.com/de/kunst-bildmaterial-malerei-1030169/
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Prolog
Ketelwald bei Kleve, Sommer 980
Juttas Vater weinte ohne Unterlass. Leise zwar – eher war es ein Wimmern –, aber Jutta brachte es dennoch um den Schlaf. Gewiss, Mutters Tod hatte auch sie bestürzt. Noch nie war Jutta so traurig gewesen. Aber Mutter ließ sich nicht wieder zum Leben erwecken, indem man Rotz und Wasser heulte, das stand fest. Außer Liebkosungen der noch lebenden Mutter hatte Weinen Jutta noch nie etwas eingebracht. Und selbst damit war es nun vorbei.
Gegen Mitternacht beschloss das sechsjährige Mädchen, den Vater zu trösten. Sie erhob sich von ihrem Strohlager und tappte zielsicher durch das Dunkel, bis sie Vaters Schlafstätte auf der anderen Seite des Raums erreichte.
»Papa«, sagte Jutta leise und kniete sich neben ihn.
Helmprechts Wimmern verstummte abrupt. »Geh wieder schlafen«, forderte er sie auf, um Beherrschung bemüht. Obwohl sie in der Dunkelheit sein Gesicht kaum erkennen konnte, glaubte sie einen Ausdruck von Beschämung darin zu lesen. Vater hatte in ihrem Beisein noch nie geweint. Jutta überhörte seinen Befehl und legte sich neben ihn.
»Mama ist im Himmel!«, sagte sie tröstend.
Helmprecht schwieg dazu, machte aber keine weiteren Anstalten, sie fortzuschicken und ließ sogar zu, dass sie sich an ihn schmiegte.
»Gute Nacht«, sagte Jutta.
Irgendwann weckte das Schreien des Säuglings sie auf. Das erste Licht des frühen Tages fiel durch den Fensterverschlag. Draußen krähte unaufhörlich der Hahn. Jutta ordnete ihre rostroten Haare so gut sie konnte. Früher hatte das immer die Mutter erledigt.
Der Vater war schon aufgestanden. Unbeholfen stand er neben der Wiege und blickte auf das Kind hinab, welches angefangen hatte zu weinen. Jutta fragte sich, ob er böse auf den kleinen Wurm war. Mutter war unmittelbar nach der Entbindung gestorben. Es war keine einfache Geburt gewesen, und die alte Hebamme hatte nichts tun können, um die Blutung zu stillen.
»Sie hat Hunger, nicht wahr?«, fragte Jutta.
Helmprecht nickte nur.
»Was sollen wir tun, Papa?«
Darüber schien auch Helmprecht nachzudenken. Jutta fiel auf, dass er es tunlichst vermied, in die Richtung zu schauen, wo die tote Mutter zugedeckt mit einem Tuch aus Sackleinen auf einer Bank lag. Niemand wusste, dass Jutta früher schon einmal einen Toten gesehen hatte. Aus gutem Grund hatte sie es bis heute allen verschwiegen.
»Das Kind braucht eine Amme, die es nährt«, erklärte Helmprecht heiser. »Ohnehin müssen wir ins Dorf gehen, um Pater Roland herbeizurufen. Auf dem Weg werde ich am Forsthaus Halt machen. Beim Förster wohnt eine Amme, weil seine Frau nicht stillen kann. Vielleicht reicht ihre Milch ja auch für deine Schwester.«
Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau sprach er mehr als einen Satz. Wirich, der Förster, war ein guter Freund und würde ihm seine Hilfe nicht verweigern.
Jutta war froh über die Abwechslung, die der Marsch ins Dorf mit sich brachte. Obwohl sie noch so jung war, wusste sie, dass sie keine Bäuerin sein wollte. Aber die Mutter hatte ihr einmal gesagt, dagegen könne man nichts machen. Man sei dazu geboren, es sei Gottes Wille. Und überhaupt müsse das Leben hart sein, damit man einst ins Paradies gelangen könne. Wenn das stimmte, dachte Jutta, dann war der Mutter das Himmelreich mehr als gewiss. Dennoch schien dem Mädchen ein Leben als Bäuerin wenig erstrebenswert. Manchmal träumte sie davon, ein junger Edelmann würde eines Tages um sie werben. Auch wenn die Mutter darüber gelacht und gemeint hatte, solche Flausen solle sie sich lieber aus dem Kopf schlagen.
Draußen gedieh der junge Tag. Vögel sangen, im Osten stieg ein praller Sonnenball über die Wipfel der Bäume. Die Hühner scharrten im Dreck. Eigentlich war alles wie immer, als sei gestern nicht das Geringste geschehen. Und doch – Jutta ahnte es – würde jetzt alles anders werden.
Die beiden versorgten die Kuh und das Schwein und machten sich anschließend auf den Weg durch den Wald. Helmprecht presste den in eine Decke gewickelten Säugling an seine Brust. Wiljo, ein zotteliger schwarzer Hund, folgte ihnen mit wedelndem Schwanz. Helmprecht hüllte sich wieder in Schweigen. Wenigstens hörte das Kind bald auf zu schreien.
»Wie geht es nun weiter?«, fragte Jutta den Vater.
Der hob die Schultern und sah geradeaus. »Was weiß ich?«, knurrte er.
»Wer dreht mir jetzt die Zöpfe? Du?«
»Gott behüte. Ich werde wohl wieder heiraten müssen.«
Jutta erschrak. Dieser Gedanke war ihr noch gar nicht gekommen, obwohl es doch naheliegend war, dass Vater eine neue Frau brauchte.
»Und wen?«, fragte sie, ohne sich ihre Bestürzung anmerken zu lassen.
Er antwortete nicht, aber Jutta sah ihm an, dass er darüber nachdachte und möglicherweise schon eine Wahl getroffen hatte.
»Ich muss mal«, verkündete Jutta und verschwand hinter einem Gebüsch. Plötzlich verspürte sie das Bedürfnis, allein zu sein. An die Aussicht, eine Stiefmutter zu bekommen, musste sie sich erst einmal gewöhnen. An wen der Vater wohl dachte?
»Beeil dich!«, rief Helmprecht ihr nach, ohne stehen zu bleiben. Nur der gute Wiljo verharrte vor dem Gebüsch, um auf sie zu warten.
Jutta hob ihr Kleidchen aus Leinen und hockte sich nieder. Aus den Augenwinkeln sah sie plötzlich eine Bewegung und ahnte bereits, wer dort stand.
»Brun! Was gibt es denn da zu glotzen?«
Ein Junge, vielleicht drei Jahre älter als Jutta, trat hinter einem Baumstamm hervor. Er war ein wenig dicklich, hatte flachblondes, fransiges Haar und ein schiefes Grinsen im Gesicht. Jutta mochte ihn etwa so gut leiden wie Bauchschmerzen. Er lebte auf einem der Nachbarhöfe, nicht allzu weit von ihrer Kate entfernt.
»Ich sehe dir beim Pinkeln zu, kleine Kröte«, erklärte er dreist.
»Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Sonst …«
»Sonst was?«
»Hetz ich dir den Hund auf den Hals. – Wiljo!« Der Hund bellte zweimal kurz.
»Huh! Da wird mir ja angst und bange.«
Jutta erhob sich und sortierte ihre Kleidung. Wütend sah sie den frechen Kerl dabei an. »Du bist widerlich!«
»Und du schuldest mir einen Denar.«
Das sagte er immer, wenn sie sich sahen. Aber niemals gab sie ihm eine Antwort darauf.
»Hab gehört, deine Mutter ist tot«, sagte Brun, ohne dass es sonderlich mitfühlend klang. Offenbar hatte die Nachricht schon die Runde gemacht.
»Was geht dich das an?«, zischte Jutta.
»Ich weiß, wie das ist.«
»Na und?« Sie stapfte davon. »Komm, Wiljo!«
Helmprecht war bereits ein gutes Stück voraus. Jutta sputete sich, um ihn einzuholen. Bruns letzte Worte hallten ihr immer noch durch den Kopf: Ich weiß, wie das ist! Richtig, auch er hatte vor zwei oder drei Monaten seinen Vater verloren. Er war beim Holzfällen von einem Eichbaum erschlagen worden. Plötzlich durchfuhr es sie siedend heiß.
»Papa«, keuchte sie aufgeregt, nachdem sie aufgeschlossen hatte. »Wirst du Bruns Mutter heiraten?«
Ihre Frage überraschte ihn sichtlich, aber er schwieg.
»Papa! Ist es so?«
»Stell nicht solche Fragen, Kind. Deine Mutter ist noch nicht einmal begraben.«
»Also stimmt es. Nicht wahr, du hast es vor.«
»Und wenn’s so wäre«, brummte Helmprecht. »Was zerbrichst du dir den Kopf darüber?«
»Brun wäre mein Stiefbruder. Igitt!«
»Sei leise, sonst weckst du noch deine Schwester.«
Lieber Gott, ich bitte dich, tu etwas dagegen!, betete Jutta still. Einmal mehr dachte sie an den Edelmann aus ihren Träumen, der sie eines Tages in ein anderes Leben führen würde.
Als das aus Feldsteinen errichtete Forsthaus sich vor ihnen aus dem Grün des Waldes schälte, wunderten sie sich über die Betriebsamkeit, die vor dem Gebäude herrschte. Ein gutes Dutzend Pferde rastete dort, zwei Reisewagen waren zu sehen, Knechte liefen aufgeregt umher oder tränkten die Pferde aus Holzeimern. Außerdem – und das schien Helmprecht sichtlich zu beunruhigen – patrouillierten bewaffnete Ritter in Kettenhemden vor dem Haus.
»Was machen diese Männer, Papa?«, fragte Jutta verwundert.
Helmprecht wusste nicht im Geringsten, was dort vor sich ging und wunderte sich, die alte Hebamme zu sehen, die noch am Abend zuvor vergeblich um Hroswithas Leben gekämpft hatte. Von einem Trossknecht wurde sie ins Haus geführt.
»Warte hier, bis ich dich rufe«, wies er Jutta an und ging voraus.
Jutta dachte nicht daran, ihm zu gehorchen, zu groß war ihre Neugier. Sie folgte ihm. Einer der bewaffneten Männer trat Helmprecht breitbeinig entgegen. Seine Hand lag auf dem Knauf des Langschwertes, das er an der Seite trug. Er blickte äußerst grimmig drein.
»Verschwinde, Bauer!«
Seine Sprache klang fremd; vermutlich sprachen so die Sachsen. Helmprecht war es gewöhnt, dass Menschen höherer Herkunft so mit ihm redeten. Der Säugling in seinen Armen begann erneut zu wimmern. Nicht nur deshalb war Helmprecht fest entschlossen, sich von dem Ritter nicht einschüchtern zu lassen.
»Ich möchte zum Förster, Herr«, erklärte er mit respektvoll geneigtem Kopf. Aber seine Stimme war klar und fest.
»Das geht heute nicht!«
»Und darf ich fragen, warum?«
»Das siehst du doch. Der Förster hat hohen Besuch, da hat er keine Zeit für dich.«
Inzwischen war Jutta bei ihrem Vater angelangt. Sie merkte, dass er sich mühsam beherrschte.
»Verzeiht, aber es ist von großer Dringlichkeit. Dieser Säugling hier braucht dringend eine Amme, und der Förster …«
»Herrgott noch mal, komm morgen wieder!«
Jutta konnte nicht länger an sich halten. »Hoher Besuch? Wer ist es? Der Kaiser?«
»Hab ich dir nicht befohlen, drüben auf mich zu warten?«, zischte Helmprecht.
Der Ritter zeigte erstmals den Anflug eines Lächelns. »Helles Köpfchen, deine Kleine. Erraten, Mädchen, der Kaiser und die Kaiserin sind hier. Versteht ihr nun, dass ihr da nichts zu suchen habt?«
Jutta blies staunend die Wangen auf, aber Helmprecht fühlte sich auf den Arm genommen.
»Der Kaiser, wie? Gewiss doch. Ist vielleicht auch der Herr Papst bei ihm? Oder der König von Frankreich?«
Der Ritter verlor die Geduld mit ihm. »Was erlaubst du dir? Hör zu, Bauernlümmel, wenn du nicht auf der Stelle das Weite suchst …«
»Wirich!« Helmprecht erblickte seinen Freund, den Förster, der soeben das Haus verließ, und winkte ihm heftig zu. Wirich zögerte kurz, eilte dann herbei, wirkte sehr angespannt.
»Hab das von Hroswitha gehört. Es tut mir ja so leid, mein Freund. Aber im Augenblick …«
»Sind der Kaiser und die Kaiserin wirklich bei dir?«, platzte es aus Jutta heraus.
»Ja, Kleine. Sie sind hier!« Es klang wie der Seufzer eines Mannes, der sich mit allem überfordert fühlt. Was keineswegs typisch für den jungen Förster war.
Vor Staunen bekam Jutta den Mund nicht mehr zu. Helmprecht wurde endlich bewusst, dass man ihn durchaus nicht veralbert hatte.
»Wie … ich meine, warum … ausgerechnet hier?«
»Sie befanden sich mit ihrem Gefolge auf dem Weg nach Nimwegen, aber unterwegs …« Er winkte ab. Schweiß perlte auf seiner Stirn. »Freund, ich erzähl’s dir ein anderes Mal. Hab im Augenblick wirklich viel zu tun. Muss mich um all diese Leute kümmern.«
»Siehst du diesen kleinen Wurm hier, Wirich? Verdammt, er hat Hunger, und Hroswitha ist tot, verstehst du?«
»Oh«, machte Wirich nach kurzem Nachdenken.
»Die Amme, die dein Kind nährt – sie hat doch sicher noch Milch übrig, oder? Bitte, Wirich! Was soll ich sonst tun?«
»Der Kerl soll endlich verschwinden!«, meldete der Ritter sich wieder zu Wort. Unter seinem Topfhelm leuchtete ein zornrotes Gesicht.
»Schon gut, Herr. Ich bürge für diesen Mann. Von ihm geht keine Gefahr aus.«
Der Ritter blickte zu seinen Kameraden hinüber, die einen Weinschlauch kreisen ließen. »Na schön. Aber ins Haus darf er trotzdem nicht, verstanden?«
Wirich packte Helmprecht sanft am Arm, führte ihn mit sich fort und gab Jutta einen Wink, ihm zu folgen. Abseits des Hauptgebäudes gab es einen Geräteschuppen.
»Geht da hinein, ich schicke später die Amme zu euch. Verhaltet euch unauffällig, tut mir den Gefallen. Die Herren Ritter sind recht nervös.«
»Danke, Wirich«, sagte Helmprecht erleichtert.
»Ach was. Meine Pflicht als Freund und Christ. Ich werde die Amme jeden Tag zu dir nach Hause schicken. Dein Wurm soll nicht verhungern.«
»Warum sind sie hier?«, fragte Jutta. »Der Kaiser und die Kaiserin.«
»Nun, glaub mir, Kleine, ich war genauso verblüfft wie du, als sie gestern Abend mit ihrem Gefolge hier aufkreuzten.«
»Warum?«, beharrte Jutta, ahnend, dass es einen besonderen Grund für die Anwesenheit des kaiserlichen Paares an diesem abgelegenen Ort geben musste.
Der Förster schien um die Neugier des altklugen Kindes zu wissen, sie würde nicht locker lassen, bis sie eine halbwegs zufriedenstellende Erklärung gehört hatte. Auch Helmprecht sah ihn fragend an.
»Na ja, was soll’s, bald weiß es sowieso jeder. Die Kaiserin ist schwanger, wusstet ihr das? Ausgerechnet auf dem Weg nach Nimwegen hat sie ihre Wehen bekommen.«
»Gütiger Jesus«, flüsterte Helmprecht beklommen; offenbar holten die Erinnerungen an Hroswithas Torturen ihn wieder ein. »Hat sie … Hat sie endlich einen Jungen geboren?«
Seit vielen Jahren wartete man im Reich auf die Nachricht von der Geburt eines möglichen Thronfolgers, aber Kaiserin Theophanu und ihrem Gemahl waren bislang nur drei Töchter geschenkt worden. Was mancher, der der Kaiserin aus der Fremde nicht wohlgesonnen war, mit Häme und Schadenfreude zur Kenntnis nahm.
»Noch hat sie nicht entbunden«, erklärte Wirich, »aber jeden Augenblick kann es so weit sein.«
»Wo ist sie?«, fragte Jutta mit runden Augen.
»Drinnen, umhütet von ihren Zofen, die jeden, der ungefragt hereinkommt, auf der Stelle zerfleischen.«
»Darf ich sie sehen?«
Lächelnd schüttelte Wirich den Kopf. »Das geht auf keinen Fall, Kind. Hast ja gehört, was der Herr Ritter gesagt hat.«
»Ich will nicht, dass es ihr so ergeht wie Mama«, sagte Jutta zu sich selbst, nachdem der Förster verschwunden war. Der Blick, mit dem ihr Vater sie daraufhin maß, hatte beinahe etwas Feindseliges.
»Das liegt wahrlich nicht in der Hand eines törichten Mädchens«, sagte er gepresst.
Die Amme, die wenig später den Schuppen betrat, war eine gedrungene Frau mit rosafarbenem Gesicht und leicht verbissenen Zügen. Wortlos nahm sie Helmprecht den Säugling ab und legte ihn an ihre Brust. Nachdem das Kind gestillt war, wollte sie es dem Vater zurückreichen, aber Helmprecht lag inzwischen schlafend auf einem Haufen Stroh. Seit zwei Tagen hatte er kein Auge zugetan. Die Amme grunzte etwas in sich hinein, wandte sich dann an Jutta. »Hier, nimm die Kleine. Aber lass sie bloß nicht fallen!« Dann verschwand sie.
Das Baby schlummerte und sah jetzt recht zufrieden aus. Zum ersten Mal hielt Jutta die Schwester in ihren Armen. Sie war leichter, als sie gedacht hatte. Jutta fiel ein, dass sie noch keinen Namen hatte, jedenfalls hatte Vater noch keinen erwähnt.
Helmprecht schnarchte. Daheim wartete viel Arbeit, aber Jutta hielt es für besser, ihn eine Weile schlafen zu lassen. Draußen brütete der Sommer. Die Luft in dem Schuppen war stickig und heiß. Je mehr Jutta darüber nachdachte, umso überwältigender fand sie die Tatsache, dass der Kaiser und die Kaiserin leibhaftig in der Nähe waren. Sie sah zur Tür und fasste einen Entschluss.
Aber das Kind! Ließ sie es hier zurück, würde es bald erneut zu schreien beginnen. Was wiederum den Vater wecken würde. Notgedrungen musste sie also ihre Schwester mitnehmen.
Die Tür knarzte beim Öffnen. Mit einem Blick nach hinten überzeugte sich Jutta, dass Helmprecht weiter schlief. Wiljo wollte ihr folgen, aber Jutta ließ ihn zurück. Den Hund konnte sie für ihr Vorhaben nicht gebrauchen.
Draußen blendete sie das Sonnenlicht. Vor dem Haus des Försters standen immer noch die Ritter. Langsam trat Jutta näher. Niemand schien sie wahrzunehmen, nur einer der Männer sah sie kurz an, wandte sich aber sogleich wieder seinen Kameraden zu. Ein kleines Mädchen, das einen Säugling trug, stellte keine Gefahr dar.
Die Ritter unterhielten sich auf Sächsisch, doch Jutta glaubte das Wort ›Nottaufe‹ zu verstehen. Was zunächst einmal nichts Gutes verhieß.
Plötzlich trat ein mittelgroßer Mann aus dem Haus. Sofort verstummten die Ritter, sahen ihn erwartungsvoll an. Ein blonder Bart rahmte sein rötliches, noch junges Gesicht, seine Augen leuchteten wie die eines Knaben, den man reich beschenkt hatte. Über seinen Schultern lag ein purpurner Umhang, in den Händen hielt er einige Weinschläuche.
Jutta stutzte. Das musste Kaiser Otto sein.
»Männer, das Reich hat einen Thronfolger. Lasst uns trinken auf meinen Sohn!«, rief er.
Die Ritter zogen jubelnd ihre Schwerter, um sie in die Höhe zu recken. Lächelnd verteilte der Kaiser die Schläuche. Er selbst nahm ein paar kräftige Züge, sodass der Wein durch seinen Bart rann und auf sein blaues Surkot tropfte. Niemand achtete auf das Mädchen. Die Ritter führten ihren Herrn in den Schatten einer nahen Linde, stimmten einen rauen Gesang an, tranken. Ihr Kaiser schien für sie kein Unnahbarer zu sein.
Die Tür zum Haus stand weit offen und war unbewacht. Jutta zögerte nicht, trat ein. Niemand eilte herbei, um es ihr zu verbieten. Hatte die Sonne sie vorhin geblendet, so musste Jutta sich nun wieder an dämmriges Licht gewöhnen. Sie befand sich in einem Vorraum, zu ihrer Rechten führte eine steile Holzstiege nach oben.
Wo mochte die Kaiserin sein? Vermutlich nicht im Obergeschoss – wie hätte die Hochschwangere dort hinaufgelangen sollen?
Gedämpfte Frauenstimmen hinter einer Tür. Waren das die beflissenen Zofen, von denen Wirich erzählt hatte? Anders als die Männer sahen sie wohl keinen Grund, ausgelassen und vergnügt zu sein. Vermutlich befand sich das Neugeborene bei ihnen, das nun bestaunt und umhegt wurde. Der künftige König und Kaiser!
Eine weitere Tür stand halb offen. Jutta linste hinein. Auf einem Lager eine schlafende Frau. Erschöpfung zeichnete ihr ebenmäßiges Gesicht, und ihr dunkles, wie Seide glänzendes Haar wallte zu beiden Seiten über das Kissen. Nie zuvor hatte Jutta eine schönere Frau gesehen.
Die Kaiserin!
Niemand war bei ihr. Gewiss hatte man ihr Ruhe verordnet. Juttas Herz klopfte wie verrückt. Sie musste die schöne Frau unbedingt von Nahem sehen, nur mit Gewalt hätte man sie davon abbringen können. Sie schlich ins Gemach und hoffte inständig, dass die Kleine in ihren Armen nicht zu schreien begann. Später hätte Jutta nicht zu sagen vermocht, wie lange sie neben dem Bett gestanden und die Kaiserin betrachtet hatte. Wie war es möglich, dass eine Frau so schön sein konnte? Ob Kaiserinnen besonders hoch in der Gunst des lieben Gottes standen?
Urplötzlich schlug sie die Augen auf. Sie waren hell und rund und blickten Jutta offen an. Jutta wich einen Schritt zurück, doch die Faszination war größer als ihr Schrecken. Also trat sie wieder näher und hielt dem Blick Theophanus stand.
»Bist du ein kleiner Engel?«, fragte die Kaiserin. Ihre Stimme klang müde, doch ihrer Schwäche zum Trotz gelang ihr ein Lächeln.
»Ich heiße Jutta«, entgegnete die Gefragte wie verzaubert.
»Wen … trägst du da in deinen Armen, Jutta?«
Jutta wurde wieder bewusst, dass sie ein Kind hielt. Da ihre Schwester noch keinen Namen hatte, antwortete sie ein wenig hilflos: »Ach, es ist nur ein Säugling.«
»Ist es mein Junge?«
»Nein, ein Mädchen ist’s.«
Die Kaiserin stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »So hat sie also doch überlebt? Ach, hab Dank, mein kleiner Engel.«
Jutta schwieg, denn sie wusste nicht, warum die Kaiserin so sprach. Ob sie fieberte?
»Wie heißt Eure Tochter?«, hörte Jutta sich sprechen.
»Sie soll auf den Namen Irene getauft sein.« Mit müden Bewegungen nahm sie eine Spange aus ihrem Haar. »Das soll sie später daran erinnern, wie glücklich ich war, weil Gott sie am Leben ließ.«
Mit zitternder Hand reichte sie Jutta das Schmuckstück, doch das Mädchen schüttelte heftig den Kopf.
»Nein, das … das geht doch nicht.«
»Bitte, nimm es.«
Die Haarspange war aus mattem Silber gefertigt und ohne jede Verzierung; dennoch war sie das Wertvollste, was sie je in den Händen gehalten hatte. Wertvoller sogar als der runde Denar, den sie besaß.
Kaiserin Theophanu schlief wieder ein. Sie besaß lange schwarze Wimpern. Ihre Nase war lang und schmal und edel. Unvorstellbar, fand Jutta, dass es irgendwo auf der Welt eine Frau gab, die es mit ihrer Schönheit aufnehmen konnte. Wie im Traum verließ sie das Försterhaus.
Immer noch feierten der Kaiser und seine Ritter unter der Linde die Geburt des Thronfolgers. Auch Wirich befand sich unter den Männern, die ihm gönnerhaft und gut gelaunt die Schultern klopften, als sei er ihresgleichen. Niemand achtete auf Jutta. Inzwischen war der Säugling ihr sehr schwer geworden. Als sie in den Schuppen zurückkehrte, wachte Helmprecht auf, weil Wiljo das Mädchen zur Begrüßung laut anbellte.
»Warum hast du mich nicht geweckt?«, fragte der Vater vorwurfsvoll.
»Die Kaiserin hat einen Sohn geboren«, erklärte sie ihm bedeutungsvoll.
»Was du nicht sagst.« Er rieb sich die Augen und stand auf. »Eine Kaiserin lässt der Herrgott gern am Leben«, raunte er. »Lieber nimmt er sich die einfachen Leute.«
»Es gibt jetzt einen Thronfolger, Papa.«
»Komm, wir müssen weiter. Gib mir das Kind.«
»Sie heißt Irene.«
Verständnislos sah er sie an. »Irene? Was soll das denn für ein Name sein? Wir werden sie auf den Namen Magda taufen lassen – so hieß eure Großmutter! Und jetzt sei still!«
Erst viel später erfuhr Jutta, dass die Kaiserin Zwillinge geboren hatte. Allerdings war einer der Säuglinge, ein Mädchen, unmittelbar nach der Entbindung gestorben.
*
Theophanu schlug die Augen auf. Der Schmerz in ihrem Schoß hatte ein wenig nachgelassen. Neben der Bettstatt saß lächelnd Eunice, ihre Lieblingszofe. Eunices kleiner Sohn Luitger hockte auf den Knien der Mutter und betrachtete die ruhende Kaiserin mit den runden Augen eines von Forscherdrang erfüllten Kindes.
»Bring mir meine Zwillinge, Eunice«, hauchte die Kaiserin der Zofe in griechischer Sprache zu.
Über Eunices Gesicht huschte ein Schatten. »Der Junge schläft, Herrin. Es geht ihm gut, seid unbesorgt. Auch Ihr solltet noch ruhen, denn Ihr habt Fieber.«
»Das Mädchen …«
»Grämt Euch nicht länger. Es erhielt die Nottaufe und darf bereits Gottes Antlitz schauen.«
»Nein, sie lebt! Irene – ich habe sie selbst gesehen.«
Eunice schüttelte seufzend den Kopf und strich ihrer Herrin zärtlich durchs Haar. »Es war sicher nur ein Fiebertraum, Herrin. Schlaft!« Auch der kleine Luitger streckte schmachtend seine Händchen aus, um Theophanus Haare zu berühren.
Ein Traum? Theophanu verspürte ernüchternde Leere. Niemals würde Eunice sie belügen. Die Dienerin war bei ihr, seit sie vor acht Jahren übers große Meer gekommen war. Beinahe war sie ihr eine Schwester.
Nur ein Traum. Gern hätte sie ein paar Tränen vergossen. Aber das durfte sie nicht. Ein altes Versprechen, das sie sich selbst gegeben hatte, hinderte sie daran. Sie fuhr tastend durch ihre Haare. Die Spange, sie war fort! Ein schwaches Lächeln umspielte Theophanus Mund, bevor der Schlaf erneut über sie kam.
Erster Teil
972 – 974
Die Fremde
König war er und Christ,
des Vaterlands herrlichste Zierde,
den hier der Marmor bedeckt:
dreifach beklagt ihn die Welt.
Inschrift des Grabmonuments Ottos des Großen
1
Rom, April 972, kurz vor dem Osterfest, im kaiserlichen Palast zu St. Peter
Der Bote aus Benevent, der der Delegation aus Konstantinopel voraneilte, wurde unverzüglich zum Kaiser vorgelassen. Auch Adelheid, die Kaiserin, sowie der junge Thronfolger waren zugegen, als der verschwitzte Mann, ein junger Mönch aus dem Gefolge Erzbischofs Gero von Köln, in den Saal geführt wurde. Er verbeugte sich tief vor den Hoheiten und setzte an zu der üblichen Litanei der Ehrerbietungen, aber Kaiser Otto, der große Sieger vom Lechfeld, winkte ungeduldig ab. Ihn interessierte einzig und allein die Frage, ob dem Erzbischof Erfolg bei seiner Mission beschieden gewesen sei. Also beeilte der Bote sich zu versichern, die Braut des Thronfolgers befinde sich bereits auf dem Landweg nach Rom.
Eine Braut aus Byzanz! Das war die Nachricht, auf die alle gewartet hatten. Gero, der gute alte Gero, hatte geschafft, was keinem vor ihm gelungen war. Byzanz erkannte Ottos Kaisertum an, indem es zuließ, dass die beiden Herrscherhäuser verwandtschaftlich verbunden wurden. Die Zeiten, wo der Ostkaiser sich als einzigen legitimen Nachfolger der römischen Cäsaren gesehen hatte, schienen endgültig vorbei. Otto, den viele bereits den Großen nannten, war dem Basileus ebenbürtig. Er warf seiner Gemahlin einen erlösten Blick zu. Hatten sie jetzt nicht alles erreicht, was es zu erreichen gab?
Doch Adelheid blinzelte skeptisch. »Und jetzt berichtet, was Ihr uns bislang beharrlich verschwiegen habt«, forderte sie den Boten scharfsinnig auf. »Wer ist die Braut?«
»Ihr Name ist Theophanu«, erklärte der Bote nicht ohne Verlegenheit. »Sie ist eine Nichte des Basileus.«
»Eine Nichte?« Adelheids Augen schossen Blitze auf den Ärmsten ab, als habe er etwas Unanständiges gesagt. Sie wandte sich zu ihrem Gemahl. »Da seht Ihr, was Ihr Byzanz wert seid!«
Des alten Kaisers Hochstimmung war durch die letzten Worte des Boten deutlich getrübt worden. Nachdenklich spitzte er den Mund und strich sich durch den Bart.
»Die Nichte eines Thronräubers, ha!« Die Kaiserin schüttelte empört den Kopf. »Hatten wir den Erzbischof nicht ausgesendet, damit er uns eine Purpurgeborene bringt? War nicht von Anna, der Tochter des verstorbenen Kaiser Romanos, die Rede gewesen? Was erlaubt sich dieser Johannes Tzimiskes? Wieso hat Gero sich auf diesen Handel eingelassen?«
»Ich bin sicher«, versuchte Kaiser Otto sie zu besänftigen, »der Erzbischof hatte gute Gründe dafür, Teuerste.«
»Byzanz verhöhnt uns«, fuhr Adelheid unbeirrt fort. »Man sendet uns eine nicht gewünschte Jungfrau.«
»Und dennoch ist sie eine Verwandte des Kaisers.«
»Wir sollten sie unverzüglich wieder nach Hause schicken, diese Theophanu.«
Der Kaiser sah hinüber zu seinem Sohn. Mit hochrotem Kopf stand der siebzehnjährige Otto im Hintergrund. Bislang hatte er zu allem geschwiegen. Sein unruhiger Blick richtete sich mal auf seine Füße, dann auf den übermächtigen Vater, dann wieder auf den Überbringer der Neuigkeiten.
»Erzählt uns von der Prinzessin!«, forderte der alte Kaiser den Boten auf.
»Sie ist hochgebildet und äußerst begabt, mein Kaiser. Das Lateinische beherrscht sie fließend und auch unsere Sprache hat sie während der Reise vorzüglich zu sprechen gelernt.«
»Ist sie hübsch?«
Die Frage schien den Boten zu überraschen, denn er räusperte sich. »Ob sie …?«
»Ziert Euch nicht. Ihr habt die Frage verstanden, oder etwa nicht?«
Der Bote holte tief Luft. »Nie zuvor sah ich ein Mädchen von solcher Schönheit.« Rasch fügte er hinzu: »Und die Brautschätze, die sie aus ihrer Heimat mitbringt, sind von unermesslichem Wert.«
Abermals blickte der Kaiser seinen Sohn an. »Nun, was meinst du, Junge?«
Das Gesicht des jüngeren Otto leuchtete immer noch. Zaghaft setzte er zu einer Antwort an, doch bevor er sprechen konnte, verkündete sein Vater die Entscheidung, die er offenbar längst gefällt hatte.
»Prinzessin Theophanu wird eine Bereicherung für unser Geschlecht sein.«
»Ihr beabsichtigt nicht, sie wieder heimwärts zu schicken?«, fragte Kaiserin Adelheid, die sichtlich um Fassung rang.
»Warum sollten wir das tun? Sie ist eine byzantinische Prinzessin. Unser Haus wird verbunden sein mit dem Blut der Romäer. War das nicht unsere Absicht? Die Hochzeit kann stattfinden – gleich nach der Osterwoche.«
Kurze Zeit später jagte ein Trupp kaiserlicher Panzerreiter über die alte Via Appia, um der Prinzessin entgegenzureiten und sie wohlbehalten in die Ewige Stadt zu geleiten.
Rom war in den Augen der vierzehnjährigen Prinzessin Theophanu ein Ort aus Dreck, Trümmern und verblichener Herrlichkeit. Die Ruinen, kolossal aber kalt, die sich allerorten aus dem Staub der Jahrhunderte hoben, erschütterten sie im Stillen. Büsche und Sträucher wuchsen aus altersmorschen Mauern. Bezeichnete man Konstantinopel als das zweite Rom, so war Theophanu froh, nicht im ersten Rom geboren und aufgewachsen zu sein. Die Behauptungen ihrer Lehrer waren nicht übertrieben gewesen: Rom führte längst ein Schattendasein auf dieser Erde; auch die Anwesenheit der anmaßenden Päpste konnte an dieser Tatsache nichts ändern. Mochte die Stadt für die Franken aus dem Norden auch immer noch imponierend und prächtig sein, für jemanden aus Konstantinopel glich sie einem gigantischen Steinbruch, einem Spottbild ihrer selbst.
Während der Reisewagen, begleitet von des Kaisers Eskorte, sich rumpelnd durch die Gassen pflügte, St. Peter entgegen, spähte Theophanu aus dem Fenster, um die Menschen zu betrachten, die am Wegesrand standen und den prachtvollen Zug bestaunten. Die Prinzessin trug eine goldbestickte Haube, langes dunkles Haar wallte über ihre Schultern.
»Sehen sie nicht aus wie Bauern?«, raunte sie Eunice zu. Die Dienerin, ein paar Jahre älter als ihre Herrin, kicherte in ihre Hand hinein.
»Es sind Bauern, Herrin. Seht Ihr nicht die Schweine an jeder Ecke?«
»Ha! Sogar die Schweine sehen in Konstantinopel vornehmer aus.«
»Und all diese Mücken! Heiliger Pantaleon! Sie scheinen sich hier besonders wohl zu fühlen. Ich hoffe nur, dass es im Norden von Kaiser Ottos Reich weniger von diesen Biestern gibt.«
»Wenn ich Kaiserin bin, werde ich sie verbannen. Was hältst du davon?«
»Viel. Außerdem könntet Ihr anordnen, dass jeder Römer und jeder Barbar sich täglich zu waschen hat. Und zwar von Kopf bis Fuß.«
Nun kicherten sie beide. Die ungezwungene Ausgelassenheit nach der langen tristen Reise tat gut. Erzbischof Gero von Köln aber, der den beiden jungen Frauen gegenübersaß, runzelte die Stirn. »Ihr solltet nicht abfällig über die Römer sprechen, Prinzessin! Sie beherrschten einst die Welt. Und vergesst nicht das Blut der Märtyrer, das in dieser Stadt geflossen ist. Es ist geheiligter Boden, auf dem Ihr Euch befindet.«
Manchmal vergaß Theophanu, dass Gero des Griechischen mächtig war.
»Gewiss. Verzeiht mir, Herr Bischof.« Sie klang nicht sonderlich zerknirscht, aber es lag ihr nichts daran, Gero zu verärgern. Sie mochte den alten weißbärtigen Mann. In den vergangenen Wochen war er ihr ein großväterlicher Mentor gewesen. Während der langen Schiffsreise hatte er ihr mit viel Geduld die Sprache ihres neuen Volkes beigebracht und von Sitten und Bräuchen berichtet, an die sie sich nur langsam gewöhnen würde.
Geros Ernsthaftigkeit riss sie zurück in die Wirklichkeit. Den Gedanken, dass sie in Kürze ihrem Bräutigam entgegentreten würde, hatte sie so weit wie möglich in den Hintergrund gedrängt. Das Leben, das sie gekannt hatte, war Vergangenheit. Sie war eine Fremde in einem fremden Reich und auch Eunices Gegenwart war ihr plötzlich nur ein schwacher Trost. Jetzt spürte sie ihr Herz klopfen. Fortan schwieg sie zu dem, was da draußen an ihr vorüberglitt. Einmal winkte sie einem Mädchen zu, das einen Blick auf sie erhaschte und vor lauter Staunen den Mund nicht zubekam.
Sie überquerten eine Tiberbrücke. Theophanu sah in die trüben Fluten des Flusses und dachte wehmütig an die blauen Wasser des Bosporus, über die ein frischer Wind strich und kräuselnde Wellen formte. Der alte Erzbischof schien zu wissen, was ihr durch den Kopf ging.
»Du musst keine Angst haben, Theophanu«, sagte er leise zu ihr. Zum ersten Mal sprach er sie nicht als Prinzessin an, aber Theophanu störte es nicht.
»Ihr denkt, ich habe Angst?« Es gelang ihr nicht, ihrer Stimme einen amüsierten Beiklang zu verleihen.
»Auch eine Löwin hat manchmal Angst«, erwiderte Gero flüsternd. »Und du bist eine Löwin, meine Tochter, deine Augen verraten es mir. Du wirst allen Widrigkeiten trotzen. Gott wird dir dabei helfen, dafür bete ich. Denn ich weiß, dass du Gott gefällst.«
»Wie könnt Ihr da so sicher sein?« Die Huldigung aus dem Mund des ehrwürdigen Erzbischofs beschämte Theophanu. Statt einer Antwort verzog er den Mund zu einem Lächeln.
»Bitte erzählt mir von meinem künftigen Gemahl«, bat sie ihn, da er offenbar nicht näher auf seine kryptischen Behauptungen eingehen wollte.
»Habt Ihr mir diese Frage in den vergangenen Wochen nicht schon hundert Mal gestellt, Prinzessin?«
»Möglich, doch Eure Antworten gaben mir stets Mut und Hoffnung.«
Er lächelte immer noch. »Ich übertrieb nicht, als ich Euch den jungen Otto als einen Menschen beschrieb, der Eurer würdig ist. Aber Ihr werdet ihn gleich selbst kennenlernen, Prinzessin, deshalb werde ich mich nicht wiederholen. Seht es mir nach.«
Theophanu seufzte leise. Eunice zwinkerte ihr verschwörerisch zu. Einer der Reiter ließ sich zurückfallen und spähte ins Innere des Wagens. »Wir nähern uns St. Peter, Eure Exzellenz«, informierte er den Erzbischof.
Gero nickte und wandte sich erneut an Theophanu: »Meine Aufgabe ist nun erfüllt, Prinzessin.«
Beinahe trieben seine Worte, die so sehr nach Abschied schmeckten, ihr Tränen in die Augen. Als der Wagen kurz darauf zum Stehen kam, wusste Theophanu, dass ihr neues Leben begann. Sie warf sich Gero in die Arme.
»Schon gut, kleine Löwin«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Denk immer an meine Worte und vertraue auf Gott. Sieh nur, dein künftiger Gemahl ist erschienen, um dich zu empfangen.«
Theophanu nickte tapfer.
Der junge Kaiser überragte sie allenfalls um einen halben Kopf. Sein Gesicht war jungenhaft und dennoch ernst, ein zarter blonder Bart bedeckte seine Wangen. Die Hand, die er ihr reichte, um ihr beim Aussteigen behilflich zu sein, fühlte sich weich an, aber nicht kraftlos. Theophanu versuchte in seinen Augen zu erkennen, was er bei ihrem Anblick empfand, doch es stand keine Antwort darin geschrieben. Sie begriff, dass auch sie selbst nichts fühlte außer der Aufregung dem Neuen gegenüber. Es fuhr kein Blitz in ihr Herz, als sie den Mann erblickte, mit dem sie schon bald vermählt werden sollte. Aber sie empfand das nicht als Enttäuschung. Die Sonne, die wohltuend wärmend am römischen Himmel stand, verbat ihr, sich um Dinge zu sorgen, die längst beschlossen waren.
»Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise!«
Der junge Kaiser sprach langsam und ruhig; er besaß eine glockenhelle Stimme. Theophanu war überrascht über seinen vertraulichen Ton, empfand ihn aber nicht als störend. Otto schien es wirklich zu interessieren, ob sie eine gute Reise gehabt hatte. Er verzichtete auf die umständlichen Regeln der Etikette. Sie sah ihm tief in die Augen und spürte, wie sehr er sich mühte, ihrem Blick nicht schüchtern auszuweichen.
»Ein paar Wochen zur See können sehr beschwerlich sein«, erklärte sie ihm mit erhobenen Brauen. »Und nach ein paar Tagen im Reisewagen spürt man jeden einzelnen Knochen. Aber sonst war die Reise gut, vielen Dank.«
Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass sie seine Sprache so gut beherrschte, denn sein Mund blieb offen stehen, ohne dass er etwas zu erwidern wusste. Theophanu fragte sich, ob sie nicht zu forsch gewesen sei; auch für Otto war dies eine Begegnung, über deren möglichen Verlauf er sicherlich viel nachgedacht hatte. Doch mit einem Mal zeigte sich ein verschmitztes Lächeln auf seinen Lippen.
»Oh, ich glaube, ich kann es dir nachfühlen«, behauptete er. »Nach ein paar Tagen auf dem Pferd fühle ich mich ähnlich malträtiert.«
»Und ich weiß genau, welches Körperteil dir nach dem Ritt besonders schmerzt!«
Otto warf den Kopf in den Nacken und begann laut zu lachen. So überrascht war Theophanu über seine Reaktion, dass sie ihn regelrecht anstarrte. Dann lachte auch sie, denn Ottos unerwarteter Anfall von Fröhlichkeit wirkte ansteckend. Eunice, die inzwischen hinter sie getreten war und sich verhalten räusperte, brachte sie wieder zur Besinnung. Theophanu rief sich in Erinnerung, dass sie nicht unbeobachtet waren. Vor dem Palast, nur wenige Schritte entfernt, stand das Kaiserpaar – kein Zweifel, bei den beiden bekrönten Gestalten handelte es sich um Ottos Vater und seine Gemahlin Adelheid. Sie waren umgeben von einer beträchtlichen Gefolgschaft aus Rittern, Dienern und Geistlichen.
»Vermutlich musst du mich nun meinen künftigen Schwiegereltern vorstellen«, flüsterte Theophanu, von neuer Nervosität erfüllt. Auf der Stelle wurde Otto ernst.
»Oh, gewiss. Bitte!« Er bot ihr seinen Arm dar.
Es fiel ihr nicht schwer, würdevoll an seiner Seite zu schreiten, schon im frühesten Kindesalter hatte man ihr das beigebracht. Bei den Wartenden angelangt, neigte sie mit klopfendem Herzen den Kopf vor dem Kaiser und der Kaiserin, achtete aber darauf, dass es nicht wie eine Verbeugung wirkte.
Kaiser Otto der Große erwiderte ihre Geste. Er war größer und kräftiger als sein Sohn. Ein grauer, sorgsam gestutzter Bart verlieh ihm Hoheit. Seine sanften Augen musterten Theophanu freundlich. Trotz seiner Körperfülle wirkte er eher unscheinbar, doch Theophanu vergaß es nicht einen Moment lang: Allein der Tatkraft dieses Mannes war es zu verdanken, dass die räuberischen Horden der heidnischen Ungarn keine Gefahr mehr für die christliche Welt darstellten. In einer großen Schlacht hatte Otto sie einst vernichtend geschlagen.
»Wie ich sehe, hat der Bote des guten Gero nicht übertrieben. Seid willkommen, Prinzessin Theophanu!«
»Habt Dank für den freundlichen Empfang.«
»Wir fühlen uns geehrt, dass Ihr unserer Einladung gefolgt seid.«
Als ob sie eine Wahl gehabt hätte! Aber Ottos Stimme war so sanft wie sein Blick, und Theophanu wusste in diesem Augenblick, dass sie sich bestens mit ihrem Schwiegervater verstehen würde. Bei Adelheid hatte sie jedoch ihre Zweifel. Zur Begrüßung hatte die Kaiserin ihr nur kurz zugenickt, ihre Miene blieb unbewegt, fast kühl.
Adelheid war deutlich jünger als ihr Gemahl und von unverkennbarer Schönheit. Theophanu wusste, dass ein abenteuerliches Leben hinter ihr lag und war deshalb sehr gespannt auf die erste Begegnung mit ihr gewesen. In Byzanz hielt man sich in der Bewunderung westlicher Herrschergestalten traditionell zurück, doch Adelheids Schicksal war selbst den Ammen und somit den Kindern bekannt. Für die kleine Theophanu war Adelheid eine Heldin gewesen. Diese Heldin ihrer Kindheit stand nun leibhaftig und würdevoll vor ihr und sah sie aus schmalen Augen an. Endlich verzog sich ihr Mund zu einem halben Lächeln.
»Ihr seid ein wenig bleich, Prinzessin. Ich hoffe, die Reise war nicht allzu anstrengend.«
Nichts im Klang ihrer Stimme gab etwas preis von dem, was sie beim Anblick ihrer künftigen Schwiegertochter empfinden mochte. Theophanu ahnte, es würde nicht einfach sein, sich Adelheids Vertrauen und Zuneigung zu erwerben. Noch bevor sie etwas erwidern konnte, fuhr die Kaiserin fort: »Bis zur Hochzeit werde ich mich Eurer annehmen. Es wird Euch an nichts mangeln.«
»Habt Dank für Eure Güte, kaiserliche Hoheit!«
Adelheid gab einigen Dienerinnen, die etwas abseits auf Anweisungen warteten, einen Wink. »Man wird Euch nun in meine Gemächer führen, Prinzessin. Auch um Euer Gepäck werden meine Zofen sich kümmern. Sicherlich braucht Ihr etwas Ruhe.«
Theophanu nickte fügsam, obwohl sie alles andere als müde war und am liebsten auf der Stelle einen Streifzug durch jene Stadt unternommen hätte, in der einst die Geschicke der Welt entschieden wurden. Sie tauschte einen kurzen Blick mit Eunice, die ergeben näher trat.
»Ihr werdet der Dienste Eurer Zofe vorerst nicht bedürfen, Prinzessin«, verkündete Kaiserin Adelheid leise, aber nachdrücklich. »In meinen Gemächern steht mein Gesinde Euch jederzeit zur Verfügung.«
Theophanu verbarg nicht ihren Missmut über diese Worte. »Um Vergebung, kaiserliche Hoheit. Aber meine Dienerin möchte ich keinesfalls missen.«
Es folgte ein kurzes Schweigen, das Kaiser Otto beendete, indem er herzhaft zu lachen begann. »Recht hat sie, die junge Prinzessin. Hat sie nicht schon Fremde genug um sich? Teuerste Gemahlin, um Himmels Willen, lasst ihr doch ihre Dienerin.«
»Wie Ihr wünscht«, erwiderte Adelheid mit dünner Stimme.
Bevor man Theophanu in den Palast führte, warf sie einen letzten Blick zurück, winkte noch einmal dem alten Gero zu. Ihrem künftigen Gemahl, der neben seinem Vater wie verloren wirkte und ihr verträumt hinterherblickte, schenkte sie ein Lächeln.
»Ich hasse dieses Land, Herrin. Sehnt auch Ihr Euch nach Konstantinopel zurück?«, raunte Eunice ihr seufzend zu.
»Sei unbesorgt«, tröstete Theophanu ihre Dienerin. »Es ist Gottes Wille, dass wir hier sind.«
2
Adelheid war von burgundischem Adel. Ihre Kindheit hatte sie auf der Burg Saint-Maurice im Rhonetal verbracht. Nach dem Tod ihres Vaters, des Burgunderkönigs Rudolf, heiratete ihre Mutter Berta notgedrungen den streitbaren Hugo von Vienne, König der Lombardei, der sich auf diese Weise zugleich die Herrschaft in Burgund sichern wollte. Die sechsjährige Adelheid gelangte somit nach Pavia und wurde mit Hugos achtjährigem Sohn Lothar verlobt; zehn Jahre später wurde die Ehe vollzogen.
Die Zahl der Gegner Hugos war nicht gering. Der Mächtigste darunter hieß Berengar von Ivrea. Berengar machte ihm die Königskrone bald streitig; resigniert zog der ohnmächtige Hugo sich in ein Kloster zurück. Sein Sohn Lothar, Adelheids Gemahl, gelangte auf den Thron, doch Berengar blieb der eigentliche Machthaber. Wobei dieser wiederum, wie man munkelte, unter dem unheilvollen Einfluss seiner nicht minder machthungrigen Gemahlin Willa stand. Als Lothar zwanzigjährig starb, blieb es nicht aus, dass Berengar und Willa des Giftmordes verdächtigt wurden. Mit nur achtzehn Jahren war Adelheid zur Witwe geworden.
Berengar, der seine Stunde gekommen sah, trug ihr die Hand seines Sohnes Adalbert an. Aber Adelheid lehnte ab. Die Verweigerung der jungen Frau war mutig. Vor allem aber war sie gefährlich, denn Adelheid blieb zunächst auf sich allein gestellt. Berengar handelte rasch, ließ sich wider alles Recht von den Großen zum König wählen. Adelheid wurde nicht nur enteignet und ihrer Kleinodien beraubt, sondern alsbald auch verhaftet, von Berengar und Willa eigenhändig misshandelt und auf der Burg in Garda eingekerkert. Nur ein Pater und eine Dienerin durften bei ihr bleiben.
Trotz strenger Bewachung gelang es Adelheid, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Bischof Adalhard von Reggio, ein erklärter Gegner Berengars und Willas, versprach ihr Hilfe. Als Adelheid eines Tages aus dem Fensterloch ihres Verlieses schaute, erblickte sie im Burghof einen Knecht, der mit Holzscheiten das Wort »Grabet« auslegte. War dies das Zeichen ihrer Retter, auf das sie so lange gewartet hatte?
Die Gefangenen begannen, den hartgestampften Lehmboden ihres Verlieses aufzugraben. Wochen vergingen, fast wollten sie schon entmutigt aufgeben. Dann aber stießen sie auf eine kleine Grotte, die in einen Gang mündete. Ein längst vergessener Geheimgang, von dessen Existenz zumindest einer ihrer Gönner gewusst haben musste. Ein Weg, der in die Freiheit führte.