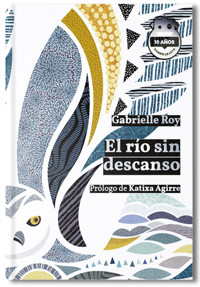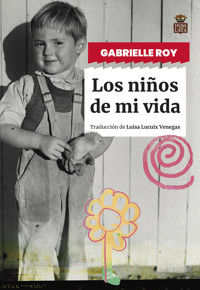16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Gabrielle Roy war ihrer Zeit weit voraus." Margaret Atwood
Zum ersten Mal in der Geschichte Québecs wagte es Gabrielle Roy, von den sozialen Missständen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erzählen und den Frauen eine Stimme zu geben. Ihre Hauptheldin ist die 19-jährige Florentine, eine lebenshungrige Kellnerin aus ärmlichen Verhältnissen, die sich auf der Suche nach Liebe und Glück verrennt. Roy verwebt das Schicksal der jungen Florentine gekonnt mit dem ihres Angebeteten, einem kaltherzigen Emporkömmling, sowie den Nöten der Mutter und Geschwister. Der Roman schildert drei Monate in Montreal im Jahr 1940 – und zoomt mitten hinein in eine Zeit der Klassenkämpfe, enttäuschten Hoffnungen und Zukunftsträume.
Gabrielle Roy gilt als Wegbereiterin der Moderne und Grande Dame der feministischen Literatur Kanadas. Mit ihren Heldinnen hat sie ganze Generationen geprägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Gabrielle Roy war ihrer Zeit weit voraus.« Margaret Atwood
Zum ersten Mal in der Geschichte Québecs wagte es Gabrielle Roy, von den sozialen Missständen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erzählen und den Frauen eine Stimme zu geben. Ihre Hauptheldin ist die 19-jährige Florentine, eine lebenshungrige Kellnerin aus ärmlichen Verhältnissen, die sich auf der Suche nach Liebe und Glück verrennt. Roy verwebt das Schicksal der jungen Florentine gekonnt mit dem ihres Angebeteten, einem kaltherzigen Emporkömmling, sowie den Nöten der Mutter und Geschwister. Der Roman schildert drei Monate in Montreal im Jahr 1940 – und zoomt mitten hinein in eine Zeit der Klassenkämpfe, enttäuschten Hoffnungen und Zukunftsträume. Gabrielle Roy gilt als Wegbereiterin der Moderne und Grande Dame der feministischen Literatur Kanadas. Mit ihren Heldinnen hat sie ganze Generationen geprägt.
Über Gabrielle Roy
Gabrielle Roy wurde 1909 als jüngstes von elf Kindern in der kanadischen Provinz Manitoba geboren. Sie arbeitete als Lehrerin, bevor sie nach England und Frankreich ging, um dort Drama zu studieren. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Kanada zurück und arbeitete in Montreal als Journalistin. Ihr Roman »Gebrauchtes Glück« verkaufte sich allein in den USA über eine Dreiviertelmillion Mal. Gabrielle Roy starb mit 73 Jahren.
Sonja Finck, geboren 1978 in Moers, lebt als literarische Übersetzerin in Berlin und Gatineau (Kanada). Sie überträgt unter anderem Annie Ernaux, Léonora Miano und John Boyne ins Deutsche.
Anabelle Assaf, geboren 1986 in Recklinghausen, ist Literaturagentin, freie Übersetzerin und lebt in Köln.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Gabrielle Roy
Gebrauchtes Glück
Roman
Aus dem Französischen (Québec) von Anabelle Assaf und Sonja Finck
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Impressum
Für Mélina Roy
Vorwort
Als Gabrielle Roy 1945 ihren ersten Roman veröffentlicht, ahnt sie nicht, dass Gebrauchtes Glück zum Klassiker der Québecer Literatur avancieren, weltweit gelesen, in Hollywood verfilmt werden und in ihrer Heimat sogar weitreichende politische Veränderungen anstoßen würde.
1909 kommt Gabrielle Roy als jüngstes von elf Kindern in Saint-Boniface zur Welt, womit die heute bekannteste Autorin Québecs streng genommen eine Francomanitobaine ist, also zur französischsprachigen Minderheit im kanadischen Bundesstaat Manitoba gehört. 1937 geht sie nach Europa, um in Paris und London eine Schauspielausbildung zu machen, und sammelt dort erste Erfahrungen als Journalistin. London wird zudem Schauplatz einer kurzen, aber leidenschaftlichen Liebesgeschichte mit einem ukrainischstämmigen Anglokanadier, der sich jedoch als Geheimagent im Auftrag gegen die Sowjetregierung entpuppt.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs muss sie in ihre Heimat zurückkehren und lässt sich in Montréal nieder, zu jener Zeit die einzig wirkliche Metropole Kanadas, wo sie ihre journalistische Arbeit fortführt. In dieser außergewöhnlichen Stadt, die damals wie heute vom Nebeneinander vieler Sprachen geprägt ist, allen voran Französisch und Englisch, begibt sich Gabrielle Roy auf Entdeckungsreise. Es ist eine Zeit des Umbruchs – der in Europa wütende Krieg erreicht den nordamerikanischen Kontinent, überall melden sich junge Männer freiwillig zum Wehrdienst, getrieben von Abenteuerlust, aber mehr noch von der Aussicht, endlich ein wenig Geld zu verdienen. Wie in vielen industriellen Großstädten jener Zeit prallen in Montréal Reichtum und Elend unmittelbar aufeinander. Vom symbolträchtigen Berg, dem Mont Royal, blicken die feudalen Villen der anglophonen Großverdiener hinunter auf die dreckigen, vom Qualm der Fabrikschlote und Dampflokomotiven verpesteten Armen- und Arbeiterviertel am Kanal Lachine.
Dort, in Saint-Henri, einem jener Viertel, in denen während der vierziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts hauptsächlich ehemalige Landbewohner leben, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft in die Stadt gekommen sind, dann aber durch die Weltwirtschaftskrise in die Arbeitslosigkeit getrieben wurden, begegnet Gabrielle Roy den Heldinnen und Helden ihres späteren Romans. Sie trifft auf eine Elterngeneration, die gottesfürchtig und schicksalsergeben das Joch der Ausbeutung erträgt und Kinder in die Welt setzt, die sie kaum ernähren kann, wie die Romanfiguren Rose-Anna und Azarius. Aber auch auf eine jüngere, bereits in der Großstadt geborene Generation, die sich den Verlockungen des modernen Amerika zuwendet, dem strengen Katholizismus ihrer Eltern zunehmend den Rücken kehrt und vorsichtig gegen die herrschenden Strukturen aufbegehrt. Auf junge Frauen wie Florentine, die dem Schicksal ihrer Mütter, dem Elend und den unzähligen Geburten, entgehen wollen, und auf junge Männer wie Emmanuel und Jean, die nach sozialem Aufstieg und Unabhängigkeit streben und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Vor allem aber auf die Masse der Arbeitslosen, auf Kinder, die frieren und hungern, während andere immer reicher werden. All dies veranlasst die Journalistin Gabrielle Roy, das Unrecht nicht mehr nur in Zeitungsartikeln, sondern in einem Roman aufzuschreiben.
»Gebrauchtes Glück« ist in der frankophonen Literatur Kanadas ein Wendepunkt, eine Abkehr von der früheren littérature du terroir, die vornehmlich und im Sinne der katholischen Kirche das idyllische Landleben propagierte, hin zu einer realistischen, urbanen und psychologisch begründeten Literatur, die erstmals spürbar politisch ist. Auch wenn es bis zur Stillen Revolution, die die Vormachtstellung der Kirche und ihr Verbot aufklärerischer Kunst beendet, noch fast zwanzig Jahre dauern sollte, ebnet Gabrielle Roy ihr bereits den Weg. Der Roman ist ein Erwachen, ein Bewusstmachen, ein Anprangern, ein literarisches Wagnis – zum ersten Mal in der frankokanadischen Literatur werden Mündlichkeit und die Sprache der Arbeiterklasse in Dialogen verwendet –, in seinem Stellenwert vergleichbar mit Döblins Berlin Alexanderplatz oder Joyce’ Ulysses.
Gabrielle Roy kreiert mit ihrer realistischen und zugleich poetischen Art zu schreiben einen bemerkenswerten, wiedererkennbaren Stil, der nicht umsonst Gegenstand zahlreicher akademischer Publikationen ist und nachfolgende Generationen maßgeblich in ihrem literarischen Schaffen beeinflusst hat. Saint-Henri erscheint mit seinen Gebäuden und Straßenzügen vor unserem Auge, wir haben den Ruß im Gesicht, spüren die sommerliche Schwüle, riechen die verqualmte Luft, frieren im winterlichen Schneesturm. Margret Atwood, eine große Bewunderin Gabrielle Roys, schreibt 2017 in einem Artikel für Maclean’s: »Dieser Roman war seiner Zeit voraus, aber nicht so weit, dass er seine Leser*innen zurückgelassen hätte.« Ihr zufolge reproduziert Roy keine Stereotype über Armut, sondern schildert schonungslos und durchaus drastisch die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse: »Roys Weigerung, auf frühere Darstellungen der ›Armen‹ zurückzugreifen, während sie gleichzeitig unmissverständlich klar macht, dass diese einen Anspruch auf ein besseres Leben haben, war sicher mitverantwortlich für den großen Erfolg des Romans. […] Doch der größte Beitrag, den Gebrauchtes Glück für die damalige Gesellschaft geleistet hat, betrifft die Frauenrechte. Roy verwendet kein explizites feministisches Vokabular, da die erste Frauenbewegung, die hauptsächlich für das Wahlrecht kämpfte, zu ihrer Zeit bereits der Vergangenheit angehörte und die Sprache der sexuellen Befreiung, die für die zweite Frauenbewegung typisch ist, noch nicht erfunden war. Vielmehr verdeutlicht Roy mit erzählerischen statt mit sprachlichen Mitteln, wie hart und ungerecht die damalige gesellschaftliche Lage der Frauen ist.«
1947 erhält Gabrielle Roy in Frankreich, als erste Ausländerin überhaupt, den bedeutenden Prix Fémina für ihr Debüt. Zum ersten Mal geht damit ein wichtiger französischer Literaturpreis an eine Autorin oder einen Autor aus Kanada. Im selben Jahr kürt die Literary Guild of America die englische Fassung des Romans, The Tin Flute, zum Book of the month, woraufhin sich diese über Dreiviertelmillionen Mal verkauft. In der Folge wird Gebrauchtes Glück in zahlreiche weitere Sprachen übersetzt. Der Roman ist nicht nur ein künstlerischer, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolg. So schreibt Gabrielle Roy Geschichte als eine der ersten weiblichen Autorinnen, die von ihrer Arbeit leben können. 1947 ist im Übrigen auch das Jahr, in dem sie den Arzt Marcel Carbotte heiratet. Marcel, der vermutlich homosexuell war, und Gabrielle bleiben ihr Leben lang verheiratet und sind phasenweise durchaus glücklich, es gibt jedoch immer wieder lange Perioden, die sie getrennt voneinander verbringen. Die Ehe bleibt kinderlos, und Gabrielle konzentriert sich voll und ganz aufs Schreiben. Bis zu ihrem Tod 1983 veröffentlicht sie sechs weitere Romane, zahlreiche Kurzgeschichten und Kinderbücher.
Heute zählt Gabrielle Roy zu den einflussreichsten Autor*innen Kanadas. Gebrauchtes Glück ist Schul- und Universitätslektüre. 2017 erklärt der Québecer Kultusminister Luc Fortin das Erscheinen des Romans offiziell zu einem »bedeutenden historischen Ereignis«. In Montréal werden Stadtführungen durch Saint-Henri zu den Schauplätzen des Romans und den teilweise noch existierenden kleinen Holzhäusern angeboten, die Roy als Vorbild für die Häuser ihrer Protagonist*innen dienten. In Saint-Henri gibt es seit 2017 einen nach dem Roman benannten Platz mit Bänken, auf deren Rückenlehnen Sätze aus dem Text stehen. Ein Zitat aus »Gebrauchtes Glück« ziert eine Wand des Friedensturms im kanadischen Parlament in Ottawa.
Bei aller Bedeutung des Romans für seine Heimatstadt, seine Heimatprovinz, sein Heimatland ist und bleibt er vor allem ein ergreifendes Zeugnis menschlichen Strebens nach Glück. Eine Geschichte über Liebe und Verzweiflung, über einen Auf- und Ausbruch, über die Ungerechtigkeit von Krieg und Klassengesellschaft. Gabrielle Roy hat den ins Abseits gedrängten Bewohnern Montréals, den Frauen, den Armen, den Schwachen eine Stimme gegeben, die bis heute nachklingt und die nichts von ihrer Dringlichkeit verloren hat.
Anabelle Assaf und Sonja Finck, Mai 2021
I
Florentine ertappte sich dabei, wie sie nach dem jungen Mann Ausschau hielt, der ihr gestern zwischen allerhand Frotzeleien zu verstehen gegeben hatte, dass er sie hübsch fand.
Ein nervöses Fieber überkam sie, eine Art Unruhe, vermischt mit dem konfusen Gefühl, dass hier im Quinze-Cents, inmitten des Getümmels und geschäftigen Treibens, irgendwann alles stillstehen und ihr Leben seine Richtung finden würde. Sie dachte nicht einmal daran, dass ihr das Schicksal anderswo begegnen könnte als an diesem Ort mit seinem stechenden Karamellgeruch, zwischen den großen Wandspiegeln mit dem Mittagsgericht auf dünnen Klebestreifen, an diesem Ort, wo die zuknallende Kassenschublade ihre verzweifelte Sehnsucht auszudrücken schien. Hier kam alles zusammen, was ihr Leben in Saint-Henri ausmachte: Hektik, Unruhe und Not.
Ihr Blick wanderte über die fünf, sechs Gäste, die sie bedienen musste, hinweg zu den Ladentischen – das Restaurant befand sich ganz hinten im Kaufhaus –, und zwischen all den spiegelnden Glasscheiben, verchromten Flächen und Blechtafeln blieb ihr leeres, unnahbares, verdrossenes Lächeln an irgendeinem glänzenden Ding hängen, das sie gar nicht richtig sah.
Zwar ließ ihr der Job als Kellnerin keine Zeit, in Ruhe dem aufregenden und verstörenden Ereignis des Vortags nachzuhängen, aber wenigstens konnte sie hin und wieder für einen Augenblick das Gesicht des unbekannten jungen Mannes heraufbeschwören. Das Klappern des Geschirrs und die Rufe der Gäste vermochten sie nicht sogleich aus ihren Träumereien zu reißen, die manchmal ein Zucken über ihr Gesicht huschen ließen.
Plötzlich machte sie ein entgeistertes und leicht gedemütigtes Gesicht. Während sie die Menschenmassen beobachtet hatte, die durch die Glastüren ins Kaufhaus strömten, hatte der fremde junge Mann an dem langen Tresen aus falschem Marmor Platz genommen und winkte sie ungeduldig herbei. Sie ging zu ihm, mit leicht geöffneten Lippen, mehr einer Schnute als einem Lächeln. Es missfiel ihr sehr, dass er sie derart überrumpelte, gerade als sie versucht hatte, sich sein Gesicht und den Klang seiner Stimme in Erinnerung zu rufen!
»Wie heißt du eigentlich?«, fragte er schroff.
Mehr noch als die Frage störte sie die Art und Weise, wie er sie stellte, höhnisch, dreist, fast schon unverschämt.
»Was ist das’n für ’ne Frage?«, sagte sie missbilligend, aber nicht abweisend, nicht so, als wollte sie ihn zum Schweigen bringen. Im Gegenteil, ihre Stimme lud zu einer Antwort ein.
»Du hast recht«, sagte der junge Mann grinsend. »Ich heiße Jean. Jean Lévesque. Und von dir weiß ich immerhin, dass du Florentine heißt. Florentine hier, Florentine da. Oh, Florentine ist heute aber schlecht gelaunt, man kann ihr nicht mal ein Lächeln entlocken! Ja, deinen Vornamen kenne ich, und er gefällt mir …«
Dann änderte er fast unmerklich den Ton, und sein Blick wurde härter. Mit gespieltem Ernst sagte er: »Aber du bist Mademoiselle wer? Willst du es mir nicht verraten?«
Sein Gesicht kam näher, und er warf ihr von unten einen Blick zu, in dem sie all seine Unverfrorenheit las. Der harte, willensstarke Kiefer, der unerträgliche Spott in den dunklen Augen, das waren die beiden Dinge, die ihr heute am meisten auffielen, und sie ärgerte sich über sich selbst. Wie hatte sie nur tagelang so viele Gedanken an den Kerl verschwenden können? Sie richtete sich so abrupt auf, dass die Bernsteinkette um ihren Hals leise klirrte.
»Und als Nächstes wolln Se dann wissen, wo ich wohn und ob ich heut Abend schon was vorhab«, sagte sie. »Ich kenn euch doch!«
»Euch? Wen meinsten du?«, spottete er und warf einen Blick über die Schulter, als wollte er nachsehen, ob jemand hinter ihm stand.
»Na, euch Männer!«, rief sie gereizt.
Dennoch gefiel ihr der dreiste, fast schon derbe Ton, mit dem der junge Mann sich zu ihr herabließ, besser als sein bisheriges Auftreten, seine bisherige Art zu sprechen, bei der sie immer das unbestimmte Gefühl eines großen Abstandes zwischen ihnen gehabt hatte. Auf ihren Lippen erschien ein Lächeln, schnippisch, provokant.
»Also!«, sagte sie. »Womit kann ich dienen?«
Wieder warf er ihr diesen gnadenlos unverschämten Blick zu.
»Ich hatte gar nicht die Absicht, dich zu fragen, ob du heut Abend schon was vorhast«, fuhr er fort. »So eilig habe ich es nicht. Damit hätte ich noch drei Tage gewartet, mindestens … Aber wo du schon damit anfängst …«
Er lehnte sich leicht zurück und drehte seinen Barhocker hin und her. Während er sie musterte, verengten sich seine Pupillen.
»Also, Florentine: Hast du heute Abend schon was vor?«
Er sah sofort, dass die Frage sie aus der Fassung brachte. Ihre Unterlippe zitterte, sie biss leicht mit den Zähnen darauf. Dann machte sie sich an dem verchromten Serviettenspender zu schaffen, zog eine Papierserviette heraus und breitete sie vor ihm aus.
Sie hatte ein schmales, zartes, fast schon kindliches Gesicht. Während sie um Beherrschung rang, schwollen die blauen Adern an ihren Schläfen an, pulsierten, und ihre fast durchsichtigen Nasenflügel zogen sich so heftig zusammen, dass die Haut über den Wangenknochen spannte, eine blasse Haut, glatt wie Seide. Ihr Mund wirkte unsicher, und ihre Lippen bebten immer noch leicht, doch als Jean ihr in die Augen sah, war er überrascht von deren Ausdruck. Dann senkte sie die Lider unter den gezupften, mit einem Stift nachgezogenen Brauen, und ihr goldbrauner Blick drang nur noch durch einen schmalen Spalt nach außen, vorsichtig, wach und ungeheuer gierig. Sie schlug mit den Wimpern, und da war das ganze Auge wieder, erfüllt von einem plötzlichen Flackern. Eine Mähne hellbrauner Locken fiel ihr über die Schultern.
Ohne klare Absicht musterte der junge Mann sie gründlich. Sie verwunderte ihn eher, als dass sie ihn anzog. Und selbst die Frage, die er ihr soeben gestellt hatte: »Hast du heute Abend schon was vor?«, hatte er sich nicht zurechtgelegt gehabt, sie war ihm einfach so über die Lippen gekommen, er hatte sie probeweise vorgebracht, so wie man einen Stein in einen Schacht wirft, um seine Tiefe auszuloten. Ihre unerwartete Reaktion ermunterte ihn allerdings zu einem weiteren Vorstoß. ›Würde ich mich schämen, wenn ich mit ihr ausginge?‹, schoss es ihm durch den Kopf. Dass ihm dieser Gedanke kam, obwohl er sich nicht viel aus dem Mädchen machte, ärgerte ihn und trieb ihn zu noch größerer Kühnheit. Die Ellbogen auf dem Tresen, Florentine nicht aus den Augen lassend, wartete er geduldig auf eine Regung von ihr, an der er seine eigene ausrichten würde, wie bei einem grausamen Spiel.
Unter seinem gnadenlosen Blick versteifte sie sich, und er sah sie jetzt noch besser; er sah ihren Oberkörper im Wandspiegel, und ihm fiel auf, wie dünn sie war. Gleichwohl sie sich den Stoffgürtel ihres grünen Kellnerinnenkleids straff um die Taille gebunden hatte, ahnte man, dass es ihr um den mageren Körper schlackerte. Mit einem Mal stand dem jungen Mann ihr Leben in dem unruhigen Strudel von Saint-Henri vor Augen, das Leben eines dieser feschen Mädchen, die sich schminkten und schick machten, Groschenhefte lasen und sich die Finger an armseligen Feuern eingebildeter Liebe verbrannten.
Seine Stimme klang jetzt scharf, fast schon schneidend.
»Bist du von hier? Aus Saint-Henri?«, fragte er.
Sie zog eine Schulter hoch, und statt einer Antwort lächelte sie gezwungen, halb ironisch, halb beleidigt.
»Ich auch«, fuhr er süffisant fort. »Dann können wir doch Freunde sein, nicht?«
Er bemerkte, wie ihre Hände, schmal wie die eines Kindes, zuckten; über dem Ausschnitt ihres Kleids zeichneten sich die Schlüsselbeine ab.
Nach einem Moment ließ sie sich dazu hinreißen, eine Hand in die Hüfte zu stemmen, um ihre müden Füße zu entlasten; ihre Gereiztheit verbarg sie hinter einem Schmollmund, doch er sah sie schon nicht mehr so, wie sie da auf der anderen Seite des Tresens vor ihm stand. Er sah sie zum Ausgehen bereit, für den Abend herausgeputzt, mit viel Rouge im Gesicht, das die Blässe ihrer Wangen überdeckte, mit klimperndem Schmuck überall an ihrem schmächtigen Körper, einem albernen Hütchen und vielleicht sogar einem kleinen Schleier, hinter dem ihre von Kajal hervorgehobenen Augen schimmerten: ein junges Mädchen, aufgedonnert, flatterhaft, ganz überdreht von dem Wunsch, ihm zu gefallen. Und dieses Bild durchfuhr ihn wie ein zerstörerischer Windstoß.
»Gehst du heute Abend mit mir ins Kino?«
Er spürte ihr Zögern. Zweifellos hätte sie seine Einladung angenommen, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, sie freundlicher zu formulieren. Aber genau das wollte er nicht, er hatte sie absichtlich hart und direkt ausgesprochen, als wäre ihm nicht gelegen daran, dass sie zustimmte.
»Also ist es abgemacht«, sagte er. »Und jetzt bring mir das Tagesgericht.«
Er zog ein Buch aus seinem Mantel, den er auf den Hocker neben sich geworfen hatte, schlug es auf und vertiefte sich in die Lektüre.
Florentine stieg Röte in die Wangen. Genau das hasste sie so sehr an diesem jungen Mann: seine Fähigkeit, sie, nachdem er sie aus der Fassung gebracht hatte, sogleich wieder aus seinen Gedanken zu verbannen, sie stehen zu lassen wie ein Ding, an dem er das Interesse verloren hatte. Dabei war er derjenige, der sie seit Tagen umwarb. Sie hatte nicht den ersten Schritt getan. Nein, er war derjenige, der sie aus diesem tiefen Schlaf gerissen hatte, in dem sie versunken gewesen war, fernab des Lebens, voller Kummer und Groll, allein, erfüllt von unbestimmten Hoffnungen, die sie nicht richtig wahrnahm und unter denen sie nicht ernsthaft litt. Er hatte diesen Hoffnungen eine Gestalt gegeben, so dass sie jetzt stechend waren, quälend, ein Bedürfnis.
Sie betrachtete ihn einen Moment lang stumm, und ihr Herz zog sich zusammen. Er gefiel ihr schon jetzt sehr, dieser Bursche. Er wirkte elegant. Ganz anders als die Gäste, die sie sonst bediente, langweilige Angestellte oder Arbeiter mit speckigen Krägen und Ärmeln, und himmelweit entfernt von den Jungs, denen sie abends im Viertel begegnete, wenn sie mit Pauline und Marguerite in ein Café ging, wo sie zu ein oder zwei Liedern aus der Jukebox tanzten, eine Tafel Schokolade knabberten oder einfach stundenlang vor sich hinträumten, verborgen in einer Sitzecke, von der aus sie den jungen Männern, die durch die Tür kamen, nachschauten oder sich über sie lustig machten. Ja, er war ganz anders als die Typen, denen sie in ihrem turbulenten, leeren Leben über den Weg lief. Ihr gefiel, wie sein volles schwarzes Haar zu Berge stand. Manchmal hatte sie große Lust, mit beiden Händen durch dieses kräftige, wilde Haar zu wuscheln.
Als er das Quinze-Cents zum ersten Mal betreten hatte, war er ihr gleich aufgefallen, und sie hatte es so eingerichtet, dass sie es war, die ihn bediente. Jetzt wäre sie am liebsten vor ihm davongelaufen, aber gleichzeitig wollte sie nicht klein beigeben, sondern ihm beweisen, dass er ihr ganz und gar gleichgültig war. ›Irgendwann wird er mich sicher fragen, ob ich mit ihm ausgehe‹, hatte sie bei ihrer ersten Begegnung gedacht, mit einem seltsamen Gefühl der Macht in der Brust. Und gleich im nächsten Moment besorgt: ›Und was soll ich dann sagen?‹
Ihre Kolleginnen, Louise, Pauline und Marguerite, alle außer Éveline, der »Chefin«, nahmen hin und wieder eine Einladung an, die spaßeshalber während eines kurzen Geplänkels in der Mittagspause ausgesprochen worden war. Pauline sagte, solche Flirts seien nicht gefährlich, solange der Junge dich zu Hause abhole und man nur ins Kino gehe. Dort könne man sich seinen Verehrer dann in Ruhe anschauen und sich überlegen, ob man ihn wiedersehen wolle. Louise hatte sich sogar mit einem jungen Soldaten verlobt, den sie im Restaurant kennengelernt hatte. Seit Kriegsbeginn stand den jungen Männern, die sich freiwillig zum Dienst meldeten, der Sinn danach, sich zu binden, bevor es zur Ausbildung in die Kaserne ging, und so wurden Bekanntschaften sehr schnell und unter ganz neuen Bedingungen geschlossen. Manche mündeten sogar in der Ehe.
Florentine wagte nicht, diesen Gedanken zu Ende zu führen. Selbst beim Lesen verzog der junge Mann die Mundwinkel zu einer spöttischen Grimasse, die sie nicht kalt ließ.
›Ich werd ihm schon zeigen‹, dachte sie mit zusammengekniffenen Lippen, ›dass er mich nicht die Bohne interessiert.‹ Trotzdem wollte sie wissen, was er da las, und ihre Neugier war stärker als ihr Trotz. Vorwitzig beugte sie sich über das aufgeschlagene Buch. Es war eine Abhandlung über Trigonometrie. Beim Anblick der Rauten, Dreiecke und komplizierten Gleichungen lächelte sie innerlich über ihr Unverständnis.
»Kein Wunder, dass Sie so oberschlau daherreden«, sagte sie, »wenn Sie so was lesen …«
Dann lief sie zum Mikrophon und flötete: »Einmal das Tagesgericht für dreißig Cent!«
Ihre hohe Stimme schallte durch das ganze Restaurant, und Jean Lévesque spürte, wie ihm eine dumme Röte in die Stirn stieg. Er verfolgte das Mädchen mit einem leicht flackernden Blick, finster und nachtragend, zog sein Buch näher, beugte sich darüber, stellte beide Ellbogen auf den Tresen und stützte das Gesicht in die kräftigen, dunklen Hände.
Neue Gäste strömten zum Tresen. Es war der übliche Ansturm zwischen Mittag und ein Uhr: eine Handvoll Arbeiter aus dem Viertel in grobem Drillich, kleine Angestellte aus den Geschäften der Rue Notre-Dame im weißen Hemd und mit einem weichen Filzhut auf dem Kopf, den sie auf den Tresen warfen, zwei Nonnen von der Fürsorge im grauen Habit, ein Taxichauffeur und mehrere Hausfrauen, die sich zwischen zwei Einkäufen mit einem heißen Kaffee oder einem Teller Pommes frites stärkten. Die fünf jungen Kellnerinnen liefen hin und her und rempelten sich in ihrer Eile gegenseitig an. Bisweilen fiel ein Löffel klirrend auf den Terrazzo-Boden. Hastig hob ihn eine Kellnerin auf, warf ihn schimpfend in die Spüle und lief, um keine Zeit zu verlieren, mit gesenktem Kopf und gekrümmtem Rücken weiter. Sie hatten alle Hände voll zu tun. Die schnellen Schritte, das Kommen und Gehen, das Rascheln der gestärkten Kleider, das Klicken des Toasters, wenn die Brotscheiben hochsprangen, das Gluckern der Kaffeekannen auf den elektrischen Herdplatten und das Knistern des Mikrophons bildeten eine Geräuschkulisse, ein hitziges Flirren wie im Hochsommer, das nach Vanille und anderen süßen Dingen roch. Dazu erklang das dumpfe Brummen der Standmixer, in denen sich in großen Chrombechern die Malzmilch drehte, ein Geräusch wie das Surren von Fliegen, die in Leim festhingen, hin und wieder das Klimpern von Münzen auf dem Tresen und in regelmäßigen Abständen das Klingeln der Registrierkasse, wie ein Schlusspunkt, ein hektisches Totengeläut, dünn, aber unermüdlich. Und obwohl die Kälte die schweren Glastüren des Kaufhauses mit Raureif versah, herrschte in dem Getümmel drinnen eine brütende Hitze.
Marguerite, ein großes, fülliges Mädchen, dessen ungeschminkte, von Natur aus rosige Wangen selbst in diesem Backofen aussahen, als würde ihr ständig ein eisiger Wind ins Gesicht fahren, machte sich an den Eistruhen zu schaffen. Sie hob einen Deckel an, stieß den Portionierlöffel tief in die Eiskrem und ließ den Inhalt in eine flache Dessertschale fallen. Sie nahm eine Papptülle und drückte etwas Schlagsahne heraus wie aus einer Zahnpastatube. Dann zog sie eine Metallschublade auf, fuhr mit dem Löffel hinein und sprenkelte ein paar weiße Marshmallows über die Sahne, begoss das Ganze mit Karamellsoße oder Fruchtsirup und setzte schließlich noch eine halbe kandierte Kirsche obendrauf, knallrot und appetitlich. Im Handumdrehen stand der bei den Gästen äußerst beliebte Sundae Special für fünfzehn Cents auf dem Tisch, wie eine willkommene Abkühlung an einem heißen Sommertag. Marguerite sammelte die Münzen ein, ging zur Kasse und kehrte zu ihren Eistruhen zurück, um den nächsten Sundae Special zuzubereiten. Obwohl die Prozedur immer dieselbe war, ließ Marguerite noch bei der zehnten kunstfertigen Kreation dieselbe Sorgfalt walten wie bei der ersten und empfand dabei dieselbe unbedarfte Freude. Sie kam vom Land und lebte erst seit ein paar Jahren bei Verwandten in der Stadt, war noch ganz geblendet vom schönen Schein des Viertels. Genauso, wie sie die Überraschungen und den süßen Geruch des Restaurants noch nicht leid war. Der Trubel, die sich ringsherum anbahnenden Flirts, die Atmosphäre aus Avancen, Zurückweisungen, halbherzigen Zusagen und Schäkereien störte sie überhaupt nicht, im Gegenteil, das alles gefiel ihr und amüsierte sie. »Florentines Verehrer«, wie sie Jean Lévesque nannte, beeindruckte sie besonders. Als Florentine mit einem vollen Teller an ihr vorbeiging, konnte sie sich wie immer eine Bemerkung nicht verkneifen, begleitet von einem lauten, fröhlichen Lachen:
»Dein Verehrer macht dir wieder schöne Augen, was?«
Sie leckte sich über die feuchten Lippen, die schwach nach Marshmallows zu schmecken schienen, und fügte hinzu:
»Ich finde ihn jedenfalls schneidig. Wart’s nur ab, Florentine, bald wird er dir seine Liebe gestehen.«
Florentine lächelte abfällig. Marguerite, dieses Dummchen, dachte wohl, das Leben wäre ein steter Reigen aus Sundaes, an deren Ende sie beide mühelos, ohne auch nur den kleinen Finger zu rühren, verlobt sein und wenig später im Brautkleid und mit einem Brautstrauß in der Hand vorm Altar stehen würden. Während sie auf Jean Lévesque zusteuerte, sinnierte sie mit einem Gefühl der Genugtuung, dass der junge Mann allerdings tatsächlich großes Interesse an ihr zeigen musste, wenn selbst die dicke Marguerite es bemerkt hatte und sie damit aufzog. ›Aber was ist das für ein merkwürdiges Interesse‹, dachte sie bitter und verzog das Gesicht auf eine Weise, die sie hässlich machte.
Sie stellte den Teller vor Jean Lévesque ab und wartete darauf, dass er etwas sagte. Doch er war so in sein Buch vertieft, dass er nur »danke« murmelte, ohne den Blick zu heben. Geistesabwesend griff er nach der Gabel und begann zu essen, während sie immer noch unschlüssig herumstand. Schon jetzt ertrug sie das Schweigen des jungen Mannes schwerer als seine zweideutigen Worte. Wenn er mit ihr redete, konnte sie ihm wenigstens Paroli bieten. Langsam schlenderte sie zum anderen Ende des Tresens und schaute nach den Hotdogs. Da befiel sie plötzlich eine tiefe Erschöpfung, eine unbestimmte Traurigkeit, die sie manchmal aus dem Nichts überkam und sie niederdrückte, weshalb sie sich für einen Moment mit dem Rücken an den Rand der verchromten Spüle lehnte.
Gott, was hatte sie dieses Leben satt! Ungehobelte Männer bedienen, die sie mit ihren Avancen beleidigten, oder welche wie Jean Lévesque, deren Werbung vielleicht nur Ironie war. Bedienen, immer nur bedienen! Und dabei nie vergessen zu lächeln. Ununterbrochen lächeln, selbst wenn einem die Füße brannten, als würde man über glühende Kohlen laufen! Lächeln, selbst wenn einem die Wut wie ein schwerer, harter Klumpen im Hals lag! Lächeln, selbst wenn einem die schmerzenden Beine fast versagten!
Ihr Blick wurde eigenartig stumpf. Über ihre mädchenhaften, stark geschminkten Züge schob sich in diesem Moment das Bild der alten Frau, die sie einmal sein würde. In den Mundwinkeln erahnte man die Falten, in denen die Kontur, die Anmut der Wangen versinken würden. Doch nicht nur der gefürchtete Verfall bemächtigte sich Florentines Gesicht, auch die ererbte Ohnmacht, die ausweglose Armut, aus deren Teufelskreis Florentine nicht ausbrechen konnte und die den Verfall beschleunigte, schien aus der Tiefe ihrer erloschenen Augen aufzusteigen und sich wie ein Schleier über ihr Gesicht zu legen, das in diesem Moment nackt und ohne Maske war.
All das geschah in weniger als einer Minute. Ruckartig richtete sich Florentine wieder auf, kerzengerade und nervös, und wie von selbst verzogen sich ihre grellroten Lippen zu einem Lächeln. Von den vielen konfusen Gedanken, die ihr in diesen Sekunden durch den Kopf geschwirrt waren, blieb nur ein einziger klarer Eindruck zurück, hart wie ihr falsches Lächeln: Sie musste jetzt sofort, noch in diesem Augenblick, alles, was sie hatte, auf eine Karte setzen, ihre gesamten körperlichen Vorzüge, in einem verbissenen Wettlauf um das Glück. Als sie sich vorbeugte, um ein paar schmutzige Messer und Gabeln abzuräumen, sah sie Jean Lévesque im Profil, und da überkam ihr Herz so etwas wie ein Entzücken und eine Wunde, das Gefühl, dass der junge Mann, ob sie es wollte oder nicht, ihr nicht mehr gleichgültig war. Noch nie war sie so kurz davor gewesen, ihn zu hassen. Sie wusste nichts von ihm, außer seinem Namen, den er ihr soeben genannt hatte, und außer dem, was Louise ihr erzählt hatte, denn ihr waren ein paar Dinge zu Ohren gekommen, unter anderem, dass er als Maschinenschlosser in einer Gießerei arbeitete. Aus derselben Quelle wusste Louise auch, dass Jean nie mit Mädchen ausging, was Florentine neugierig gemacht hatte und ihr immer noch sehr gefiel.
Sie warf einen Blick schräg den Tresen hinunter. Vor sich sah sie mehrere über Teller gebeugte Gesichter, offene Münder, mahlende Kiefer, fettige Lippen – ein Anblick, der sie immer zutiefst abstieß – und ganz hinten die kantigen, starken Schultern des jungen Mannes, die sich deutlich unter dem braunen Anzug abzeichneten. Er stützte das dunkle Gesicht in eine Hand. Die Haut seiner Wangen spannte über den zusammengebissenen Zähnen. Vom Kinn zu den Schläfen verliefen fächerförmig feine Linien. Trotz seines jungen Aussehens furchten bereits leichte Falten seine hohe, sture Stirn. Und seine Augen, ganz gleich, ob sie nun einen Menschen, ein Ding oder das aufgeschlagene Buch fixierten, schimmerten hart.
Schlank, fast lautlos näherte sie sich ihm und musterte ihn unter halbgeschlossenen Lidern. Sein Tweedanzug schien nicht aus einem der Geschäfte im Viertel zu stammen. Allein dieses Kleidungsstück war ihr ein Beweis dafür, dass er Charakter hatte und ein privilegiertes Leben führte. Nicht, dass er besonders sorgfältig gekleidet gewesen wäre. Im Gegenteil, er stellte eine gewisse Nachlässigkeit zur Schau: Seine Krawatte war lose gebunden, die Hände ein wenig ölverschmiert und das Haar immer zerzaust und widerspenstig, da er nie einen Hut aufsetzte, ob bei Regen, Sonne oder Kälte. Doch gerade die Tatsache, dass er keinen Wert auf solche kleinen Details legte, verlieh den teuren Dingen, die er trug, eine noch größere Bedeutung: die Armbanduhr, deren Ziffernblatt bei jeder Bewegung aufblitzte, das feine Seidentuch, das er sich salopp um den Hals geschlungen hatte, die edlen Lederhandschuhe, die halb aus der Tasche seines Sakkos hingen. Florentine hatte den Eindruck, dass sie, wenn sie sich zu dem jungen Mann vorbeugte, den Geruch der Großstadt einatmete, den berauschenden Duft einer gut gekleideten, zufriedenen Stadt mit vollem Magen, die sich kostspieligen Vergnügungen hingab. Plötzlich musste sie an die Rue Sainte-Catherine denken, die Schaufenster der Luxuskaufhäuser, die elegante Menschenmenge am Samstagabend, die Auslagen der Blumengeschäfte, die Restaurants mit ihren Drehtüren und den Tischen hinter spiegelnden Glasscheiben, die fast auf dem Bürgersteig zu stehen schienen, die beleuchteten Foyers der Lichtspieltheater, die Treppen, die sich hinter den verglasten Kassenhäuschen zwischen großen Spiegeln, blank polierten Geländern und Grünpflanzen emporwanden und, als gehorchten sie einer natürlichen Ordnung, hoch zur Leinwand führten, über die die schönsten Bilder der Welt flackerten: Alles, wonach sie sich sehnte, was sie bewunderte und worum sie andere beneidete, stand ihr vor Augen. Ah! Diesem jungen Mann war an Samstagabenden sicher nicht langweilig! Sie selbst hingegen war oft traurig. Hin und wieder, wenngleich auch selten, hatte ein junger Mann sie ausgeführt, aber immer nur in das kleine Stadtteilkino oder in einen heruntergekommenen Saal in einem Vorort, und dann hatte er zu allem Überfluss versucht, sich dieses zweifelhafte Vergnügen durch Küsse bezahlen zu lassen. Sie war die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, ihn sich vom Leib zu halten, und hatte den Film überhaupt nicht genießen können. Manchmal ging sie mit ein paar Freundinnen im Westen der Stadt aus, aber in dieser schnatternden, ganz und gar weiblichen Schar empfand sie eher Scham und Bitterkeit als Freude. Ihr Blick blieb an jedem Paar hängen, das an ihnen vorbeiging, und der Anblick verstärkte ihren Groll. Die Stadt war für Paare da, nicht für vier oder fünf junge Mädchen, die einander dumm den Arm um die Taille legten, die Rue Sainte-Catherine entlangschlenderten und in jedem Schaufenster Dinge bewunderten, die sie niemals besitzen würden.
Aber jetzt rief die Stadt sie, und zwar in Gestalt von Jean Lévesque! Durch diesen Fremden erschienen ihr die Lichter heller, die Menschen fröhlicher, und selbst der Frühling war nicht mehr weit, die kümmerlichen Bäume von Saint-Henri konnten jeden Moment ausschlagen. Ihr schoss durch den Kopf, dass sie, wenn sie nicht von dieser außerordentlichen Vorsicht und Zurückhaltung gebremst worden wäre, die ihr der junge Mann einflößte, zu ihm gesagt hätte: »Lass uns ein Stück spazieren gehen! Wir sind füreinander bestimmt.« Gleichzeitig empfand sie wieder das unsinnige Bedürfnis, ihm mit der Hand durch das strubbelige dunkle Haar zu fahren. In ihrem ganzen Leben war sie noch keinem Menschen begegnet, der derartige Zeichen des Erfolgs an sich trug. Noch mochte er nur ein einfacher Schlosser sein, dieser Bursche, aber sie hatte keinen Zweifel daran, dass er bald, sehr bald sogar etwas aus sich machen würde, genauso wie sie nicht an ihrem Instinkt zweifelte, der ihr riet, sich mit ihm zu verbünden.
Sie tauchte aus ihren Tagträumen auf und fragte ihn in dem distanzierten Ton, den sie Gästen gegenüber anschlug:
»Darf’s noch ein Nachtisch sein?«
Jean stützte sich auf die Ellbogen, um sich ein Stück aufzurichten, straffte die starken Schultern und sah sie direkt an, voller Ungeduld und Schalk.
»Nein, aber du hast mir immer noch nicht verraten, ob ich heute Abend der lucky guy sein werde. Du denkst jetzt seit zehn Minuten darüber nach; wie lautet deine Entscheidung? Gehst du mit mir ins Kino oder nicht?«
Er sah ohnmächtige Wut in Florentines grünen Augen aufwallen. Dabei hatte sie schnell die Lider gesenkt. Jetzt sagte sie mit einer Stimme, die gleichzeitig zornig und kläglich klang und sich trotz allem immer noch versöhnlich gab:
»Warum sollte ich mit Ihnen ins Kino gehen? Ich kenn Sie doch nicht! Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind!«
Er musste lachen, ein kehliges Lachen tief aus dem Hals, weil ihm aufging, dass sie ihm nur eine Auskunft über seine Person entlocken wollte.
»Das wirst du schon noch herausfinden«, sagte er, »falls dir der Sinn danach steht.«
Die Doppeldeutigkeit der Aussage setzte ihr weniger zu als der Gleichmut des jungen Mannes, und so dachte sie erniedrigt: ›Er versucht, mich zum Reden zu bringen. Vielleicht will er sich nur über mich lustig machen.‹ Sie stieß ihrerseits ein dünnes, gezwungenes Lachen aus.
Doch er beachtete sie schon nicht mehr. Er schien auf Geräusche von draußen zu lauschen. Im nächsten Moment hörte Florentine dumpfe Trommelschläge. Vor den großen Glastüren bildete sich eine Menschenmenge. Ein paar Verkäuferinnen, die nichts zu tun hatten, kamen hinter ihren Tresen hervor. Obwohl Kanada Deutschland schon vor über sechs Monaten den Krieg erklärt hatte, waren Militärparaden in Saint-Henri noch etwas Neues und zogen viele Schaulustige an.
Jetzt befand sich die Truppe auf Höhe des Quinze-Cents. Florentine beugte sich vor, um besser sehen zu können, mit fast kindlichem Interesse, überrascht und begierig. Die Soldaten, kräftige Burschen in khakifarbenen Mänteln, marschierten in zackigem Gleichschritt und mit gestreckten Armen durch den aufwirbelnden Schnee. Florentine fuhr zu dem jungen Mann herum, mit strahlendem Gesicht, als wollte sie ihre naive Begeisterung mit ihm teilen, aber sein Gesichtsausdruck war so abweisend, so grimmig, dass sie nur mit den Achseln zuckte und ein paar Schritte näher zur Tür ging, weil sie nichts von dem Spektakel auf der Straße verpassen wollte. Jetzt kamen die neuen Rekruten in Sicht, noch in Zivil: eine Handvoll junger Männer, manche in dünnem Anzug, andere in einem löchrigen, mehrfach ausgebesserten Herbstmantel, in den der beißende Wind hineinfuhr. Manche der jungen Männer, die den Soldaten folgten, kannte sie vom Sehen. Sie hatten wie ihr Vater länger von der Fürsorge gelebt. Beim Anblick dieser aufregenden, geheimnisvollen, dramatischen Heraufbeschwörung des Krieges hatte sie den unbestimmten Eindruck einer schrecklichen Misere, die hier ihre unerschöpfliche Reserve paradieren ließ. Wie in einem verschwommenen Traum zogen die Jahre der Arbeitslosigkeit an ihr vorbei, in denen sie als Einzige der Familie etwas Geld nach Hause gebracht hatte. Und vorher, als sie noch ein Kind gewesen war, die Arbeit ihrer Mutter. Rose-Annas Bild erschien klar und deutlich vor ihren Augen und erinnerte sie an ihr tagtägliches Unglück. Für einen Moment sah sie die jungen, bereits im Paradeschritt marschierenden Männer in ihren zerlumpten, schlechtsitzenden Kleidern durch die Augen ihrer Mutter. Doch ihr Geist hielt sich nicht lange mit diesen Überlegungen auf, die nur verwirrende, lästige Gedankenketten nach sich zogen. Sie fand das Spektakel, das sich ihr bot, vor allem unterhaltsam, geeignet, die Monotonie der langen Stunden im Kaufhaus zu durchbrechen. Mit aufgerissenen Augen und Wangen, die unter der Schminke leicht gerötet waren, wandte sie sich wieder Jean Lévesque zu. Und dann kommentierte sie die Szene schwungvoll, fast schon unbekümmert mit zwei kurzen erbarmungslosen Worten:
»Verrückt, nicht?«
Doch anders als sie es sich erhofft hatte, lächelte er nicht über ihre Bemerkung, sondern sah sie so feindselig an, dass sie dachte, fast schon fröhlich, wie eine heimliche Rache: ›Und der Kerl ist auch verrückt!‹ Ihn innerlich derart zu verurteilen, verschaffte ihr einen Moment lang Genugtuung.
Er fuhr sich immer wieder mit der Hand übers Gesicht, als wollte er lästige Gedanken vertreiben, vielleicht war es aber auch nur Müdigkeit oder Gewohnheit, dann sah er Florentine an und fragte noch einmal:
»Also, wie heißt du? Sag mir deinen Namen!«
»Florentine Lacasse«, antwortete sie schroff, schon wieder ernüchtert nach ihrem kurzfristigen Triumph und erbost, weil es ihr nicht gelang, sich seinem Zugriff zu entziehen.
»Florentine Lacasse«, murmelte er belustigt und suchte in seiner Hosentasche nach einer Münze. »Also schön, Florentine Lacasse, bis du einen Soldaten nach deinem Geschmack findest, kannst du ja mit mir ausgehen. Heute Abend um acht Uhr vor dem Cartier?«, fügte er beinahe vergnügt hinzu.
Sie rührte sich nicht, enttäuscht, aber auch in Versuchung gebracht. Sie dachte nach. Das war nicht die Einladung, die sie sich erhofft hatte. Andererseits lief im Cartier gerade Bitter Sweet. Am Tag zuvor hatte Marguerite ihr die Geschichte erzählt, und sie war herzzerreißend schön. Außerdem dachte sie an den schicken neuen Hut und das Parfüm, das sie vor Kurzem gekauft hatte, und während ihre Gedanken eine immer versöhnlichere Richtung einschlugen, ging ihr durch den Kopf, was für ein elegantes Paar sie und Jean abgeben würden, da sie fast gleich groß waren. Die Leute würden ihnen gewiss neugierige Blicke zuwerfen, wenn sie sie zusammen sähen. Florentine stellte sich sogar vor, wie die Leute über sie reden würden. Der Gedanke amüsierte sie. Würde sie sich um das Geschwätz scheren? Ganz und gar nicht! Sie sah sich nach der Vorführung mit dem jungen Mann in einem feinen Restaurant hier im Viertel sitzen, zu zweit in einer abgetrennten Sitzecke mit schummriger Beleuchtung, während im Hintergrund leise ein elektrisches Grammophon spielte. Dort wäre sie sich ihrer Macht und ihres Charmes sicher. Dort würde sie dafür sorgen, dass ihr dieser dreiste junge Mann aus der Hand fraß. Sie würde ihn schon noch dazu bringen, ihr verlockendere Einladungen zu machen. Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, leichtsinnig und verträumt, während Jean aufstand und ein Fünfzig-Cent-Stück auf den Tresen warf.
»Der Rest ist für dich«, sagte er kalt. »Kauf dir davon etwas zu essen … Du bist viel zu dünn.«
Ihr lag eine böse Erwiderung auf der Zunge. Sie war tödlich beleidigt, vor allem, weil sie sich ihm still unterworfen hatte, und sie hätte ihm seine Gemeinheit am liebsten heimgezahlt, aber Jean zog bereits den Mantel an.
»Du verabscheust mich, nicht wahr?«, murmelte er. »Und du hasst das alles hier«, fuhr er fort, leicht vorgebeugt, als könnte er ihr direkt ins Herz schauen und würde dort ein ödes Feld sehen, auf dem bisher nur Bitterkeit und Abscheu wuchsen.
Dann ging er mit schnellen Schritten davon, und in der Bewegung seiner Schultern lag etwas Entschlossenes, Starkes und Angespanntes. Er musste die Menschenmenge nicht mit ungeduldigen Ellbogen teilen. Die Leute traten beiseite, um ihn durchzulassen. In diesem Augenblick ahnte Florentine, dass sie ihn nie wiedersehen würde, wenn sie nicht zu der Verabredung ginge. Während sie ihm nachblickte, hatte sie mit einem Mal den Eindruck, dass dieser Fremde sie durchschaute, dass er sie instinktiv verstand, und zwar besser als sie selbst. Er hatte ein grelles Licht auf ihr Inneres geworfen, und in diesem Licht hatte sie im Bruchteil einer Sekunde unzählige Dinge über ihr Leben erfahren, die bisher im Dunkeln gelegen hatten.
Und jetzt, da er fort war, hatte sie das Gefühl, mit einem Mal wieder in die Ignoranz ihrer eigenen Gedanken zurückzufallen. Eine tiefe Verwirrung überkam sie. ›Ich gehe nicht hin, ich gehe nicht hin, ich weiß nicht, ob ich hingehen soll‹, dachte sie und bohrte sich die Fingernägel in die Handfläche. Da sah sie, wie Éveline sie beobachtete und sich dabei eindeutig ein Lachen verbiss. Und Marguerite, die sich mit einem Sundae an ihr vorbeidrängte, raunte ihr ins Ohr:
»Ich hätt jedenfalls nix dagegen, wenn er mir Avancen macht! Der Kerl gefällt mir!«
In Florentines Herz hatte sich die Wut bereits gelegt, sie vermischte sich mit dem angenehmen Gefühl, beneidet zu werden. In ihrem Leben hatte sie den Besitz irgendwelcher armseliger Dinge, flüchtiger Bekanntschaften und selbst vager Erinnerungen immer nur dann genießen können, wenn sie sie durch die Augen anderer sah.
II
Nach der Rückkehr in die Gießerei, wo er seine gesamte Aufmerksamkeit eigentlich der Reparatur eines Motors hätte widmen sollen, dachte Jean den ganzen Nachmittag: ›Was bin ich dumm, was bin ich verrückt! Ich will doch gar nichts von dieser Florentine. Wenn solche Mädchen erst einmal angebissen haben, wird man sie nicht wieder los. Ich will sie doch gar nicht wiedersehen. Was hat mich nur geritten, mich mit ihr zu verabreden?‹
Er hatte geglaubt, den Flirt jederzeit beenden zu können, einen Flirt, der im Übrigen noch gar nicht richtig begonnen hatte. Immer wenn er in der Vergangenheit, was ohnehin nur selten vorgekommen war, ein Mädchen zu erobern versucht hatte, war er die Sache halbherzig angegangen, entweder weil das Mädchen es ihm allzu leicht machte oder weil er ihm nicht seine ganze Freizeit opfern wollte. Denn nur eins war ihm in seinem Ehrgeiz wirklich wichtig: seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und bislang hatte er sie zum Studium genutzt, ohne Bedauern und ohne es als Belastung zu empfinden, fleißig und zielstrebig.
Doch als er an diesem Abend zu Fuß zurück zu seinem Zimmer in der Rue Saint-Ambroise am Kanal Lachine ging, wunderte und ärgerte er sich über die Beharrlichkeit, mit der Florentines Bild sich ihm aufdrängte.
›Dabei ist sie wie alle Mädchen‹, dachte er. ›Sie will sich auf Kosten eines Mannes amüsieren, will ihm das Geld aus der Tasche ziehen, ihm seine Zeit stehlen … Mehr will sie nicht. Von mir oder einem anderen …‹ Dann sah er wieder ihren mageren Körper, den kindlichen Mund, die gequälten Augen. ›Nein‹, dachte er. ›Sie ist anders … Und deshalb interessiert sie mich … vielleicht … ein bisschen.‹
Während er allein durch die dunklen Straßen lief, musste er mit einem Mal lachen. Denn plötzlich sah er sich mit Florentines Augen: ein Possenreißer, ein böser Junge, vielleicht sogar gefährlich, mit Sicherheit aber anziehend wie jede echte Gefahr. Und er sah die Widersprüche zwischen ihm selbst, dem wahren Jean Lévesque, und der Kunstfigur, die er erschaffen hatte, einem verschlagenen Burschen mit großspurigem Auftreten und einem vermeintlich ausschweifenden Leben, jemand, den alle bewunderten. Der wahre Jean Lévesque war anders. Wortkarg, stur, vor allem arbeitsam. Dieser Jean Lévesque gefiel ihm eigentlich besser, ein praktisches Wesen, das die Arbeit liebte, nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie zu Ehrgeiz und Erfolg anstachelte, ein junger Mann ohne hochfliegende Träume, der sich der Arbeit hingab wie einer Rache.
›Das ist es!‹, dachte er und sah sich abends allein in seinem kleinen Zimmer über den Hausaufgaben sitzen, die per Post kamen. Dieses Bild erfüllte ihn mit Genugtuung. Kein Hindernis war zu hoch für ihn. Seine Bildung war ungenügend, also sorgte er für Abhilfe. Im Übrigen, wer hatte in der Schule jemals etwas Sinnvolles gelernt? Er war sein eigener Lehrer, unnachgiebig, streng. Er hatte sich selbst gut im Griff. Alles andere, und darunter verstand er auch die äußeren Zeichen des Erfolgs wie Reichtum und Ansehen, konnte warten. Den wahren Rausch des Erfolgs kannte er längst, wenn er sich in sein Zimmer zurückzog wie in eine Wüste, sich mit einer kniffligen Algebra- oder Geometrieaufgabe herumschlug und zähneknirschend dachte: ›Eines Tages werde ich allen zeigen, wie weit ich’s gebracht habe!‹ Noch ein paar Jahre, dann hätte er sein Ingenieurdiplom in der Tasche. Dann würde die Welt, die zu dumm war, seinen Wert schon jetzt zu erkennen, nicht schlecht staunen. Alle würden sehen, wer er war, er, Jean Lévesque. Und wenn er selbst später an diese Zeit zurückdenken würde, wüsste er, dass die Bestandteile seines Erfolgs bereits im Keim vorhanden gewesen waren und diese Jahre allem Anschein zum Trotz nicht nutzlos und erbärmlich gewesen waren.
In seinem Zimmer angekommen, setzte er sich aus Gewohnheit an seinen Schreibtisch, aber schon bald begann der Gedanke an seine Verabredung mit Florentine erneut an ihm zu nagen.
»Pah! Ich gehe einfach nicht hin«, murmelte er und schlug seine Bücher auf. Doch die Gedanken waren aufsässig. Er ahnte, dass er an diesem Abend weniger Lernstoff schaffen würde als sonst, und vor lauter Ärger darüber schob er die Hefte mit einer unwilligen Bewegung fort.
Normalerweise reichte es ihm voll und ganz, einmal in der Woche auszugehen. Das entspannte ihn und verlieh den Abenden, an denen er lernte, einen größeren Wert. Einmal in der Woche, am liebsten samstags, ging er allein auf die Rue Sainte-Catherine, sah sich im Palace oder im Princess einen Film an und aß hinterher in einem Restaurant im Westen der Stadt zu Abend. Danach kehrte er beschwingten Schrittes und vergnügt vor sich hinpfeifend in das rauchverhangene Arbeiterviertel zurück, denn er empfand diese Ausflüge als Bestätigung seiner heimlichen Ambitionen. In jenen Momenten beglückwünschte er sich selbst noch überschwänglicher als sonst, dass er frei war, vollkommen frei, ohne Familie oder Freunde, die ihn zu sehr in Anspruch genommen und ihn von seinem vorgezeichneten Weg abgebracht hätten. Die Samstage bestärkten seine Hoffnungen auf eine strahlende Zukunft. Und deshalb waren sie für ihn unverzichtbar. Genauso wie die gute Kleidung, die er trug, Ausdruck seines Selbstbewusstseins war, musste er ab und zu unter Leute gehen, um die ganze Kraft seiner Überzeugungen zu spüren, seiner standhaften Weigerung, auch nur eine Faser seiner Einzigartigkeit, seines individuellen Werts aufzugeben.
Manchmal machte er sich jedoch Sorgen wegen einer Neigung, die er ebenfalls in sich spürte: einer unbändigen Neugier auf andere Menschen, die bisweilen Mitleid gleichkam. Oder Verachtung, das wusste er nicht so recht. Doch er hatte den Eindruck, dass sein ständiges Bedürfnis nach Überlegenheit vielleicht auf einer Art Mitgefühl für all jene Menschen beruhte, die ganz unten standen, weit weg von ihm selbst.
›Mitleid oder Verachtung?‹, fragte er sich auch, als seine Gedanken zu Florentine zurückkehrten. Wer war sie? Wie lebte sie? Es gab so viele Dinge, die er gern über sie gewusst hätte, ohne ihr deshalb gleich seine kostbare Zeit widmen und vor allem ohne ihr etwas von sich selbst verraten zu wollen. Seit er zum ersten Mal im Quinze-Cents zu Mittag gegessen und Florentine erblickt hatte, erschien sie ihm in den unpassendsten Momenten, mal in der Gießerei, wenn die Klappe des Hochofens offenstand und ihm die Flammen vor Augen tanzten, mal sogar hier in seinem Zimmer, wenn der Wind wie heute Abend an seinen Fenstern rüttelte und ihn von allen Seiten umzingelte. Irgendwann war seine Obsession so stark geworden, dass es nur einen Weg gab, sich davon zu befreien: Er war besonders zynisch und hart zu dem jungen Mädchen gewesen, um es dazu zu bringen, ihn zu hassen, zu fürchten und zu meiden, damit er dies nicht selbst tun brauchte. Dennoch hatte er, nach einem oder zwei Vorstößen in diese Richtung, das Restaurant erneut aufgesucht. Er hatte Florentine wiedergesehen, und heute hatte er sich sogar dazu hinreißen lassen, sie einzuladen. Aus Mitleid? Interesse? Oder einfach nur, um ihr etwas anzutun, was sie ihm nicht würde verzeihen können, denn eine so plumpe, barsche Einladung hätte sie eigentlich ablehnen müssen. Hatte er sich darauf verlassen, dass sie Nein sagen würde?
Er sah sie wieder vor sich, blass, mit diesem unruhigen Flackern in den Augen, und fragte sich: ›Ob sie mir geglaubt hat? Ob sie wohl den Mumm hat, zu der Verabredung zu kommen?‹
Die Neugier, das wusste er nur zu gut, würde ihm keine Ruhe lassen, eine Neugier, die brannte wie eine Leidenschaft, das einzige Gefühl im Übrigen, das er nicht zu unterdrücken suchte, weil es ihm für sein persönliches Fortkommen unentbehrlich schien. Seine Neugier war entfesselt wie der Wind, der heute Abend durchs Viertel blies, entlang des Kanals, durch die menschenleeren Straßen, rings um die kleinen Holzhäuser, überall, bis hinauf zum Mont Royal.
Nach einer Weile versuchte er, sich wieder auf seine Hausaufgaben zu konzentrieren, aber sein Bleistift machte sich selbstständig und setzte Florentines Vornamen unter die Gleichungen. Zögernd fügte Jean »Lacasse« hinzu, radierte den Namen jedoch gleich wieder aus. Florentine, dachte er missmutig, das klang so jung und fröhlich, nach Frühling, aber der Nachname hatte etwas Ärmliches, Proletarisches, das den Charme des Vornamens zerstörte. Und so war sie selbst vermutlich auch, die kleine Kellnerin aus dem Quinze-Cents: halb Proletariat, halb anmutiger Frühling, ein kurzer Frühling jedoch, der rasch verwelkte.
Diese müßigen Überlegungen, die vollkommen untypisch für ihn waren, wurmten ihn gewaltig. Er stand auf, trat ans Fenster, öffnete es trotz Wind und Schnee sperrangelweit, steckte den Kopf hinaus und atmete die Nachtluft ein.
Der Wind fegte durch die leeren Straßen und wirbelte den Schnee auf, pudrig, blendend weiß. Die Flocken erhoben sich in die Luft, stoben an den Häusern empor, machten kleine, unberechenbare Sprünge wie eine Tänzerin, die von einer Peitsche verfolgt wird. Der Wind war der Herr, der die Gerte schwang und den Schnee vor sich hertrieb. Die wendige Tänzerin drehte Pirouetten und warf sich auf seinen Befehl zu Boden. Dann sah Jean nur noch einen langen weißen Schal, der sich leicht flatternd an die Türschwellen der Häuser schmiegte. Doch schon knallte der nächste Peitschenhieb, und die Tänzerin sprang wieder auf und umhüllte die Straßenlaternen mit ihrem Schleier. Sie schraubte sich in die Höhe, immer weiter bis zu den Dächern, wo sie umherirrte, während ihr Klagelaut und ihre unendliche Müdigkeit an den geschlossenen Fensterläden abprallten.
»Florentine … Florentine Lacasse … halb Proletariat, halb Lied, halb Frühling, halb Leid …«, murmelte der junge Mann vor sich hin. Und wie er da unverwandt auf den tanzenden Schnee starrte, zeichnete sich vor seinen Augen eine menschliche Silhouette ab, Florentines Silhouette, und ihm schien, dass sie trotz ihrer Erschöpfung nicht aufhören konnte, sich zu drehen und sich zu verausgaben. Ihm schien, dass sie dort draußen in der Dunkelheit tanzte und in ihren Pirouetten gefangen war. ›So sind die jungen Mädchen heutzutage‹, dachte er. ›Sie rennen hierhin und dorthin und laufen blind in ihr Verderben.‹
Um sich von diesen Gedanken abzulenken, ließ er den Blick aufmerksam durch sein Zimmer schweifen, als wollte er sich seiner Stärke vergewissern und sich darauf besinnen, wie stolz er auf sein Leben und seine Entscheidungen war. Von der niedrigen moosbedeckten Holzdecke hing das Stromkabel herab, das von einer Schnur über dem Schreibtisch gehalten wurde. Das Licht der nackten Glühbirne fiel auf seine aufgeschlagenen Bücher, mit Notizen vollgeschriebene Papiere, den Stapel dicker Nachschlagewerke. In einer Ecke des Zimmers stand die elektrische Herdplatte, auf der eine Kaffeekanne gluckernd schwarzen Schaum produzierte. Das Bett war ungemacht, auf dem Kopfkissen waren mehrere Bücher verstreut. Weitere lagen nebst einigen Kleidern auf einem abgewetzten Plüschsessel. Keine Regale, kein Spind, kein Kleiderschrank. Im Zimmer gab es nichts, wo er seine Habseligkeiten hätte einräumen können. Es sah permanent so aus, als befände er sich mitten im Umzug. Genau das gefiel Jean. Ihm war sehr daran gelegen, den provisorischen Charakter seines Zuhauses zu bewahren, um sich vor Augen zu halten, dass er nicht für ein Leben in Armut geschaffen war und sich nicht damit abfinden würde. Er hatte sich schon immer gleichermaßen mit Schönem und Hässlichem umgeben, denn das stärkte die Willenskraft. Das Zimmer hatte auf ihn dieselbe Wirkung wie seine einsamen Streifzüge durch die erleuchteten Prachtstraßen Montréals. Es regte ihn an, beflügelte ihn, lieferte ihm ein unmittelbares Hindernis, das es zu überwinden galt. Normalerweise spürte er, sobald er das Zimmer betrat, Pläne, Ambitionen und die Lust am Lernen in sich brodeln. Doch heute Abend verweigerte das kleine Zimmer ihm seine Medizin. Er fühlte sich wie ein Raubtier im Käfig, ohne die übliche Selbstsicherheit. In seinem Kopf spukte ununterbrochen die Frage herum: ›Wird sie zu unserer Verabredung kommen?‹
Jean wurde klar, dass seine Gedanken, solang er seine Neugier nicht befriedigte, weiter um Florentine kreisen würden. Mit einem Achselzucken dachte er, dass es außer dem Lernen noch weitere nützliche Tätigkeiten gab. Außerdem hatte es ihn schon immer beruhigt und bereichert, seine Neugier zu stillen.
Er zog sich warm an und verließ eilig das Zimmer.
Draußen auf der Straße war es still. Es gibt nichts Ruhigeres als die Rue Saint-Ambroise in einer Winternacht. Von Zeit zu Zeit huscht ein Passant vorbei, angezogen vom schummrigen Licht einer Kneipe. Eine Tür wird geöffnet, ein heller Streifen fällt auf den verschneiten Bürgersteig, gedämpftes Stimmengewirr erklingt. Der Passant verschwindet, die Tür fällt ins Schloss, und auf der leeren Straße, zwischen dem fahlen Schein der Stuben und den düsteren Mauern entlang des Kanals, klafft nur noch die Nacht.
Früher endete hier die Stadt. Dies waren die letzten Häuser von Saint-Henri, dahinter kam nur noch brachliegendes Land. Damals umwehte eine nahezu saubere, fast schon ländliche Luft die schlichten Giebel und kleinen Gärtchen. Von dieser guten alten Zeit waren in der Rue Saint-Ambroise nur zwei, drei große Bäume übriggeblieben, die ihre Wurzeln unter den Zement des Gehsteigs schoben.
Textilfabriken, Getreidesilos und Lagerhallen waren neben den Holzhäusern in die Höhe geschossen, hatten ihnen die frische Landbrise genommen und sie allmählich von allen Seiten umzingelt. Die Häuser standen immer noch hier, mit ihren kleinen schmiedeeisernen Balkonen, ihren friedlichen Fassaden, der leisen Musik, die manchmal abends hinter den Fensterläden hervordrang und sich in die Stille schmiegte wie eine Stimme aus einer vergangenen Zeit: einsame Inseln, vom Wind mit den Ausdünstungen sämtlicher Kontinente gepeitscht. Ganz gleich, wie kalt die Nacht war, sie schaffte es immer, der Speicherstadt die Gerüche von Weizen, gemahlenem Getreide, ranzigem Öl, Melasse, Erdnüssen, Pelzen, weißem Mehl und harzigem Fichtenholz abzuringen.
Jean war hierher gezogen, weil die Mieten in der abgelegenen, fast gänzlich unbekannten Straße bezahlbar waren und weil ihn die Gegend mit ihrem feierabendlichen Dröhnen, Rattern und Tuten und ihrer bangen nächtlichen Stille zur Arbeit antrieb.
Allerdings war es im Frühjahr vorbei mit der nächtlichen Stille. Sobald der Kanal wieder befahrbar war, dröhnten bis zu hundertmal am Tag die Schiffssirenen. Ihr Tuten hallte von morgens bis abends durch die Rue Saint-Ambroise, durch das ganze Viertel bis hoch zum Mont Royal.
Das Haus, in dem Jean ein kleines möbliertes Zimmer angemietet hatte, stand direkt an der Drehbrücke in der Rue Saint-Augustin. Das Haus sah Frachter, nach Öl oder Benzin stinkende Tanker, mit Baumstämmen beladene Lastkähne und Kohlenschiffe an sich vorbeiziehen, und alle stießen direkt vor seiner Tür drei Warnsignale aus, die nach Freiheit und weiten Gewässern klangen, obwohl sie diese erst sehr viel später erreichen würden, wenn sie die Städte am Ufer des Sankt-Lorenz hinter sich ließen und ihr Kiel die Wellen der Großen Seen durchschnitt.
Doch das Haus stand nicht nur an der Route der Frachtschiffe. Es stand auch an den Schienen. Vor seiner Tür begegneten sich der Schiffs- und der Eisenbahnverkehr aus Osten und Westen. Von hier aus gelangte man gleichermaßen zum Atlantischen Ozean, zu den Großen Seen, zu den Prärien.
Links schimmerten die Gleise, und direkt vor der Tür prangten rote und grüne Signalscheiben. Abends versank das Haus in Kohlestaub, Räderrattern, dem Stampfen der Dampfloks, dem Pfeifen der Kessel und den aus Schornsteinen puffenden Rauchwolken; dazu gesellte sich das schrille Bimmeln der Warnglocken, und über dem Getöse schnurrten behäbig die Schiffsschrauben. Wenn Jean in der Nacht von dem Radau aufwachte, glaubte er sich auf Reisen, mal auf einem Frachtschiff, mal in einem Schlafwaggon. Dann schloss er die Augen und schlief wieder ein, mit dem wohligen Gefühl, dass er sein Leben hinter sich ließ, weit hinter sich.
Das schmale Haus bot sich der Straße auf eigentümliche Weise dar: schräg, als wollte es alle Angriffe abwehren. Seine Mauern liefen v-förmig auseinander. Es erinnerte an ein plumpes Schiff, das mit seinem reglosen Bug den Lärm und die Dunkelheit zerteilte.
Jean blieb einen Moment in der Tür stehen. Er liebte das Haus mehr als alles andere in diesem Viertel. Sie hatten sich vor langer Zeit verbündet und gaben beide nicht so schnell auf.
Ein Windstoß erfasste ihn von der Seite und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Der Wind trieb ihn nach Westen, die Straße hinunter, und Jean duckte sich an die Hauswände. An der Ecke der Rue Saint-Ferdinand drang das Klagelied einer Gitarre aus einem undichten Fenster. Er trat an die beschlagene Scheibe und sah durch ein kleines Viereck zwischen den Werbeschildern ganz hinten im Raum das rosige Gesicht Mère Philiberts, der Besitzerin des Lokals. Sie saß hinter ihrem Tresen auf einem hohen Hocker und streichelte eine schwarze Katze, die mit dem Schwanz auf das blank polierte verwitterte Holz klopfte. Aus den nassen Mänteln, Mützen und Handschuhen, die die Gäste über das Schutzgitter geworfen hatten, stieg Dampf auf, der die Gesichter verzerrte. Jean konnte den Gitarrenspieler nicht sehen, aber er sah das Instrument und die Finger, die die Saiten zupften. Weiter hinten entdeckte er einen zweiten Musiker, der zwei Löffel aneinanderschlug und ein Geklapper wie von Kastagnetten erzeugte. ›Die Bande vergnügte sich wie immer preiswert‹, dachte Jean.
Hinten im Raum saßen zwei, drei Fremde, deren Gesichter er nicht kannte; manchmal brachte jemand einen Außenstehenden mit, einen frisch eingestellten Textilarbeiter oder einen jungen Arbeitslosen, und Mère Philibert hieß die Neulinge genauso eifrig willkommen wie ihre Stammgäste. Seit Jahren bot die Kneipe einer lauten, streitlustigen Truppe Zuflucht, deren Mitglieder nur selten einen Cent in der Tasche hatten.
Jean dachte an die Zeit zurück, als auch er in der Textilfabrik gearbeitet und Abend für Abend die Gaststätte besucht hatte, außer an Zahltagen. Schon damals hatte es eine Tradition gegeben: Samstagabends ging man gemeinsam ins Kino auf der Rue Notre-Dame, während man an anderen Tagen mit dem abgegriffenen Kartenspiel, der Musik und den anderen billigen Vergnügungen vorliebnahm, die es bei Emma Philibert gab. Bei der »dicken Emma«, wie sie von ihnen genannt wurde. Die herzliche Wirtin war sicher der liebevollste, mütterlichste Einfluss in seinem Leben gewesen, dachte Jean. Er hatte ihren barschen Ton im Ohr, wenn ein Gast anschreiben wollte: »Bei dir piept’s wohl? Du bist doch notorisch pleite!«, schnauzte sie den Bittsteller an. Dann hievte sie sich ächzend von ihrem Hocker und flüsterte ihm zu: »Du willst ein Päckchen Tabak, um dich zu vergiften und dir die Zähne kaputtzumachen? Hier, nimm. Auf mein Geld wart ich dann wohl bis zum Sankt Nimmerleinstag.« Dann wieder laut: »Ich, Emma Philibert, lasse mich nicht vergackeiern! Von mir bekommst du keinen Krümel!«