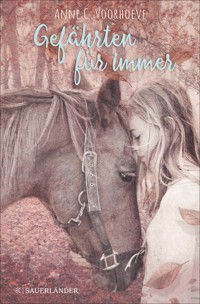
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
1943: Die vierzehnjährige Lotte aus Hannover flüchtet nach verheerenden Luftangriffen auf das Trakehnergestüt Waldeck in Ostpreußen. Weit weg vom Kriegsgeschehen findet sie auf dem idyllischen Gut ein neues Zuhause und erlebt auf dem Rücken der Trakehnerstute Lilie eine nie zuvor gespürte Freiheit. Doch der Krieg schreitet voran, und nach zwei Sommern muss Lotte erneut fliehen und alles zurücklassen, was ihr ans Herz gewachsen ist. Aber so schwer der Weg, der vor ihr liegt, auch sein mag: Lotte stellt sich mutig ihrem Schicksal. Und gibt niemals auf. Eine packende Fluchtgeschichte, ein aufregender Pferderoman und vor allem: eine eindrucksvolle Schilderung davon, wie wichtig es ist, auch in schwersten Zeiten die Hoffnung nicht zu verlieren. Nach »Liverpool Street« der neue große zeitgeschichtliche Roman der Autorin Anne C. Voorhoeve.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anne Voorhoeve
Gefährten für immer
Über dieses Buch
1943: Die vierzehnjährige Lotte flüchtet nach verheerenden Luftangriffen auf Hannover nach Ostpreußen, auf das Trakehnergestüt Waldeck. Weit weg vom Kriegsgeschehen findet sie auf dem idyllischen Gut ein neues Zuhause und erlebt auf dem Rücken der Trakehnerstute Lilie eine nie zuvor gespürte Freiheit. Doch der Krieg schreitet voran, und nach zwei Sommern muss Lotte erneut fliehen und alles zurücklassen, was ihr ans Herz gewachsen ist. Aber so schwer der Weg, der vor ihr liegt auch sein mag: Lotte stellt sich mutig ihrem Schicksal. Und gibt niemals auf.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Eva Schöffmann-Davidov
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5060-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Karte
Hannover Juli 1943
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Waldeck/Provinz Ostpreußen August 1943
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Stettin/Provinz Pommern November 1944
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Von Stettin nach Hannover Februar/März 1945
23. Kapitel
24. Kapitel
Polen Juni 2005
25. Kapitel
26. Kapitel
Nachwort
Wer früher Trakehner geritten hat, der muss heute schon Porsche fahren, um das Niveau zu halten.
(Marion Gräfin Dönhoff, 1909–2002)
Hannover Juli 1943
1
Ich hasse Briefe schreiben. Das waren die Worte, die sich vor alle anderen schoben, während ich meine Abschiedsrunde machte. Nicht: Ich hasse den Krieg, oder: Ich hasse Papa, der mich fortschickt. Ich hasse Briefe schreiben. All unsere Diskussionen, all meine Tränen und Wutausbrüche der letzten drei Tage lösten sich auf in diesem letzten albernen Protest. Immerhin schien ich begriffen zu haben, dass ich aus der Sache nicht mehr herauskam.
»Seit wann hast du Verwandte in Ostpreußen?«
Gitti klang vorwurfsvoll. Ich klang, als müsste ich mich verteidigen: »Hab ich gar nicht. Antonia ist eine Schulfreundin meiner Mutter, ich hab sie in meinem Leben vielleicht zweimal gesehen.«
Erinnern konnte ich mich nur an das letzte Mal, und auch das ziemlich verschwommen. Ein schmales, freundliches, unendlich trauriges Gesicht. Eine leise Stimme: »Es tut mir so leid, Lotte.« Das, was an dem Tag alle gesagt hatten.
Aber plötzlich fiel mir ein, dass Antonia von Waldeck es schon damals vorgeschlagen hatte: »Komm uns besuchen. Wir haben viel Platz, du kannst reiten und schwimmen und einfach mal ausspannen. Meine Nichte ist in deinem Alter.«
Ich hatte es komplett vergessen, aber Papa musste es sich gemerkt haben. Am 27. Juli, nur einen Tag nach dem Angriff auf Hannover, hatte er Antonia aus dem Hut gezaubert wie Houdini das weiße Kaninchen. Dabei wusste er genau, dass er auf mich nicht verzichten konnte. Wie sollte ich mich in Waldeck sicher fühlen (was immer das in diesen Tagen noch bedeutete), ohne zu wissen, ob er zurechtkam? Ob die Lehmann Wort hielt und sich um ihn kümmerte, und wozu das wiederum führen mochte.
»Glaubst du, das war meine Idee?«, fuhr ich meine Freundin beinahe an. »Ich bin nicht einmal gefragt worden!«
»Das«, meinte Gitti immer noch zweifelnd, »sieht deinem Vater aber gar nicht ähnlich …«
Da hatte sie recht. Die letzten zweieinhalb Jahre war ich zu Hause der Chef gewesen, das wusste jeder, und plötzlich brach es aus mir heraus: »Er meint, er kann mich nicht mehr beschützen. Kannst du mir verraten, was das heißen soll? Ich bin es doch, die auf uns beide aufpasst! Wenn ich am Montag nicht gewesen wäre …«
Ich brach ab. Dass mein Vater und ich bei dem Angriff vor drei Tagen nicht im Luftschutzkeller gewesen waren und wieso und warum, davon schaffte ich es einfach nicht zu sprechen. Nicht einmal mit meiner besten Freundin, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte.
»Vielleicht«, sagte Gitti leise, »haben wir ja Glück, und das alles ist bald vorbei.«
Das alles. Diese Worte benutzte fast jeder; es gab mittlerweile einfach zu viele Dinge, die hoffentlich bald vorbei waren, als dass man sie noch einzeln aufzählen konnte.
Gitti und ich standen vor dem Trümmerhaufen, der bis vor drei Tagen unsere Markthalle gewesen war, und konnten, während wir uns über unsere eigenen »Dinge« unterhielten, eine ganze Reihe fremder »Dinge« miterleben, ohne uns auch nur vom Fleck rühren zu müssen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite durchforsteten ehemalige Bewohner die Ruine ihres Hauses nach noch brauchbaren Möbeln und Kleidungsstücken. Was sie retten konnten, luden sie in einen kleinen Holzkarren, der von zwei Knirpsen bewacht wurde. Weiter hinten räumten Kriegsgefangene, die wir eben noch in langer Reihe an uns hatten vorbeimarschieren sehen, zusammen mit Anwohnern Trümmer von der Straße. Ein Postbote, per Fahrrad unterwegs, trug ersehnte und gefürchtete Botschaften aus.
Ich hasste Briefe schreiben, und ich würde es hassen, auf Briefe zu warten. Bisher hatte ich alle, die mir etwas bedeuteten, in meiner Nähe gehabt – ganz im Gegensatz zu Gitti und so vielen meiner Schulkameraden, deren Väter an der Front waren. Nun würde auch ich zu denen gehören, die auf Briefe warten mussten, um zu erfahren, ob es meine Leute noch gab.
Der Krieg dauerte schon fast vier Jahre; komisch, dass man trotzdem nie damit gerechnet hatte, dass er auch bei uns in Hannover ankommen würde.
»Wann fährst du?«
»Morgen früh.«
Eine bedrückende Pause entstand. Was sollte Gitti auch groß sagen?
Schließlich sagte sie: »Ich verabschiede mich nicht. Wir schreiben uns ja«, und nach kurzem Nachdenken: »Dann lade ich zu meinem Geburtstag eben noch Marlies ein.«
Nicht besonders nett von ihr, fand ich: mich darauf aufmerksam zu machen, dass das Leben zu Hause weitergehen würde, wenn ich weg war! Aber wie sollte ich es ihr übelnehmen? Nach vorne denken lautete eine weitere Parole, die man an jeder Straßenecke hören konnte.
Und es war ja keineswegs so, als ob ich das nicht gern versucht hätte – es funktionierte bloß einfach nicht. Ab morgen nicht mehr neben Gitti sitzen zu können oder in meiner Stadt unterwegs zu sein lag völlig außerhalb meiner Vorstellung. Das Einzige, was ich mich in Zukunft tun sehen konnte, war Briefe schreiben. Auf Briefe warten. Beides hassen.
»Dabei habe ich schon dein Geschenk.«
Gittis Schultern sanken herab. »Ach, Lotte, so ein Schiet. Was sagt denn deine Tante?«
»Die weiß es noch nicht …«
»Bestimmt freut sie sich für dich. Bomben fallen da oben jedenfalls nicht. Heißt Ostpreußen nicht Reichsluftschutzkeller?«
»Nein, damit ist Pommern gemeint, Ostpreußen ist im letzten Krieg ganz schön zerschossen worden. Ostpreußen ist bloß die Reichskornkammer.«
»Aha! Genug zu essen gibt es also. Stell dir nur vor – ein Ei zum Frühstück! Wieder mal ein Schnitzel!« Plötzlich hellte sich ihr Gesicht auf. »Vielleicht kann ich dich ja besuchen.«
»Bestimmt! Dann halten wir eine Fressorgie.«
Gitti strahlte. Ab sofort kannte sie jemanden in der Reichskornkammer! Ob sie sehr enttäuscht wäre, wenn ich morgen den Zug verpasste …? Das hatte ich mir nämlich in der Nacht zuvor überlegt: Papa auf Wiedersehen zu sagen und einfach eine Station weiter wieder auszusteigen.
Aber bei Licht betrachtet, war das kein guter Plan. Papa würde mir auf der Stelle eine neue Fahrkarte kaufen und sich diese von Geld absparen, das ohnehin knapp war. Auch damit hatte er übrigens argumentiert: Für ihn allein würde unser Geld länger reichen. Das war eine ziemlich miese Karte gewesen, die ich ihm übelnahm.
Apropos übelnehmen: Irrte ich mich oder fing Gitti gerade an, sich darüber zu freuen, dass ich wegfuhr? »Vielleicht kannst du ja ab und zu ein Paket schicken«, schlug sie vor.
Ich war die Anhänglichere von uns beiden, das spürte ich in solchen Momenten deutlich. Wenn wir gestritten hatten, war immer ich es, die umfiel und die Hand ausstreckte – und dass wir selten stritten, hing möglicherweise damit zusammen, dass ich in der Regel schon vorher umfiel. Wie jetzt.
»Ich könnte den Paketen an Papa etwas für dich beilegen.«
»Ach, Lotte, das wäre phantastisch!«
Der Abschiedsfrieden war gewahrt. Die Einzige, die bei Gittis und meiner letzten Umarmung ein komisches, heimlich enttäuschtes und verratenes Gefühl hatte, war ich.
Nun blieb nur noch Tante Fips, und ich hatte es gewusst: Der Weg durch die zerstörte Stadt würde schlimm werden. Am Dienstag und Mittwoch hatte ich mich nur ein kleines Stück weiter vorgewagt, nicht nur weil ich fürchtete, einen Augenzeugen aus der Apotheke wiederzutreffen, sondern auch weil man vor jeder Ecke unwillkürlich den Atem anhielt: Gab es diese Straße noch, jenes Geschäft; wie sahen die Häuser aus, in denen Mitschüler wohnten? Es waren Ferien, und ich hatte keine Ahnung, ob vielleicht sogar jemand von uns gestorben war. Allein der Gedanke wäre mir bis vor drei Tagen nie gekommen.
Dabei hatte es früher schon Angriffe auf Hannovers Industriegebiete gegeben, Fliegeralarm waren wir längst gewohnt. Nahmen feindliche Bomber Kurs auf Berlin oder Hamburg, mussten nämlich auch wir in den Keller. Hoch über uns hörte man es dann dröhnen, hielt den Atem an und dachte an die, die es in den nächsten Stunden erwischte.
Aber diesmal, nur einen Tag nach dem Feuersturm in Hamburg, waren tatsächlich wir dran gewesen. Dabei hatten sich die Hannoveraner immer so sicher gefühlt. Die Engländer und wir waren praktisch verwandt; unsere Könige waren auch mal die ihren.
Dass Amis die Angreifer gewesen waren und nicht die Briten, war ein gewisser Trost: Es konnte bedeuten, dass die Bombardierung der Altstadt ein Versehen gewesen war oder nicht mit den Tommys abgestimmt. Wahrscheinlich war die Conti das eigentliche Ziel gewesen, unsere große Reifenfabrik, über der ja auch die meisten Bomben heruntergekommen waren.
Vor dem Schaukasten der Hannoverschen Zeitung drängten sich die Leute und lasen stumm und aufmerksam, als müssten sie sich noch einmal davon überzeugen, was sie erlebt hatten. Was in der Zeitung steht, glaubt sich leichter.
Der Blick umher war schwerer zu begreifen. Die Oper war abgebrannt, den Turm der Marktkirche hatte ich selbst zusammenstürzen sehen, die Georgstraße war einfach weg. Jahrhundertealte, vertraute Gebäude, binnen zwanzig Minuten reduziert auf einen Haufen Steine, Scherben und verkohlte Dachbalken. Leute mit leeren Einkaufstaschen standen fassungslos vor der Ruine von Café Kröpcke und wussten nicht, wohin.
Über unser Stadtbild hatte ich mir früher nie Gedanken gemacht; erst jetzt, wo große Teile der Altstadt als trübseliger Haufen Geröll im Weg lagen, ging mir auf, wie schön es hier bis vor ein paar Tagen gewesen war und wie viel Mühe und Sorgfalt unsere Vorfahren darauf verwendet hatten, Hannover zu etwas Besonderem zu machen. Unsere Altstadt konnte jetzt als das Ruhrgebiet durchgehen, wo es schon länger so aussah. Wo just in diesem Augenblick vielleicht ebenfalls Leute vor Trümmerhaufen standen und sich fragten, wann das alles wohl aufhörte, und ob das alles eigentlich irgendjemand gewollt haben konnte.
Obwohl vereinzelt noch Häuser brannten – unsere Feuerwehren waren am Sonntag zur Unterstützung nach Hamburg ausgerückt, und wir selbst daher am Montag praktisch schutzlos gewesen –, hatte an vielen Stellen schon das große Aufräumen begonnen. Frauen, Alte, Kinder, alle packten mit an. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich an einem solchen Trupp vorbeieilte, ohne Hilfe anzubieten, und hoffte, dass mich niemand ansprach.
Ich habe keine Zeit, ich werde morgen evakuiert und muss mich verabschieden …
Du bist vierzehn, du bist doch kein Kind mehr! Du wirst hier gebraucht, Lotte Harms!
Zum Glück achtete niemand auf mich. Zu tun, als gehörte ich zu einer der vielen Familien, die mit allem, was sie tragen konnten, stadtauswärts unterwegs waren, war ein alter Trick – so alt, dass ich es mittlerweile ganz automatisch tat und nicht einmal mehr darüber nachdachte. Die Mutter mit den vier Kindern zum Beispiel, von denen jedes genau einen halben Kopf kleiner war als das nächstältere – die passten zu mir, da konnte ich mich größentechnisch glatt einreihen! Sie hatten Koffer dabei, einen Kinderwagen und ein mit Bettzeug beladenes Fahrrad. Ausgebombte vom Montag.
»Kann ich vielleicht helfen?«
Ich konnte es einfach nicht lassen. Es war wirklich eine Schwäche: Wenn es mir nicht gutging, lief ich durch die Stadt und stellte mir vor, jemand anderes zu sein.
Aber diese Mutter zuckte nur zusammen, starrte mich misstrauisch an und schien sogar noch einen Schritt zuzulegen, und jetzt erkannte ich es selbst: Auf den zweiten Blick war sie leider überhaupt nicht sympathisch. Der älteste der kleinen Jungs streckte mir sogar die Zunge heraus. »Hau ab, das sind unsere Sachen!«
Sollten sie sehen, wie sie zurechtkamen! Als wir an einem Krater mitten auf der Straße ins Stocken gerieten, weil Fußgänger mit Karren und Kinderwagen sich vor dem einzigen schmalen Durchgang am Rand stauten, schob ich mich an ihnen vorbei, kletterte durch das Loch und kümmerte mich wieder um meine eigenen Dinge.
Die Stadt klang fremd. Man hörte Löschwasser durch zerstörte Treppenhäuser rieseln und das Klacken von Steinen, die aus dem Weg geworfen wurden; hohle Wände warfen ein vielstimmiges Hämmern und Klopfen zurück. Überall war jetzt Baustelle. Hier und da schwelte und qualmte es, Asche- und Rußpartikel schwirrten durch die Luft, und ich musste an Sonnenwendfeuer denken. »Geh nicht zu dicht heran!«, hätte Mama gesagt, die das alles nicht mehr erlebt hatte. Aber jetzt blieb mir nichts anderes übrig: Ich musste mitten hindurch, rechts Trümmerhaufen, links Häusergerippe, die jeden Augenblick einstürzen konnten, und dazwischen jemand, der mit Kreide eine Botschaft an eine verkohlte Mauer kratzte: Familie Bergmann lebt!!!
Drei Ausrufezeichen. Genauso war mir zumute gewesen, als ich vor drei Tagen ins Freie gezogen worden war. Nicht wegen der Leute im Keller, von denen ich erst am nächsten Tag erfahren hatte; und auch nicht wegen der Katastrophe draußen, deren Ausmaß mir erst nach und nach so richtig klarwurde. Nein, der größte Schock war gewesen, dass ich etwas anderes, ganz Simples erkannt hatte: Die wollen uns umbringen!
Natürlich hätte ich das wissen müssen, vom Feind hörte man ja wahrlich genug. Aber so, dass ich es persönlich zu nehmen hatte, war es bisher nie gewesen. Nun war die Lage nicht mehr abzustreiten: Die hatten tatsächlich versucht, uns umzubringen, Papa und mich, die niemandem etwas getan hatten, die seit Jahren einfach nur versuchten, irgendwie zurechtzukommen. Wir, Hans und Lotte Harms, hatten Feinde. Das Wort hatte eine andere Bedeutung seit Montag, und jedes Mal, wenn ich seitdem durch die Stadt gelaufen war, war mir von neuem bewusstgeworden, dass der Feind es wieder versuchen würde.
Ich fuhr zusammen, als etwas Großes, Grünes mir über den Kopf segelte. Ein Papagei! Elegant schwang er sich höher hinauf und landete auf dem Geländer eines Balkons, der wie ein schiefer Einkaufskorb an der Außenmauer einer Altbauruine hing. Mit ruckartigen Bewegungen begann der Vogel zu balancieren, als wollte er ausprobieren, ob das Gitter womöglich noch glühte.
Ich war froh, dass ich kein Haustier besaß. Tiere durften nicht in die öffentlichen Luftschutzkeller, und von Gitti wusste ich, dass sie bei jedem Fliegeralarm Qualen litt wegen ihres Katers Lupo. Zwar konnte er sich ins Freie retten, weil wegen der Druckwellen der Explosionen alle Fenster offen bleiben mussten, aber von Sicherheit konnte draußen natürlich keine Rede sein.
Die Besitzer des Papageis schienen diesem sogar, bevor sie gingen, die Käfigtür geöffnet zu haben. Keine Ahnung, wie sie ihn wieder einfangen wollten – falls sie sich überhaupt bemühten und jetzt nicht ganz andere Sorgen hatten. Geschickt kletterte der Vogel auf dem Geländer herum und ließ ein Krächzen hören, das ziemlich zufrieden klang.
Er war ein fröhlicher Farbfleck zwischen all dem verkohlten Grau und Schwarz, und ich war nicht die Einzige, die seinetwegen stehen blieb. Leute schauten hinauf und lächelten, ein Mann pfiff und lockte: »Jakob, komm! Oder vielleicht Willi? Willi! Peterle! Rasputin!«
Ich hoffte für den Vogel, dass er, falls seine Leute ihn nicht wiederfanden, in einem anderen gastfreundlichen Fenster und nicht gerupft und als Hühnchenersatz im Ofen landete. Da es kaum Fleisch auf unsere Lebensmittelkarten gab, waren inzwischen angeblich auch Hunde und Katzen nicht mehr sicher – ein weiterer Grund für Gittis Angst um Lupo, und als ich rasch weitergehen wollte, um neben meinen eigenen Sorgen nicht auch noch über schutzlose Tiere im Krieg nachdenken zu müssen, hob sich der Papagei plötzlich kreischend in die Höhe.
Er musste es eine Sekunde früher gespürt haben als wir. Ein gewaltiges Krachen fuhr mir in die Glieder, der Boden bebte, Putz und lose Steine rieselten von umliegenden Häusern, und dann sah ich über den Dächern auch schon eine gewaltige Staubwolke aufsteigen. Blindgänger oder Bomben mit Zeitzünder waren die größte Gefahr, wenn es nach einem Angriff ans Aufräumen ging. Jederzeit konnte irgendwo noch eine hochgehen und weitere Häuser einstürzen lassen, Ruinen zerbröseln wie Sandburgen.
Instinktiv flüchtete ich in die Mitte der Straße – wie der ganze Menschenpulk, eine Schar Tauben, die aufgeschreckt losflatterte. Als die Staubwolke auf uns herabfiel, drückte ich mir einen Ärmel ins Gesicht, aber es half nichts, wir alle husteten, die Augen brannten, binnen Sekunden waren wir von beißendem hellem Pulver überzuckert, das zwischen den Zähnen knirschte.
Das hatte ich nicht erwartet. Ein verblüffter, vorwurfsvoller Satz, den am Dienstag irgendjemand auf der Straße gesagt und den ich seitdem in Gedanken oft wiederholt hatte. Er fasste alles zusammen, was auch mir durch den Kopf ging. Mehr gab es eigentlich nicht zu sagen.
Tante Fips’ Haus war unversehrt, ihre Straße seltsam ruhig. Bis vor drei Tagen hatte man hier immer Spatzen gehört.
Meine Tante öffnete die Tür und starrte mich an. Erst als ich sagte: »Ich glaube, ich muss mich kurz mal waschen«, schien sie mich zu erkennen.
»Du liebe Güte, Lotte.« Das war alles. Keine Fragen, was passiert war, in diesen Tagen hing ohnehin alles mit Montag zusammen.
Mit schlechtem Gewissen machte ich reichlich Gebrauch von dem kostbaren Stück Seife, das in der Schale auf dem Waschtisch lag, wusch mir die Haare und sah im Spiegel, wie unter der Staubschicht mein Gesicht wieder zum Vorschein kam. Sommersprossen, grüne Augen, breiter Mund. Dass mit meinem Gesicht etwas nicht stimmte, war mir erstmals aufgefallen, als wir im vorigen Jahr unsere Sitznachbarn hatten zeichnen sollen, und die Kunstlehrerin zu Gittis Porträt von mir die unvergessenen Worte gesprochen hatte: »Sehr gut. Der breite Mund, die mürrische Unterlippe – das ist unsere Lotte.«
Als ich aus dem Badezimmer kam, hatte Tante Fips Tee gekocht und sogar noch irgendwo Kekse aufgetrieben. Wir saßen in ihrer Küche wie zu Friedenszeiten. Tante Fips war Mamas Chefin in der Buchhaltung bei der Hanomag; nach Mamas Tod hatte ich ein paar Wochen bei ihr gewohnt, und auch vorher manchmal einige Tage, wenn meine Eltern auf Reisen gewesen waren.
Und kaum hatte ich Platz genommen, merkte ich, wie satt ich das alles hatte. Tante Fips war die Vierte, der ich an diesem Tag dieselbe Geschichte klagte, und während ich Ärger und Enttäuschung über Papa in schon viel weniger Worten zusammenfasste als vorhin gegenüber Johanna, Helga und Gitti, wurde mir klar, was das bedeutete. Ich hatte mich abgefunden. Ich konnte mir die Luft sparen.
Tante Fips musste man ohnehin nicht viel erklären. Sie meinte: »Deine Mutter hätte genauso entschieden.«
Es traf mich jedes Mal tief, wenn sie so etwas sagte. Nicht nur weil mir dann blitzartig das Gesicht meiner Mutter vor Augen stand – etwas, das mir kaum noch gelang, wenn ich mich bewusst darauf konzentrierte –, sondern weil ich selbst nur noch selten auf die Idee kam, mich zu fragen, was Mama eigentlich gewollt hätte.
Tante Fips hingegen brachte sie oft ins Spiel. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie hätte mehr Erinnerungen an meine Mutter als ich, obwohl das nicht sein konnte. Bei mir war wohl einfach vieles, was an guter Erinnerung in mir stecken musste, vom Ende her überschattet.
»Aber jetzt noch nach Ostpreußen?«, sagte sie kopfschüttelnd. »Ob das eine gute Idee ist?«
»Wie meinst du das?«
Schon ließ sich beobachten, was immer passierte, wenn Erwachsenen eine unvorsichtige Bemerkung entschlüpfte: Du machst ein verblüfftes Gesicht, der Erwachsene rudert zurück.
Dabei war ich nicht blöd; natürlich wusste ich um die besondere Lage Ostpreußens. Nach dem Großen Krieg hatten die Siegermächte Westpreußen und Posen den Polen zugesprochen, Ostpreußen durch den sogenannten »Polnischen Korridor« also praktisch vom Rest des Deutschen Reichs abgeschnitten. Auch darum war es zu dem neuen Krieg gekommen, den wir seit vier Jahren erlebten. Unsere Truppen hatten den Korridor zurückerobert, aber der Rest der Welt wollte das nicht hinnehmen.
»Natürlich will ich nicht sagen, dass der Führer auch nur einen Zoll ostpreußischen Bodens preisgeben würde!«, setzte Tante Fips hastig hinzu. »Aber der Osten ist sehr umständlich zu erreichen, wenn dein Vater dich besuchen will.«
»Das kann er nicht. Wie denn?«
Es war eine rein rhetorische Frage. Dass der Führer Ostpreußen nicht aufgeben würde, gehörte nach meiner Einschätzung zu den Dingen, die man nicht äußern durfte – weil es in Wirklichkeit nichts anderes bedeutete, als dass man bereits darüber nachdachte. An der Ostfront lief es nicht gut, das war kein Geheimnis; streng verboten war bloß, nicht an eine Wende zu glauben.
Erleichtert stieg Tante Fips auf mein Ablenkungsmanöver ein. »Ich meine ja nur. Die meisten Leute schicken ihre Kinder jetzt nach Süddeutschland. Die nächste Kinderlandverschickung geht in den Harz, vielleicht solltest du lieber dort mitfahren.«
»Papa schickt mich nicht mit der Hitlerjugend.«
Das dufte man wiederum sagen, denn es war allgemein bekannt, dass Eltern zögerten, ihre Kinder mit Hilfe der HJ in Sicherheit zu bringen. Jetzt würde vielen Familien nichts anderes übrigbleiben, als sich zu trennen, da sie am 26. Juli obdachlos geworden waren. Auch mir waren die Plakate aufgefallen, die seit dem Vortag wieder Werbung für die Kinderlandverschickung machten – fröhliche Pimpfe und blonde Jungmädel mit flatternden HJ-Halstüchern, aus Zügen winkend.
»Nach den Ferien sollen ganze Schulklassen evakuiert werden«, hatte Tante Fips bereits gehört. »Dann wärst du vielleicht sowieso dabei gewesen.«
Plötzlich stand sie auf. »Würdest du etwas für mich aufheben?«
»Ja, natürlich!«
Sie verschwand im Schlafzimmer. Ich war dankbar für die Pause. Ich wusste, dass Tante Fips den Führer nicht schätzte, und dass ich das eigentlich nicht wissen dufte. Sie wiederum wusste, dass ich, obwohl ich niemals eine ihrer Äußerungen weitertratschen würde, eigentlich die Pflicht dazu gehabt hätte. Irgendwie hatten wir es trotzdem immer geschafft, einander nicht in Verlegenheit zu bringen, aber heute fand ich dieses ganze Drumherumgerede nur noch anstrengend.
»Ach was, aufheben«, sagte sie, als sie zurückkam. »Du kannst sie behalten«, und noch bevor ich die kleine Schachtel öffnete, wusste ich, was darin war.
»Auf keinen Fall! Das kann ich nicht annehmen, Tante Fips.«
»Bitte. Du tust mir einen Gefallen, und ich hätte sie dir sowieso vererbt.«
»Vererbt? Jetzt hör aber auf! Wir sehen uns wieder, Tante Fips, das weiß ich ganz genau!«
»Das denke ich auch, Lotte. Aber nimm die Spieluhr trotzdem mit.«
Das winzige Karussell, auf dem sich drei weiße Porzellanpferde zur Melodie des »Treuen Husaren« drehten, hatte ihrer Tochter Beate gehört, die an Typhus gestorben war – damals, im letzten Krieg. Erschrocken und verlegen fummelte ich daran herum, bis ich den Mechanismus gefunden hatte, der die Karussellpferde in Betrieb setzte. Und als wir schließlich der zarten Melodie lauschten, spürte ich mit jedem Ton, wie leer meine Worte gewesen waren, und dass wir uns jetzt eigentlich etwas anderes sagen mussten als: Natürlich sehen wir uns wieder.
Doch dafür, dass ich womöglich zum letzten Mal mit meiner alten Tante Fips an ihrem Küchentisch saß, fand ich in meinem Kopf kein einziges Wort.
Und leider auch nicht dafür, was uns am Montag zugestoßen war. Dabei war Tante Fips meine letzte Chance, mit jemandem zu reden, bevor ich fuhr; die letzte Gelegenheit, das, was passiert war, zurücklassen zu können. Hier bei ihr, die mir schon einmal geholfen hatte.
Komisch eigentlich, dass sie gar nicht fragte, wie wir den Angriff erlebt hatten. Ob Papa sie schon angerufen hatte? Aber hätte sie nicht gerade dann gefragt?
Es hätte schon gereicht, sie sagen zu hören: »Du konntest nichts anderes tun.«
»Seit Mamas Tod bin ich nicht mehr geritten«, plauderte ich schließlich einfach los.
»So etwas verlernt man nicht«, meinte Tante Fips. »Das ist nicht anders als schwimmen.«
»Hoffentlich. Und schwimmen werde ich dort sicher auch, Waldeck liegt an einem der Masurischen Seen. Mama hat mir erzählt, dass sie und Antonia oft mit dem Boot rausgefahren sind. Damals war auch Krieg, und eines Tages kamen sie zurück zum Gut, und Antonias Vater war gefallen.«
So viel zu meinem Versuch des leichten Tons. Fußangeln überall, als ob man sich nicht mehr unterhalten konnte, ohne immer neue Schatten herbeizurufen.
Tante Fips fragte zwar rasch, obwohl sie es schon wissen musste: »Ist das die Freundin, die in Hannover im Mädchenpensionat war?«
Und ich plapperte von neuem drauflos, aber weit kamen wir auch diesmal nicht.
»Antonia hat in einer Pension für höhere Töchter gewohnt und ist auf Mamas Schule gegangen. Das war vielleicht eine Sensation, als eine echte Gräfin in die Klasse kam! Aber umso größer war die Enttäuschung, weil Antonias Familie überhaupt nicht reich war. Sie haben alles Geld in ihre Pferdezucht gesteckt und selbst richtig spartanisch gelebt. Im Winter wurde bei denen nur ein einziges Zimmer beheizt.«
»Na, wollen wir mal hoffen, dass das heute anders ist«, meinte Tante Fips.
»Wenn nicht, komme ich eben wieder nach Hause. Vielleicht ist der Krieg sowieso bald zu Ende! Wenn der Führer erst die Wunderwaffe einsetzt …«
»Ach ja, richtig«, murmelte sie. »Die Wunderwaffe. Die kommt ja auch noch.«
»Die kommt bestimmt! Sie heißt V2, so viel weiß man schon.«
»Ich würde gern daran glauben, Lotte. Aber wenn der Führer die Wunderwaffe hat, wird es langsam Zeit, meinst du nicht?«
Plötzlich legte sie alle Vorsicht ab und holte Luft, es platzte geradezu aus ihr heraus.
»Man traut sich gar nicht mehr, die Zeitung aufzuschlagen. Seitenlange Todesanzeigen, eine neben der anderen! Familienväter, junge Burschen. Um uns herum geht alles in Trümmer, wir haben uns die ganze Welt zum Feind gemacht. Da braucht es wirklich eine Wunderwaffe, etwas anderes wird uns nämlich nicht mehr helfen.«
»Aber … Tante Fips!«
»Die Witwe Grossmann hat letzte Woche ihren zweiten Jungen verloren. Herbert, du kennst ihn. Wollte Geiger werden. Hat mir manchmal die Kohlen raufgetragen.«
Ihre Hand, die Tee nachschenken wollte, zitterte so stark, dass der Deckel von der Kanne fiel.
»Die Grossmann hat Gift genommen, konnte gerade noch gerettet werden. Und was denkst du, einen Tag später holt die Gestapo sie direkt aus dem Krankenhaus wegen defätistischer Äußerungen in ihrem Abschiedsbrief!«
Mir klappte der Mund auf. Die Grossmann, ausgerechnet! Die, die bei Paraden die größte Fahne am Fenster hatte, die am lautesten Heil schrie. Die vor Stolz fast geplatzt war über zwei Söhne in Uniform. Wenn Leute wie die Grossmann umkippten, dann wurde es wirklich Zeit für den Einsatz der Wunderwaffe!
Aber irgendwie ahnte ich, dass Tante Fips etwas anderes gemeint hatte und dass sie jetzt nicht mehr anders konnte, als es loszuwerden.
»Die Leute wachen auf. Reichlich spät zwar, aber über kurz oder lang können die da oben uns nur noch bei der Stange halten, indem sie uns drohen. Ihrem eigenen Volk!«
Meine Schultern sanken herab. »Ich darf mir das nicht anhören, Tante Fips.«
»Ich weiß. Am besten gehst du jetzt, Lotte. Ich wünsche dir eine gute Reise.«
Sie sah mich an. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Wenn Krieg herrscht, tritt man keine Reise an, ohne sich zu verabschieden, das war ein ungeschriebenes Gesetz, und ganz gewiss gehörte auch dazu, niemanden, der sich verabschieden wollte, hinauszuwerfen!
Im Flur entschuldigte sie sich noch einmal: »Es tut mir leid. Heute ist nicht mein bester Tag.«
»Schon gut. Pass auf dich auf.«
Aber selbst solche Worte konnte man nicht mehr sagen, ohne dass sie eine andere Bedeutung bekamen. »Natürlich. Draußen halte ich den Mund, ich bin ja nicht blöd«, meinte Tante Fips.
Und im selben Moment, als ich mich zum Gehen wandte, jaulten die Sirenen wieder los.
O nein, alle meine Sachen, mein Notfallkoffer, alles zu Hause, wenn wir ausgebombt werden, besitze ich nichts mehr!
Gefahr hält die Welt an. Was dich eben noch beschäftigt hat, ist dir mit einem Mal egal, du hast es bereits vergessen. Das Herz springt in den Hals, drückt dir jäh die Luft ab, die Gedanken überschlagen sich. Aber deine Füße finden wie von selbst den Weg.
Papapapapapa! Die Lehmann nimmt dich mit, sie hat es versprochen …
Türen knallten, das Trappeln meiner eigenen Schritte verband sich mit dem hastigen, polternden Aufbruch der anderen Hausbewohner. Keine fünf Minuten später verschloss der Luftschutzwart die Kellertür. Wenn der Alarm kam, wusste jeder, was er zu tun hatte: Fenster öffnen, Notfallkoffer greifen, raus aus der Wohnung. Wer jetzt noch nicht im Keller war, kam nicht mehr herein; niemand wusste das besser als ich.
Also doch kein Versehen der Amis … hinterher konnte ich mich nicht erinnern, ob jemand im Keller es laut ausgesprochen hatte, aber eins wusste ich plötzlich genau: Ich will hier raus! Egal wohin, aber so etwas wie vor drei Tagen wollte ich nie wieder erleben.
Und ich weiß auch noch, dass ich zum ersten Mal dachte: Ab morgen kann mir das nicht mehr passieren. In Ostpreußen brauche ich mich nicht zu verkriechen, da ist die Luft klar, die Häuser sind noch ganz. In Ostpreußen werde ich einfach meine Ruhe haben.
2
Das Schlimmste war das Warten. Das bange Horchen, die trockene Kehle, das Zähneklappern – all das hatten wir oft genug geübt. Aber seit Montag kam etwas hinzu, das die Angst jedes Einzelnen in der Stadt noch viel schlimmer machte: unser Wissen. Auch bei Tante Fips war der Luftschutzraum der eigene Keller, und ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, dass ich nur deshalb noch lebte, weil ich beim letzten Angriff eben nicht in einem Kellerraum gesessen hatte.
Tante Fips’ Keller war noch kleiner und muffiger als unserer, die einzige Lichtquelle ein mattes Glühbirnchen, das in der Mitte des Raums von der Decke hing. Gebannt starrte ich darauf und wartete, dass es zu schwanken begann. Die Gesichter der Nachbarn, die sich auf den höchstens acht Quadratmetern drängten, nahm ich nur schemenhaft wahr. Dass ich den einen oder anderen kennen mochte, interessierte mich nicht, es hätten genauso gut Fremde sein können. Man achtete eher darauf, wo sie den Kloeimer aufgestellt hatten.
Dienstag hatte es in der Zeitung gestanden: Die meisten Toten waren in ihren Kellern entdeckt worden. Leute, die nicht mehr herauskamen, denen der Fluchtweg abgeschnitten war, die unter ihren brennenden Häusern jämmerlich verglüht und erstickt waren. Ob sie alle so lange geschrien hatten wie die Menschen unter der Apotheke?
Davon hatte die Zeitung geschwiegen, das musste ich mich seitdem selber fragen, auch wenn ich, sobald die Erinnerung zurückdrängte, verzweifelt versuchte, sofort an andere Dinge zu denken. Auch jetzt war alles plötzlich wieder da, laut und erschreckend nah, als hätte ich auf irgendeinen Eingang zu meinem Kopf nicht aufgepasst.
»Hallo, Lotte.«
Ich zuckte hoch. Georg Schurig, na so was. Ihn hätte ich hier nicht erwartet, obwohl ich wusste, dass er und seine Mutter in Tante Fips’ Hinterhaus wohnten. Die Mutter drückte sich neben ihm an die Kellerwand, als wollte sie darin verschwinden.
Wenigstens einen meiner Klassenkameraden hatte ich hiermit also lebend angetroffen. »Hast wohl Tante Fips besucht?«, fragte er.
Auch das war eine Überraschung: dass er nicht Frau Winter zu Tante Fips sagte. Und dass ich an seiner Stimme hören konnte, dass er lächelte.
Plötzlich musste ich daran denken, wie ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Wie er vor der Klasse stand in seinem langen Mantel und stumm darauf wartete, irgendwohin gesetzt zu werden. Wie alle hofften, dass es sie nicht traf. Jeder wusste, wer sein Vater war, wo sein Vater war, und dass man sich mit so einem besser nicht abgab.
Die Leute, die mit Georg und seiner Mutter Kontakt pflegten, konnte man bis heute an einer Hand abzählen. Ein Finger dieser Hand war Tante Fips, die sich von niemandem etwas vorschreiben ließ, aber damit, dass sie und die Schurigs so vertraut miteinander waren, hatte ich nicht gerechnet. Und erst recht nicht damit, dass Georg mich freundlich und ungezwungen begrüßte, als ob nie etwas zwischen uns gestanden hätte.
»Draußen fliegt ein Papagei«, erzählte er. »Ich hätte ihn fast gehabt, als die Sirene losging. Ich wollte ihn abrichten – auf glitzernde Gegenstände, verstehst du? Er könnte in Häuser fliegen, die die Bewohner nicht mehr betreten können, und ihren Schmuck einsammeln. Den würde ich dann bei den Leuten wieder abgeben, gegen Finderlohn!«
Jungs sind so doof, dachte ich. Aber gleichzeitig fiel mir ein, dass Georg in der Klasse zwar keine Freunde, aber von Anfang an den Eindruck gemacht hatte, als ob ihm unsere Verachtung nichts anhaben konnte. Im ersten Jahr hatten Klaus Wirth, Ingo Lücke und Rolf Zimmer ihn noch ab und zu verhauen, aber bald davon abgelassen, weil es einfach keinen Spaß machte mit jemandem, der nie heulte, nie bettelte, der sich einfach drei gegen einen verprügeln ließ und hinterher wieder aufstand. Wenn die drei weitergemacht hätten, wären womöglich sogar sie es gewesen, die lächerlich ausgesehen hätten.
»Mensch, Lotte, das war doch ein Witz«, sagte Georg und kam zu mir herüber.
Was sollte das jetzt? Gerade eben hatte ich mir zwar selber die Frage beantwortet, warum Georg so ungezwungen mit mir umging – es gehörte wohl ebenso zu seiner defensiven Strategie wie der Verzicht auf aussichtslose Gegenwehr. Aber dass er sich neben mich setzte, fand ich nun doch übertrieben.
Ich rückte ein Stück von ihm weg. Erst dann ging mir auf, dass es nicht so abweisend aussah, wie es gemeint war, sondern eher so, als wollte ich ihm Platz machen.
»Dass ein Papagei draußen herumfliegt, ist aber wahr«, verteidigte er sich.
»Weiß ich, den hab ich auch gesehen. Aber der sah nicht aus, als ließe er sich fangen.«
»Wollen wir wetten?«
Draußen begann die Flak zu knattern, die Flugzeuge mussten jetzt direkt über uns sein. Verzweifelt versuchte ich, mir vorzustellen, wie die Suchscheinwerfer sie einfangen und einen nach dem anderen vom Himmel schießen würden. Marlies, unsere BDM-Führerin, sagte immer: Alles kann wahr werden, wenn man fest genug daran glaubt.
Dann fiel mir ein, dass helllichter Tag war und Scheinwerfer auch nichts nutzten.
»Wollen wir wetten?«, fragte Georg noch einmal, als ob er gänzlich taub wäre für den Krach dort draußen.
Wahrscheinlich wollte er mich ablenken. Ich wünschte, er würde einfach den Mund halten. »Ich wette auf gar nichts mehr«, erklärte ich unfreundlich. »Morgen fahre ich nämlich nach Ostpreußen.«
»Und dein Vater?«
Großartige Ablenkung – an meinen Vater versuchte ich, gerade nicht zu denken! Ob er einfach in der Wohnung geblieben war und sich geweigert hatte, mit der Lehmann in den Keller zu gehen? Ob das vielleicht sogar besser war? Wie oft hatte man wohl das Glück, den passenden Schutzengel, die richtige Eingebung oder was auch immer und blieb verschont?
»Ich nehme an, er bleibt sowieso besser in seiner vertrauten Umgebung«, meinte Georg.
Konnte Tante Fips sich nicht mit ihm unterhalten? Sie saß neben mir und reihte im Halbdunkeln eine Strickmasche an die nächste. Klack, klack, klack, sonst kam von ihr nichts. Was für eine idiotische Idee, in diesen Tagen quer durch die ganze Stadt bis zu ihr zu laufen – hätte es ein Abschiedsbrief nicht auch getan?
Aber das mit der vertrauten Umgebung hatte Papa auch gesagt.
»Er findet sich ja schon ziemlich gut zurecht«, meinte der unbeirrte Georg.
»Aha, und woher weißt du das?«, erwiderte ich spitz.
»Ich habe euch ein paarmal in der Markthalle gesehen.«
Tante Fips wendete ihr Strickzeug und bemerkte: »Lotte und ihr Vater sind am Montag verschüttet worden.«
Mein Hals schnürte sich zusammen. Papa hatte also mit ihr geredet.
»Das tut mir leid. Das muss ja schrecklich sein«, erwiderte Georg.
Glaub mir, das war es. Und glaub mir, ich will nicht darüber reden!
»Was habt ihr gemacht?«, fragte er prompt. »Nur zur Information. Vielleicht kann ich eure Idee ja mal gebrauchen.«
Idee! Du hast vielleicht Nerven.
»Moment mal«, sagte er plötzlich und richtete sich kerzengerade auf. »Ihr wart doch nicht die beiden, die als Einzige aus dem Keller unter der Apotheke herausgekommen sind …?«
Etwas in mir explodierte, ein heißer Ball raste durch meinen Bauch nach oben; drei Tage hatte er dort gesteckt, jetzt zischte er brennend durch Magen, Speiseröhre, Kehle. Instinktiv drückte ich mir die Hand vor den Mund, aber zu spät, mein Mund riss auf, und ich kotzte Georg direkt vor die Füße.
Viel kam zum Glück nicht – zwei Kekse und ein bisschen Tee, sonst hatte ich seit dem Morgen nichts gegessen. Jemand schimpfte trotzdem, war ja klar, die Nerven lagen blank da unten in den Kellern. Durch Tränenschleier erkannte ich, dass Georgs Mutter aufstand und etwas zum Saubermachen holte.
»… nur gehört, dass es jemand aus unserer Schule war, tut mir leid, wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass ihr das wart …«
Georg konnte nicht aufhören, sich zu entschuldigen. Das machte es nur noch peinlicher, weil nun alle, wirklich alle gafften. Rasch nahm ich Frau Schurig den Lappen aus der Hand. Nicht nur um das Malheur selbst zu beseitigen, sondern um wenigstens mein Gesicht abwenden zu können, während Tante Fips den Rest der Geschichte erzählte.
Sie tat es nicht. Obwohl natürlich gleich jemand nachfragte: »Wie habt ihr das geschafft? Gibt es irgendetwas, das wir hier wissen sollten?«
Frau Schurig erklärte: »Wenn das Haus über uns einstürzt, kommen wir nur noch raus, wenn wir ein Loch in die Wand zum Nachbarkeller schlagen. Das ist bekannt.«
Und der Luftschutzwart beschwichtigte: »So ist es, meine Herrschaften. Der Hammer liegt schon bereit, bleiben Sie ganz ruhig.«
»Aber vielleicht«, meinte eine andere Frau, »sollten wir vorsichtshalber jetzt schon ein Loch schlagen? Das kann doch nicht schaden.«
»Ja, genau, warum eigentlich nicht?«
Im Hintergrund der Lampe konnte ich ihre Gesichter kaum erkennen, aber ich sah, wie Bewegung in die bis eben noch stummen Gestalten kam.
»Fangen Sie einfach schon mal an, Herr Dücker!«
»Aber meine Herrschaften, noch ist es doch bloß Alarm …«
»Na los. Das ist Ihre Aufgabe! Der Junge kann mithelfen.«
Mehrere standen jetzt. Dabei hatte der Luftschutzwart recht: Draußen hörte man nur Sirenen und Flakfeuer, als ob die Männer an den Geschützen demonstrieren wollten, wie viel Munition sie hatten. Ganz von ferne etwas wie ein Dröhnen, das vielleicht von feindlichen Fliegern kam, vielleicht aber auch nur das ängstliche Rauschen der eigenen Ohren war.
Eindeutig feindlich knisterte es bloß im Keller. »Ich verstehe nicht, wie Sie sich weigern können!«, empörte sich ein alter Herr. »Na schön, dann geben Sie eben mir den Hammer!«
»Herr Dücker! Wollen Sie einen Siebzigjährigen Ihre Arbeit machen lassen?«
Der Luftschutzwart bückte sich unter seinen Sitz; als er sich erhob, hielt er einen Hammer in der Hand. Er merkte wohl, dass jeder andere Entschluss eine Meuterei ausgelöst hätte.
»Na, dann lassen Sie mich mal durch, Herr Schmitz.«
Bänke wurden gerückt, Schatten huschten durchs Licht, und im nächsten Moment hörten wir den Hammer mit einem harten Plong! gegen die Wand zum Nachbarhaus krachen. Beim dritten Schlag rieselte es bereits, die Steine lockerten sich, und den vierten Schlag musste der Luftschutzwart schon nicht mehr allein tun – er kam aus dem Nebenkeller.
Applaus brach aus. Wenn die Nachbarn mitmachten, konnte es nicht lange dauern! Auch ich war so erleichtert, dass ich mich wieder neben Georg setzte, und wir gemeinsam zusahen, wie der erste Stein zu Boden plumpste, und ein schmaler Streifen Licht vom Nachbarkeller zu uns hineinfiel. Gleich darauf rief auch schon jemand von der anderen Seite: »Haltet durch, Freunde, gleich gibt’s ein Schnäpschen.«
Auf beiden Seiten explodierte Gelächter. Wie eine Druckwelle brach es hervor, die alle erfasste, auch mich, obwohl das Schlagen eines Lochs nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hatte, warum Papa und ich mit dem Leben davongekommen waren.
»Wenn du willst, kann ich bei deinem Vater vorbeischauen, während du weg bist«, bot Georg an.
Sein Arm war dicht an meinem und strahlte Wärme aus, eigentlich ganz angenehm, wenn man ohne Jacke in einem fremden, kühlen Keller strandete. Ich brachte es immer noch nicht fertig, zu ihm hinüberzusehen, aber plötzlich ahnte ich, wo die dicke braune Haarsträhne sitzen musste, die ihm immer ins Gesicht hing, und erinnerte mich an seine auffallend blauen Augen. Ich war peinlich berührt, dass ich daran denken musste, und hoffte, dass er mich bei diesem Licht nicht beobachten konnte.
Moment – hatte er gerade irgendetwas gefragt?
»Keine Sorge, du stehst dann nicht in meiner Schuld. Lange wirst du bestimmt nicht weg sein, und vielleicht braucht er ja gar keine Hilfe. Aber mich an deiner Stelle würde es beruhigen.«
»Gute Idee, Georg«, antwortete Tante Fips für mich. »Am besten bringst du Lotte nach Hause, sobald wir Entwarnung bekommen, und machst dich mit Herrn Harms bekannt.«
Augenblick mal!, hätte ich jetzt sagen müssen, es irgendwie auch sagen wollen; keine Ahnung, warum ich die Worte verschluckte.
»Na, Schaden wird er wohl nicht anrichten«, wandte ich mich stattdessen mit falschem Lachen an Tante Fips.
Ich hatte erwartet, dass Georg auf meinen ironischen Ton entsprechend antworten würde, aber er sagte nichts, und nun fiel auch mir auf, dass dies genau die Art von Herablassung war, die er von unserer Klasse gewohnt war. Was mir von neuem die Sprache verschlug, weil ich es nicht nur nicht böse gemeint, sondern mehrere Minuten lang beinahe vergessen hätte, was mit Georg war.
»Übrigens«, hörte ich mich plötzlich sagen, »sind wir nicht als Einzige aus dem Keller unter der Apotheke herausgekommen. Wir waren nämlich gar nicht drin, weil wir zu spät kamen, und die anderen uns nicht mehr eingelassen hatten. Wir saßen auf der anderen Seite der Kellertür, als das Haus einstürzte, und konnten uns beinahe selbst ausbuddeln.«
Wie einfach es klang. Drei Sätze nur, und die Geschichte, die mich in meinen Träumen verfolgte, war erzählt. In groben Zügen wenigstens. Den Mittelteil ließ ich aus; darüber mit einem Quasifremden zu sprechen konnte nun wirklich niemand von mir verlangen.
Georg fragte nicht weiter; vielleicht hatte er verstanden, dass ich ihm nur davon erzählt hatte, um etwas wiedergutzumachen. Wie lange war er schon in meiner Klasse – seit drei Jahren? Noch nie hatte ich mit ihm geredet, war ihm aus dem Weg gegangen wie alle anderen. Ich wusste selbst nicht, warum ich mich plötzlich dafür schämte.
Zwischen den beiden Kellern purzelten die Mauersteine, und kurz darauf schob sich in Maulwurfmanier ein Oberkörper hindurch. Hände wurden geschüttelt, vergnügte Rufe flogen hin und her: »Wo bleibt der Schnaps?« – »Was gibt’s denn bei euch?« – »Wollt ihr ein paar verschrumpelte Kartoffeln?«
»Komisch eigentlich«, sagte Georg plötzlich. »Mit irgendwelchen fremden Menschen im Keller zu verrecken oder zu überleben. Und sich am nächsten Tag auf der Straße vielleicht nicht einmal wiederzuerkennen.«
Wärme schoss mir in die Wangen, war dies doch genau die Frage, die ich mir in den letzten Tagen selbst oft gestellt hatte. Kenne ich einen von euch? War jemand dabei? Und: Erkennt mich irgendjemand …?
Kurz darauf verstummte erst die Flak, dann die Sirene, und auch in den beiden Kellern wurde es schlagartig still, während jeder von uns mit nach oben gerichtetem Blick lauschte. Der Luftschutzwart stand auf, um zur Kontrolle ein kleines, mit Verdunkelungspappe abgedecktes Fenster zu öffnen, das auf den Lichtschacht hinausführte. Und mit grenzenloser Erleichterung, die sich in einem einzigen gemeinsamen Ausatmen Luft machte, erkannten wir, dass kein Dröhnen feindlicher Flugzeuge zu hören war. Wenn überhaupt welche da gewesen waren, würden ihre Bomben an diesem Nachmittag andere treffen.
Ein Lichtstreifen fiel von oben in den Keller. Komisch, dass einem die Zeit dort unten immer so lang vorkam, dass ich am Ende eines Tagalarms jedes Mal dachte, es müsste inzwischen dunkel sein.
Draußen war keine neue Zerstörung zu erkennen. Man überzeugte sich ganz automatisch davon, mit raschen prüfenden Blicken, obwohl man doch wusste, dass gar keine Bomben gefallen waren. Auch die Stadt hatte diesmal Glück gehabt.
»Sieh mal, da ist er ja!«, rief Georg.
Wir waren seit dem Aufbruch von Tante Fips schweigend nebeneinanderher gegangen, fünf oder zehn Minuten vielleicht, die sich in die Länge zogen. Wahrscheinlich bedauerte Georg längst, mir die Begleitung nach Hause angeboten zu haben. Oder hatte er gar nicht …? War es nicht in Wirklichkeit Tante Fips’ Idee gewesen?
Doch zu sagen: »Ab hier schaffe ich es alleine«, brachte ich nicht fertig. Dass es meinem Ansehen schaden konnte, wenn Klassenkameraden mich an der Seite von Georg Schurig durch die Stadt spazieren sahen, war mir zwar kurz durch den Kopf gegangen – aber geschenkt! Erstens konnte es mir von morgen an sowieso egal sein. Zweitens hatte ich, als wir an einem Schaufenster vorbeikamen, bemerkt, dass wir ziemlich gut miteinander aussahen. (Ehrlich gesagt, hatte ich es nicht ganz zufällig bemerkt, da ich bereits eine solche Vermutung gehegt und nur aus diesem Grund überhaupt in das Schaufenster geguckt hatte.) Worauf mir, drittens, die brauchbare Ausrede eingefallen war, dass es in jeder anderen Stadt völlig selbstverständlich gewesen wäre, neben Georg Schurig zu gehen, dass also in Wahrheit die Stadt das Problem war und nicht Georg.
Ein gescheiter Gesprächseinstieg fiel mir trotzdem nicht ein. Selten in meinem Leben war jemand in einem passenderen Moment aufgetaucht als der Papagei.
»Er ist zu hoch oben«, erklärte ich. »Den kriegst du nicht.«
»Man müsste ein paar Nüsse oder Grünzeug haben, um ihn zu locken! Wenn er seit Montag unterwegs ist, müsste er doch Hunger haben.«
»Nein, sieh doch, er fliegt in offene Wohnungen! Da steht bestimmt noch viel auf den Tischen herum, weil die Leute einfach rausgerannt sind.«
»Stimmt. Wahrscheinlich findet der da oben gerade mehr zu fressen als wir.«
Nicht ohne Neid blickten wir zu dem Vogel auf. Die Häuserfront direkt vor uns war eingestürzt, und man konnte geradewegs in ehemalige Küchen blicken, deren Vorratsschränke vielleicht noch manches hergaben. In Schlafzimmer, wo geblümtes Bettzeug zu einem Nickerchen einlud, in Kinderzimmer mit wahrscheinlich heißgeliebtem Spielzeug. Papageien auf kostbare, verlorene Gegenstände abzurichten erschien, wenn man vor einem solchen Haus stand, mit einem Mal gar keine so schlechte Idee.
»Du brauchst mich nicht nach Hause zu bringen«, sagte ich nun doch. »Ich will nicht schuld sein, wenn du deinen Goldvogel verpasst. Das ist vielleicht die letzte Chance, und ich muss jetzt wirklich schleunigst packen.«
»Nein, nein, ich kann dich schon bringen«, erwiderte Georg, aber sein Blick war auf den Papagei gerichtet, und er schien nicht einmal zu merken, dass ich schon einige Schritte ohne ihn gegangen war.
Ich blieb wieder stehen. Kam einen Schritt zurück. »Ich sage meinem Vater, dass du vielleicht mal vorbeikommst. Weißt du denn überhaupt, wo wir wohnen?«
»Ja, weiß ich«, antwortete er geistesabwesend, und ich verbiss mir die Frage: Woher …?
Stattdessen versuchte ich es anders. »Georg«, sagte ich, und es fühlte sich seltsam an, seinen Namen auszusprechen, »Georg, du kannst nicht in das Haus. Es ist zu gefährlich.«
»Aber wenn er in eins der Zimmer fliegen würde, die auf den Hof hinausgehen … Alles, was hinten liegt, sieht doch noch ganz stabil aus.«
Von irgendwo schlug eine Kirchturmuhr, ich zählte automatisch die Schläge mit und dachte: Papa muss inzwischen verrückt werden vor Angst. Trotzdem dauerte es mindestens eine weitere Minute, bis ich endlich sagte: »Na dann tschüs und viel Erfolg.«
Dabei bohrte ich ihm die Augen geradezu in die Seite. Jetzt musste er doch mal zu mir hinüberschauen! Wenigstens ganz kurz!
Als er mich anlächelte, kam es dennoch so unerwartet, dass mir die Röte in die Wangen schoss. »Gute Reise. Viel Glück in Ostpreußen!«
Das war alles. Schon hatte er wieder den Papagei im Visier.
Idiotin!, schalt ich mich selbst. Aber zu spät, jetzt konnte ich nicht mehr anders, als davongehen, und als ich mich an der nächsten Ecke noch einmal umblickte, um vielleicht zu winken (falls er rein zufällig gerade guckte), war Georg nicht mehr zu sehen.
Ob er wirklich in die Ruine eingestiegen war? Mich hatte er bereits vergessen, so viel war klar. Aber wenn ich noch ein Weilchen geblieben wäre, wenn ich ihm geholfen hätte, den Vogel zu fangen, und wenn, ja wenn ich morgen nicht nach Ostpreußen fahren müsste, dann hätten wir uns jetzt vielleicht angefreundet.
Ein gänzlich unbekanntes, trauriges kleines Gefühl nistete sich in mir ein, während ich mich zusammenriss und weiterging. Als wäre ich gerade eben an einer völlig falschen Stelle abgebogen und würde nicht einmal mehr erfahren, was ich eigentlich verpasst hatte.
3
Papa saß auf dem Bett und blickte in meine Richtung. Durchs geöffnete Fenster fiel ein Sonnenstrahl in sein Gesicht. Jeder andere hätte jetzt blinzeln müssen, Papa aber nicht. Wie es von morgen an ohne mich hier weitergehen sollte, war mir ein Rätsel.
Draußen hing Abendsonne über den Dächern, und ich packte unser Leben in drei mal zwei Kisten. Seit gestern standen diese im Elternschlafzimmer, und erst als ich sie gesehen hatte, hatte ich endgültig begriffen, dass es meinem Vater ernst war.
Weder Papa noch ich hatten Mamas Sachen bisher angerührt. Einige Male hatte ich die Tür des Kleiderschranks geöffnet, Mamas Duft eingeatmet und versucht, mich zu erinnern. Aber ich hatte es nie lange ausgehalten. Jetzt stand die Schranktür offen, und ihre Kleider hingen im letzten, von Staubfäden durchzogenen Sonnenlicht. Sie sahen seltsam aus, schlaff und grau, als ob, wenn man starb, auch die Farben und Formen der eigenen Kleider verblassten. Sie mit meiner fröhlichen Mutter in Verbindung zu bringen war unmöglich und ihre Sachen herauszunehmen weit weniger schlimm, als ich erwartet hatte.
Vielleicht auch deshalb, weil ich anderes im Kopf hatte und nicht die feierliche Stimmung aufbringen konnte, die dieser gemeinsamen Aktion angemessen gewesen wäre. Ostpreußen! Was in aller Welt sollte ich da? Mein Platz war hier, jetzt erst recht; ich wäre am liebsten auf der Stelle aus der Wohnung gerannt und zurück zu der Ruine gelaufen, an der ich Georg zuletzt gesehen hatte. Was, wenn ihm etwas zugestoßen war, während er darin herumkletterte? Ich war vielleicht die Einzige, die wusste, dass er überhaupt dort eingestiegen war.
Wahllos zog ich das erste Kleidungsstück vom Bügel und stopfte es in Mamas Kiste. Wir wollten zum Packen den Rest des Tageslichts ausnutzen, um Strom zu sparen.
Papa war weniger in Sorge als ungehalten gewesen, dass ich so spät von Tante Fips zurückgekehrt war. Den Fliegeralarm hatte er zwar selbst erlebt – in der Wohnung, wie ich es mir schon gedacht hatte –, aber das ließ er als Entschuldigung nicht gelten: Ich hätte, meinte er, einfach nicht gehen dürfen, ohne vorher alles Wichtige erledigt zu haben.
Für ein Zeichen der Erleichterung, dass uns beiden nichts passiert war, obwohl wir heute zum ersten Mal getrennt voneinander in Gefahr geraten waren, hatte er sich keine Zeit genommen, und ich merkte, wie Ärger und Enttäuschung mir von neuem in den Bauch krochen. Seit zweieinhalb Jahren kreisten meine Gedanken darum, wie es ihm ging; ich nahm Rücksicht auf gute und schlechte Tage und war ständig damit beschäftigt, zu erspüren, wie er sich fühlte. Und wenn es ein Mal, ein Mal! um mich ging, war das offenbar schon zu viel!
Mama konnte nichts dafür, aber das nächste ihrer Kleider riss ich geradezu vom Bügel. Dass ich zurück zu der Ruine und nachsehen musste, ob alles in Ordnung war, wusste ich mit einem Mal so sicher, dass ich für meine Mutter gar kein Gefühl mehr übrig hatte.
Nicht einmal schlechtes Gewissen. Ja, natürlich hätten wir uns ihre Sachen früher vornehmen sollen, als Zeit genug gewesen wäre, jedes einzelne Stück mit einer Erinnerung zu verknüpfen. Aber sollte es unter Zeitdruck nicht um die Lebenden gehen?
»Was hast du in der Hand?«, fragt Papa.
»Das braune Kostüm.«
»Dazu gehört die hellblaue Bluse. Vielleicht legst du beides zusammen.«
Auch das noch. Die Bügel klapperten wie verrückt, als ich ärgerlich nach einer hellblauen Bluse suchte und sie nicht gleich fand, weil eine andere darüberhing.
»Papa, bitte!« Endlich machte ich mir Luft. »Ich kann doch hierbleiben. Was soll ich in Ostpreußen?«
Aber er ging nicht auf mein Betteln ein. »Was kommt als Nächstes?«
»Das grüne Kleid mit den Knöpfen.«
»Ah, das ist alt. Das hat sie schon in der Tanzstunde getragen.«
Plötzlich gab es mir fast den Rest, Papa mit gefalteten Händen auf dem Bett sitzen zu sehen, den Blick auf mich, aber alle Aufmerksamkeit auf diese blöden Klamotten gerichtet.
»Wenn ich gehe, verliere ich vielleicht einen Freund, Papa.«
Jetzt war es heraus. Ich ließ das grüne Kleid sinken. Sehen konnte er mich nicht, aber musste er nicht wenigstens spüren, wie ernst es mir war? Blinde spüren mehr, hieß es doch immer.
»Wenn du nicht gehst, verlierst du vielleicht dein Leben«, sagte er ungerührt.
Er fragte nicht einmal, welchen Freund ich meinte, dabei hatte ich mit einem Mal den fast überwältigenden Wunsch, mit jemandem über Georg zu sprechen. Und sei es nur darüber, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte.
»Was hast du jetzt?«
»Eine gelbkarierte Bluse.«
Unsere Wohnung lag im zweiten Stock, das war günstig. Als meine Eltern vor mehr als fünfzehn Jahren eingezogen waren, hatten sie gewiss nicht daran gedacht, aber je tiefer die Wohnung gelegen war, desto mehr Zeit hatte man, seinen Hausrat zu retten, wenn Bomben den Dachstuhl in Brand setzten. Papa hatte sich überlegt, dass ich unsere wichtigsten Sachen in je zwei Kisten packen sollte, die man leichter bergen konnte, sollten wir – oder vielmehr er – ausgebombt werden. Er wollte die Nachbarn, die dann mit der Suche nach ihren eigenen Dingen beschäftigt sein würden, nicht über Gebühr in Anspruch nehmen.
Mit seinen Sachen hatten wir angefangen. Ich hatte ihm die Teile zugerufen, er mit »Nein« oder »Kiste« geantwortet, und da er sich alles schon gut überlegt hatte, waren wir erfreulich schnell fertig gewesen.
Bei mir hatte es kaum länger gedauert, Bücher, Stofftiere und Fotoalben zu verstauen, und auch mein Koffer für die Reise war schnell gepackt gewesen. Viele Kleidungsstücke besaß ich nämlich nicht; wir waren im vierten Kriegsjahr, und es gab kaum noch Kleidung zu kaufen. Früher hatte Mama Stoff an Blusen und Röcke angenäht, aus denen ich herausgewachsen war. Jetzt, wo ich nicht mehr wuchs, trug ich meine Sachen auf, bis sie buchstäblich auseinanderfielen, und das Schwierigste war gewesen, meine zerschlissenen Klamotten so vorsichtig in den Koffer zu falten, dass sie überhaupt eine Chance hatten, unversehrt in Waldeck anzukommen.
Ganz zum Schluss war nun Mamas umfangreiche Garderobe an der Reihe, und mein Vater wollte offenbar, dass jedes einzelne Stück in die Kisten kam, um gerettet zu werden.
»Die zweite Kiste ist auch gleich voll, Papa.«
»Dann nimmst du aus meinen Kisten eben etwas heraus.«
Ich schloss für einen Moment die Augen und erlaubte mir, ein paar widerstreitende Gefühle zu ordnen: Wut, Enttäuschung, Ungeduld. Den Wunsch, nicht zu streiten, der bei mir meist die Oberhand gewann. Aber heute war es anders, heute dachte ich ernsthaft darüber nach, Papa das grüne Kleid an den Kopf zu werfen und einfach aus der Wohnung zu laufen.
»Zum Teufel, Lotte, das hier ist wichtig!«
Also hatte er doch etwas gemerkt. Aber ganz bestimmt würde ich seine Kisten jetzt nicht wieder auspacken!
Damals, am Tag bevor er aus dem Krankenhaus kam, hatte ich mir die Augen verbunden und fest vorgehabt, es einen ganzen Nachmittag durchzuhalten. In unserer Wohnung, die ich wie meine Westentasche zu kennen glaubte, stieß ich gegen Möbel und prallte gegen Türrahmen; binnen Sekunden hatte ich nicht einmal mehr gewusst, wo ich war. Ich war stehen geblieben, die Arme ausgestreckt, und anstatt mich zu orientieren, war der ganze Schrecken dessen, was Papa zugestoßen war, mir tief in die Glieder gefahren.
Ich Glückliche konnte jederzeit die Binde von den Augen reißen und nachsehen, wo ich war. Aber mein Vater konnte das nicht, er würde für immer in völliger Dunkelheit leben, und einige Momente lang gespürt zu haben, wie das für ihn sein musste, konnte ich nie wieder vergessen. Ich war seitdem der Chef – verantwortlich dafür, dass zu Hause überhaupt funktionierte. Ich führte Papa durch die Stadt, las ihm aus der Zeitung vor, »mein Augenlicht« nannte er mich, und es war mehr als ein Kosename.
Doch an diesem Abend ging mir plötzlich auf, dass ich mich getäuscht hatte. Ich, der Chef? Obwohl wir ständig zusammen waren, ging es immer um ihn, und auf einmal fielen mir auch die Worte wieder ein, mit denen er meine Reise wirklich begründet und die ich meinen Freundinnen gegenüber falsch wiedergegeben hatte, weil ich sie erst jetzt verstand.
Papas Worte waren nicht gewesen: »Ich kann dich nicht beschützen«, er hatte mir das Gegenteil erklärt: »Wir können einander nicht beschützen. Du mich nicht, ich dich nicht. Vielleicht kommen wir besser klar, wenn jeder nur auf sich selber aufpassen muss.«
Nun, damit konnte er recht haben! Es wurde Zeit, dass ich anfing, für mich selbst zu sorgen.
»Deine Kisten packe ich nicht wieder aus, Papa, aber ich könnte ein paar von Mamas Sachen mit nach Waldeck nehmen. Die Bluse würde mir passen.«
Dass noch keiner von uns auf den Gedanken gekommen war …! Die beiden Pullover und die Strickjacke konnte ich auch gebrauchen, und für den Winter den langen warmen Mantel, der ganz unten in der Kiste lag. Schlafanzüge gab es gleich vier, auch die Unterwäsche sah noch brauchbar aus. Und da … waren das etwa Seidenstrümpfe?
Papa sagte nichts.
»Ich nehme wenigstens den Mantel mit. Meiner taugt nichts mehr. Mama hätte nicht gewollt, dass ich friere, wenn ich im Winter noch dort bin.«
»Gut«, sagte er, »den Mantel kannst du haben.«
Das traf mich mehr, als wenn er generell nein gesagt hätte. War ich in seinen Augen nicht wert, alle Kleider meiner Mutter zu tragen? In der Kiste würden sie vergammeln, da nutzten sie niemandem etwas.
Und plötzlich sah ich mich etwas tun, das ich nie von mir erwartet hätte. Ich sagte »Danke«, dann nahm ich die Bluse, die beiden Pullover und die Strickjacke und legte sie in meinen Koffer, bevor der Mantel obenauf kam.
Uff. Einen Blinden zu betrügen war kein gutes Gefühl, auch wenn ich im Recht war, für mich selber sorgen sollte und die Sachen mir zustanden, irgendwie.
»Mama hätte es gewollt«, rechtfertigte ich mich noch einmal.
Damit hatte ich mich verraten. »Hast du noch etwas genommen?«
Eine kleine Pause entstand, dann sagte ich ja, und er meinte: »In Ordnung.«
»Da sind noch Schlafanzüge …«
Mein Herz klopfte. Papa sagte: »Nimm dir, was du brauchst«, und die nächsten Minuten hörte man nichts außer dem – nun ganz leisen – Klappern der Kleiderbügel. Mamas Sachen waren viel besser erhalten als meine eigenen, die nun größtenteils und ohne Bedauern wieder aus dem Koffer flogen. Ich probierte die Hosen, Röcke und ein, zwei Kleider, drehte mich vor dem Spiegel und versuchte, nicht zu Papa hinüberzuschauen.
»Das kann ja dauern. Deine Mutter hat gern eingekauft«, erinnerte er sich, und als ich doch schaute, lächelte er. »Was hast du gerade an?«
»Das Kleid aus der Tanzstunde. Die meisten Sachen sind ein bisschen zu weit.«
»Wart’s ab, die wirst du schon noch ausfüllen«, meinte Papa.
»Macht es dir wirklich nichts aus?«
»Im Gegenteil. Schade, dass ich nie sehen werde, wie du darin tanzt. Aber ich werde es mir gern vorstellen, und dazu …«
Er stand auf und streckte mir die Arme entgegen.
Papa und ich teilten eine große Schwäche: Es war schwer für uns, über unsere Gefühle zu reden. Mama war anders gewesen, aber ich kam ganz nach meinem Vater, und als er mich für einige wenige Schritte in den Arm nahm, spürten wir beide, dass das unser Abschied war, und dass dieser kleine Tanz all die vielen Worte ersetzen musste, die andere sich morgen am Bahnsteig sagen würden.
Die Straßen waren dunkel, die Laternen seit langem ausgeschaltet, um dem Feind keine Orientierung zu bieten. Nur hier und da blinzelte hinter Verdunkelungspappen ein schmaler Streifen Licht aus einer Wohnung hervor.
Dennoch waren erstaunlich viele Menschen unterwegs. Noch nie war mir das aufgefallen, da ich um diese Zeit immer längst zu Hause gewesen war – Papa vorlesend, vor dem Radio oder im Winter dick eingemummelt mit einem Buch im Bett. Abends unterwegs zu sein war nicht ohne Risiko, da man woanders als zu Hause von einem Fliegeralarm erwischt werden konnte, und was dann passierte, hatten wir ja am Montag erlebt.
Massenpanik. Das war, neben verschüttet
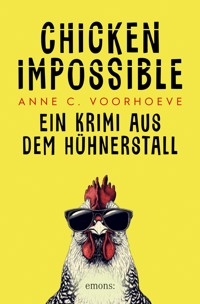














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













