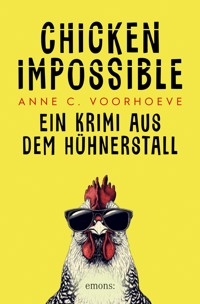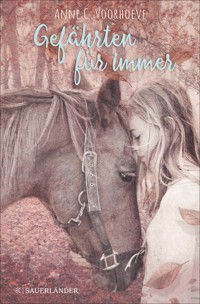2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kascha kann ihre Probleme kaum an einer Hand abzählen. Fast jeder im Dorf lehnt ihre Sinti-Familie ab. Ihre große Schwester will durchbrennen, ihr Großvater wird nicht mehr lange leben, und ein Mord ist nach vielen Jahren noch immer ungeklärt. Manchmal spukt es in Kaschas Kopf, als könne sie in die Zukunft sehen, aber zu nutzen scheint ihr das nichts. Doch dann kommt der "Große Schnee" und wirbelt alles durcheinander. Eine Katastrophe bricht über Norddeutschland herein, schneidet Mensch und Tier von der Außenwelt ab und zwingt Kascha zu einer nervenaufreibenden Notgemeinschaft ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anne C. Voorhoeve
Kascha und der große Schnee
© 2018 Anne C. Voorhoeve
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel „Kascha Nord-Nordost“ im Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH.
ISBN
Paperback:
978-3-7469-9315-7
Hardcover:
978-3-7469-9316-4
e-Book:
978-3-7469-9317-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1
Nie mehr. Zwei kleine Worte können über dich hereinbrechen wie ein einstürzendes Dach, und genau so ging es mir, als meine Schwester die Küche betrat. Dabei wusste ich im Tiefsten meines Herzens längst Bescheid, hatte ich Zippi doch seit Wochen im Auge behalten und Zwei und Zwei zusammengezählt. Wobei man in diesem Fall, wenn ich ehrlich sein soll, nicht gerade Inspektor Columbo sein musste.
„Groschen bitte alle aufheben fürs Telefonhäuschen!“ (Wir hatten seit über einem Jahr ein eigenes Telefon.)
„Ich habe ein paar Klamotten aussortiert. Schau mal in den Karton, Kascha!“ (Dass ich Zippis Sachen auftrug, war normal, aber noch nie hatte sie sich von so vielen Kleidungsstücken auf einmal getrennt. Selbst Bücher und angebrochene Kosmetik waren in dem Karton.)
„Träumst du nicht manchmal davon, dass du das Zimmer für dich hast?“ (Nein, davon hatte ich nie geträumt, was Zippi genau wusste, also konnte die Frage in Wahrheit nur eins bedeuten: Mach dich schon mal darauf gefasst, dass bald keiner mehr zum Quatschen da ist.)
Unser Dorf Groß-Mooren ist nicht sehr geeignet, um unbemerkt hinter jemandem herzuschleichen. Das Land hier oben ist platt wie eine Seite im Atlas; wenn du dich auf unsere Mauer stellst, kannst du an klaren Tagen zwischen Scheune und Wohnhaus des linken Nachbarhofs hindurch bis zu einem dunklen Streifen am Horizont gucken. Dieser Streifen ist der Deich und liegt genau 1,7 Kilometer von unserem Hof entfernt. Hinter dem Deich liegt der Strand. Wenn der Deich bricht, was schon vorgekommen ist, liegst du also entweder in der Ostsee oder auf dem Dach, bis der Hubschrauber kommt.
Zugegeben: Der Deich hatte, seit wir in Groß-Mooren wohnten, gehalten. Es war unser dritter Winter an der Küste und ich wartete vergebens darauf, dass etwas Ungewöhnliches passierte. Ich habe die Landschaft auch nur erwähnt, um zu erklären, warum man in Groß-Mooren nicht unbemerkt hinter seiner Schwester herschleichen kann. Wenn du es dennoch tust und sie nicht stehen bleibt, um zu rufen: He, Kascha, was tust du da hinter dem nicht mehr als fünfzehn Zentimeter breiten Lichtmast…?, dann weiß sie genau, dass du da bist, und will dich bloß nicht blamieren. (Was nicht heißt, dass man sich weniger albern vorkommt.)
Zippi machte sich erst nach dem Abendessen auf den Weg ins Dorf, woraus ich ableitete, dass ihr Freund Arbeit hatte, denn Zippi hätte ihn ja sonst schon am Nachmittag aus dem Telefonhäuschen vor der Fabrik anrufen können. Ich nahm nicht an, dass sie sich erst einmal schön machen und den Fischgeruch abduschen wollte, wovon der Unbekannte am Telefon schließlich nichts gehabt hätte.
In sicherem Abstand huschte ich am Rande der Landstraße hinter Zippi her. Die Fenster der Nachbarhöfe tupften Licht in den dunklen Winterabend. Vier Höfe liegen auf dem Weg ins Dorf, die aussehen wie unserer und auch genau gleich groß sind, und von jedem Hof führen dieselben schnurgeraden Einfahrten zur Straße. In den Einfahrten stehen die schon erwähnten Lichtmasten und der jeweilige Briefkasten, und außerdem lebt auf jedem Hof ein Hund.
Inferno! In Groß-Mooren haben alle Hunde einen Knall, weil sie an Ketten vor ihren Hütten angebunden sind. Unser Muggele geht, wenn jemand in der Einfahrt auftaucht, erst mal nachsehen, ob er Freund oder Feind zu melden hat. Die Groß-Moorer Hunde hingegen haben gar keine andere Wahl, als bei jeder Bewegung auf der Straße komplett durchzudrehen. Es ist ihre einzige Freiheit, von der sie ausgiebig Gebrauch machen. Kaum fängt einer an, machen die anderen mit. Erzähl mir einer was über die Ruhe auf dem Lande!
Der Ortsvorsteher war wegen Muggele schon mehrmals bei uns. Unternommen haben sie aber noch nichts.
Nicht einmal die Hunde brachten Zippi dazu, sich umzudrehen, was ich ziemlich leichtsinnig fand – statt meiner hätte schließlich auch ein gesuchter Straftäter hinter ihr her sein können! Meine Schwester ist sehr hübsch, und wann immer die Lichter eines Autos auftauchten, bildete ich mir ein, dass ich sie in Wirklichkeit nicht bespitzelte, sondern beschützte. Aber die Fahrer bremsten nur leicht ab, wenn sie erst Zippi, dann mich am linken Straßenrand sahen, gingen kurz vom Gas und fuhren weiter.
Groß-Mooren hängt wie an einer Schnur links und rechts der Landstraße, die zwischen den beiden Ortsschildern Dorfstraße heißt und sich rühmen kann, damit auch schon die einzige Straße in Groß-Mooren zu sein. In zweiter Reihe liegen weitere Häuser, die man durch Einfahrten zwischen den Häusern der ersten Reihe erreicht; genau in der Mitte des Dorfes befinden sich ein winziger Supermarkt, die Kneipe „Zum Walfisch“, ein Kiosk und ein Telefonhäuschen. Du guckst in Groß-Mooren ein einziges Mal auf und ab und kennst dich bereits aus. (Schule, Kirche, Apotheke und Post brauchst du gar nicht erst zu suchen, die liegen acht Kilometer weiter in Gelting.)
Das gelbe Telefonhäuschen auf dem Bürgersteig war schwach beleuchtet und ich sah Zippi den Hörer abnehmen, Münzen einwerfen und sich mit dem Rücken zu mir an die zerkratzte, mit Handabdrücken bedeckte Seitenwand lehnen. Von meinem Platz hinter der Hecke von Hausnummer 17 starrte ich so intensiv hinüber, dass ich den typischen Telefonhäuschengeruch geradezu in der Nase hatte: jene besondere Mischung aus kaltem Zigarettenrauch, fremdem Körpermief und vergammeltem Metall. Oft liegen leere Flaschen herum, du klebst mit der Sohle in einer Bier- oder Fantapfütze oder musst als besonderen Höhepunkt den Münzeinwurf erst mal von Kaugummi befreien. War ich froh, dass wir endlich ein eigenes Telefon hatten!
Aber Zippi war das alles egal; nach wenigen Sekunden durchlief ein kleiner fröhlicher Ruck ihren Körper – und ich zerbrach mir vergebens den Kopf, wer jetzt wohl am anderen Ende der Leitung hing.
Dabei hätte es so einfach sein können. Wo das Schicksal die beiden ereilt hatte, war nämlich nicht schwer zu erraten. Im vergangenen Sommer waren wir wegen der Krankheit meines Puro* nur auf einem einzigen Sippentreffen gewesen, der Wallfahrt in Frankreich. Zu meinem Verdruss konnte ich mich jedoch nicht erinnern, zu welchem Jungen Zippi auffallend freundlich gewesen war, mit wem sie besonders häufig gesprochen oder neben wem sie bevorzugt gesessen hatte. Mit Sicherheit hatte es jemanden gegeben, aber ich war leider voll und ganz damit beschäftigt gewesen, Donny Leverenz aus dem Weg zu gehen (Stichwort: hoffnungslose erste Liebe) und mit gleichaltrigen Mädchen und Jungen herumzuhängen. Was schließlich der Sinn dieser Treffen war, oder nicht? Dass wir weit verstreuten Familien uns nicht aus den Augen verloren, dass Freundschaften entstanden, sich vertieften …
… und die Älteren von uns einen Partner fürs Leben fanden. Zu dumm, dass ich diesen Teil des Plans den ganzen Sommer nicht in Zusammenhang mit meiner eigenen Schwester gebracht hatte! So musste ich nun hinter der niedrigen Hecke von Hausnummer 17 in Deckung gehen und grübeln und wachen.
Das ging genau zwei Abende gut.
Als wir im Herbst 1976 nach Groß-Mooren gekommen waren, hatte selbst mein kleiner Bruder Janko schnell begriffen, was los war. Die Groß-Moorer hatten über uns abgestimmt, und dass wir den Hof von Müller Zwo am Ende doch übernehmen durften, lag einzig daran, dass der Sohn und Erbe von Müller Zwo keinen anderen Käufer fand. Mal ehrlich: Wer wollte schon nach Groß-Mooren? Auf einen abgetakelten alten Hof, wo es durch alle Ritzen pfiff, durchs Dach tropfte, wo sich das Gerümpel im Wohnhaus bis unter die Decke türmte und der Belag auf dem Boden der künftigen „Antik-Scheune“ aus einem Meter knochenharter, plattgewalzter Kuhscheiße von vor zwanzig Jahren bestand?
Die Sohn von Müller Zwo war so happy, als wir mit unserem Wohnwagen in den Hof gerollt kamen, dass er uns entgegenrannte, das Tor aufriss und es blitzschnell hinter uns abschloss. Den Schlüssel versenkte er tief in seiner Hosentasche, wohl in der Absicht, ihn erst herauszurücken, wenn Dadas* Unterschrift schwarz auf weiß unter dem Vertrag stand.
Keiner im Dorf war seitdem besonders gut zu sprechen auf den Sohn von Müller Zwo. Dem konnte es egal sein, der wohnte in Kiel.
Später, während der Renault von Müller Zwo mit überhöhter Geschwindigkeit vom Hof buckelte, stellte Dada uns mit Blick zur Straße auf: mich selbst, Janko und Zippi und meine älteren Brüder Hanno und Gecko, daneben unseren Puro, Mama und natürlich Muggele.
„Ab der Landstraße wird nur noch Deutsch gesprochen“, schärfte mein Vater uns ein, „immer, selbst wenn ihr unter euch seid, damit ihr es nicht vergesst. Geht in sauberen Sachen vom Hof. Wer euch begegnet, wird gegrüßt. Seid höflich, lasst euch auf keinen Streit ein.“ Und nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: „Bleibt im Dunkeln von ihren Häusern weg.“
Junge, das saß. Meine Mutter und der Puro wurden ganz grau im Gesicht, als mein Vater das sagte. Aber auch Janko und ich, die Jüngsten, hatten eigentlich erwartet, dass wir am Ende der langen Fahrt aus Süddeutschland endlich zu Hause angekommen sein würden. Dass wir die Toten zurücklassen konnten – nicht vergessen, bestimmt nicht, aber dass die Geschichte ganz weit oben im Norden vielleicht keine so große Rolle mehr spielen würde.
Dumm von mir, das weiß ich jetzt. Mama denkt ständig an ihre eigene Mutter und die beiden Schwestern, obwohl sie bei dem Mord erst fünf Jahre alt war. Sie und der Puro waren nicht zu Hause, als es passierte; das ist der einzige Grund, warum sie noch leben.
Und warum es mich gibt, Zippi und meine Brüder. Mehr ahnte ich damals allerdings nicht. Ich spürte nur, wann die Erwachsenen wieder einmal darüber geredet hatten: wenn sie schlagartig still wurden, sobald ich das Zimmer betrat. Und das kam ziemlich häufig vor.
Trotzdem fiel Dadas Mahnung, mich im Dunkeln von den Häusern der Gadsche* fern zu halten, mir erst wieder ein, als es zu spät war. Ich muss einfach so intensiv auf Zippis Rücken gestarrt haben, dass ich die Männer auf der Straße erst bemerkte, als ich schon keine Chance mehr hatte, zu verschwinden. Instinktiv warf ich mich hinter der Hecke auf den Boden, aber ihre Schritte und Stimmen kamen unaufhaltsam näher, von vorn, von der Seite, von hinten.
Ich kniff die Augen zu, als Schatten über mich fielen. Angst fuhr mir in die Knie, die Brust, den Kopf, Angst schoss durch mich hindurch und wieder hinaus. Und dabei schien sie etwas von mir mitzunehmen, denn plötzlich spürte ich, wie ich zu schweben begann, und erwartete dankbar und überrascht, mich im nächsten Moment einfach über die Hecke in die Luft zu erheben.
Eine Taschenlampe blitzte, jemand riss mich hoch und zischte: „Wo sind die anderen?“
Ich fühlte mich wie ein Fisch: Ich zappelte und klappte den Mund auf, um zu brüllen, aber es kam kein Ton heraus. Der Gadscho mit der Taschenlampe gab mir eine Ohrfeige.
„Wusste ich’s doch!“, knurrte er. „Das Pack vom Müllerhof!“
Als könne ich mich selbst von außen beobachten, sah ich mich zwischen ihren Schatten stehen: sieben oder acht Männer, denen ich allesamt schon begegnet war, zwischen denen ich am Kiosk gewartet hatte, an denen ich auf der Straße vorbeigegangen war.
„Da sind bestimmt noch mehr! Hat jemand eine Waffe?“
„Vorsicht, die fackeln nicht lang und ihr kriegt ein Messer zwischen die Rippen!“
„Wir sollten besser die Polizei rufen!“
„Bis dahin sind die über alle Berge!“
Zwischen meinen Zähnen spürte ich Blut und stocherte erschrocken mit der Zunge herum, aber mein Gebiss schien komplett. Kam es noch darauf an? In den umliegenden Häusern gingen Lichter an, Leute erschienen an den Fenstern; keiner wollte etwas verpassen, jetzt, wo es endlich losging. Weitere Männer und auch zwei Frauen rannten über die Straße und warfen sich im Laufen ihre Mäntel um. Einer hatte einen Hund dabei.
Nur meine Schwester Zippi in ihrem Telefonhäuschen bekam von alldem nicht das Geringste mit. Sie lehnte an der Glaswand, wickelte die Telefonschnur um ihren Finger und hing selig am Hörer.
„Ziiiiippiiiii!“ Endlich fand ich meine Stimme wieder. „Zippi, lauf!“
Immer noch lachend, drehte sie sich halb um und legte die Stirn an die Scheibe, um ins Dunkle zu spähen. Ich sah, wie ihr der Mund aufklappte und der Hörer aus der Hand fiel. Ich sah, wie sie die Tür aufstieß und nicht weg-, sondern auf mich zu rannte.
Ich muss zugeben, dass ich trotz allem heilfroh war. Zwei Mädchen sind schließlich schwerer zu erschlagen als so ein einziges dünnes Ding wie ich.
Doch meine Schwester Zippi, das fiel mir an diesem Abend staunend auf, war kein Mädchen mehr. Sie stieß die Männer beiseite, stemmte die Hände in die Seiten und blitzte den, der mich festhielt, furchtlos und zornig an.
„Sind Sie noch ganz bei Trost? Lassen Sie sofort das Kind los.“
„Das Kind“, spuckte der Gadscho, „ist auf meinen Grund und Boden eingedrungen!“
„Meinen Sie etwa Ihre mickrige Hecke?“, fragte Zippi verächtlich. „Wie können Sie von eingedrungen reden, wenn Sie nicht mal einen Zaun haben?“
„Frech wie Dreck“, knurrte ein anderer, aber immerhin: Niemand hinderte meine Schwester daran, auf mich zuzugehen und meinen Arm zu befreien.
„Ist das Blut, Kascha? Hat er dich geschlagen?“
„Keiner hat hier irgendwen geschlagen!“
„Stimmt, das kann ich bezeugen!“
Zippi drehte mich ins Licht der Straßenlaterne und begutachtete meine Lippe. „Schämen Sie sich“, sagte sie verächtlich. „Ein achtjähriges Kind!“
„Sie ist nicht acht, sie ist in meiner Klasse!“
Ein paar Schritte hinter mir stand in der Hauseinfahrt der Junge, der in der Schule wegen seines runden Gesichts Qualle genannt wurde, und grinste triumphierend. Wahrscheinlich war er froh, dass er auch mal etwas wusste. In der Schule war Qualle nämlich nicht gerade eine Leuchte.
„Die lügen wie gedruckt!“, schrie eine Frau. „Ruf doch endlich mal einer die Polizei! Da hinten sind gerade noch zwei von denen weggerannt!“
Weggerannt?, dachte ich. Na, das sind ganz sicher keine von uns!
Einige Groß-Moorer trabten halbherzig in die Richtung, die die Frau wies – um nach ein paar Schritten wieder stehen zu bleiben. „Die kriegen wir sowieso nicht mehr. Und wer weiß, ob es wirklich nur zwei waren …“
„Polizei kommt!“, meldete jemand aus einem Haus.
„Sehr gut!“, erklärte Zippi und stellte sich neben mich.
Ich versuchte ihren verächtlichen Blick nachzuahmen, aber so ganz wollte es mir nicht gelingen. Ehrlich gesagt, hatte ich ganz schön Schiss. Die Polizei hat uns noch nie geholfen, im Gegenteil. Von der Polizei hören wir, wenn überhaupt, nur eins: „Haut ab!“, oder: „Macht, dass ihr wegkommt!“, oder: „Ihr habt zwei Stunden, um zu verschwinden.“
Andererseits: War Verschwinden heute Abend nicht genau unser Ziel? Ich fasste Mut. Als der Hund, ein hübscher Boxer, an meinen Beinen schnüffelte, streckte ich die Hand nach ihm aus. Ich kenne keinen Hund, der mir oder meinen Geschwistern je etwas getan hätte. Hunde sind schlau, die merken, wer sie gern hat. Doch der Besitzer riss den Boxer augenblicklich von mir weg und herrschte: „Pfui, Tarras!“
Das Warten war so feindselig, dass es knisterte. Nach einer kleinen Ewigkeit kam ein Polizeiwagen ziemlich langsam und wichtigtuerisch angerollt. Kurz bevor er uns erreichte, ging das Blaulicht an, als wäre dem Fahrer im letzten Moment eingefallen, dass das ja auch noch irgendwie dazugehörte.
Dem Wagen entstiegen die beiden dicken Beamten von der Wache in Gelting. Sie heißen Heinrich und Schulz und waren schon mehrmals auf unserem Hof. Sie sehen sich wortlos um und verschwinden ebenso wortlos wieder. Keine Ahnung, was sie bei uns zu finden hoffen; wahrscheinlich wollen sie nur ab und zu darauf hinweisen, dass sie da sind.
Heinrich warf einen Blick auf uns und bemerkte: „Aha!“, als brauchte ihm niemand mehr etwas zu erklären.
Die Groß-Moorer bestürmten die beiden dennoch. Zippi und ich hatten uns, wie wir bei der Gelegenheit nun auch endlich erfuhren, auf mehreren Grundstücken herumgetrieben. Unsere Komplizen, die einzig durch aufmerksame Anwohner an einem Raubzug gehindert worden waren, seien auf der Flucht über die Felder von Zeugen beobachtet worden. Außer uns beiden seien es noch mindestens zwei gewesen, wahrscheinlich die beiden Brüder, und wo denn wieder mal die Polizei gewesen sei, als man sie brauchte.
„Was willst du denn, Fritz, wir sind doch da!“, sagte Heinrich unwillig.
„Ja, jetzt! Ihr behauptet, dass ihr den Müllerhof im Auge behaltet, aber wenn der Piet nicht zufällig aus dem Fenster geguckt hätte …!“
Und Bla, und bla, und bla. Ich war ganz schön baff. Wenn ich lüge, dann weiß ich das nämlich genau, und ich vergesse es keinen Moment, schon um mich nicht zu verplappern. Aber diese Leute waren phänomenal. Was sie dem Schulz ins Notizbuch diktierten, schienen sie tatsächlich zu glauben! Sie fielen sich gegenseitig ins Wort, einer setzte den Satz des anderen fort und am Ende stand eine komplette Geschichte, als hätten sie sich vorher abgesprochen.
Der Schulz schrieb mit wie verrückt. Wenn ich mich nicht genau erinnert hätte, wo Zippi und ich tatsächlich gewesen waren, während das alles mit uns in der Hauptrolle angeblich stattgefunden hatte, hätte ich jedes Wort glatt selbst geglaubt.
„Ich hab da drüben telefoniert, das hat hier jeder gesehen“, erklärte Zippi, als sie endlich auch mal etwas sagen durfte. „Meine kleine Schwester hat mich begleitet. Wegen der freundlichen Herrschaften hier würde nämlich keine von uns allein ins Dorf gehen.“
„Euch hat hier auch keiner eingeladen!“, schnappte Nummer 17, wohl der Vater von Qualle.
„Hat jemand gesehen, dass sie telefoniert hat?“, fragte Schulz und leckte an seinem Bleistift.
Lange Stille. Ich blickte von einem zum anderen. Einige hatten immerhin den Anstand, den Kopf zu senken.
„Ich hab’s gesehen“, ertönte plötzlich eine müde Stimme. In der erleuchteten Haustür von Nummer 17 stand eine Frau in Bademantel und Pantoffeln.
„Du gehst wieder ins Bett, Line“, befahl ihr Mann.
„Sie hat telefoniert. Wir haben es alle gesehen“, wiederholte Qualles Mutter, zog den Bademantelgürtel enger und verschwand mit schleppenden Schritten wieder im Haus.
Als sie gegangen war, lag plötzlich etwas ganz Seltsames über dem Abend, etwas Dumpfes, Schweres, Atemloses, aus dem man sekundenlang gar nicht herauskam. Dann sagte jemand: „Vielleicht hat sie telefoniert, um ihre Komplizen …“
Aber er brach ab und wir erfuhren nicht, was Zippis „Komplizen“ im Sinn gehabt haben mochten. Stattdessen öffnete Heinrich die rückwärtige Tür des Polizeiwagens und ordnete an: „Rein mit euch.“
„Warum?“, fragte Zippi misstrauisch.
„Weil wir keine Lust haben, euretwegen den ganzen Abend hier herumzustehen!“
Ich hatte erwartet, dass die Groß-Moorer unseren Abgang im Polizeiwagen beifällig kommentieren würden, aber niemand sagte mehr etwas. Auf dem Rücksitz drückte Zippi ermutigend meine Hand. Es ging nicht sofort nach Hause, aber auch nicht zur Wache; der Wagen fuhr einfach eine Viertelstunde mit uns durch die Gegend, wendete dann und fuhr durch Groß-Mooren zurück. Die Dorfstraße war längst wieder menschenleer, so leblos und langweilig, wie die Leute hier oben es schätzen.
Wahrscheinlich war das der Zweck der kleinen Rundfahrt gewesen: die Groß-Moorer denken zu lassen, dass „Heinrich & Schulz“ etwas unternommen hatten. In der Einfahrt zu unserem Hof setzten sie uns ab.
„Passt beim nächsten Mal besser auf“, riet Schulz. „Die Leute hier sind nicht verkehrt, sie haben einfach Angst.“
„Vor uns?“, erwiderte Zippi, aber sie bekam keine Antwort. Der Polizeiwagen setzte rückwärts aus der Einfahrt und entfernte sich Richtung Dorf.
Wir blickten seinen Lichtern nach. „Mit wem hast du eigentlich telefoniert?“, fragte ich.
Ich fand mich ziemlich abgebrüht, als ich mich so reden hörte – als wäre mir alles, was wir eben erlebt hatten, bereits egal! Dabei war die Frage in Wahrheit echte Notwehr. Dieser Abend gehörte zu denen, die du am besten von der ersten Sekunde zu vergessen versuchst, sonst setzen sie sich fest und du wirst sie nie mehr los.
Zippi zog mich an den Haaren. „Sei nicht so neugierig!“
Wir gingen zum Haus. Ich wartete, ob Zippi noch etwas sagen wollte, aber von ihr kam nichts und mir wurde dreierlei klar. Erstens, dass wir uns in der Einschätzung des Abends einig waren. Zweitens, dass ich, wenn Zippi zu Hause nichts erzählte, auch kein Wort sagen durfte, um nicht die Frage aufkommen zu lassen, was meine Schwester im Dorf eigentlich gewollt hatte. Und drittens, dass ich mit genau dieser Frage am Ende des Abends nicht weniger allein dastand als vorher, eben weil Zippi nicht darüber redete.
Das hieß, es war ernst. Verdammt ernst. Was wiederum in sich eine Art Antwort war.
In den folgenden Nächten hielt ich mich unter äußerster Selbstbeherrschung wach, indem ich mir ausmalte, in unserem Kleiderschrank säße der Mörder aus dem letzten Aktenzeichen XY. Es funktionierte so gut, dass ich wie erstarrt im Bett lag, bis Zippi endlich aus dem Zimmer schlich. Nur einmal konnte ich mich dazu zwingen, aufzustehen und – am Schrank mit dem Mörder vorbei – meiner Schwester bis zum Treppenabsatz zu folgen. Unten im Flur, wo das Telefon steht, hörte ich sie leise kichern.
Das war alles. Die Kürze ihrer Telefonate konnte auf Ferngespräche hindeuten, andererseits auch bloß darauf, dass meine Schwester an die Telefonrechnung dachte. Keine gesicherten Erkenntnisse, wie es bei Eduard Zimmermann immer heißt.
Doch als Zippi anfing, hinter sich aufzuräumen, wurde mir alles klar: Zippis Zukünftiger würde nicht zu uns auf den Hof ziehen, obwohl wir genügend Platz hatten. Zippi würde in die andere Familie wechseln.
Ich stand unter Schock. Praktisch jeden Tag konnte ich jetzt also aus der Schule kommen und von der Entdeckung niedergeworfen werden: Zippis Sachen aus unserem Schrank verschwunden, ihr Bett abgezogen, ihr Platz am Tisch verwaist.
Neben der Treppe in unserem Hausflur steht ein kleines Altärchen: die Muttergottes mit einem Zweig vom Palmsonntag, einem ewigen Licht, einem Weihwasserfläschchen und Fotos von der Puri* und meinen ermordeten kleinen Tanten. Sie alle flehte ich mehr oder weniger an, etwas zu unternehmen.
„Eine Flucht ist ja normal“, argumentierte ich mit meiner Großmutter, „irgendwann trifft es jede, auch mich. Aber deine Enkelin Zippi ist gerade erst siebzehn! Was, wenn sie weit weg geht? Sie wäre doch todunglücklich ohne uns! Ja, wäre es nicht besser, sie wartet, bis sie jemanden aus der Nähe kennen lernt? Könnt ihr da nicht schnell noch was drehen …?“
Und wirklich: Die Weihnachtsferien begannen und Zippi war noch da, Heiligabend verstrich, der erste und zweite Feiertag und der Tag danach und an diesem Morgen hatte ich den ersten unerlaubten Silvesterböller gehört. War Zippi ins Grübeln gekommen? Hatte sie es sich noch einmal überlegt? Als ich auf dem Weg zum Frühstück am Altärchen vorbeiging, konnte ich nicht anders: Ich zwinkerte Puri zu.
Doch als Zippi die Küche betrat, wusste ich sofort Bescheid. Dies war der Tag. Donnerstag, der 28. Dezember 1978. Der Tag, an dem meine Schwester niemandem von uns mehr ins Gesicht sah: weder meinem Vater noch Hanno und Gecko, die kurz danach vom Tisch aufstanden, um in die Scheune zu gehen, und auch nicht Mama, Janko und mir, die an diesem Ferientag noch etwas herumtrödelten. Und bei Puro würde Zippi bestimmt erst vorbeischleichen, wenn er nach seinem Frühstück im Bett wieder eingeschlafen war.
Ich senkte den Kopf tief über meinen Teller und versuchte zu schlucken, aber das Butterbrot steckte mir im Hals wie ein Pflock. Außer mir schien nur Muggele etwas zu ahnen. Normalerweise liegt er beim Frühstück gehorsam auf seinem Platz neben der Sitzbank; heute trabte er mit hängender Zunge zwischen Küche und Haustür auf und ab, als wäre es Mai und Zeit, den Wagen fertig zu machen.
Unser Muggele gab mir den Rest. Ich fühlte, wie Tränen den letzten Bissen Brot wieder nach oben drückten. Ich bekam größte Lust, ihn geradewegs vor mich auf den Tisch zu würgen.
In diesem Augenblick stieß von unten Jankos Fuß gegen mein Schienbein. „Heulsuse, Heulsuse!“
Mein Fuß, meine beiden Beine, mein ganzer Körper stieß zurück, dass es nur so krachte. „Die Katze soll deine Hoden fressen!“
„Valentina Natzweiler!“
Wenn Mama meinen Papiernamen benutzt, kann das zweierlei bedeuten: Entweder habe ich einen richtig guten Witz gemacht, worunter Flüche bei meiner Mutter in der Regel nicht fallen, oder es heißt Rausschmiss. Ich stand langsam auf. Meine Beine fühlten sich an, als hätte ich sie einen dieser Fernsehtürme hochgehetzt, wo oben Kameras stehen und filmen, wie die Leute mit baumelnden Spuckefäden vor der Brust über die letzte Stufe kriechen.
Janko sagte nichts, doch ich war sicher, dass ich es später zurückbekommen würde. Mein Bruder Janko ist zwei Jahre jünger als ich, aber leider ein Junge, was bedeutet, dass er sich einbildet, mich herumkommandieren zu dürfen.
Jetzt – jetzt war es also soweit. Jetzt war nur noch ich übrig, als einziges Mädchen unter drei Brüdern. Meine bisherige Verbündete schmierte Marmelade auf ihr Brot und schickte sich an, mich im Stich zu lassen. Ihrem traumverlorenen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war sie bereits weg.
Ich stand vor der Haustür, blickte in den nassen, schmuddeligen Morgen und dachte: Nicht mal der Scheiß-Winter ist kalt genug, um sich noch schnell eine Lungenentzündung zu holen.
2
Als wir noch in Ravensburg wohnten, stellten sich mir jedes Mal die Haare auf, sobald die Rede darauf kam, wann der Puro endlich unser Haus zurückbekam. Unser Haus stand am Rande der Altstadt und da wir, wenn wir in die Stadt fuhren, das Auto immer auf einen bestimmten Parkplatz in der Nähe stellten, kamen wir ziemlich oft daran vorbei. Zu oft, wenn du mich fragst! Puro und meine Eltern blieben jedes Mal stehen und guckten sich unser Haus ratlos und vorwurfsvoll an, bis irgendwann das Fenster im Erdgeschoss aufflog und die Gadschi, die jetzt dort wohnte, brüllte, wir sollten verschwinden.
Ich wurde nie angebrüllt – ich war nämlich längst weg. Ich konnte gar nicht schnell genug an unserem Haus vorbeikommen. Ein kalter Wind wehte mich daraus an, selbst im Sommer, und während ich an der Straßenecke auf meine Familie wartete, ganz Gänsehaut und Zähneklappern, betete ich aus tiefstem Herzen, dass wir es bitte nie, nie zurückbekamen.
Ich lebte gern im Ummenwinkel, obwohl die Gegend so heruntergekommen war. Im Ummenwinkel gab es Holzöfen statt Heizungen und Generatoren für den Strom, es gab kein fließendes Wasser und bei Regen liefen wir alle in Gummistiefeln, weil die Straße nicht geteert war. Aber das störte mich nicht. Tausendmal lieber wollte ich mit einem Kanister an der Wasserpumpe anstehen, als in einem Haus zu wohnen, in dem drei Morde geschehen waren!
Im Schrank über unserem Küchenherd stand ein dicker Ordner, der sich kaum zuklappen ließ vor lauter abgeheftetem Papier. So lange, seit fast zwanzig Jahren, versuchte Puro nämlich schon, unser Haus zurückzubekommen. Manchmal kam ein Mann in einem weißen Audi, der Anwalt, und las den Erwachsenen ein neues Schreiben vonder Stadt vor. Einer meiner Brüder musste unterdessen auf den Audi aufpassen, weil der Anwalt glaubte, die Ravensburger Verbrecher lebten alle im Ummenwinkel. Dabei lebten sie in Wirklichkeit ganz woanders, aber zu meiner Enttäuschung brachte Eduard Zimmermann nie etwas darüber.
Eines Nachmittags stieg der Anwalt mit diesem besonderen Grinsen aus dem Audi und mir war klar, dass meine Tage im Ummenwinkel gezählt waren. Meine glückliche Kindheit war vorüber. Wir zogen zurück in unser Haus.
Als es anfing, dunkel zu werden, versammelte sich halb Ummenwinkel unter dem Baum, auf dem ich saß.
„Ich komme nicht mit!“, schrie ich und trat nach Geckos Hand. „In dem Haus ist der Mulo*!“
Es regnete Kastanien. „Wovon in aller Welt redet das Kind?“, wunderte sich Tante Tiki.
Der Duft von Grillfleisch umwehte meine Nase, ich hörte Geigen und Schifferklaviere. Die andere Hälfte vom Ummenwinkel, die nicht unter meinem Baum stand, feierte, dass wir unser Haus zurückbekamen.
„Aber wir ziehen doch gar nicht zurück in unser Haus, Kascha!“, rief Zippi, der plötzlich ein Licht aufging. „Wir haben bloß endlich Geld dafür bekommen!“
Ich guckte vom Baum. Zwischen Blattwerk erblickte ich die aufrichtigen Gesichter mehrerer Tanten und Nachbarinnen, die aus meiner Perspektive direkt in bunte Pantoffeln übergingen.
„Gott bewahre, Kindchen!“, versprach Großtante Öggla. „Ihr zieht doch nicht zurück in dieses Haus!“
Sie mussten beiseite springen, so schnell kam ich vom Baum.
„Und mit dem Geld vom Haus“, ergänzte Zippi mit leuchtenden Augen, „können wir jetzt machen, was wir wollen.“
Ich hätte es ahnen müssen: Bei so vielen Möglichkeiten, die du hast, wenn du machen kannst, was du willst, konnte es gar nicht weit genug weggehen vom Ummenwinkel. Von Machen, was wir wollen führt eine schnurgerade Linie direkt nach Groß-Mooren, und an manchen Tagen kannst du entlang dieser Linie nur noch sehen, was du verloren hast.
Dies war so ein Tag. Im Ummenwinkel wäre ich nach meinem Rausschmiss aus der Küche einfach nach nebenan gegangen zu Mali. Ich hatte Dutzende Freundinnen dort, und wenn ich mal heimlich heulen wollte, den Pferdestall mit sechs warmen, duftenden Ponys. In Groß-Mooren bleibt nur die Scheune. Antik-Scheune hat mein Bruder Hanno in großen weißen Buchstaben an die Mauer gepinselt, und kleiner darunter: An- und Verkauf von Möbeln und Musikalien.
In den Sommermonaten halten Touristenautos auf dem Weg zum oder vom Strand. Im Winter restaurieren meine Brüder alte Möbel, in einem kleinen Extra-Raum baut Dada an seinen Geigen und du kriegst einen Besen in die Hand gedrückt, sobald du die Scheune betrittst.
Andererseits ist die Scheune der Ort, an dem ich es beinahe wieder in Ordnung zu finden beginne, dass wir nach Groß-Mooren gezogen sind. Wenn Dada den Klang der Geigen testet, wenn meine Brüder singen und pfeifen und ich das Holz hören kann: das Holz, wie es unter der Raspel, dem Schmirgel, dem Messer klingt, wie es unter dem Pinsel gierig schmatzt und wie es knarzt und quietscht, wenn irgendwas nicht passt. Im Ummenwinkel habe ich das gar nicht gewusst, weil meine Brüder in einem gemieteten Schuppen in der Stadt arbeiteten.
Hanno und Gecko kaufen aber nicht nur Möbel, wenn sie über Land fahren. Im letzten Jahr bekamen wir eines Tages die Mitteilung, wir sollten auf dem Güterbahnhof Pferde entladen! Dada rührte fast der Schlag, aber leider hatten meine Brüder in Frankreich bloß ein altes Kinderkarussell gekauft und die zwölf Holzpferde per Bahn zu uns geschickt.
Die Pferde sind Geckos Winterprojekt; er befreit sie von ihren abgeplatzten Farben, malt ihnen anstelle des alten gelbzahnigen Grinsens verschmitzte, erwartungsvolle Gesichter und stellt sie auf stabile Podeste mit Rollen. Man könnte die Gadsche-Kinder glatt beneiden, deren Eltern ihnen im kommenden Sommer eines dieser Pferde kaufen.
Ich natürlich nicht – ich bin längst zu alt für ein Holzpferd. Ich setze mich nur gern mal drauf, das ist alles, setze mich drauf und träume von den Ponys im Ummenwinkel, und wie sie uns im Winter mit unseren Schlitten und Skiern durch den Schnee zogen. In Groß-Mooren hatten wir Ende Dezember immer noch über zehn Grad plus, auf den Wiesen lag Matsch und weiter nichts und allmählich färbte das Wetter auf meine Fähigkeit ab, mich aus diesem Kaff hinaus zu träumen. Den ganzen Morgen konnte ich an nichts anderes denken als an Zippi, ob sie sich vielleicht gerade in diesem Moment davonschlich und welch trübseliges Licht es auf ihre Zukunft warf, dass sie ausgerechnet in diesen grauen Tag flüchtete.
Fortwährend ging mein Blick zur verschlossenen Scheunentür, als könne ich noch etwas, irgendetwas unternehmen. Aber was? Dada und meinen Brüdern im letzten Moment alles erzählen? Undenkbar. Noch nie hatte ich davon gehört, dass eine Flucht durch eine jüngere Schwester verraten worden war. Verachten würde man mich, vielleicht würde nicht einmal jemand mit mir flüchten wollen, wenn der Tag kam!
Der Gedanke zog mich noch mehr herunter. Ich war froh, als die einzige Abwechslung des Tages nach zwei Stunden endlich auftauchte.
Die einzige Abwechslung in der Scheune ist im Winter der Hugomüller. Da er jeden Vormittag um dieselbe Zeit auftaucht, ist er eigentlich schon gar keine Abwechslung mehr, aber egal, er ist derjenige unserer Nachbarn, der nicht nur nichts gegen uns hat, sondern sich im Gegenteil über uns freut. Selbst wenn das weniger an uns persönlich liegt, sondern daran, dass der Hugomüller so spinnefeind war mit seinem Cousin Müller Zwo.
Denn wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was der Hugomüller behauptet, dann muss auf diesem unscheinbaren Grund und Boden über Jahre Die Schlacht von Groß-Mooren stattgefunden haben. Der Hugomüller weiß noch genau, wo die Stolperfallen auf den Zufahrten lauerten und wer wem wann die Bremsen durchgeschnitten hat. Es gab rätselhafte Tode von Hoftieren und Luftgewehrbeschuss von Haus zu Haus, bis Heinrich & Schulz anrückten. Mit Verstärkung!
Die beiden alten Müllers müssen sich richtig reingesteigert haben und dass einer von beiden noch lebt, kann einzig daran liegen, dass der andere eines Morgens tot im Bett lag. Der Hugomüller ist über siebzig und sieht nicht aus, als hätte er viel länger durchgehalten. Nicht dass er das je zugeben würde, aber Müller Zwo hat ihm durch sein eigenes Dahinscheiden praktisch das Leben gerettet.
„Wirfst du einen Brief für mich ein?“, fragte der Hugomüller und wedelte mit einem länglichen Umschlag vor meiner Nase herum. „Kriegst auch ne Mark.“
„Klar, Herr Hugomüller“, sagte ich und schnappte mir den Umschlag.
Der Hugomüller kicherte. Langsam tut er mir leid, weil er immer noch solchen Spaß an dem alten Scherz hat. Denn natürlich hatte ich damals schnell kapiert, dass unser Nachbar Hugo Müller und nicht „Herr Hugomüller“ heißt. Wenn der Arme aus dem kleinen Missverständnis unserer ersten Begegnung nach über zwei Jahren noch einen solchen Heiterkeitsgewinn zieht, dann muss er außerhalb der Antik-Scheune ein freudloseres Leben führen, als man ohnehin schon ahnt, wenn man Groß-Mooren kennt.
Deshalb bin ich auch immer besonders freundlich zum Hugomüller; ich gehe auch für ihn zum Briefkasten, wenn es keine Mark gibt. An diesem Vormittag wäre ich schon deshalb sofort gegangen, um endlich einen Blick vors Haus werfen zu können.