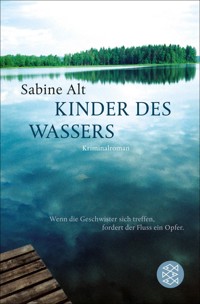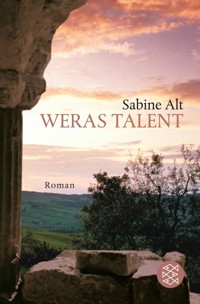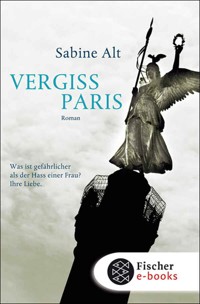8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn sich auch nur einer erinnert, ist es einer zuviel Stefanie Plessen hat es geschafft. Sie ist beruflich erfolgreich und ein angesehenes Mitglied der Berliner Gesellschaft. Doch dann sieht sie sich beim Besuch einer Vernissage mir ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Liebe, Verrat und Schuld, alles vereint in einer einzigen entlarvenden Fotografie. Bisher fühlte Stefanie Plessen sich sicher, aber jetzt weiß sie, dass es einen Zeugen gegeben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sabine Alt
Gegen das Licht
Roman
Über dieses Buch
Wenn sich auch nur einer erinnert, ist es einer zuviel
Stefanie Plessen hat es geschafft. Sie ist beruflich erfolgreich und ein angesehenes Mitglied der Berliner Gesellschaft. Doch dann sieht sie sich beim Besuch einer Vernissage mir ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Liebe, Verrat und Schuld, alles vereint in einer einzigen entlarvenden Fotografie. Bisher fühlte Stefanie Plessen sich sicher, aber jetzt weiß sie, dass es einen Zeugen gegeben hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie, München
Foto: imagebroker/strandperle
© S. Fischer Verlag GmbH,
Frankfurt am Main 2009
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400639-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Gegen das Licht
Berlin
Berlin
Berlin
Amsterdam
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Danksagung
Gegen das Licht
Berlin
August 2009
Eine müde Sonne hängt über der Stadt. Schmucklose Mietshäuser werfen ungnädige Schatten auf den Asphalt vor dem stillgelegten Flughafen Tempelhof. Auf den Straßen und ihren Bewohnern lastet eine schwere Sommerhitze, obwohl es schon nach sieben Uhr am Abend ist.
Als Stefanie Plessen die U-Bahn-Station am Platz der Luftbrücke verlässt, bilden sich sofort winzige Schweißperlen auf ihrer Stirn. Zwischen nachlässig gekleideten Jugendlichen und erschöpft aussehenden Arbeitern nimmt sich die elegante Frau in dem leichten Leinenkostüm merkwürdig aus. Doch sie sieht fast hochmütig über ihre Umgebung hinweg, während sie mit energischen Schritten der Ampel zustrebt, ohne die ein Überqueren des breiten Tempelhofer Damms unmöglich wäre. Tosend umgibt der Feierabendverkehr das Luftbrückendenkmal, hinter dem das imposante Flughafengebäude liegt.
Zu beiden Seiten des Portals erstreckt sich der zweiflügelige Bau mit den massiven Kolonnadengängen. Die grauen Quader bilden einen ungerührten Hintergrund für das Treiben auf den vielbefahrenen Straßen. Wuchtig döst das Gebäude in der Abendsonne. Ein steinernes Gehirn, gespickt mit den Erinnerungen einer ganzen Stadt.
Auch Stefanie Plessen verbindet einiges mit diesem Ort. Es hat Zeiten gegeben, da ist sie ein- bis zweimal im Monat über den Vorplatz gelaufen, um nach Basel zu fliegen und ihren damaligen Freund zu besuchen. Eine Episode ihres Lebens, an die sie nur ungern zurückdenkt. Trotzdem kann sie es nicht vermeiden, dass die Bilder ihrer letzten Ankunft auf dem Tempelhofer Flughafen sich jetzt aufdrängen. Eine Serie alter, aber überscharfer Dias, die ein allzu eifriger Handlanger ihrer Psyche in immer schneller werdender Reihenfolge durch Stefanie Plessens inneren Projektor jagt.
Ein heißer Berliner Sommertag. Eine Gangway im Gegenlicht. Eine schlecht geschlossene Reisetasche, in deren Rahmen der Träger eines Büstenhalters klemmt. Ein hastig bestiegenes Taxi mit einem mürrischen Fahrer. Eine Schaufensterscheibe, dekoriert mit den Fotos tätowierter Körperteile.
Stefanie Plessen wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn, als könne sie gleichzeitig mit dem Schweiß auch die Erinnerungen abstreifen. Als jetzt der Verkehr vor dem Überweg stoppt und die Fußgängerampel grün wird, setzen sich alle Wartenden in Bewegung. Nur Stefanie Plessen zögert. Ganz gegen ihre Gewohnheit.
Vielleicht sollte sie umkehren.
Aber nein. Dies alles liegt mehr als zehn Jahre zurück. Danach ist sie nie wieder von Tempelhof aus geflogen. Denn der Sommer, der auf ihre letzte Ankunft hier folgte, hat ihr gesamtes Dasein verändert.
Doch das ist Vergangenheit.
Und das Einzige, das für Stefanie Plessen zählt, ist die Gegenwart. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will und vor allem, was sie nicht will. Eine Frau, die überdies sehr genau weiß, woran sie keinesfalls erinnert werden will.
Längst ist die Fußgängerampel wieder rot und zwingt ihr eine erneute Wartezeit auf, die sie nutzt, um sich auf die vor ihr liegende Veranstaltung zu konzentrieren.
In einem Teil des stillgelegten Flughafens werden ab heute Abend die Fotografien des serbischen Künstlers Milan Matic in einer spektakulären Schau zu sehen sein. Ende des letzten Jahrtausends hat Matic seiner krisengeschüttelten Heimat den Rücken gekehrt, um durch das westliche Europa zu reisen. In Wien, Berlin, Prag, Paris und Amsterdam hat er jeweils einige Wochen, manchmal sogar Monate verbracht, in denen er ganze Serien von Stadtimpressionen auf Zelluloid bannte.
Bereits vor Eröffnung der Ausstellung sind vier Abbildungen in der Tagespresse zu sehen gewesen, die Stefanie Plessens Interesse geweckt haben. Ein Fuchs, der seine Notdurft auf einem nächtlich verlassenen Boulevard verrichtet. Ein etwa sechsjähriges Mädchen im braven Matrosenkleid, das einen starken Kontrast zu dem dunkel überschminkten Mund und der aufreizenden Pose bildet, mit der das Kind an einer Hausmauer lehnt. Ein badender Greis in der Moldau unterhalb der Prager Karlsbrücke. Eine gardinenlose Fensterfront in einem Amsterdamer Grachtenhaus, hinter der gestochen scharf muskulöse Möbelpacker zu erkennen sind, die die Wohnung leerräumen. Jede dieser Fotografien ist mit präzisen Orts- und Zeitangaben versehen, die in verstörendem Gegensatz zu dem zeitlosen Charakter des Dargestellten stehen.
Stefanie Plessen weiß, dass die Exponate nicht billig sein werden, zumal die Auflage vergleichsweise niedrig ist, aber die Tatsache, dass sie seit zwei Jahren als einzige Frau dem Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe angehört, hat ihr ein monatliches Salär beschert, das es ihr erlaubt, ihrer Passion in großzügiger Weise nachzugehen. Ihr Ruf als Sammlerin zeitgenössischer Fotografie hat sie längst zum festen Bestandteil jeder Berliner Vernissage-Einladungsliste werden lassen. Außerdem ist sie mit dem Galeristen Walter Studer seit Jahren gut bekannt. Fast nie verlässt sie seine Vernissagen, ohne eine der ausgestellten Arbeiten erworben zu haben.
Wieder wird die Ampel grün. Diesmal überquert Stefanie Plessen mit erfolgsgewohntem Gang die Straße und steuert das Portal des Flughafengebäudes an. Sie drückt eine der schweren Türen auf und tritt in die hohe rechteckige Eingangshalle.
Kalte, trockene Luft und der Geruch nach Staub empfangen sie. Und obwohl das ehemalige Abfertigungsgebäude leergeräumt ist, wirkt es auf Stefanie Plessen plötzlich wie ein gut bestücktes Lager, in dem sich entschieden zu viele Bilder ihrer persönlichen Vergangenheit in erschreckend lebhaften Farben gehalten haben. Sehr zum Vergnügen des hinterhältigen Vorführers in ihrem Kopf, der nichts Eiligeres zu tun hat, als die Serie ihrer Erinnerungsbilder wieder zu einem Film aneinanderzureihen und jenen Sommer voller Betrug und Verrat lebendig werden zu lassen.
Der Fluchtimpuls wird stärker. Aber Stefanie Plessen gibt nicht auf. Sie ignoriert die Erinnerungsbilder und sucht nach einer Hinweistafel zu der Fotoausstellung.
Die Exponate werden ein ähnliches Alter wie ihre Erinnerungen haben, ein Umstand, den sie für einen makaberen Zufall hält, gibt es doch eine plausible Erklärung für die zeitverzögerte Präsentation der Fotografien Milan Matics. Erst im vergangenen Jahr ist dem Serben der renommierte World Press Photo Award zuerkannt worden, der wichtigste internationale Preis im Bereich der Pressefotografie. Unverzüglich nach dem Bekanntwerden dieser Ehrung ist der Marktwert aller verfügbaren Matic-Abzüge um ein Vielfaches gestiegen, eine Entwicklung, die weitere Progression versprach und dem umtriebigen Galeristen Studer nicht entgehen konnte.
Als Stefanie Plessen endlich die Hinweistafel zu den Ausstellungshallen entdeckt hat, atmet sie auf. Gleich ist es vorbei. Sie wird die Empfangshalle verlassen und sich auf die Fotos konzentrieren. Nichts wird ihre Stärke dämpfen. Sie drückt die Schultern durch und zieht mit einer oft geprobten Bewegung die Schöße ihres Leinenkostüms glatt. Gut so. Trotzig wendet sich Stefanie Plessen noch einmal der Halle zu. Siegesgewiss und kühl bis ins Herz, lässt sie den Blick durch die Leere wandern.
Aber die Halle ist nicht mehr leer.
Förderbänder und Abfertigungsschalter, hastende Passagiere und Stewardessen in dunkelblauen Schneiderkostümen füllen den Raum.
Eine drängende Vergangenheit hat die Türen zur Gegenwart aufgestoßen.
Berlin
Juli 1999
Mit einem dumpfen Krachen stößt die Gangway an den Flugzeugrumpf. Die Tür der Boeing 707 schwingt auf. Die tiefstehende Sonne wirft ein Lichtband ins Innere des Flugzeugs, von dem die Passagiere geblendet ins Freie treten. Es sind vorwiegend Geschäftsleute, erkennbar an dem guten Tuch ihrer Anzüge und dem einförmigen Handgepäck. Die einzige Frau unter den Männern trägt ein Kostüm, dessen Jacke sie über den Arm geworfen hat. Ihre helle Bluse ist ärmellos und voller Knitterfalten. Die Frau blinzelt ins Gegenlicht, ohne die Sonnenbrille aus den Haaren zu nehmen. Auf der Gangway strauchelt sie trotz ihrer flachen Schuhe. Als der Steward ihr stützend die Hand reichen will, weist sie seine Hilfe ab.
Während der kurzen Fahrt mit dem Shuttlebus über das Rollfeld ist sie die Einzige, die sich hinsetzt. In der Abfertigungshalle bleibt sie am Gepäckband stehen und blickt den anderen Fluggästen hinterher, die nur mit Handgepäck gereist sind und bereits dem Ausgang zustreben. Konzentriert beobachtet die Frau, wie sich deren Silhouetten beim Passieren der Doppeltüren im Abendlicht auflösen.
Allein steht sie am Förderband, das sich ruckend in Bewegung setzt, ohne dass ein Koffer auf ihm erschiene. Die Frau hätte Muße, die monumentale Architektur des Gebäudes auf sich wirken zu lassen und die eigenartige Mischung aus Dreißiger-Jahre-Sachlichkeit und nationalsozialistischem Pathos zu studieren. Doch sie interessiert sich nur für das anachronistische Flugobjekt, das ganz oben an der Hallendecke schwebt. Mit weit in den Nacken gelegtem Kopf mustert sie die Propellermaschine, die Teil einer hoch über den Köpfen der Flughafenbesucher schwebenden Ausstellung zur Geschichte der Luftfahrt ist. Erst nachdem ihre Reisetasche mehrere Runden auf dem Förderband gedreht hat, bemerkt die Frau das Gepäckstück und zerrt es vom Band. Die Tasche ist prall gefüllt, sie wirft Beulen nach allen Seiten. An einer Stelle ist die Naht des Reißverschlusses aufgerissen. Aus dem Schlitz hängt der spitzenbesetzte Träger eines graublauen Büstenhalters. Hastig stopft die Frau das Kleidungsstück zurück in die Tasche, wobei sie den Riss in der Naht versehentlich vergrößert.
Die Frau hebt die Reisetasche mit der linken Hand an und verlagert ihren Körperschwerpunkt auf die rechte Seite. Vergeblich versucht sie, mit ihrer Handtasche und der Kostümjacke, die sie noch immer über dem Arm trägt, ein Gegengewicht herzustellen. Mit schiefen Schultern und unnatürlich nach vorn gerecktem Kopf durchquert sie die Schalterhalle und steigt die breite Treppe zum Ausgang hinauf. Nach der gedämpften Stille der Abfertigungshalle ist der lärmende Verkehr der Großstadt wie ein Schock. Die Frau bleibt stehen, blinzelt auch jetzt wieder ins Abendlicht, ohne ihre Sonnenbrille aus dem Haar zu ziehen. Sie lässt die Reisetasche fallen. Ihr Blick wandert über den Platz vor dem Flughafengebäude, streift das Luftbrückendenkmal auf der kleinen Grünfläche ebenso wie die Reihe bereitstehender Busse, deren wechselnden Rhythmus bei Tag und bei Nacht sie auswendig hersagen könnte. Sie arbeitet als Koordinatorin für die Fahrpläne der Berliner Busse und Bahnen, manchmal fühlt sie sich als heimliche Herrscherin über den Puls der Stadt.
Sie weiß genau, dass keiner der wartenden Busse sie ans Ziel bringen wird. Und eine Fahrt mit der U-Bahn würde sie jetzt nicht ertragen, obwohl deren Station nur wenige Meter hinter dem Luftbrückendenkmal jenseits der befahrenen Straße liegt. Vor dem Abfertigungsgebäude steht nur noch ein einziges Taxi. Die Frau winkt es herbei und stemmt, bevor der Fahrer ihr zu Hilfe eilen kann, die schwere Tasche in den Kofferraum. Als habe sie sich nach langem Zögern einer unerwünschten Last entledigt, richtet sie sich auf. Jetzt erst scheint sie die Hitze und die Helligkeit der Großstadt wahrzunehmen. Sie wischt sich mit einer fahrigen Geste den Schweiß von der Stirn, zieht die Sonnenbrille aus dem Haar und schiebt sie über ihre Augen, obwohl der vor ihr stehende Wagen dunkel getönte Scheiben hat. Dann steigt sie in den Fond und nennt eine Adresse, die nicht die ihrer Wohnung ist.
Berlin-Mitte, Alte Schönhauser Straße.
Kaum ist das Taxi angefahren, lehnt sich die Frau ins Polster zurück und schließt die Augen hinter der Sonnenbrille. Sie öffnet sie erst wieder, als der Wagen stoppt und der Fahrer das Taxameter ausstellt.
»Aufwachen, junge Frau. ARTattoo. Ist das richtig hier?«
Die Frau nickt, ohne aus dem Fenster zu sehen, und holt ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Während sie nach den Münzen fürs Trinkgeld sucht, mustert der Fahrer verwundert das mit roten und grünen Scheinwerfern angestrahlte Ladenlokal, vor dem er sein Auto geparkt hat. ARTattoo. Hinter bodentiefen Schaufensterscheiben stehen Wände mit quadratmetergroßen Fotos tätowierter Schultern, Brüste und Hinterbacken. Als die Frau den Taxifahrer bezahlt, ignoriert sie die Frage in seinen Augen.
Die Inhaberin des Tattoo-Studios lehnt in der Tür und bittet die Besucherin herein, ohne zu lächeln. Obwohl ihre letzte Begegnung schon Jahre zurückliegt, erkennt Linda Doorn Stefanie Plessen sofort. Sie bietet ihr Kaffee und Zigaretten an. Beides lehnt die Besucherin ab. Sie wirkt nervös, als sie erklärt, sie wolle sich tätowieren lassen.
Linda verbirgt ihre Überraschung nicht. Ein einmal gestochenes Tattoo sei nicht ohne weiteres zu entfernen, das wisse sie doch sicher. Eben, darum gehe es gerade, beharrt Stefanie. Welches Motiv es denn sein solle, fragt Linda und beginnt zu plaudern, ohne auf eine Antwort zu warten. Sie spürt die Anspannung der anderen und redet gekonnt dagegen an.
Linda Doorn ist Holländerin, etliche Jahre älter als Stefanie, beide haben sich vor sieben Jahren auf einer Studentenparty kennengelernt. Linda war damals noch nicht tätowiert. Aber gepierct. In der Nase und am Bauchnabel. Es war Sommer, und Linda trug ein sehr kurzes T-Shirt. Als Stefanie nach der Party mit zu Linda ging, wollte sie vor allem herausfinden, ob es auch an Lindas Schamlippen einen weiteren dieser kleinen Ringe gab. Natürlich war Stefanie betrunken. Lindas Haut war dunkel, kreolisch, wie sie sagte, und ihr restlicher Körper frei von jedem Piercing.
Jetzt hat Linda etliche Tattoos. Schon aus Gründen der Eigenwerbung. Sie spricht von den besonderen Schwierigkeiten, von der Herausforderung, die es darstellt, die Farben auf ihrer satten Haut zum Leuchten zu bringen. Dann zeigt sie Stefanie ihre Nixe auf der Schulter, die Doppelaxt an der sauber gestochenen Gliederkette unterhalb des Kehlkopfes und die kauernde Fruchtbarkeitsgöttin mit ihren verkümmerten Gliedmaßen zwischen den Brüsten. Lindas Tattoo-Studio läuft gut, sie betreibt es mit einer Freundin. Das Kunststudium hat sie längst an den Nagel gehängt.
Als Linda ihre Hose öffnet, damit Stefanie den Weg des Schlangenkörpers verfolgen kann, dessen Schwanz sich um ihre linke Brustwarze wickelt, winkt die Besucherin ab. Sie sei nicht daran interessiert, der Höhle, die Lindas Schlangenkopf zweifellos hüte, einen zweiten Besuch abzustatten. Im Übrigen wisse sie genau, wie ihr Tattoo aussehen solle. Linda nimmt einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette und bläst den Rauch in Ringen an die vergilbte Decke. Sie wartet. Mit fester Stimme erklärt Stefanie, sie wolle eine physikalische Formel auf ihrer linken Schulter tragen.
Die Unschärferelation.
Ob sie nicht eigentlich Mathematikerin sei, erkundigt sich Linda. Ja, schon, bekommt sie zur Antwort. Dann schweigt die Besucherin. Linda steckt sich eine neue Zigarette an der Kippe der alten an. Sie lässt der anderen Zeit. Vielleicht ahnt sie etwas von dem Film, der gerade auf Stefanies innerem Bildschirm abläuft.
Ihr Freund, Physiker, und sie selbst gestern Abend am Rhein. Sie schlug vor, im nächsten Jahr zu ihm nach Basel zu ziehen. Nicht, dass er sie jemals darum gebeten hatte, aber ihre Beziehung bestand seit drei Jahren. Sie lief gut, auch über die räumliche Distanz hinweg. Stefanie fühlte sich ausreichend geborgen in der Nähe dieses Mannes, um den Vorstoß zu wagen.
Doch der Physiker reagierte distanziert, geradezu abwehrend. Sie verstand nicht, fragte nach. Er zögerte, bemühte dann für seine Erklärung die Heisenberg’sche Unschärferelation, die besage, dass es unmöglich sei, Ort x und Impuls p eines Teilchens gleichzeitig beliebig genau zu bestimmen. Für das Produkt aus Orts- und Impulsveränderung gelte immer, dass die Abweichung eine bestimmte Konstante, die zwar klein, aber nicht unwichtig sei, nicht unterschreite.
»Und was hat das mit uns beiden zu tun?«
»Sei nicht so ungeduldig. Hör mir einfach nur zu. Zur Ortsmessung braucht man Licht, also Photonen, die man auf das Teilchen schießen muss. Diese Photonen übertragen jedem Teilchen aber auch einen Impuls, dessen weitere Auswirkungen niemand voraussagen kann.«
»Wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet es ja wohl, je genauer man den Ort eines Teilchens bestimmen kann, umso ungenauer wird die Information über das zukünftige Verhalten dieses Teilchens.«
»Genau. Kluges Mädchen.«
»Und würdest du mir bitte jetzt endlich sagen, was das Ganze mit meinem Vorschlag zu tun hat.«
»Deine Wahrnehmung meiner Person ist zwar in der Vergangenheit zutreffend gewesen, lässt aber keine Prognose für die Zukunft zu.«
»Was redest du für einen Blödsinn? Es geht nicht um Physik, es geht um das Leben, um deins und meins. Wir waren doch glücklich miteinander, trotz der elenden Pendelei.«
Er nickte.
»Stefanie, genau das ist es ja gerade. Das Licht. Unterschiedliches Licht an unterschiedlichen Orten. Du hast dich zwangsläufig in mir täuschen müssen. Ich habe mich auch in deiner Abwesenheit bewegt. Ich habe nicht aufgehört zu leben. Und zu diesem Leben gehört seit zwei Jahren auch eine andere Frau. Wir sind verheiratet, wir haben ein Kind.«
Die Sonne geriet im Dunst ins Trudeln, die Rheinbrücke schwankte, und Stefanie schaffte es mit Mühe, aufrecht zu bleiben. Mit durchgedrückten Schultern und hocherhobenem Kopf verließ sie die Brücke ohne ein einziges weiteres Wort.
Auch jetzt drückt sie die Schultern durch, hebt den Kopf und wiederholt ihre Forderung.
»Die Unschärferelation. Ich will sie auf meiner Schulter tragen.«
Linda Doorn drückt mit einer sparsamen Bewegung die Zigarette aus, ohne ihr Gegenüber aus den Augen zu lassen.
»Was ist denn nun?« Stefanies Stimme klingt aggressiv. »Stichst du mir die Formel oder nicht?«
Linda nickt und zieht gleich darauf schwungvoll einen Vorhang zur Seite. Der Korridor hinter dem Ladenraum hat kein natürliches Licht. An beiden Längsseiten stehen je zwei Liegen, über jeder von ihnen brennt eine OP-Lampe. Ein Greis sitzt auf einer der Pritschen und jault mit leise vibrierender Stimme, während Lindas Kompañera ihre Stiche setzt. Es sind eher Lust- als Schmerzlaute. Der Geruch nach verbranntem Fleisch steht in der Luft. Der faltige Altmännerkörper ist bis zur Taille nackt und durchgängig mit blauschwarzen Tattoos bedeckt. Es kann nicht leicht gewesen sein, überhaupt noch eine freie Stelle zu finden.
Stefanie muss sich zwingen, den Alten nicht ständig anzustarren. Wahrscheinlich würde es ihn noch nicht einmal stören.
»Er geht gleich, Süße, wir warten solange«, sagt Linda leise, als sie die Besucherin zu einer Liege begleitet. Den Vorhang zum Ladenraum lässt sie offen, so dass Stefanie Linda im Gespräch mit einer weiteren Kundin beobachten kann. Ohne Scham zieht die Neue sich das T-Shirt über den Kopf und entblößt schwere Brüste. Eine ist bereits mit grellbunten ineinanderfließenden Farbfeldern bedeckt. Die zweite Brust wirkt dagegen kahl und verletzlich. Linda legt eine Hand unter die schon tätowierte Brust, hebt sie an wie ein Stück Fleisch beim Metzger und studiert die Farbfelder, die die Brustwarze umgeben. Dann greift sie nach einem Fettstift und umreißt identische Felder auf der anderen Brust, die in ihrer Nacktheit fast obszön wirkt. Der Greis auf der gegenüberliegenden Pritsche hat das Jaulen eingestellt und kommentiert jetzt mit heiserer Stimme jeden Stich. Im Hintergrund skandiert eine Heavy-Metal-Band Sätze, die weder jugendfrei noch druckreif sind.
Noch könnte Stefanie fliehen. Schon steht sie auf, verlässt den Korridor, greift nach der Klinke der Ladentür. Aber Lindas kühle Hand auf ihrem Oberarm hindert sie.
»Bleib hier. Gleich geht’s los.«
Linda deutet nach hinten, wo der Greis sacht über den Pflasterverband streichelt, der seine frische Tätowierung bedeckt. Dann steht er auf. Im Vorbeigehen nickt er der neuen Kundin aufmunternd zu.
Als die Nadel zum ersten Mal Stefanies Haut verbrennt, hält sie es für einen schlechten Scherz. Sie hat mit einem leichten Stechen gerechnet, mit einem Brennen auf der Oberhaut. Aber keinesfalls damit.
In der Nacht beginnt es zu schneien, obwohl doch Hochsommer ist, und es hört nicht mehr auf, bis alle Straßen weiß sind. Leichten Schrittes läuft Stefanie durch den Schnee. Sie trägt nur ein dünnes Trägerhemd, aber sie friert nicht, denn aus der frischen Wunde an ihrer Schulter steigt Wärme auf, eine Wärme, die ihren ganzen Körper umgibt und doch den Schmerz nicht überdecken kann.
Die verschneite Stadt ist leer und still. Gespenstisch, angsteinflößend. Stefanie beginnt, Lärm zu machen, sie schlägt gegen ein Straßenschild, bis es scheppert, und wirft Schneebälle gegen Fensterscheiben, um sie zum Klirren zu bringen. Doch die Geräusche verhallen in der umfassenden Ruhe, sie finden keinen Halt in der Schneewelt. Und als Stefanie ihren Mund öffnet, um zu schreien, kommt kein Ton, nur Wärme tritt heraus und bringt den Schnee zum Schmelzen, taut die Polster auf Straßenschildern und Autodächern. Hinter den Fensterscheiben der Mietshäuser erscheinen die Bewohner und starren mit großen Augen auf das Wunder der Schneeschmelze und auf die einsame Eiskönigin.
Mit einem Stöhnen wacht Stefanie auf. Ihr Nachthemd ist verschwitzt, die Stelle an der Schulter, wo das frische Tattoo sitzt, fühlt sich taub und gleichzeitig wund an. Sie steht auf, streift das Nachthemd vom Körper und würde am liebsten unter die Dusche steigen. Aber das darf sie nicht. Linda Doorn hat es verboten, zuerst muss die Wunde heilen. Also lässt sie kaltes Wasser ins Becken laufen und fährt immer wieder mit dem nassen Lappen über Arme und Brüste, über Nacken und Bauch, wartet auf ein Gefühl von Frische, das sich bis zum Frösteln steigern soll.
Immer noch nackt bis auf das Pflaster auf ihrer linken Schulter, geht sie in die Küche, zieht den Vorhang vors Fenster und macht das Deckenlicht an. Der Lampenschein ist grell und unangenehm, nicht mit dem Schneelicht ihres Traums zu vergleichen. Stefanie schaltet die Deckenlampe aus und zündet zwei Kerzen an. Im Dämmerschein setzt sie einen Tee auf. Während er zieht, dreht sie am Radioknopf auf der Suche nach dem Jazzsender. In Wellen schwappt die Musik durch die Küche. Die Töne beruhigen sie. Noch mehr tut es die wohlmodulierte Stimme des Ansagers. Stefanie nimmt das Teenetz aus der Kanne und gießt ihren Becher halb voll. Sie riecht am Tee, Hibiskus, Frucht südlicher Gärten, dann will sie trinken, aber der Tee ist noch heiß, sie verbrennt sich die Zunge.
Die dunkle Wohnung ist warm und riecht vertraut wie ein lang geliebtes Kleidungsstück. Im Arbeitszimmer steht der Schreibtisch im matten Licht einer Straßenlaterne unterhalb des Fensters. Stefanie holt ein bordeauxrotes Fotoalbum aus der Tiefe einer Schublade und trägt es in die Küche. Die Schlaftablette des letzten Abends hat einen Schleier auf ihrer Wahrnehmungsfähigkeit hinterlassen, eine Bewusstseinstrübung, die auch im wachen Zustand das Denken erschwert, es träge und lahm werden lässt und die Scheu vor unliebsamen Erinnerungen herabsetzt. Während Stefanie den jetzt abgekühlten Tee in langen, gierigen Schlucken trinkt, schlägt sie das Album auf.
Da ist die mittlere Rheinbrücke, Basels Herzstück, mit den beiden so unterschiedlichen Ausblicken, der Hochhauslandschaft im Norden und dem lieblichen Tal im Süden. Auf den Fotos steht Stefanie in einer der halbkreisförmigen Ausbuchtungen, lehnt sich auf das steinerne Geländer, lacht oder runzelt die Stirn, droht mit dem Finger, lacht noch einmal. Auf der nächsten Seite findet sich der Physiker an derselben Stelle. Das Album hat sein gewinnendes Lächeln für sie aufbewahrt, obwohl es längst einer anderen gilt. Ein Anblick, der schmerzt. Ein Schmerz, den sie nicht länger ertragen will.
Stefanie nimmt den Deckel von der Kanne, die noch halb voll ist. Die Fotos lassen sich leicht vom Karton des Albums lösen. Die ersten versinken schnell in dem roten Aufguss. Später muss sie nachhelfen, die Fotos drücken und stoßen, sie zwischen ihre Vorgänger quetschen, hinein in den lauwarmen Tee, der jetzt schlecht riecht. Innerhalb der gläsernen Wände der Teekanne entstehen Klumpen von aufgequollenen Fotopapieren, eine Mischung von Flüssigem und Festem. Als Stefanie das letzte Foto aus dem Album löst, es in Fetzen reißt und die Einzelteile über die quellende Masse in der Kanne streut, ist kaum noch genügend Tee vorhanden, um auch dieses Foto anzufeuchten und zu seiner Auflösung beizutragen.
Wie ein fetter Kloß steckt der Inhalt des Albums zwischen den Glaswänden. Stefanie streicht ein letztes Mal leicht mit dem Finger an der Außenhaut der Teekanne entlang, hinter der verwesend der Körper des fast nicht mehr Geliebten klebt, dann öffnet sie mit ihrem Fuß den Treteimer für den Müll, wirft die Kanne hinein und drückt energisch den Deckel zu.
In der Nacht hat es geregnet. Das Straßenpflaster dampft im Morgenlicht. Die Luft ist feucht und mild und offen für Gerüche. Hundekot, Brötchenduft, Benzin. Dazu die betäubend süßen Blüten einer Pflanze, die irgendwo unten auf dem Bahngelände wachsen muss und deren Geruch Stefanie nicht kennt, noch nie wahrgenommen hat. Dabei geht sie diesen Weg täglich, immer zur gleichen Uhrzeit, morgens um halb acht. Es sind von ihrer Wohnung nur zehn Minuten zu Fuß zum Kleistpark, wo die BVG-Hauptverwaltung in einem wuchtigen Gebäude ihren Sitz hat. Zur Hauptstraße hin ist die Fassade gebogen, der breite Bau wirkt massig, markant, abweisend. Stefanie lässt den Mitarbeitereingang links liegen, auch den opulent ausgestatteten Eingang für die Öffentlichkeit benutzt sie nicht. Sie weiß, dass die Prachtentfaltung der Halle sich sofort verliert, wenn man in die nur den Angestellten vorbehaltenen Bereiche vordringt.
Am Ende des langen Gebäudes führt eine Doppelreihe von Kolonnaden in den Kleistpark, der sich als dichtbepflanzte Rotunde rücklings in die Wölbung der BVG-Zentrale schmiegt. Über vierhundert Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die drei Quertrakte teilen das staubige Grün des Parks, als seien sie Reißzähne eines Pflanzenfressers, der zufrieden grinsend seine grüne Morgenmahlzeit zu sich nimmt.
Jeden Morgen umrundet Stefanie das domestizierte Grün, hängt ihre Blicke in Zaubernuss und Forsythie, Mahonie und Schmetterlingsflieder, beobachtet das Blühen und Welken der Sträucher, deren Attraktionen kunstvoll gestaffelt sind vom Februar bis zum November. Und während sie zwischen den bröckelnden Kolonnaden hindurchläuft mit dem Blick auf vertrocknete, staubige Rhododendronbüsche, die zu Füßen abgehalfterter Göttinnen den Hitzetod sterben, denkt sie, dass es ein Fehler war, sich das Tattoo stechen zu lassen. Ein Fehler, der sie für den Rest ihres Lebens zeichnen wird.
Stefanie reißt den Blick von den Pflanzen los und mustert das Kammergericht, das auf der anderen Seite des Rondells wie ausgestorben liegt. Für die Juristen ist es noch zu früh am Morgen, nur die BVG steht auch in ihren Arbeitszeiten zu ihrer proletarischen Herkunft. Stefanie ist das recht, sie ist gern früh auf den Beinen, eine Abwehrreaktion, die sie schon in jungen Jahren entwickelt hat, um dem Schlendrian ihrer Mutter zu entkommen. Als alleinerziehende Schauspielerin war Monika Plessen selten vor der Mittagszeit auf den Beinen. Auch dann nicht, wenn sie gerade kein Engagement hatte, was leider häufig der Fall war. Fast nie hat Stefanie es gewagt, eine Schulfreundin mit nach Hause zu bringen, denn die Wohnung war klein und unaufgeräumt und die Mutter oft missmutig. Die Tochter gab ihrem unbürgerlichen Beruf die Schuld und begann, ihn zu hassen. Die festen Regeln des Schulalltags sagten der jungen Stefanie mehr zu, als das Laisser-faire, das zu Hause herrschte. Als Monika Plessen nach Jahren der Arbeitslosigkeit doch noch ein festes Engagement in der hessischen Provinz bekam, war Stefanie gerade achtzehn geworden. Sie nutzte die Chance, um ein WG -Zimmer zu beziehen, dessen Miete höchst widerwillig von dem mittelmäßigen Regisseur bezahlt wurde, der laut Geburtsurkunde ihr Erzeuger war und den sie in ihrer Kindheit nur alle ein bis zwei Jahre für ein paar Stunden zu Gesicht bekommen hatte. Mittlerweile ist der Kontakt zu ihm ganz abgerissen, und auch die Mutter meldet sich kaum noch bei ihrer Tochter, ein Umstand, der Stefanie eher erleichtert als betrübt.
Sie verscheucht die Gedanken an ihre Kindheit, blickt kurz zu ihrem Bürofenster am Kopfende eines der Quertrakte hinauf und betritt das Gebäude durch eine Hintertür. Von hier aus kann Stefanie ihr Büro ohne Umwege durch die langen Flure erreichen. Die Treppen nimmt sie im Laufschritt, um möglichst schnell der deprimierenden Atmosphäre des Aufgangs zu entkommen.
Am Ende des Korridors steht die Tür zu ihrem Zimmer offen. Heiko Wuttke, der Mitarbeiter, mit dem sie sich den Raum teilt, ist schon da. Zwei Kollegen lehnen an seinem Schreibtisch. Heiko erzählt vom Wochenende. Auf seinem Rechner läuft ein Computerspiel. Autorennen. Stefanie bittet die drei Kollegen, ihr Gespräch auf dem Gang fortzusetzen. Die Männer verdrehen die Augen beim Hinausgehen. Sie drückt die Tür hinter ihnen ins Schloss, lässt sich in ihren Schreibtischstuhl fallen und stützt den Kopf auf beide Hände.
Heiko und sie sind ein Team, theoretisch. Die Diplommathematikerin und der Wirtschaftswissenschaftler mit Fachhochschulstudium sind gemeinsam eingestellt worden und sollen eine neue Steuerungsabteilung aufbauen. Auch die BVG hat die Zeichen der Zeit erkannt und bemüht sich seit einigen Jahren um ein effizientes Leistungsmanagement. Vor allem sind Abgleiche mit anderen deutschen und europäischen Städten gefragt, eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe, wie Stefanie findet. Leider ist Heiko Wuttke nicht ganz dieser Auffassung. Stefanie hat noch nie einen Menschen mit so wenig Ehrgeiz getroffen.
Heiko, der sich selbst gern und häufig als Führungskraft bezeichnet, genügt es, die Einsatzpläne für den Berliner Bereich zu kontrollieren, die Vergleiche mit anderen Metropolen hält er für Spielereien der Führungsebene. Theoretisch ambitioniert, praktisch sinnlos.
»Funktioniert höchstens auf dem Papier«, war noch der freundlichste seiner Kommentare.
Welches Bild die anderen Mitarbeiter wohl von ihrer Abteilung haben, wenn schon ihr engster Kollege so skeptisch ist?
Stefanie blickt hinunter in den Park. Vielleicht halten alle sie für eine arme Irre, deren gesunder Menschenverstand durch das allzu lange Hochschulstudium vollends zum Verkümmern gebracht worden ist. Dafür spräche, dass ihre Vorschläge zur Fahrplanoptimierung für gewöhnlich in irgendwelchen Schubladen verschwinden, ohne jemals wieder aufzutauchen. Andererseits hat sie einen der begehrten Schreibtische mit Kleistparkblick, das gilt als Privileg. Vielleicht schätzt man sie doch mehr, als sie vermutet.
In ihrem Rücken wird die Tür aufgestoßen. »Na, auch schon fleißig bei der Arbeit«, spottet Kollege Heiko und wirft schwungvoll die Tür ins Schloss.
»Ist ja noch früh am Tag.« Sie zwingt sich zu einem freundlichen Tonfall, ohne den Blick vom Fenster abzuwenden.
Auf der anderen Parkseite torkelt ein übernächtigter Alkoholiker die Treppe zum Kammergericht hinauf, seine rechte Hand schwenkt eine Flasche. Er beschirmt mit dem linken Unterarm die Augen gegen die blendende Morgensonne und zerschlägt die Flasche mit einer schnellen, geübten Bewegung an der Metallplatte neben dem Eingang. Dann kickt er die Scherben mit seinen Turnschuhen die Stufen hinunter und stolpert selbst hinterher.
»Sieh mal den da drüben. Gleich wird er sich auf eine der Parkbänke werfen und seinen Rausch ausschlafen.«
Heiko nickt, ohne richtig hinzusehen. »Übrigens, ich muss noch mal weg. Mit meiner Taucheruhr stimmt was nicht. War ganz schön lästig im Urlaub. Also, wenn der Chef fragt, ich bin draußen. Kleine Recherche im wahren Leben wegen der Turnusumstellung beim 148er.«
»Lass dir Zeit! Ich regle das schon.«
»Danke.«
Ein letztes Krachen der Tür, dann ist Ruhe. Stefanie weiß genau, vor dem Ende der Mittagspause wird Heiko nicht wieder im Büro auftauchen. Zu viele interessante Geschäfte liegen auf seinem Weg durch die Stadt, außerdem schafft er es immer, einen der unzähligen Staus auf den Straßen Berlins zu entdecken und als Alibi für seine ausgedehnten Shopping-Touren zu missbrauchen.
Stefanie Plessen deckt Heikos Eskapaden, so gut sie kann. Für drei bis vier Stunden wird sie jetzt Frieden haben. Das sind ihr die kleinen Lügen wert. Sie fährt ihren Rechner hoch und zieht die untere Schublade ihres Schreibtisches auf. Hier verwahrt sie den Stadtplan mit den roten, grünen und schwarzen Linien, die sie in den drei Wochen von Heikos Abwesenheit in geduldiger Detailarbeit mit dem Kugelschreiber gezogen hat. Einmal im Jahr gönnt sie sich die Freude und entwirft die Routen sämtlicher Buslinien neu. Niemand hat sie je darum gebeten, es ist eher ein Hobby, man könnte es auch eine Passion, vielleicht sogar eine fixe Idee nennen.
So wie sie den Stadtplan jetzt aus der unteren Schublade zieht, verschwindet das Resultat ihrer Arbeit höchstwahrscheinlich in einer ebensolchen Schublade ihres Chefs. Sein Argument gegen ihre Vorschläge wird der Verweis auf die Fahrgäste sein. Alle wissen, dass die Kunden der BVG irritiert auf jede Umstellung der Linienführung reagieren. Niemand verabschiedet sich gern von vertrauten Dingen, auch wenn sie objektiv betrachtet umständlich oder sogar unbequem sein sollten.
Trotzdem nimmt Stefanie immer wieder Korrekturen an dieser rot, grün und schwarz gemalten Partitur vor, nach der Tag für Tag die Sinfonie der Großstadt gespielt werden könnte. Wenigstens der Entwurf soll perfekt sein. Der Gedanke, dass Dinge dem Zufall überlassen bleiben, die sie hätte kanalisieren können, die sich in Zahlen und Pläne fassen lassen, ist ihr unerträglich. Nichts würde sie lieber tun, als dem Fahrgast die Wahl zu nehmen, sie möchte, dass es für jeden eine ideale Verbindung gibt, und zwar nur diese einzige, die sie für ihn gefunden hat und für die er ihr künftig dankbar sein soll. Ihr Ziel ist nicht eine bessere, sondern die ideale Stadt.
Das Objektiv streunt durch den Park, schnüffelt, wendet sich ab, trottet weiter. Die Menschen reagieren neugierig oder verschämt. Das Objektiv ist immer gleich aufdringlich oder gleich dezent. Es ändert seinen Abstand nicht, streift Bäume, Sträucher, Bänke aus sicherer Distanz. Folgt einem Schotterweg, strandet an einem See. Fängt Türkenkinder und Buggybabys. Ignoriert einen Fußball und einen Federballschläger. Auch den Kegel eines Jongleurs, der durch die Luft saust.
Das Objektiv ist auf der Suche. Es ist geduldig und unbestechlich. Es weiß, was es will, und verschwendet seine Aufmerksamkeit nicht. Es hat Zeit, es kann warten. Nachsichtig und obszön streicht es über Körper und Haare. Falsche Körper. Von Männern oder alten Frauen. Muskulös oder faltig. Körper von Kindern. Glatt, rund, schmal. Hundekörper, Katzenkörper. Fell, Ohren, Krallen, feuchte Schnauzen.
Das Objektiv hat schon große Teile der Stadt abgesucht. Pankow, Mitte, Friedrichshain. Den Wochenmarkt vor dem Rathaus Schöneberg, den Winterfeldtplatz am Samstag und den Türkenmarkt am Landwehrkanal. Jetzt ist es hier. In Tiergarten. Doch die Linse steht still und schließt sich nie. Kein Auslöser, kein Reflex. Die Linse kann warten.
Bäume bleiben am Bildrand zurück. Sie weichen Straßen, Häusern, einer Kirche. Kulturforum, Staatsbibliothek, Neue Nationalgalerie. Glasfassade, Drehtür, polierter Granit. Menschenschlange auf der Treppe, Menschentraube vor dem Eingang. Dichtgedrängte, verschwitzte Körper. Grüne Wolle, Apfel, Fingernagel, Lockenkopf, Schriftzeichen.
Da schließt sich die Linse. Einmal, zweimal, fünfmal. Ein Ausbruch, eine Erlösung, ein Orgasmus. Das leise Klicken ein Stöhnen der Lust.
Die Stimmen der Menschen hallen laut durch das Foyer. Wer hört schon das Stöhnen? Und doch dreht die Frau sich um. Haare fliegen. Hastig schnappt die Linse ein letztes Mal zu, bevor sie sich im Schoß des Mannes zur Ruhe begibt.
Die Menschenschlange beginnt neben den verwaisten Garderoben im Erdgeschoss, schiebt sich die breite Treppe hinunter, durchmisst diszipliniert Schritt für Schritt das ganze Foyer des Tiefgeschosses. Sie besteht aus Kunstfanatikern, aus Picasso-Enthusiasten. Zwar werfen die Wartenden ihre Köpfe nervös in alle Richtungen wie ungeduldige Pferde, und ihre Füße scharren bei jeder Bewegung der Schlange auf dem Steinboden, doch niemand drängt sich vor, niemand schert aus der Reihe der Wartenden aus. Eine schlecht gefärbte Blondine strickt an einem Pullover. Der giftgrüne Wollfaden verlässt ruckartig ihre zwischen den Füßen abgestellte Patchworktasche, schlängelt sich den Frauenkörper hinauf und windet sich in engen Maschen um die Stricknadeln. Ein Herr im Nadelstreifenanzug hält einen Apfel in der Hand, in den er schamlos krachend beißt. Viel zu dicht an seiner Seite steht eine anatolische Schönheit, die abschätzende Blicke auf die Wartenden wirft, während sie ungeduldig an ihren langen Fingernägeln nagt.