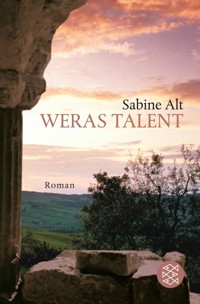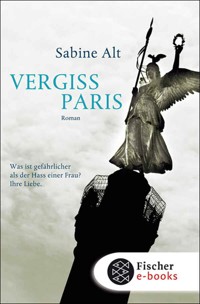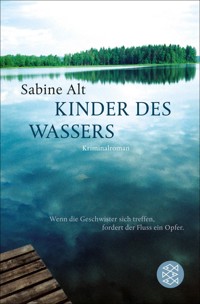
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Johanna und Jacob sind Zwillinge. Seit zehn Jahren haben sie sich nicht gesehen, seit ihr gemeinsamer Freund Jan unter mysteriösen Umständen in einem Fluss ertrank. Jetzt besucht Johanna ihren Bruder - und innerhalb weniger Stunden werden zwei Menschen tot aus dem Fluss geborgen, genau an der Stelle, an der Jan damals ertrank. Zufall? Mord? Was geschah vor zehn Jahren wirklich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sabine Alt
Kinder des Wassers
Kriminalroman
Über dieses Buch
Johanna und Jacob sind Zwillinge. Seit zehn Jahren haben sie sich nicht gesehen, seit ihr gemeinsamer Freund Jan unter mysteriösen Umständen in einem Fluss ertrank.
Jetzt besucht Johanna ihren Bruder - und innerhalb weniger Stunden werden zwei Menschen tot aus dem Fluss geborgen, genau an der Stelle, an der Jan damals ertrank. Zufall? Mord? Was geschah vor zehn Jahren wirklich?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Coverabbildung: Enholm/Etsa/Corbis
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490744-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Bochum und Paris
I
II
III
IV
V
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
Sei ruhig, o mein Schmerz, und sei besonnen.
Den Abend wolltest du; sieh her; er kam:
Ein dunkler Hauch hat schon die Stadt umsponnen,
Den einen bringt er Frieden, andern Gram.
Baudelaire: Recueillement/Besinnung
Bochum und Paris
Sommer 2003
I
Todesbilder
Auf dem hellen Marmor stehen keine Daten, nur ein Name. Jan Täuscher. Und ein einziger Satz: Du gingst zu früh.
Eine mannshohe Eibenhecke umgibt Grabstein, Beet und den kurzen Pfad aus verwitterten Steinplatten, der sich durch die krautige Bepflanzung windet. Vorsichtig betritt Johanna den Weg. Sie weiß, dass die Platten auch bei Sonnenschein glatt und rutschig sind.
Direkt vor dem Grabstein bleibt sie stehen, wirft eine Hand voll kurzer, stachliger Rosen auf die geharkte Erde und wartet. Aber nichts rührt sich in ihr, vielleicht weil der Friedhof in dieses gleißende Frühlingslicht getaucht ist, das die Besucher beschämt und die Toten verrät. Es ist vollkommen still, nur unten im Tal fährt ein Traktor. Johanna ahnt das Schlagen des Motors mehr, als dass sie es hört.
Im Laufschritt verlässt sie den Friedhof. Erst auf dem abschüssigen Waldweg wird sie langsamer. Immer wieder schimmert der Fluss zwischen den Bäumen hindurch. Jedes Mal, wenn Johanna den Fluss aus den Augen verliert, geht sie schneller. Stiege sie den Abhang hinunter, wäre sie bald an seinem Ufer, doch sie bleibt auf dem sicheren Weg. Nur einmal tritt sie nah an den Rand der Böschung. Jetzt kann sie auch das alte Schleusenhaus sehen. Schon seit Jahren fließt kein Wasser mehr durch die Metalltore. Seit man den Fluss umgeleitet und die Schleuse stillgelegt hat, sind die Becken hinter dem Haus zu flachen Tümpeln verkommen, in denen die Vögel nach Würmern picken. Und an den steilen Wänden, wo das Wasser früher schillernde Blasen geworfen hat, kleben Trockenflechten in rissigen Spalten. Doch das Rauschen des Wassers, das durch die Metalltore drängt, die Schlafmusik ihrer Kindheit, hört Johanna immer noch, als sei es niemals verstummt.
Das Holz splittert. Jacob flucht leise über ein Astloch, das er übersehen hat. Er wirft das halb fertige Stuhlbein auf den Boden und fährt sich mit der Hand durchs Haar. Staub rieselt auf seine Wimpern. Jacob blinzelt, dann muss er niesen. Mit tränenden Augen stellt er den Bandschleifer ab. In der plötzlichen Stille ist das Posaunen von Gabriel zu hören. Gabriel heißt für alle anderen Herr Blauschutz und war in seinem ersten Leben Klavierlehrer. Jetzt ist er der Erzengel persönlich und übt für das Abendmahl des HERRN, das nach seiner Überzeugung pünktlich um 18 Uhr eines jeden Tages stattfindet. Begleitet von Gabriels schiefen Posaunentönen speist dann der HERR höchstselbst – unsichtbar, aber zweifelsfrei anwesend – auf der Terrasse vor dem Klinikgebäude. Die falschen Läufe aus des falschen Erzengels Posaune werden von den anderen Patienten klaglos, fast respektvoll ertragen und nur selten von Jacobs leise korrigierenden Bemerkungen unterbrochen. Außer ihm darf niemand es wagen, in die sakralen Handlungen von Herrn Blauschutz einzugreifen. Denn das Instrument, auf dem der selbst ernannte Erzengel zum Abendmahl aufspielt, die ein wenig verstimmte, aber klangvolle Posaune, ist eine Leihgabe von Jacob.
Er bückt sich, um das Stuhlbein aufzuheben. Er wird den Riss leimen und das Werkstück weiterverwenden. Jacob liebt seine Arbeit. Trotz Staub und Lärm, trotz der Monotonie, die das tägliche Zusammenflicken von immer wieder zertrümmerten Möbelstücken mit sich bringt. Während das geleimte Stuhlbein in der Schraubzwinge trocknet, räumt Jacob auf. Die reparaturbedürftigen Stücke in die Ecke, die reparierten neben die Tür.
In der Schleusenklinik geht das Wenigste durch Abnutzung kaputt. Häufig lassen die Patienten ihre Wut an den Möbeln aus. Stühle sind beliebte Wurfgeschosse.
Jacob schultert zwei aufgearbeitete Exemplare und trägt sie hinaus in den Garten, wo ein junges Mädchen auf einer Bank neben dem Erdbeerbeet sitzt. Die Pflanzen sind mit winzigen weißen Blüten übersäht, die Ernte wird üppig ausfallen. Aber der Blick des Mädchens wandert leer über den großen gepflegten Garten, der im Anstaltsjargon »Patienten-Park« genannt wird.
Irre arbeiten gern mit Hacke und Spaten.
Es ist ein warmer Apriltag. Jacob trägt eine Jeans und ein T-Shirt. Er ist neunundzwanzig Jahre alt, nicht besonders groß, aber schlank, nur seine Arme und die Brustmuskulatur sind von der körperlichen Arbeit der letzten Jahre so kräftig geworden, dass Jacob seinen eigenen Kopf manchmal als zu klein empfindet. Obwohl er sich selbst für eine auffallende Erscheinung hält, muss er feststellen, dass er durch die Blicke des Mädchens geht wie ein Geist.
Vor der Bank bleibt Jacob stehen. Das Mädchen ist mager und hat die Haare zu zwei Zöpfen geflochten, die wie schlappe Schlangen neben ihren schweren Brüsten hängen. Sie trägt ein T-Shirt in einem grellen Apfelgrün, das zu weit für ihren schmalen Körper ist. Aus dem Ausschnitt, der verrutscht auf den Mädchenschultern liegt, ragen die knochigen Schlüsselbeine hervor. Immer noch sieht das Mädchen durch Jacob hindurch.
»Sind Sie neu bei uns?«, fragt er leise.
»Nein.« Ihre Stimme ist ein Hauch.
»Ich habe Sie noch nie gesehen.«
Das Mädchen schweigt, nur ihr Blick flackert leicht.
Jetzt sieht auch sie Jacob zum ersten Mal.
»Soll ich Ihnen den Fluss zeigen?«
Mit einer vagen Geste deutet Jacob hinüber zur Grundstücksgrenze. Hinter den Kräuter- und Gemüsebeeten kommen die Rosenrabatten. Und dahinter stehen Birken dicht an dicht, sodass sie den meterhohen Zaun verdecken, der das Gelände umgibt und die Patienten vor den Verlockungen des Wassers schützen soll. Nur wenige haben einen Schlüssel zur Pforte im Zaun. Jacob ist einer von ihnen.
»Der Fluss interessiert mich nicht«, sagt das Mädchen unerwartet klar und blickt Jacob direkt ins Gesicht.
»Das ist nicht wahr.«
Lächelnd hebt Jacob die Stühle auf und geht grußlos davon. Als er die Pforte im Zaun aufschließt, ist er sicher, dass der Blick des Mädchens ihm diesmal gefolgt ist.
Jenseits des Zauns ist das Grundstück verwildert. Der graue Fluss zerschneidet Wiesen voller Klee und Unkraut. Träge verzweigt sich der Fluss in überflüssig scheinende Arme, um sie an der nächsten Biegung wieder zusammenzuführen. Inmitten der Wasserläufe steht das alte Schleusenhaus, umgeben von Becken und Wegen aus Gussbeton. Früher schoss das Wasser in stündlichem Rhythmus in die Kammern, und ein fortwährendes Rauschen erfüllte die Luft bis weit hinauf zur anderen Talseite, wo Jacob aufgewachsen ist. Jetzt steht in den brüchig gewordenen Becken ein grünliches Brackwasser, auf dessen Oberfläche Algen und tote Insekten schwimmen. Und in dem alten Kamm vor dem ersten Staubecken, der früher dafür sorgte, dass kein Treibgut in die Schleusenanlage geriet, verfangen sich nur noch zufällig einzelne Gegenstände und verkommen zwischen den rostigen Zinken. Auch das eiserne Geländer der schmalen Holzbrücke, die über einen Seitenkanal zum Schleusenhaus führt, ist längst verrostet.
Der lang gestreckte Bau dient der Klinik seit Jahren als Lager. Von der ungepflegten Fassade blättert die grüne Farbe ab, doch das massive Holztor ist mit Jacobs Schlüssel zur Zaunpforte ganz leicht zu öffnen.
Ein schwerer Geruch von altem Maschinenöl schlägt ihm entgegen. Die ausrangierten Maschinen beherrschen den hohen Raum, an dessen Wänden zwei Fensterreihen übereinander liegen. Aus allen vier Himmelsrichtungen fällt das Licht auf rostiges Metall und bringt die Staubteilchen zum Flimmern, die Jacob mit jedem Schritt aufwirbelt. Die von ihm reparierten Betten, Tische und Nachtschränkchen stehen längs einer Turbinenwelle zu wackligen Haufen getürmt und warten darauf, dass der Hausmeister sie abholt, um sie gegen kürzlich zerstörtes Mobiliar auszutauschen.
Jacob stellt die beiden Stühle zu den anderen Möbeln. Dann tritt er nah an das Endteil der Welle heran, das in einem gusseisernen Getriebegehäuse verschwindet. Unter dem Gewicht der schweren Maschine ist im Lauf der Jahrzehnte ein handbreiter Riss im Beton entstanden. Nur Jacob kennt diesen Riss, der im Schatten, den das Metallmonster wirft, kaum zu sehen ist. Hier hat Jacob seine wenigen Schätze versteckt, ein Bündel Briefe und ein Tagebuch. Die Briefe tragen alle die gleiche Handschrift, es sind die klaren Buchstaben einer Frau, rund und schnörkellos. Neun Kuverts aus hellgrauem Leinenpapier liegen ungeöffnet in der Spalte unter dem Getriebe. Und auch der zehnte Brief, den Jacob jetzt aus der rückwärtigen Tasche seiner Jeans zieht, wird ungelesen bleiben, weil Jacob ihn zu den anderen legt, ohne die Gummierung des Umschlags auch nur angerührt zu haben.
Hastig verlässt er das Schleusenhaus, wirft das breite Tor hinter sich ins Schloss und stürmt zu der Brücke über dem Kanal. Erst jetzt nimmt er den Geruch nach verwestem Fisch wahr, der von dem Brackwasser aufsteigt. Die Holzplanken der Brücke sind trocken und trittsicher, trotzdem muss sich Jacob am Geländer festhalten. Warum setzt er seinen Fuß so zögernd auf die Bretter, die er doch täglich betritt? Unter seinen Füßen kräuselt sich das Wasser. Was wäre, wenn Jacob hineinfiele? Dem Geländer fehlt jede Querverstrebung, umstandslos würde er unter der Griffleiste hindurchrutschen. Aber er weiß, dass das Becken nicht tief ist. Jacob erreicht die Mitte der Brücke, jetzt wäre der Weg zurück auch nicht kürzer als der Weg hinüber. Der Gedanke ermöglicht ihm die letzten Schritte und schließlich den Sprung von den federnden Balken auf den Weg. Atemlos erreicht er die Pforte im Zaun. Im Laufschritt passiert er die Reihe der Birken – und bleibt plötzlich stehen.
Schon von weitem sieht er die Fremde.
Der Nebelschleier, der sich in seinem Kopf ausbreitet und alle Erinnerungen frisst, fühlt sich leicht und angenehm an. Jacob denkt gar nicht daran, ihm einen Widerstand entgegenzusetzen.
Die Frau ist nicht älter als er, schmal und so groß wie er selbst. Zu groß für eine Frau, zu groß, um anmutig zu gehen. Sie hat kurzes, dunkles, struppiges Haar. Es ist sicher weich, denkt Jacob, und in seinen Fingerkuppen wächst das Verlangen. Als die Frau den Weg bis zum Erdbeerbeet gegangen ist und neben dem sitzenden Mädchen stehen bleibt, erreicht ihn ihre Stimme.
»Jacob! Warte!«
Die Stimme ist tief und melodisch wie die einer Sängerin. Das Erdbeermädchen unterbricht seine Zwiesprache mit dem Nichts, um die große Frau zu mustern, die nach Jacob gerufen hat und ihm nun entgegenläuft. Plötzlich erinnert sich Jacob an die Fremde. Eine Folge von Bildern, die gerade durch leichte Abweichungen in der Zeichnung ihre Ähnlichkeit betonen, zieht vorüber. Jedes Frühjahr taucht diese Frau für wenige Stunden auf dem Gelände der Schleusenklinik auf. Wahrscheinlich gilt sie längst als geheilt und macht jährlich wiederkehrende melancholische Besuche. Allerdings sollte sie sich besser nicht von einem der Ärzte dabei ertappen lassen, wie sie ihn mit flackernden Blicken mustert.
»Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas?«
Jacob spricht langsam, deutlich und leise, genau wie vorhin mit dem Erdbeermädchen. Man hat ihn zu Beginn seiner Tätigkeit darum gebeten. Es ist eine unaufdringliche Demutsgeste, die im Allgemeinen gut von den Kranken aufgenommen wird.
Doch die Unbekannte reagiert wütend. Ihre Stimme kippt. Jacob versteht ihre Worte nicht. Jetzt greift die Frau nach seinem Arm. Ihr Atem riecht nach Kaffee und Zitrone.
»Haben Sie Kopfschmerzen?«, fragt Jacob mitfühlend.
»Ja. Woher weißt du das?«
Dass sie ihn duzt, stört Jacob nicht, das tun hier fast alle.
»Der Geruch.« Jacob zeigt auf ihren Mund. »Meine Mutter hat diese Mischung aus Kaffee und Zitronensaft immer getrunken, wenn sie Migräne hatte.«
»Ich weiß«, antwortet die Fremde.
Manchmal kann selbst Jacob den Irrsinn, der ihn umgibt, nicht mehr ertragen. Jetzt ist so ein Moment. Er heftet seinen Blick schnell auf das Erdbeermädchen, das sich gerade mit beiden Armen von der Parkbank hochstemmt, als müsse es gegen große Widerstände ankämpfen. Dabei beugt es den Oberkörper so weit nach vorn, dass Jacob ihre nackten Brüste sehen kann. Doch schon richtet das Mädchen sich auf und schlurft mit hängenden Schultern zu den Birken hinüber. Jacob würde ihr wirklich gern den Fluss zeigen, obwohl das streng verboten ist. Aber er kann nicht weg, die fremde Frau krallt sich an seinem Arm fest und krächzt:
»Jacob, hör auf mit dem Theater! Du weißt genau, wer ich bin. Johanna!«
Ohne sich zu besinnen, schlägt Jacob nach ihrer Hand.
Auf der Terrasse des Haupthauses erscheint ausgerechnet jetzt die neue Stationsärztin. Noch ist sie in ein Gespräch mit Dr. Habicht, dem Oberarzt, vertieft, aber es kann nicht lange dauern, bis beide ihn und die fremde Besucherin entdecken werden. Jacob weiß instinktiv: Das muss er verhindern. Doch er weiß nicht, warum. Er will das Erdbeermädchen einholen, bevor es zwischen den Birken verschwindet. Das Erdbeermädchen ist wichtiger als diese Fremde, deren Geruch nach Kaffee und Zitronen ihn wütend macht und wahrscheinlich auch den Nebel in seinem Kopf verursacht. Bevor sie wieder nach ihm greifen kann, läuft Jacob mit eiligen Schritten dem Mädchen im grünen T-Shirt hinterher.
Ein Rütteln, das in seiner Regellosigkeit immer von neuem ins Gleichmaß fällt, das leise Kichern von zwei jungen Mädchen auf den Fensterplätzen. Der Wechsel von Hell und Dunkel hinter geschlossenen Lidern, viel zu schnell für Erinnerungen an die Wirklichkeit. Die Rückenlehne gerade, aber den Kopf notdürftig gestützt durch die Rundungen der senfgelben Polster aus Plastik. Wie beim Zahnarzt, denkt Johanna, jetzt ist es wieder dunkel, aber doch kein Tunnel, nur flaches Land, Nordfrankreich.
Das Knallen entfernter Abteiltüren, das Tuscheln der Mädchen am Fenster, das Rattern der Räder auf den Schienen, all dies macht den Hals geschmeidig und lässt die Beine vibrieren. Ein Knie rutscht weg, ins weiche Fleisch der Nachbarin, pardon Madame, pardon, hell, dunkel, hell, Baum, Lücke, Baum, Lücke, Baum.
Johanna steigt breite Stufen hinab, eine Treppe ohne Geländer, blauer Beton, eigentlich grau, aber jetzt eher blau, purpur, violett. Die Farbe gefällt Johanna, ein weicher Wind trägt sie auf, die jungen Bäume am Flussufer neigen sich im Takt. Es ist vollkommen ruhig, wie hinter Glas, in der Ferne rauscht ein Zug. Sanfte Wellen überziehen die Treppenstufen, lautlos, regelmäßig. Ein Fliegenschwarm wogt in der Luft, warm und feucht streicht der Wind über das Wasser.
Johannas Gummisohlen treten sicher auf Algen und Moos, ein krautiges Grün verdrängt das Blau des Betons. Die Treppe führt tief hinunter, vielleicht bis auf den Grund des Flusses. Das Wasser macht schwappende Geräusche in Johannas Leinenschuhen, es kühlt ihre Knöchel und benetzt ihre Hosenbeine.
Rostige Haken ragen aus dem Beton. An einem hängt ein zerfaserter Strick. Er endet an Jacobs Handgelenk. Der Männerkörper treibt rücklings auf dem Wasser. Die Augen des Toten sind offen. Seine Haare umgarnen ein Seerosenblatt, das dunkle Blond schimmert rötlich. Er hat sich die Haare gefärbt, denkt Johanna verwundert. Doch Jacobs Pullover sieht aus wie immer, seine Jeans haben die Farbe des Betons, und seine Füße sind nackt. Die Mokassins stehen ordentlich nebeneinander auf der Treppe. Johanna lächelt den Schuhen zu und steigt weiter hinab. Der reglose Körper gleitet aus ihrem Gesichtsfeld.
Der Zug hält so plötzlich, dass Johanna fast von ihrem Sitz rutscht. Im Abteil entsteht Bewegung, die korpulente Dame vom Nebensitz schiebt sich an Johanna vorbei und öffnet lautstark die Tür. Johanna schließt die Augen und versucht, das Traumbild festzuhalten. Auf dem Gang dröhnen Stimmen, Koffer krachen gegen die Abteilwand, Johanna zieht den Vorhang vor das Fenster. Der Zug fährt wieder los und findet zu seinem alten Rhythmus zurück. Der Platz neben Johanna bleibt leer, sie vermisst die Wärme an ihrer Seite. Auch die Treppe glänzt nicht mehr violett, die Sonne ist untergegangen und das Flusswasser unfreundlich und kalt.
Am Gare du Nord bleibt Johanna unschlüssig neben ihrer Tasche stehen. Es nieselt. Die Bahnhofsuhr zeigt drei Uhr nachmittags. Johanna weiß, dass Ludwig sie frühestens am Abend zurückerwartet. Einen halben Tag hat sie noch für sich, einen Rest nutzloser Stunden, ein Niemandsland aus Zeit, das eigentlich ihrem Treffen mit Jacob gehören sollte, diesem quälenden Ritual, das alljährlich misslingt, weil Jacob vor Jahren schon aus der Zeit getreten ist.
»Vouz voulez une chambre? A nice room? Zimmer?« Der Junge ist höchstens zwölf, aber die Zigarette hält er lässig zwischen Daumen und Zeigefinger. Johanna schüttelt den Kopf. Manchmal wünscht sie sich, keine anderen Sprachen zu können. Das Leben ist leichter, wenn man weniger versteht. Eine Gruppe von Rentnerinnen drängelt sich an ihr vorbei. »Pardon mademoiselle, bonjour ma chère, ça va bien?« »Ça va, ça va.« Die Haare der Damen sind lila verfärbt, und in ihren tiefen Falten sitzt das Make-up wie Spachtelmasse. Schnatternd erreichen sie die Treppe.
Plötzlich ist der Bahnsteig leer.
Das Grau des Bodens erinnert Johanna an etwas. Sie kommt nicht gleich darauf. Dann sieht sie wieder die Treppe aus Beton und Jan Täuschers rotblonde Haare auf Jacobs Kopf zwischen den Blättern der Seerose. Das Traumbild hätte beiden gefallen. Sie mochten Seerosen. Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. Die Baudelaire-Zeile hat das Rütteln der Bahnfahrt überlebt, jetzt lockt sie Johanna zum Cimetière Montparnasse. Vielleicht hat der Regen die Touristen vertrieben, und Johanna kann ungestört an Baudelaires Grab ausruhen.
In den langen Gängen hinunter zur Metro spürt sie das Gewicht ihrer Reisetasche. Immer nimmt sie zu viele Bücher mit, als sei es eine Sünde, nichts zum Lesen zu haben. Die Fliesen an den Wänden sind erstaunlich sauber, aber vorn an der Ecke steht schon der erste Bettler.
»Pas de travaille, pas de monnaie, pas de billet du cinéma, mesdames, messieurs, un euro de chaque personne, ça, ce n’est pas trop.«
Johanna greift nach ihrem Portemonnaie. Unten rauscht die Metro, und die Treppe will gar kein Ende nehmen. Als sie den Bahnsteig erreicht, keuchend wegen der schweren Tasche, ist der Zug weg. Doch da kommt schon die nächste Metro, alle Wagen sind voll. Rushhour, gibt es dafür einen französischen Ausdruck? Natürlich gibt es einen, warum fällt er Johanna nicht ein? Heiße Luft wabert durch den Waggon, den sie besteigt, der bullige Mann neben ihr riecht sauer. Nur nicht den Rucksack loslassen, vorhin hat die Bahnaufsicht gerade wieder vor Trickdieben gewarnt. Johanna sucht nach einer stabilen Haltung und lässt den Blick schweifen. So viele Schwarze hat sie lange nicht mehr gesehen. Glatte glänzende Haut, Männer mit kahl rasierten Köpfen. Eine Flasche scheppert dumpf auf den Linoleumboden. »Merde«, krächzt es von schweren Lippen, Johanna riecht den Weinbrand. Der Zug hält, die Flasche schlittert über den Boden, der Betrunkene kriecht, unverständliche Flüche lallend, hinterher. Das Pärchen neben Johanna züngelt heftig, zwischendurch reicht der junge Mann dem Bettler einen Euro, das Züngeln muss er dafür gar nicht unterbrechen.
Der Bettler zeigt sich erkenntlich. »Bonne chance, monsieur.« Sein Lachen klingt höhnisch.
Johanna denkt darüber nach, dass Ludwig sie noch nie in der Öffentlichkeit geküsst hat. Vor vier Jahren begegnete sie ihm zum ersten Mal. Johanna betrat seine antiquarische Buchhandlung als Kundin und blätterte lange in einer Prosa-Anthologie aus den Fünfzigern. Als sie schon auf dem Weg zur Tür war, hielt Ludwig sie am Arm fest. Johanna blieb sofort stehen und zog schuldbewusst die Anthologie unter ihrem Pullover hervor.
»Ich bekomme erst in der nächsten Woche mein monatliches Stipendium überwiesen. Ich hatte Angst, dass das Buch dann nicht mehr da sein könnte.«
Ludwig ließ ihren Arm los und sagte: »Wenn Sie heute Abend mit mir essen gehen, schenke ich Ihnen den Band.«
Daraufhin sah Johanna nicht ihn, sondern das Buch an. Mehrmals strich sie nachdenklich über den Leinenumschlag, bevor sie schließlich nickte und die Einladung annahm.
Ludwig ist unruhig. Seit dem Morgen kann er sich nicht konzentrieren und läuft alle Viertelstunde auf der Suche nach Ablenkung durch sein Haus. Immer wieder zieht es ihn in die beiden Dachzimmer, die Johanna vor wenigen Monaten bezogen hat. Heute Abend erwartet er seine Freundin zurück. Ihr Schreibtisch ist unordentlich wie immer, und in einem der Regale sind einige Bildbände umgefallen. Monet, Degas, Sisley. Ludwig richtet die Bücher mechanisch wieder auf. Als er den Raum verlassen will, bemerkt er, dass die Kanten der Bildbände über den Regalboden hinausragen. Ein kurzer Stoß gegen die Bücherrücken hilft nichts, also zieht Ludwig die Bücher heraus. Vielleicht ist ein schmalerer Band oder ein schlecht gebundener Ausstellungskatalog dahintergerutscht.
Tatsächlich, es steckt wirklich etwas dahinter. Ein altes Fotoalbum. Dem gedrungenen Format nach muss das Album aus Johannas Kindheit stammen. Es ist in weinrotes Kunstleder gebunden, das unter einem Zellophanbezug seine Farbe bewahrt hat. Nun löst sich das brüchige Zellophan vom Kunstleder und knistert unter Ludwigs Fingern.
Auf den ersten Doppelseiten kleben Ferienfotos in verblassten Farben. Ein junges Paar vor einem himmelblauen Käfer. Ein verwaschenes Mittelmeer hinter einer lachenden Frau im züchtigen Badekostüm. Ein Tisch mit einem karierten Tischtuch, auf dem ein Spaghettigericht und eine Bastflasche stehen.
Die nächste Doppelseite ist leer. Wäre Ludwig nicht beim Zuklappen ein loses Foto entgegengesegelt, hätte er das Album wieder zwischen die Bildbände geschoben. Er hält sich nicht für übermäßig neugierig. Niemals würde er heimlich in den persönlichen Dingen der Frau wühlen, die er liebt.
Aber das Foto, das nun vor Ludwigs Füßen auf dem Teppichboden liegt, passt nicht zu der vergilbten Adria-Romantik der anderen Bilder. Obwohl es einen altmodischen Büttenrand hat, muss diese Aufnahme sehr viel später entstanden sein. Sie zeigt ein Brautpaar. Mann und Frau nebeneinander, er schwarz, sie weiß gekleidet. Zwei strahlende Gesichter, die erstaunlich ähnlichen Profile einander zugewandt. Im ersten Moment denkt Ludwig, es handele sich um die beiden jungen Leute von den ersten Seiten. Gut möglich, dass sie später geheiratet haben. Doch das Paar auf dem Foto ist jünger – nicht nur jünger als die Italienurlauber, sondern viel zu jung, um überhaupt heiraten zu dürfen.
Schnell erkennt Ludwig, was ihn zu seiner irrigen Annahme verleitet hat. Der Junge im Frack und das Mädchen im Brautkleid sind den beiden Adriatouristen ähnlich. Wenn sie sich gegenseitig auch weitaus mehr gleichen. Schmale Gesichter, hohe Stirnen, kleine Nasen, übermäßig große Augen unter dunklem Strubbelhaar. Bei dem Brautpaar muss es sich um Geschwister handeln – und bei den Italienreisenden um deren Eltern.
In der Braut auf dem Foto Johanna zu erkennen, ist nicht schwer. Doch Johanna ist als Einzelkind aufgewachsen, so hat sie es immer erzählt. Und es gab für Ludwig bisher nicht den geringsten Grund, an ihren Worten zu zweifeln.
Energisch schiebt er das Foto in das Album zurück, ohne nach weiteren Bildern zu suchen. Er versteckt das Album sogar wieder hinter den Bildbänden. Dann verlässt er Johannas Zimmer und greift nach dem Schlüsselbund für sein Ladengeschäft. Am Vortag ist ein Karton mit Ostasiatika angekommen, aufgekauft aus dem Nachlass eines Filmregisseurs. Ludwig hatte ohnehin vor, den Bestand schnell zu prüfen, um die Bände noch in den nächsten Katalog aufnehmen zu können.
Ludwig geht zu Fuß, das Antiquariat liegt nur wenige Minuten von seinem Haus entfernt. In den beiden dämmrigen Räumen ist es so kalt, dass Ludwig den elektrischen Heizkörper anstellt. Die warme Luft ist nicht gut für die alten Bücher, aber es nieselt seit Tagen, und die Feuchtigkeit, die durch alle Fenster dringt, schadet den Büchern noch mehr. Außerdem friert Ludwig nicht gern.
Er kauert sich auf das brüchige Parkett, öffnet die Büchersendung und breitet die großformatigen Bände mit Zeichnungen und Farbdrucken vor sich aus. Dann unterbricht für lange Zeit nur Ludwigs Blättern die schwebende Stille. Doch der Frieden, der sonst bei dieser Beschäftigung über Ludwig kommt, will sich heute nicht einstellen. Immer wieder sieht Ludwig Johanna vor sich, wie sie beim Abschied vor fünf Tagen auf dem Bahnsteig stand. Schroff, beinahe herzlos und ohne Gruß ist sie in den Zug gestiegen, den Wind im kurzen Strubbelhaar. Aus dem Abteilfenster hat sie dann doch noch gewinkt. Er nahm Johanna ihr Verhalten nicht übel, er tut es auch jetzt nicht. Er kennt sie zu gut. Manchmal muss sie schroff sein.
Unruhig steht Ludwig auf, lässt die Bildbände am Boden liegen und verlässt den Laden. Ein Milchkaffee und ein kleines Mittagessen werden ihm gut tun. Das Straßencafé ist bis auf zwei greisenhafte Stammgäste leer. Auf der Terrasse ist es kühl, das Pflaster glänzt vom morgendlichen Regen. Außer Ludwig sitzt niemand im Freien. Er studiert das Gemüsesortiment des Ladens gegenüber. Auberginen, Brokkoli, Kohlköpfe, Weintrauben. Der vietnamesische Besitzer kennt keine Schließungszeiten. Während er mit dem Nachbarn plaudert, rührt seine Frau hinter der Kasse eine Sauce fürs Familienessen, die Zutaten nimmt sie direkt aus den Regalen. Auf der Straße zeichnen ihre Kinder mit bunter Kreide Kästchen aufs Pflaster.