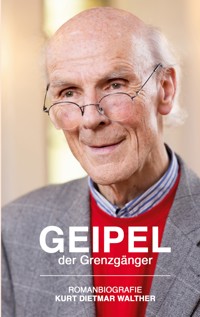
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roland Geipel ging 1957 aus der DDR in die Bundesrepublik und kam nach zwölf Jahren nicht nur der Liebe wegen zurück. Als Ausreisepfarrer und Bürgerrechtler half er so manchen Stein aus der Mauer zu brechen. Dabei überwand er selbst eigene Grenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Frau Helga und meine Söhne Sascha und Björn
Inhalt
Teil I
1 Im Osten
Donner über den Feldern
Das Koppelschloss
Der Bote
Kartoffelfeuerrauch
Die Insel auf der Weide
Ausgebremst
In die Höhe geschossen
Kreppsohlen und Ringelsocken
Soll das alles sein?
Macht`s gut!
2 Im Westen
Wirtschaftswunderland
Uniform, Kasernenhof…
Unverhofftes Wiedersehen
Verschwundene Träume
Dienst am Kunden
Bodelschwingh
Susanne
In geheimer Mission
Außer Atem
Visionen und Realität
3 Wieder im Osten
Die Zäsur
Niemandsland
Kein Kontakt zur Außenwelt
„Teestunde“ mit Becker
Der wunde Punkt
Sauberer Vorteil
„Mitnahme ohne Bedenken“
Teil II
1 Aufbruch
Zurück zu den Wurzeln
Wem kann er trauen?
Mit Käppi und Koppel
Kopf im Wind
Eine Frage der Perspektive
Ziegenrück
Aktion „Kerze“
2 Betroffenheit
Heute wird sie es ihm sagen
Die Antwort
Altar der Wahrheit
Erntedank
Die Messer
3 Sturm
Nur über mich!
Noch unter Waffen
Der Aufruf
Akten
Bergsteiger
Torhaus
Kopfstand
EPILOG
Erinnerung
Dank
Teil I
1 Im Osten
Donner über den Feldern
April 1945
Der böige Frühlingswind schlug immer wieder dicke Regentropfen an die Fensterscheibe. Sie flossen von Tropfen zu Tropfen in schmalen, langen Bahnen wie kleine Bäche über Rahmen und Fensterblech ab. Blitze zuckten durch die dunklen Wolken, Donner grollten. Roland, der in der Küche vor dem Fenster auf einem Stuhl kniete, verfolgte die Wasserläufe mit dem Zeigefinger. Als er mit seinem Gesicht dem Glas zu nahekam, schlug sich an der Scheibe sein Atem nieder. Kurz innehaltend begann er kleine Kreise zu malen, versuchte ein Mondgesicht und übte schließlich ein großes A, wobei die Zunge tüchtig half. Seine Oma Lidda hatte ihm den Buchstaben vor ein paar Tagen gezeigt und gesagt, dass er noch dieses Jahr in der Schule das ganze Alphabet lernen würde.
Leider konnte er jetzt durch die Fensterscheibe im Dachgeschoss nicht die schöne Aussicht genießen, die sich ihm von seinem Lieblingsplatz aus sonst bot. Bei klarem Wetter schweifte sein Blick vom Fenster des dreistöckigen Hauses in der neuen Eisenbahnersiedlung im sächsischen Leubnitz über den Hof, die Hausgärten und die weiten Felder bis zu den leicht geschwungenen Bergen des Vogtlandes und des Erzgebirges. Dort waren vor einigen Wochen im März noch weiße Flecken zu sehen. Hier im Wiesenweg drangen schon Schneeglöckchen und andere Frühblüher aus dem Boden.
Die Pfützen im Hof wurden immer größer. Nach jedem Blitz und Donnerschlag schien der Regen stärker zu werden. Nur gut, dass Oma da war. So fühlte sich Roland sicher. Sie stand am Herd und kochte Suppe. Hin und wieder schaute sie ihrem Enkel zu, wie er sich die Zeit vertrieb. Der war zwar sehr geduldig, aber wenn sich das Wetter nicht bald besserte, musste sie sich etwas einfallen lassen, um den wissbegierigen Jungen zu beschäftigen. Ein Zahlenspiel wäre vielleicht am besten. Bis zehn konnte er schon zählen. Ihr Mann, Opa Willy, hatte ihm auf diese Weise beigebracht, wie weit ein Gewitter entfernt sei. Roland musste die Zahlen vom Blitz bis zum Donner aufsagen. Im Augenblick kam er bis sieben. Vorhin zählte der Kleine gerade mal bis drei. Also zog das Aprilgewitter zum Glück langsam ab.
Wo Opa nur bleibt, dachte Roland und drehte sich zu Oma um, die mit einem Löffel im Topf rührte. Der Großvater war früh ohne ihn mit dem Handwagen in den Wald gegangen, um Brennholz zu sammeln. Er hatte gemerkt, dass ein Gewitter in der Luft lag. Sein Rücken täuschte ihn nie.
Das Unwetter dauerte schon einige Zeit. Die Oma beruhigte das Kind und strich ihm liebevoll über das schwarze Haar: „Bestimmt hat sich Opa in der Waldhütte untergestellt.“ Insgeheim machte sie sich aber selbst Sorgen.
Gestern, am Sonntag, dem 15. April, feierte die Familie Geipel Rolands sechsten Geburtstag. Aus diesem Anlass hatte ihm die Oma statt des üblichen Ponys einen adretten Scheitel frisiert. Schließlich war Roland bald ein Schulkind. Ansonsten fiel die Feier in den Kriegszeiten bescheiden aus. Seine Tante Elsbeth kam mit ihrer Tochter aus Steinpleis zu Besuch. Am meisten freute sich der Junge über das kleine Pferd, das ihm der Opa schnitzte. Es passte gut in seinen Spielzeugbauernhof.
Der Regen ließ nach. Roland wäre am liebsten sofort die Treppe hinuntergelaufen und in die Pfützen gesprungen wie im vergangenen Jahr. Nun wartete er, dass er endlich die lästigen langen Strümpfe ausziehen und in kurzen Hosen barfuß spielen gehen konnte. Nur die Oma musste er davon noch überzeugen.
Das Gewitter verabschiedete sich mit einem Donnergrollen. Oma Lidda stellte zwei Teller mit Kohlrübensuppe auf den Tisch und rief Roland. Der löffelte gleich los. Die Großmutter sah ihm nachdenklich beim Essen zu. Sie wünschte sich, mal etwas Ordentliches auftischen zu können. Rouladen mit Klößen und Rotkraut oder ein Schnitzel ... Davon konnte sie im siebten Kriegsjahr nur träumen. Ihr kleiner Enkel Roland war fast genau so alt wie dieser verheerende Krieg, der nun mit Bomben nach Deutschland zurückgekommen war. Sie betete, dass die Familie weiter verschont blieb, dass niemand beweint werden musste.
Oma Lidda dachte an ihre Tochter Helene, Rolands Mutter, und trat an den Herd. Sie öffnete die Ofentür und legte ein Brikett in die schwachen Flammen. Helene hatte sich noch vor der schweren Geburt Rolands vom Kindesvater, der wesentlich älter als sie war, getrennt. Was von ihm blieb, waren ein Foto und eine Postkarte, die er ihr kurz vor Weihnachten 1938 schrieb. Auf dem Werdauer Bahnhof trafen sie sich zum letzten Mal. Helene war traurig, freute sich aber zugleich auf das Kind. Sie nannte ihren Jungen Roland, den „Schildträger“. Die Oma musste ihm manchmal erklären, was das bedeutet: ein selbstbewusster, wagemutiger Mann.
Lidda sah in Gedanken versunken zum Fenster. Rolands dünne Suppe schmeckte eigentlich nach gar nichts. Obwohl er stets das Dicke vom Grund des Kochtopfes bekam, musste er sich wie die anderen schon seit einigen Jahren mit dem faden Geschmack abfinden. Es gab fast jeden Tag das Gleiche: Kohlrübensuppe.
Der Junge blickte beim Löffeln immer wieder auf seinen kleinen Teller. Dort waren Zwerge aufgemalt. Zwischen ihnen und seinem Mund lag nur noch ein flacher, durchsichtiger See, den er jetzt auslöffeln musste. Gleich konnte er das Märchenbild vom Schneewittchen besser sehen.
Auch als Helene vor drei Jahren in Dessau, wo sie nach ihrem Pflichtjahr in den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken weiterarbeitete, den Soldaten Erich heiratete, ging es schief. Er war danach in Belgien aus der Wehrmacht desertiert und schrieb ihr, dass er dortbleiben würde. Eine Frau hätte ihn im Wald versteckt. Helene meldete dies auf Drängen der Schwiegereltern den Behörden und ließ sich von ihm scheiden. Später wurde er von der Feldgendarmerie aufgegriffen und in einer Festung inhaftiert. Das rettete ihm wahrscheinlich das Soldatenleben.
Das Donnergrollen wurde wieder stärker. Roland blickte zum Fenster, doch der Himmel war hell. Plötzlich begannen die Teller auf dem Tisch leicht zu vibrieren. Die Suppe zog Kreise. Im Küchenschrank klirrten Gläser. Erschrocken stand Roland auf und drückte sich an seine Oma, die ihn beschützend in ihre Arme nahm. „Was ist das?“, fragte er. Sie wusste darauf keine Antwort. Beide ließen die Erschütterungen voller Angst über sich ergehen. Kam das Gewitter zurück? Bombenangriff und Artilleriebeschuss wie vergangene Woche in Werdau, wo der nahe gelegene Bahnhof getroffen wurde? Liddas Gedanken überschlugen sich: Wir müssen in den Keller!
Mit dem weinenden Roland im Arm zur Küchentür eilend, wollte Oma noch kurz einen Blick durch die Scheiben riskieren, doch die waren vom Kochdunst beschlagen. Beherzt öffnete sie einen Fensterflügel. Auf den Feldern weit hinter dem Haus bewegte sich dumpf dröhnend eine Fahrzeugkolonne in Richtung Osten. Die Großmutter kniff die Augen zusammen, um mehr zu erkennen, denn in der Eile war ihre Brille unter den Tisch gefallen. Roland gab sie ihr schnell. Militär! Es waren Panzer, denen große Lastwagen folgten. Sie sah an einigen Fahrzeugen einen weißen, fünfzackigen Stern. Gott sei Dank keinen roten! „Die Amis!“, atmete sie auf. „Der Krieg ist zu Ende!“
Roland krallte sich noch immer ängstlich in ihre Schürze. Sie kniete nieder, umarmte ihr Enkelkind und beruhigte es: „Alles wird gut!“, nicht wissend, wie es nun wirklich weiter gehen sollte. Ihre nächsten Gedanken drehten sich um ihren Mann und ihre Tochter Helene. Wo waren sie? Im Wald? In der Fabrik? Gefangen?
Nun spähte auch Roland aus dem Fenster. Die schweren Brummer mit den Kanonenrohren waren fast verschwunden und mit ihnen das unheimliche Geräusch. Auf dem Feld hielten Lastwagen. Soldaten mit Stahlhelmen sprangen von den Ladeflächen und begannen große Zelte aufzubauen. Ein Jeep mit einer langen, sich biegenden Antenne kam angerast. Er bremste so kurz vor einem Laster, dass der nasse Boden aufspritzte. Interessiert beobachtete Roland, der nun vom Fenster nicht mehr wegzubringen war, wie ein Mann mit Schirmmütze lässig ausstieg und Befehle erteilte.
Plötzlich schrillte die Klingel an der Wohnungstür. Lidda und das Kind zuckten zusammen. Es folgte ein hastiges Klopfen. Zögernd ging die Großmutter zur Tür. Waren es die Amerikaner, Willy oder ihre Lene? Erst als sie den Namen Ella hörte, machte sie erleichtert die Tür auf. Es war die unter Geipels wohnende Frau, eine Kriegswitwe, deren Sohn in Russland vermisst war. Beide lagen sich gleich weinend in den Armen. Roland sah ihnen zu und drückte seinen Teddybären Horst an sich. Er konnte dem eifrigen Gespräch der Frauen entnehmen, dass es wohl auch in nächster Zeit noch Kohlrübensuppe geben würde. Die Amis wären aber auf alle Fälle besser als die Russen.
Nachdem Ella gegangen war, machte sich Oma Lidda trotz aller Erleichterung ernsthafte Sorgen. Roland merkte es an ihrem Verhalten. Immer wenn sie aufgeregt war, setzte sie ihre Brille auf und ab, putzte sie fast unaufhörlich. Jetzt lief sie ständig ans Fenster, um nach Opa Willy und Mama Ausschau zu halten. Ihr durch eine Operation ohnehin stark gebeugter Rücken krümmte sich noch mehr. „Mama und Opa kommen bestimmt gleich“, versuchte sie den Sechsjährigen zu beruhigen. Irgendwie schien die Welt aus den Fugen zu sein. Ist das die neue Zeit, fragte sie sich.
Endlich entdeckte sie Opa Willy am Ende der Straße. Er drehte sich immer wieder um und beschleunigte seine Schritte. Oma atmete auf. Aber sein Handwagen mit dem Feuerholz fehlte. Doch Hauptsache er war wieder da und gesund. Kam nicht auch noch Helene? Nein, es war eine Frau, die gleich wieder in der Häuserzeile gegenüber verschwand.
Opa schnaufte die Holztreppe hinauf und wurde von seiner Lidda mit Tränen in den Augen empfangen: „Dein Handwagen? Haben ihn die Amis?“
„Nein, der ist in Sicherheit“, antwortete Willy, nahm eine blecherne Tasse, hielt sie unter den Wasserhahn und trank sich erst mal satt. „Als ich am Waldrand merkte, dass die Amis im Anmarsch sind, habe ich den Wagen ins Unterholz gezerrt. Die dichten Brombeersträucher sind eine gute Tarnung. Außerdem ist es dort für die Amis sicher zu stachelig. Die brauchen unser Holz nicht. So wie die ausgerüstet sind.“
Roland ließ Opas Hand nicht eher los, bis er auf seinen Knien sitzend den großen Schnurrbart bewundern konnte. Währenddessen erzählte Willy seiner Frau, dass es bestimmt nicht gut gewesen wäre, von den Amerikanern mit einem Handwagen erwischt zu werden. Vielleicht hätten sie darauf Waffen vermutet.
„Wo ist Lene?“, fragte der Opa nach seiner Tochter. Lidda zuckte nervös mit den Schultern. Sie wusste auch nicht, wo sich ihre Helene aufhielt, und konnte nur hoffen, dass ihr nichts passiert war.
„Lene weiß sich schon zu helfen. Sie ist keine 20 mehr“, so der Opa. „Auf den Straßen ist es ruhig. Kein Schuss, kein Mensch.“
Und wieder sah Oma beunruhigt aus dem Fenster, so als ob Lene jetzt wirklich auftauchen müsste. Nichts! Sie war früh wie immer zur Arbeit in die Spinnerei Vogel nach Werdau gelaufen. Aber heute? Es war nicht wie jeden Tag.
Da! Oma Lidda lehnte sich noch mehr aus dem Fenster und erkannte ihre Lene auch von Weitem sofort am dunkelblauen Mantel und den hochgesteckten, brünetten Haaren. Als wenn der Teufel hinter ihr her wäre, rannte sie die Straße entlang. Der Großvater polterte die Treppe hinab, um seine Tochter an der Haustür sofort in Sicherheit zu bringen.
Rot im Gesicht und außer Atem umarmte Lene dann in der Küche Roland und Oma und setzte sich an den Tisch. Ihre Hände zitterten. Sie konnte das Glas Wasser kaum halten, das ihr die Mutter reichte. „Gott sei Dank! Oh je, das war knapp!“, sagte Lene erschöpft und erzählte, was sie erlebt hatte.
Gegen Mittag kam der Buchhalter Oskar Meier aufgeregt zu ihr ins Büro und warnte, dass die Amerikaner vor Werdau stehen. Was jetzt? Sich verstecken, nach Hause gehen oder auf den Hof laufen und jubeln? Er bot ihr an, mit ihm in seinem Auto zu fliehen. Der Schönling hatte sich schon mehrmals um die Lohnrechnerin bemüht. Die große, schlanke Helene mit dem langen Haar gefiel ihm sehr. Aber nun hatte es der Herr Meier eilig. Der Oskar! War er feige? Leicht verwundert registrierte Lene, dass plötzlich das Abzeichen der Nazipartei an seinem Revers fehlte, auf das er immer so stolz war. Da Helene ihm nicht antwortete, hielten Meier nun augenblicklich nichts und niemand mehr auf. Auch nicht Lene. Weg war er!
Viele machten sich sprichwörtlich aus dem Staub. Helene dachte kurz nach: Es konnte sein, dass sich Soldaten oder Volkssturmleute in der Nähe des Werkes verschanzt hatten, wie es gestern noch hieß: „Kämpfen bis zum letzten Blutstropfen!“ Zu Hause in Leubnitz wartete ihr kleiner Roland auf sie, seine Mama. Sie musste zu ihm. Während einige Frauen im Spinnsaal und in der Garderobe noch immer aufgeregt durcheinanderredeten und jede für sich entschied, was zu tun war, kannte Helene ihren Weg.
Sie lief vorsichtig über den Hof zum großen Werktor. Der Pförtner, der vorhin noch das Auto des Buchhalters durchließ, war verschwunden. Helenes Herz schlug bis zum Hals. Sie beruhigte sich: Die Amerikaner waren die Befreier, und sie wollte nur nach Hause zu ihrem Sohn. Was sollte ihr passieren? Die Amerikaner, nicht die Russen! Obwohl Lene selbstbewusst und von Natur aus nicht gerade ängstlich war, sagte ihr Instinkt, trotzdem achtsam zu sein. Sie umfasste den schmalen Gurt ihrer Umhängetasche noch straffer, als würde ihr ganzes Leben daran hängen und öffnete beherzt das kleine Personaltor.
In der Küche waren Oma Lidda und Opa Willy sprachlos vor Schreck. Er hatte die Stirn in Falten gelegt. Sein sonst akkurat gezogener Mittelscheitel war zerfurcht. Was hatte sich ihre Tochter dabei gedacht? Mit 28 Jahren sollte sie mehr Verstand haben! Solch ein Verhalten konnten sie nicht gutheißen. Helene war sich darüber im Klaren. Sie hatte alles aufs Spiel gesetzt. Aber zu oft machte sie nicht das, was ihre Eltern wollten. Da war sie ganz das Kind ihres Vaters. Doch die eigensinnige Lene hatte ihre Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.
Draußen vor dem Tor entdeckte sie nichts, was ihr Angst machen könnte. Trotzdem kam es wie aus heiterem Himmel, der in Wirklichkeit trübe war: Aus einer Waldschneise schoben sich Panzer auf die Straße. In ihre Richtung! Lene, die sich wegen des Lärms umgedreht hatte, erkannte am weißen, fünfzackigen Stern der Kettenfahrzeuge, dass es Amerikaner waren. Trotzdem überkam sie die Angst. Sollte sie über das Feld wegrennen? Keine Chance, die Kugeln wären schneller. Stehen bleiben? Da könnten die Soldaten auf dumme Gedanken kommen. Einfach auf dem Fußweg weiter gehen, als wäre alles ganz normal? Sie entschied sich blitzschnell für ihren letzten Gedanken und schritt scheinbar unbekümmert voran, die Panzer im Rücken.
Das Motordröhnen wurde immer ohrenbetäubender. Die Panzerketten krallten sich klirrend in den Asphalt. Es mussten nur noch ein paar Meter sein, bis Helene vom ersten Fahrzeug eingeholt wurde. Nicht umdrehen, weiterlaufen! Deutlich spürte die junge Frau, wie sich ein Geruch aus Schlamm, Motorenöl und beißendem Dieselqualm von hinten über sie legte. Sie glaubte sogar, den Schweiß der Panzersoldaten wahrzunehmen. Dann schob sich die ungeheure Masse aus Stahl und Kraft unmittelbar an ihr vorbei. Lene, die wie versteinert geradeaus blickte, sah den Koloss nur aus dem Blickwinkel. Nichts als Panzerplatten, Kettenglieder und dahinter eingepferchte Soldaten. Sie musste an die Bilder aus der „Deutschen Wochenschau“ im Kino vor einigen Jahren denken. Wie die Panzersoldaten der Wehrmacht lachend auf ihren Fahrzeugen in Polen und Frankreich einmarschierten.
Ein Panzer nach dem anderen zog an Helene vorbei. Keine Luke öffnete sich, kein Soldat sprang zu ihr herab. Dabei war sie sicher, dass die Amerikaner jeden ihrer Schritte bemerkten und registrierten. Undenkbar, wenn ein Mann auf diesem Fußweg gewesen wäre. Sie wurde in Ruhe gelassen. Vielleicht dachten die Amis an ihre Familien zu Hause, an ihre Frauen und Kinder?
Als Lene acht Panzer gezählt hatte, folgte ein Jeep. Der Offizier neben dem Fahrer grinste sie während des Überholens mit einer Zigarette im Mundwinkel breit an. Dann tippte er kurz mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger seiner rechten Hand an den Mützenschirm und erwies ihr seinen Respekt. Eine Frau, die sich nicht einmal von Panzern erschrecken ließ, war schon etwas Besonderes. Und auch Helene fühlte sich bestätigt. Sie hatte ihre Angst in einer gefährlichen Situation selbstbewusst überwunden.
Während die Panzerkolonne die Straße kurz vor Leubnitz verließ und über die Felder in Richtung Osten donnerte, hob Helene die Zigarettenschachtel auf, die der Offizier aus dem Jeep geworfen hatte, nachdem er an ihr vorbei war. Eine volle Packung! Dann besann sich Lene. Bis nach Hause war es nicht mehr weit. Sie wollte sich nicht noch einmal in Gefahr begeben, das Schicksal herausfordern und rannte die restliche Strecke bis zum Elternhaus, zu Roland. Ihr Vater stand schon an der Haustür.
Das Koppelschloss
Juni 1945
Das Leben schien sich in Leubnitz nach dem Krieg langsam zu normalisieren. Die Leute gingen ihrer Arbeit nach, sofern sie welche hatten, kümmerten sich um Haus und Hof und vor allem um die Versorgung, unternahmen Hamstertouren. In den Gärten wurden Kartoffeln, Kohlrüben und Gemüse angebaut. Es konnte alles nicht schnell genug wachsen, denn der Hunger war groß. Die von der Gemeinde zugeteilten Lebensmittelrationen reichten kaum aus.
Im Garten seines Opas gleich hinter dem Haus war Roland gerade dabei, die kleinen Möhrenpflanzen zu gießen, als Herbert, der Nachbarsjunge, zu ihm kam. Er war wie Roland barfuß. Herb, so ließ er sich von den anderen Kindern nennen, sah durch seine größere Statur älter aus als seine acht Jahre. Auch sonst unterschied er sich von den Jungen aus der Straße: rotblonde Haare und überall auf der weißen Haut Sommersprossen.
Herb trug ein blaues, ausgewaschenes Hemd, das er in die kurze Hose gesteckt hatte. Die wurde von einem breiten Ledergürtel mit einem silberfarbenen Koppelschloss gehalten. Der Gurt war so lang, dass er den Körper des Jungen fast zweimal umschlang. Sein Onkel Max soll den Gürtel im Krieg getragen haben. Dort hatte er sein linkes Bein verloren.
„Kommst du mit zu den Amis aufs Feld, zum Camp?“, fragte Herbert und strich mit der Hand stolz grinsend über seinen braunen Gürtel. Roland war richtig neidisch darauf. Er hatte nur schmale Hosenträger, die ständig von seinen Schultern rutschten.
„Ich muss noch gießen“, erwiderte Roland. Der mit seinem Ledergürtel. Angeber. Aber er hatte etwas dagegen zu setzen.
„Herb, siehst du die Pflanze dort auf dem Beet?“
„Das kleine Ding?“
Roland und Herb gingen an den vom Großvater akkurat angelegten Beeten vorbei an den Zaun und hockten sich vor die Pflanze.
„Die wird auf alle Fälle größer als du und kann sogar meinen Opa überragen, wenn es gut geht“, triumphierte Roland. „Und der ist riesengroß.“
Opa Willy hatte ihm vor ein paar Wochen die Kerne gegeben und ein kleines Beet zugeteilt, das er selbst bestellen durfte. Das wollte etwas heißen, denn die Gartenarbeit war Opas Pläsier, wie er sich ausdrückte. Da durfte kein anderer ran, auch nicht die Oma. Wahrscheinlich dachte Großvater, dass nur er einen Garten exakt anlegen und pflegen konnte. Und wenn er die Pflanzen auf den Beeten in die Erde brachte, dann ging es besonders genau zu. So genau wie er stets die Schleife seiner Arbeitsschürze vor dem Bauch band. Roland wusste: Opa Willys Ordnungssinn war enorm und machte selbst vor den Fingernägeln seines Enkels nicht halt. Die wurden stets streng kontrolliert wie das Werkzeug im Schuppen, das fein säuberlich immer griffbereit an Ort und Stelle lag. Es war für Roland manchmal anstrengend, aber er fand mit der Zeit Gefallen daran. Opa freute sich und weihte ihn in die Geheimnisse des Gartens ein.
„Ach, du meinst eine Sonnenblume“, winkte Herb gelangweilt ab. Roland ärgerte sich abermals und holte trotzig mit seiner kleinen Gießkanne gleich noch mal Wasser aus dem Fass.
„Kommst du jetzt oder nicht?“
„Na gut, ich gebe nur noch Oma Bescheid“, sagte Roland, als wäre es für Herb eine Ehre, dass er mit ihm geht, und stellte die Kanne auf einem Hocker ab.
Auf dem Weg zum Camp kamen beide hinter dem Rittergut am Sammellager für Kriegsgefangene vorbei. Vorher wurden auf dieser Wiese Kühe gehütet; nun umgab ein hoher Stacheldrahtzaun einige Dutzend entwaffnete Wehrmachtssoldaten. Hier soll auch der Leubnitzer Bürgermeister sein, ein SA-Mann, wusste Herbert. Die US-Armee hätte ihn gleich nach der Besetzung des Ortes verhaftet. Doch das ließ Roland kalt. Er kannte diesen Mann nicht. Und ob Herb wusste, wovon er sprach.
Vor dem Stacheldrahtzaun patrouillierten Posten mit Stahlhelmen und Maschinenpistolen. Die beiden Jungen hielten es für besser, nicht in ihre Nähe zu kommen. Aber sonst hatten sie keine großen Berührungsängste mit den US-Soldaten. Bei den Kindern siegten die Neugier und Unbekümmertheit. Auf der Straße wurden die Soldaten im Vorbeigehen bestaunt, ihre Uniformen und auch Waffen begutachtet. Sie gehörten jetzt zum Leubnitzer Alltagsbild. Im Gegensatz hielten sich die Erwachsenen zurück, waren vorsichtig. Einige junge Frauen bildeten wohl die Ausnahme und ließen sich auf die Soldaten ein. Aber die Deutschen blieben die Besiegten, denen man nicht in jedem Fall freundlich gesonnen war. Wer konnte die persönlichen Befindlichkeiten der Soldaten kennen, ihre Erfahrungen mit der Wehrmacht im Krieg, ihre Rache?
Es war um die Mittagszeit, als die beiden Jungen das Camp am Rand des Dorfes erreichten. Schon von Weitem hatten sie aus dem Ofenrohr eines Zeltes Rauch aufsteigen sehen. Das Küchenzelt. Herb hielt sich den Bauch und schmunzelte genüsslich. Bereits vor ein paar Tagen waren sie hier aufgetaucht. Der Koch hatte die Kinder bemerkt und ihnen zu essen gegeben. Er hieß Jim. Herb hatte die Suppenschüssel sogar ausgeleckt, so gut hatte es ihm geschmeckt. Das gefiel dem Koch natürlich. Heute wollten sie es wieder versuchen. Vielleicht konnten sie noch etwas Brot mit nach Hause nehmen. Doch Jim war nicht da.
Sie gingen um das Zelt herum und standen plötzlich vor einem Soldaten. Beide Kinder rissen die Augen weit auf! Ein schwarzer Mann! Das Gesicht, Hände, Haare… Wie oft hatten die Kinder „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ gespielt und sich nichts dabei gedacht. Es war ein Spiel. Und nun stand er vor ihnen! Roland und Herbert waren wie gebannt. Noch nie hatten sie einen gesehen. Überraschung auch bei dem Soldaten. Er wollte niemand erschrecken, schon gar keine Kinder. Obwohl er sie jetzt anlächelte und zwischen seinen vollen Lippen die weißen Zähne zeigte, schienen sie noch immer oder gerade deshalb um so mehr erschrocken zu sein.
Herb wollte weglaufen, doch der Soldat zog aus der Brusttasche seiner Uniformjacke ein kleines, glänzendes Päckchen und hielt es den beiden vor die Nase. Was war das? Sie zögerten. Schließlich riss der Soldat das Päckchen an einer Seite auf und schob einen kurzen, schmalen Streifen, den er aus dem silbernen Papier nahm, in den Mund. Dann begann er darauf herumzukauen und lachend mit den Augen zu rollen, wie gut es doch schmeckte. Daraufhin sahen sich Roland und Herb kurz an und langten zu. Die Kaugummistreifen schmeckten nach Pfefferminz.
Während sich die drei langsam auch ohne große Worte zu verstehen schienen, kam ein weiterer Soldat hinzu, ein Weißer. Beide kannten sich anscheinend gut, sie lachten und sprachen angeregt miteinander. Die Kinder verstanden nichts. „Das ist Amerikanisch“, sagte Herb zu Roland. Auf einmal setzte sich der weiße Soldat hin und begann seine Stiefel auszuziehen und die Füße zu massieren. Roland staunte nicht schlecht, denn es waren keine Stiefel, wie er sie kannte, sondern Schnürstiefel mit ellenlangen Senkeln. Die Kinder bewunderten die Geschicklichkeit, mit der sie eingefädelt wurden. Sie würden dazu wohl ewig brauchen.
Als die Soldaten ihr Staunen bemerkten, brachen sie in Gelächter aus, bis der weiße Soldat plötzlich auf Herberts Gürtel aufmerksam wurde. Seine Miene verfinsterte sich. Er ergriff das silberne Koppelschloss mit der rechten Hand und zog den Jungen mit einem Ruck zu sich heran. Gleichzeitig stieß er zwischen den Lippen: „Nazi!“ hervor. Der Schwarze hielt seinen Kameraden an der Schulter zurück, was nur mit Mühe gelang. Roland war zur Seite gesprungen. Er hörte nur Worte wie „children …“ Zum Glück tauchte in diesem Augenblick Jim, der Koch, auf und konnte alle drei auseinanderbringen. Roland sah Herb zum ersten Mal heulen.
Der Koch nahm die Kinder schließlich mit in sein Zelt. Dort durften sie sich auf eine Bank setzen und Suppe löffeln. Als sie fertig waren, kam Jim zu Herbert und deutete mit ernstem Gesicht und den Worten: „Nix Hitler!“, auf dessen Koppelschloss. Es zeigte einen Adler mit Hakenkreuz und Eichenlaub, das Symbol der deutschen Wehrmacht, die seit wenigen Wochen besiegt war. Dann buchstabierte Jim die Inschrift: „Gott mit uns“.
Er stand nachdenklich auf und ging zu einem Mast des Zeltes, an dem eine Art Rucksack an einem Nagel hing. Jim setzte seine Kochmütze ab und verstaute sie darin. Erst jetzt sahen die Kinder, dass er kurz geschorenes, rotes Haar hatte. Sie erschraken, als der Koch mit einem zusammen gerollten Gürtel vor die Bank trat. Herbert begann zu zittern. Jim wollte ihn doch nicht etwa über das Knie legen und schlagen? Auch Roland dachte sofort daran, wie ihm Herb von seinem Stiefvater erzählte, von dessen Hieben mit dem Lederkoppel auf den Hintern.
Jetzt rollte Jim den Gürtel aus. Er war aus einem starken Gewebe, nicht aus Leder. Auch die Koppelschnalle fehlte. Dann wickelte der Koch den Anfang des Gürtels, der viele ausgestanzte Löcher und eine kleine Schnalle besaß, um seine rechte Hand. Die beiden Jungen saßen mit schlotternden Knien auf der Bank. Sie wollten weglaufen, konnten sich aber nicht rühren. Gleich würde Jim den Gürtel auf ihren Hosenboden niedersausen lassen.
Doch der schien es sich anders überlegt zu haben. Er hielt plötzlich inne und lächelte genau in dem Augenblick, in dem Herb in Erwartung des Schmerzes seine Augen schon geschlossen und die Zähne zusammengebissen hatte. Der Koch legte seinen Gürtel beiseite, öffnete Herberts Koppelschloss und zog den Ledergürtel aus den Schlaufen der kurzen Hose. Dann ließ er ihn in seinem Rucksack verschwinden. Beide Kinder atmeten auf. Sie wunderten sich, als der Koch Herbert seinen Militärgürtel reichte und andeutete, dass er ihn umschnallen sollte. Dabei sagte er nochmals: „Nix Hitler“. Dann durften sie das Zelt verlassen.
Als Roland und Herb einige Tage später mit anderen Jungen aus der Straße in ihrem Versteck in der Waldschonung saßen, war Jim, der Koch, in aller Munde. Herb brüstete sich damit, dass er gar keine Angst gehabt hätte, als Jim ihn übers Knie legen wollte. Roland wusste es besser, schwieg aber. Und nun holte Herbert vor den drei Jungen sprichwörtlich zum Schlag aus: Er zog ein Päckchen amerikanische Zigaretten aus seiner Hosentasche. Roland verschlug es die Sprache. Hatte Herb die Zigaretten im Küchenzelt bei den Amis geklaut? Nie mehr würde Roland zu Jim gehen, ihm in die Augen sehen können. Herb sollte froh sein, dass er noch mal davongekommen war. Vielleicht fühlte er sich jetzt als Amerikaner, wo er doch den Gürtel trug und nun Zigaretten rauchen wollte?
Bernd, der eben so alt wie Herb war, hielt ihm ein brennendes Streichholz an die in den rechten Mundwinkel geklemmte Zigarette. Ganz genau so hatte es Herbert bei Onkel Max gesehen. Dann sog er mit genüsslicher Miene Luft durch den glimmenden Tabak und verdrehte bald die Augen, als er einen Hustenanfall bekam. Qualm drang aus Mund und Nase. Nur mit Mühe gelang es Herb, sich zu beherrschen. Entsetzt sahen ihm die anderen zu, empfanden sogar Mitleid. Ein Lungenzug war eben die hohe Schule, kein Vergleich mit dem Kartoffelfeuerrauch auf dem Feld.
Auf die amerikanischen Zigaretten schimpfend, paffte Herb trotzdem weiter und bot die Glimmstängel in der Runde an. Jeder griff zaghaft zu. „Ihr müsst ja nicht gleich einen Lungenzug machen“, meinte er aufmunternd. „Einfach ziehen und den Qualm im Mund behalten, dann ausatmen.“ Roland hielt sich daran. Noch ein paar Mal ziehen, und schon war er um eine Erfahrung reicher. Was war dran, am Rauchen? Ein blöder Geschmack im Mund, den er keineswegs für angenehm hielt.
Während Herb zu Ende rauchte und der blaue Dunst durch die Maschen des zwischen drei kleine Fichten gespannten Tarnnetzes zog, verschluckte sich Heinz total. Er drückte die Zigarette sofort wieder aus. Ihm war nur noch schlecht.
Als Herb eine silberne Taschenuhr aus der Hosentasche holte, staunten alle. „Kurz vor fünf Uhr, Zeit zu gehen!“ Eigenartig, dachte Roland, sonst wollte Herb um diese Zeit nie nach Hause. Die anderen standen sofort von ihren Baumstümpfen auf. „Also los!“, presste Herbert plötzlich heraus. Sein Kopf wurde puterrot. Alle sahen ihn an. Er erhob sich nicht. Sein Blick wurde wehleidig, war gar nicht mehr amerikanisch. Auf einmal raste er los, streifte mit einer Schulter einen Stamm, taumelte und bekam noch knapp die Kurve. Schließlich ließ er sich hinter einem großen Holunderbusch nieder und erleichterte sich geräuschvoll wie ein Bär.
Roland, Bernd und Heinz sahen überrascht zu. Sie rangen sich ein Grinsen ab, obwohl es ihnen ebenfalls nicht gut ging und jeder auf einmal auch schnell nach Hause musste. Es gab da so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Das mit dem Rauchen war wohl nichts, jedenfalls nichts für Roland. Das schwor er sich.
Zu Hause abgehetzt aus dem Wald gekommen, reizte ihn nicht einmal mehr die silberne Dose auf dem Küchentisch. Opa hatte sie mitgebracht. „Es ist kaum zu glauben“, erzählte der, „als ich heute bei den Amis am Camp vorbeikam, standen viele Leute von uns dort.“
Roland rutschte hellhörig auf seinem Stuhl zusammen.
„Ich glaube, es war das Küchenzelt“, fuhr Opa fort. „Davor hatten die Amis auf einem Tisch Dosen mit Schmalzfleisch zu einer Pyramide aufgebaut. Jeder durfte eine Büchse mitnehmen.“
Roland war froh, dass nicht ihr Besuch beim Koch das Thema war und setzte sich ans Fenster. Opa nahm die runde Dose in die Hand und öffnete sie mit seinem Taschenmesser. „Die Amis machen das doch nicht aus Höflichkeit. Da steckt etwas anderes dahinter“, meinte er zu seiner Frau Lidda. „Es wird erzählt, dass bald die Russen kommen.“
Oma zuckte zusammen. „Die Russen? Aber warum?“, fragte sie beunruhigt, die Hände ringend. Willy, der sich oft mit Karl-Heinz, seinem ehemaligen Arbeitskollegen aus dem Reichsbahnausbesserungswerk Zwickau, bei einem Bier traf und über das Kriegsgeschehen sprach, runzelte die Stirn. Über seinen Schnurrbart streichend, erklärte er ihr, dass die Russen von Osten bis an die Zwickauer Mulde vorgedrungen waren. Und nach der jetzigen Potsdamer Konferenz der drei Großmächte, USA, Russland und England, die gegen Hitler kämpften, wurde das ehemalige Deutsche Reich in drei Besatzungszonen aufgeteilt. Nun würde Leubnitz wie auch Werdau und Zwickau bald zur russischen Zone gehören. Das wurde in Potsdam so festgelegt. Da konnte man nichts machen.
Was Roland, seine Mutter, die Großeltern und die anderen Leubnitzer in den nächsten Sommertagen nach dem Abzug der Amerikaner zu sehen bekamen, hatte nichts mit der vermeintlichen Übermacht der Russen gemein. Bis zur Befreiung waren sie auf Nazi-Plakaten als zähnefletschende Bedrohung des Deutschen Reiches aus dem Osten dargestellt.
Die Russen kamen eines Nachmittags in den Ort und sahen so gar nicht wie Sieger aus. Nicht wie die Amerikaner mit Panzern, sondern mit Pferdewagen. Müde Soldaten liefen daneben, als trügen sie die ganze Last des Krieges, der nun zu Ende war. Dazwischen tauchten ab und zu Geländewagen auf, in denen Offiziere saßen. Kein Leubnitzer Bürger traute sich auf die Straße. An manchen Häusern hingen vorsichtshalber wieder weiße Fahnen aus den Fenstern. Und spät abends hörte Roland, während er im Bett lag, leise die Lieder der Russen, die sie fern der Heimat zur Balalaika sangen.
Der Bote
Juli 1947
Im Sommer war es auf dem Leubnitzer Friedhof angenehm kühl. Die alten Kastanienbäume spendeten mit ihren weit ausladenden Ästen und großen Blättern viel Schatten. Roland streifte den Weg entlang und betrachtete die Grabmale, die sich an der Mauer aneinanderreihten. Ihre Größe und Unterschiedlichkeit beeindruckten ihn. Hier stand ein Engel mit weit geschwungenen Flügeln, daneben eine schlichte, aber gewaltige Architektur. Dort leuchteten in Gold gehaltene Schriftzüge; einige Gräber weiter war kaum noch ein Buchstabe zu erkennen. Vergänglich wie das Leben. Aber Rolands Oma Lidda hatte ihn beruhigt und gemeint, dass es ein Himmelreich gäbe, und der Herrgott würde mit den Engeln auf die Seelen der Verstorbenen achten.
Eigentlich wollte der Junge zu Hause sein, doch Mutter hatte ihm gesagt, dass es draußen so schön sei. Wenn er aber in der Stube gerade mit seinem kleinen Bauernhof spielte und die Ernte einfuhr, war das für ihn noch nie ein Anlass hinauszugehen. Aber er konnte sich den wahren Grund denken: Erich, sein Stiefvater. Der kam vor einer Woche überraschend aus der Kriegsgefangenschaft in Belgien zurück.
Roland war kaum aus der Wohnung, da hörte er, wie hinter ihm der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde.
Mit seinen vielen Grabsteinen, Hecken, Bäumen und der Kapelle eignete sich der Friedhof gut zum Spielen, zum Verstecken. Der Junge und seine Kameraden waren oft da, aber erst, seit sie zur Schule gingen. Der Weg dorthin führte am Friedhof entlang. Und um die Straße zu meiden, nahmen die Schüler lieber die Kastanienallee des Gottesackers. Bald werden auf den Bäumen wieder die braunen Früchte aus ihren Schalen platzen und zu Boden fallen, dachte Roland. Er und die anderen Kinder konnten es kaum erwarten. Sie würden nachhelfen, indem sie mit Stöcken und Steinen danach warfen, denn die Kastanien waren ein begehrtes Bastelobjekt.
Wenn die Kinder an den Grabsteinen entlang gingen, rechneten sie manchmal das Alter der Verstorbenen aus. Geburtsdatum und Todestag waren in Stein gemeißelt. Das Rechnen fiel den Schülern hier leichter als im Unterricht. Und auf der Südseite des Friedhofes war alles noch einfacher. Dort befanden sich die Gräber der Leute, die in den Jahren des Krieges starben; auch gefallene Soldaten waren dabei. Oft lagen zwischen Geburt und Tod nicht einmal 25 Jahre.
Zum Glück hatte Roland seinen Opa noch, obwohl der sogar im Ersten Weltkrieg an der Front in Frankreich kämpfte. Darauf war der Großvater ein bisschen stolz, zumal er ihm im dicken Familienalbum mit der riesigen Schnalle ein Foto von sich in Uniform zeigte. Der Junge sah dort aus der Familie Geipel auch andere uniformierte Männer mit Bart, die starr und verklärt irgendein Ziel vor Augen zu haben schienen.
Der Krieg hat die Männer und Söhne so zeitig sterben lassen, erinnerte sich Roland an Omas Worte. Und viele Familien erhielten während des Krieges Briefe mit der schlimmen Nachricht. Der Briefträger wurde deshalb lange nicht gern gesehen. Am liebsten bekamen die Leute gar keine Post mehr. Und wenn doch, dann wurden selbst Briefe aus dem Lazarett aufatmend in Kauf genommen. Bloß keine Todesnachricht! Doch manche Hoffnung war vergeblich.
Roland dachte an den Nachmittag im Januar des vergangenen Jahres, als er Schnee für den Bau einer Höhle auf dem Hof zusammentrug. Da stand plötzlich der Briefträger, der Bote, vor ihm. Zum Glück fragte er nach der Familie Fenk im Nachbarhaus. Dem Jungen fiel ein Stein vom Herzen, aber … Der etwas behäbige Mann in der Postuniform hielt den Brief schon in der Hand; er wollte ihn so schnell wie möglich loswerden.
Was jetzt kam, war unvermeidlich. Roland wusste nur, dass Mutter Fenk mit ihrer Tochter große Wäsche hatte. Beide waren im Waschhaus im Kellergeschoss, aus dessen halb geöffneter Tür Wasserdampf drang. Er sagte dies dem Briefträger, aber der hatte anscheinend keine Lust, die Stufen hinunterzusteigen, zumal sie zum Teil vereist waren. Vielleicht konnte er auch nicht mehr, denn sein Atem ging schwer. So gab er kraft seines Amtes Roland die Anweisung, der Frau sofort zu sagen, dass er hier oben wartete.
Der Junge stieg vorsichtig die Stufen hinab und konnte die Fenks im grauen Dunst kaum sehen. Die Mutter stand am großen Kessel und rührte mit einem Holzstab in der Wäsche. Bettina, ihre Tochter, schüttete gerade einen Eimer kaltes Wasser in einen Bottich, um anschließend zu spülen.





























