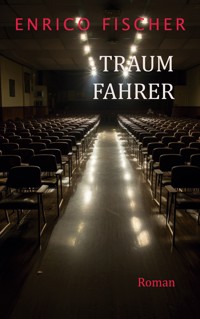Inhalt
Impressum 2
Vorwort 3
Prolog 4
1. Kapitel 11
2. Kapitel 38
3. Kapitel 58
4. Kapitel 88
5. Kapitel 107
6. Kapitel 138
7. Kapitel 162
8. Kapitel 189
9. Kapitel 212
10. Kapitel 241
11. Kapitel 271
12. Kapitel 305
13. Kapitel 327
14. Kapitel 356
15. Kapitel 383
16. Kapitel 405
17. Kapitel 434
18. Kapitel 472
19. Kapitel 495
20. Kapitel 515
21. Kapitel 539
22. Kapitel 566
23. Kapitel 590
24. Kapitel 619
25. Kapitel 623
26. Kapitel 627
27. Kapitel 645
28. Kapitel 650
29. Kapitel 655
30. Kapitel 666
31. Kapitel 674
Epilog 680
Danksagung 684
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2021 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99107-525-7
ISBN e-book: 978-3-99107-526-4
Lektorat: Alexandra Eryigit-Klos
Umschlagfotos: Taras Adamovych, Tatyana Azarova, Taiga | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Vorwort
Keine der Romanfiguren in diesem Buch hat je real existiert, wodurch mögliche Ähnlichkeiten mit tatsächlich lebenden Personen nur rein zufällig sein können.
Der Autor konnte sich allerdings nicht zurückhalten, auch eigenes Erleben in die ansonsten frei erfundene Geschichte einfließen zu lassen.
Prolog
Peter Stein parkte sein Auto im Parkhaus einer Kaufland-Filiale und ging trotz des Nieselregens den Rest des Weges zum Landgericht zu Fuß.
Der Wettergott, sollte es einen geben, hatte es anscheinend aufgegeben, sich an einem richtigen Winter zu versuchen.
Vielleicht wollte er sich auch einfach das Genörgel über seine Arbeit nicht mehr anhören.
Dabei waren es zweifellos passende Bedingungen, auch wenn Peter auf dem Weg zu einer Verhandlung und nicht zu einer Beerdigung war.
Für ihn lief es auf das Gleiche hinaus, denn schließlich sollte eine Idee und mit ihr eine Freundschaft zu Grabe getragen werden.
Es war der 7. Februar 2013, ein Donnerstag.
Trotz der frischen Luft fühlte er sich müde und zerschlagen.
Mehr als ein Jahr war es jetzt her, dass er mit seiner Amtsniederlegung die Reißleine gezogen hatte.
Unmengen Papier mit Anklagen, Erwiderungen und Schuldzuweisungen waren seitdem beschrieben worden, Papier, das die ganze Wut und die Verbitterung der Verfasser, mehr oder weniger geschickt durch den juristischen Feinschliff der Anwälte kaschiert, offenbart hatte.
Es war eine Schlammschlacht mit erschreckender Wucht und er hätte es nie für möglich gehalten, dass eine geschäftliche Auseinandersetzung so durchdringend in sein Leben eingreifen könnte.
Heute, mit der Aussicht auf ein Ende, fragte er sich, ob es nicht zu irgendeinem Zeitpunkt die Chance gegeben hatte, wenigstens einen Teil des Geschehenen zu verhindern.
Er hatte keine Antwort darauf.
Es schien einen unheimlichen Automatismus des Handelns zu geben, eine Art vorgezeichnete Kettenreaktion, dem die Beteiligten gnadenlos ausgeliefert waren.
Nach 20 Minuten Fußmarsch betrat Peter das Foyer des Gerichtsgebäudes, schaute sich um und sah rechts von ihm eine Sicherheitssperre.
Zwei uniformierte Beamte standen an der Schleuse und erwarteten dort ihre Kunden.
Peter überlegte kurz, ob er auf seinen Chef und die Anwälte warten sollte, entschloss sich dann aber doch, schon hineinzugehen.
Während er seine Jacke und alle seine metallischen Habseligkeiten in einen Korb legte, schaute er sich nach bekannten Gesichtern um, aber er konnte niemanden ausmachen.
Er zeigte den Beamten seine Zeugenladung vor.
Der Ältere der beiden warf einen kurzen Blick auf das Dokument und lud Peter mit einer lässigen Handbewegung ein, durch den Detektor zu gehen.
Natürlich gab die Maschine Signal.
„Gürtel?”, fragte der Ältere.
„Ganze Sätze sind im öffentlichen Dienst anscheinend nicht sehr gefragt“, dachte Peter belustigt.
Er nickte, gab seinen Gürtel in treue Hände und startete seinen zweiten Versuch.
Jetzt schwieg die Maschine.
„Waren Sie schon einmal hier?”
Diese Frage kam von dem Jüngeren.
Es gingen also doch ganze Sätze.
Als er verneinte, erklärte er Peter bereitwillig den Weg.
„Zwei Treppen hoch, dann rechts“, meinte er, „die Säle sind nummeriert.”
Säle waren was für das ganz große Theater.
Er hoffte inständig, dass ihm das erspart blieb.
Er hielt sich strikt an die erhaltenen Anweisungen und erreichte so erfolgreich die zweite Etage des Gebäudes. Peter betrat einen großen Flur, lang gezogen mit jeder Menge Türen.
Links neben den einzelnen Türen waren Anschläge angebracht, aus dem jeder entnehmen konnte, wann, was, und wer dort als Nächstes verhandelt wurde.
Praktisch für die Gerichtstouristen. So konnten die in Ruhe ihr Programm zusammenstellen. Morgens eine Scheidung, am Nachmittag einen kleinen Raub?
Andererseits, immer noch besser als die Hinrichtung auf dem Marktplatz.
Peter sondierte das Nummernsystem und ging in die Richtung, in der Saal 94 demnach zu finden sein musste.
Dann sah er eine Gruppe von Männern in dunklen Anzügen.
Einen von ihnen erkannte er sofort, Herrn Dr. Fröhlich.
Er gehörte zu den Anwälten, die Roland Meißner, seinen ehemaligen Freund, jetzigen Verfahrensgegner und Ursache monatelanger feindseliger Auseinandersetzungen, juristisch vertraten.
Auch Dr. Fröhlich hatte ihn jetzt gesehen und machte seine Gesprächspartner auf ihn aufmerksam.
„Was soll’s“, dachte Peter, und ging auf die Gruppe zu.
Die Begrüßung erfolgte mit förmlichem Händedruck und der in diesem Fall zu entschuldigenden Lüge, man freue sich, ihn zu sehen.
Fröhlich stellte die drei anderen Herren vor, ebenfalls Anwälte aus der gleichen Kanzlei.
Peter war es ein Rätsel, wovon Roland Meißner alle diese Leute bezahlte.
Seit seinem Beitritt zur Gruppe redete man über das miese Wetter.
Wenn man vor der Tür eines Saales steht, in dem man wenige Minuten später beabsichtigt, unter Zwang Vermögen umzuverteilen, bleibt eben nur dieses Thema übrig.
Peter beschloss, die Situation zu entkrampfen, indem er ein notwendiges Telefonat als Grund vorgab, sich wieder zu separieren.
Er drückte eine Taste auf seinem Handy, kurz darauf hörte er die Stimme seiner Frau:
„Wie weit bist du?“, fragte sie.
Peter sah auf seine Uhr und stellte fest, dass er Grund hatte, nervös zu werden.
„In zehn Minuten beginnt die Verhandlung und ich stehe hier allein mit einer Truppe wild entschlossen aussehender Anwälte. Nur dass die von der gegnerischen Partei sind.“
Sie lachte nicht.
„Ist er da?“, fragte sie stattdessen.
„Nein“, antwortete er, „ich habe ihn noch nicht gesehen.“
„Bald ist alles vorbei“, hörte er sie sagen.
Die Tür des Saales Nr. 94 öffnete sich.
„Ich weiß“, sagte er und legte auf.
Sein Blick ging in Richtung des Treppenaufgangs.
Wo zum Teufel blieb sein Chef, Lutz Dreyer, mit seinem Juristenanhang?
Und wo blieb Roland Meißner?
Es ging hier um Zahlungen in Millionenhöhe, um die Zukunft seiner Unternehmungen, dem würde er niemals fernbleiben.
Er kannte ihn lange und gut genug, um sich in diesem Punkt sicher zu sein.
Über Jahre hatten sie eng zusammengearbeitet, Projekte umgesetzt, Joint Venture aufgebaut und geleitet.
Der Erfolg sollte der Welt, entgegen anderslautender Überzeugungen, beweisen, dass Konzern und Mittelstand, fruchtbar für alle Beteiligten, miteinander kooperieren konnten.
Das Ergebnis war ein Desaster, aus dem Roland Meißner heute als Gewinner entlassen werden sollte.
Aus diesem Grund stand dessen Anwesenheit für Peter außer Zweifel.
An der offenen Tür zum Saal 94 angekommen, las Peter auf dem Anschlag „AGNISA GmbH gegen TERTUNA Zement GmbH/ECORES GmbH“.
Er schaute ins Innere des Raums.
Auf der rechten Seite waren gerade Rolands Anwälte dabei, sich häuslich einzurichten. Stapelweise Aktenordner und jede Menge Laptops wurden auf dem Tisch drapiert.
Im hinteren Teil, durch eine Art Podium erhöht, stand der Richtertisch.
Dort machte sich ein jüngerer Mann Mitte vierzig zu schaffen.
Er war erschreckend dürr.
Trotz einer stattlichen Länge von wenigstens 1,80 Metern brachte er keine 60 Kilo auf die Waage.
„Ob er krank ist?“, ging es Peter durch den Kopf.
Gegen diese Vermutung sprach allerdings sein jugendlich, forsch wirkendes Auftreten und die lebhaften Augen, die nun begannen, den Raum auf Anwesenheit zu prüfen.
Irgendetwas schien ihm zu sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war, also zog einen schwarzen Talar aus seiner Tasche und warf ihn über.
Als hätte das eine Art Zauber ausgelöst, griffen auch die rechtsseitig sitzenden Anwälte in diverse Taschen und holten nun ihrerseits ihre Berufskleidung hervor.
Peter wurde an die Blauhemdprozedur bei FDJ-Veranstaltungen erinnert und musste grinsen.
Er beschloss, nicht länger auf dem Flur herumzustehen.
Von innen betrachtet wurde aus dem Saal ein Raum, eigentlich ein Räumchen.
Peter hoffte, dass Lutz, sollte der endlich auftauchen, nicht zu viele Leute im Schlepptau hatte, denn andernfalls würden einige stehen müssen.
„Schauprozesse“, beendete Peter seine Betrachtungen, „finden hier jedenfalls nicht statt.“
Da die rechte Seite vom Gegner besetzt gehalten wurde, steuerte er auf den Tisch links vom Eingang zu, setzte sich und versuchte eine möglichst gleichgültige Miene zu zeigen.
Ein wiederholter Blick auf seine Uhr sagte ihm, dass es nur noch drei Minuten bis zur Eröffnung der Verhandlung waren.
Was sollte er tun, wenn keiner mehr kam?
Vertagung beantragen?
Endlich sah er bekannte Gesichter.
Der Syndikus der TERTUNA Zement GmbH, Erich Frenzel, stand zusammen mit ihrem Anwalt Dr. Straubig in der Tür; den Ordner unterm Arm, schienen sie die Lage zu sondieren. Hinter ihnen erkannte er Lutz Dreyer, seinen Chef.
Peter war erleichtert.
Es wurde aber auch höchste Zeit.
Sie kamen zu Peter, reichten ihm die Hand zur Begrüßung und setzten sich zu ihm an den Tisch.
„Es tut mir leid“, sagte Dreyer leise, „aber wir haben buchstäblich bis zur letzten Minute gebraucht, um den Deal im Haus abzusichern.“
„Können wir?“
Die Frage kam vom Richtertisch und löste bei den Herren gegenüber Unruhe aus.
Dr. Fröhlich stand auf und sagte:
„Unser Mandant fehlt leider noch. Wir konnten ihn bisher auch nicht erreichen.“
Rolands Nichterscheinen war also nicht nur für Peter rätselhaft.
„Sie haben entsprechende Vollmachten?“, fragte der Richter.
Fröhlich bestätigte das.
„Dann sehe ich keinen Grund, nicht mit der Verhandlung zu beginnen.“
Ohne auf eine Antwort zu warten, ließ er seine Routine anlaufen.
Ein kleines Tonbandgerät in der Hand, diktierte er einer imaginären Person, wer gegen wen was beantragt hat, durch wen und wann welche Dokumente vorgelegt wurden und welcher Streitwert angesetzt ist.
Beim letzten Punkt wurden die Anwälte naturgemäß besonders aufmerksam, da sich nach dieser Angabe ihr Honorar berechnete.
Als dieser Teil geschafft war, widmete der Richter, sichtlich befriedigt über den Erfolg seiner bisherigen Arbeit, seine Aufmerksamkeit wieder den Parteien.
„Zudem habe ich hier“, er deutete auf ein bisher nicht erwähntes Dokument, „einen Vergleichsvorschlag. Er wurde eingereicht …“, er zögerte kurz und suchte offensichtlich das Datum auf dem Eingangsstempel, „heute.“
Er zog die Augenbrauen hoch, was sein schmales Gesicht irgendwie grotesk aussehen ließ.
„Kann ich davon ausgehen, dass das Dokument allen bekannt ist?“, fragte er.
Einmütiges Kopfnicken an den beiden Tischen.
„Gut“, fuhr der Richter fort, „ist es gewünscht, dass das Gericht dieses neue Dokument in die Gesamtdokumentenlage mit aufnimmt?“
Noch einmal einmütiges Kopfnicken.
„Sehr schön“, fand der Richter, „dann verwenden wir es unmittelbar, natürlich mit der aufschiebenden Wirkung der formalen Prüfung durch das Gericht.“
Er schaute Bestätigung erwartend in den Raum.
Wieder Kopfnicken.
„Gut! Dann können wir den Vorgang hier und heute abschließen. Es bedarf zur Umsetzung zwar noch einiger notarieller Bestätigungen für das Handelsgericht, aber das sind Formalitäten. Sie wissen ja Bescheid“, ergänzte er abschließend, als könnte jeder weitere Hinweis für seine Kollegen Anwälte als Beleidigung gewertet werden.
Ein Handy summte.
Der Richter warf Dr. Fröhlich, dem Absender der Störung, einen strafenden Blick zu.
„Ich war bisher der Meinung, dass das Thema Gebrauch von Handys im Gerichtssaal umfänglich geregelt wäre.“
„Entschuldigen Sie bitte.“
Fröhlich schien selbst überrascht zu sein.
„Das ist mein privates Handy, eigentlich nur für Notfälle. Kann ich kurz nach draußen gehen?“
Er erhielt ein gnädiges Nicken und verließ den Raum.
Als er Sekunden später wieder hereinkam, sagte er mit ungewohnt unsicherer Stimme:
„Herr Richter, ich beantrage die Unterbrechung der Verhandlung. Unser Mandant …“, er stockte, als suche er nach passenden Worten, „unser Mandant ringt mit dem Tode!“
Stille im Raum.
Auf den fragenden Blick des Richters ergänzte er:
„Es ist auf ihn geschossen worden!“
1. Kapitel
Die Gebäude standen eng zusammen, dazwischen trug eine Vielzahl Rohrbrücken ein unübersichtliches Bündel von Rohrleitungen.
Alles um ihn herum hatte einen grauen Überzug, aus dem hier und da roter Backstein durchschimmerte.
Manchmal erschreckte ihn ein zischendes Geräusch. Die entweichenden Dämpfe waren nicht immer weiß, selten geruchlos.
Peter Stein konzentrierte sich auf die Buchstaben und Nummern der Straßen, die teilweise noch erkennbar an den Häuserfassaden angebracht waren und das ganze Werk zur Orientierung in Bereiche aufteilen sollten.
„Wenn du nicht weiterkommt, kannst du ja der Staubfahne folgen“, war der wohlwollende Rat eines Arbeiters, den er bei seiner Suche um Hilfe gebeten hatte.
Er würde nicht wieder fragen.
Dabei hatte der Tag problemlos angefangen.
Seine erste Station, die Personalabteilung, war im Hauptgebäude untergebracht.
Dort fand sich auch sehr schnell eine Person, die ihm bei seinem Anliegen helfen konnte.
Frau Mischnik war Mitte fünfzig, mit in einem Knoten gebändigten grauen Haar.
Dieses Strenge demonstrierende Äußere stand im Kontrast zu dem freundlichen Wesen, mit dem sie sich seines Anliegens annahm und die Formalitäten seiner Einstellung abwickelte.
Schneller als erwartet hatte er alle notwendigen Papiere zusammen.
„Wie gewünscht, für ein Jahr befristet.“
Mit diesen Worten entließ ihn die gute Frau Mischnik in den Irrgarten, genannt BUNA.
Als er sich an der Tür noch einmal umdrehte, sah er immer noch ihr mütterliches Lächeln unter dem Haarknoten.
Peter fühlte sich wie der Bergsteiger kurz vor dem Gipfel.
Es war der 1. August 1976.
Peter Stein war gerade 19 Jahre alt geworden und hatte zwei wundervolle Jahre als Student an der Pädagogischen Hochschule in Halle verbracht.
Die trug den verpflichtenden Namen N. K. Krupskaja, der Ehefrau Lenins.
Geholfen hatte es ihm nicht.
Schuld waren grundsätzliche Differenzen bezüglich der Ansicht darüber, was ein Studium letztendlich ausmacht.
Peter bevorzugte lange Nächte und hatte begreiflicherweise am Tag den Wunsch, sich zu erholen. Die andere Partei, vertreten durch den Dekan der Fakultät, sah das naturgemäß anders.
Der behauptete einseitig, Peters Verhalten wäre ein klassischer Fall von Studienbummelei.
Es folgte eine Unzahl von Disziplinarverfahren, in denen der Dekan bemüht war, seinen Standpunkt zu beweisen.
Peter hatte seinerseits darauf verzichtet, auf die Kausalität zwischen dem Fehlen im Unterricht und der Vielzahl der zu feiernden Anlässe hinzuweisen.
Er war allerdings davon ausgegangen, dass er sich keine nennenswerten Sorgen zu machen brauchte, schließlich gab es eine Exmatrikulationssperre.
Ein Umstand, in aller Munde und von der gängigen Praxis an der Hochschule auch nicht widerlegt, denn die Republik brauchte Lehrer.
Bis letzten Monat.
Peter war überzeugt davon, dass an ihm ein Exempel statuiert wurde.
Wer dafür die Verantwortung trug, stand für ihn außer Zweifel.
Sein Dekan, dieser Blödmann, hatte einfach keinen Sinn für wahres Studententum.
In einer der letzten disziplinarischen Auseinandersetzungen in seinem Büro hatte er sich herabgelassen, mit einem gespielten Anflug von Vertrautheit das Wort an Peter zu richten:
„Herr Stein“, hatte er gesagt, „Sie sollten eines wissen: Bei jedem neuen Pädagogikstudenten frage ich mich, würdest du diesen Pädagogikanwärter auf deine eigene Tochter loslassen? Bei Ihnen bin ich mir meiner Einschätzung zweifelsfrei sicher – niemals!”
Dann sorgte er dafür, dass ein solches Zusammentreffen unmöglich werden sollte.
Trotz eklatanten Lehrermangels hatte sich Prof. Nauert durchgesetzt und Peter exmatrikuliert.
Allerdings mit der Chance auf Bewährung.
Das Zauberwort hieß: Bewährung in der sozialistischen Produktion.
Er sollte dort seine Persönlichkeit festigen und seinen Charakter reifen lassen.
Die Entscheidung, wo dieser Reifeprozess stattfinden sollte, lag bei ihm.
Peter ging die Auswahl systematisch an.
Der Job musste zwei entscheidende Kriterien erfüllen.
Er sollte möglichst nah an der Hochschule sein, denn er wollte den Kontakt zu seinen Kumpeln, männlich wie auch weiblich, nicht verlieren.
Und er musste Geld einbringen.
Geldnot kannte er nämlich schon.
Das Gefühl, mit gefüllten Taschen zu leben, empfand er als eine erstrebenswerte Erfahrung.
Es war also nur logische Konsequenz, dass er jetzt durch die Straßen des BUNA-Kombinates marschierte.
Da er nicht ganz blöd dastehen wollte, hatte er sich das Buch „Die Geschichte der BUNA-Werke“ besorgt und darin geblättert.
Jetzt wusste er, dass BUNA gebaut worden war, um sich vom Import von Naturkautschuk unabhängig zu machen.
Interessant, fand Peter und hatte weitergelesen.
Ab 1936 wurden Autoreifen produziert und weil das wichtig für den später folgenden Krieg war, hagelte es amerikanische Bomben.
Dass trotzdem, von ein paar kurzen Ausfällen abgesehen, bis wenige Tage vor Kriegsende weiterproduziert wurde, hatte Peter beeindruckt.
Dann kamen die Amerikaner auch am Boden und dann die Rote Armee.
BUNA war wertvoll, also wurden die Besitzer enteignet und eine Sowjetische Aktiengesellschaft gegründet, die 1954 in einen Volkseigenen Betrieb, in das Kombinat VEB Chemische Werke BUNA umgewandelt wurde.
Wichtig, speziell für ihn, war es auch zu wissen, dass BUNA der größte Karbidproduzent der Welt war.
Dass man gerade dort das meiste Geld verdienen konnte, hatte er von der freundlichen Dame aus der Kaderabteilung erfahren.
Nicht weil man Weltmeister war, sondern wegen der vielen Zuschläge.
Da gab es Dreck, Hitze, Zwölfstundenschicht und noch ein paar andere Begleiterscheinungen und alles zusammen brachte die gewünschte Kohle.
Es war dann auch die Summe seines zukünftigen Einkommens, welche mögliche letzte Zweifel an der Arbeitsplatzauswahl zerstreut hatte, und so stand Peter Stein nach abgeschlossener Suche an diesem sonnigen 1. August vor dem Gebäude der Karbidmahlanlage.
Ein Arbeiter, der ihn mit unverhohlener Neugier ansah, zeigte ihm die Richtung zum Meisterbüro.
Dort, hinter dem Schreibtisch sitzend, wühlte der gesuchte Meister Kurt Stelter mit mürrischem Gesichtsausdruck in einem auf dem Tisch gestapelten Papierberg.
„Ich hatte es doch eben erst in den Händen“, knurrte er mit einer nicht unangenehmen, auffallend tiefen Stimme.
„Sie passt zu ihm“, fand Peter.
Bei zwei Zentnern Lebendgewicht würde eine hohe Stimme albern klingen.
Kurt Stelter war noch keine vierzig.
Wie Peter später erfuhr, hatte er in BUNA eine Lehre als Schlosser abgeschlossen und in der benachbarten Acetylen-Fabrik zu arbeiten begonnen.
Nach nur drei Jahren hatte man ihn auf die Meisterschule geschickt.
Von dort kam er ohne Parteiabzeichen am Revers wieder, bekam die Meisterstelle an der Karbidfront, an der er bis heute die Stellung hielt.
Endlich schien Kurt Stelter das Gesuchte auf seinem Tisch gefunden zu haben.
„Setz dich“, forderte er Peter auf.
Dieser schaute sich im Raum um und entdeckte hinter sich an der Wand einen Stuhl.
Es war eine dieser Sitzgelegenheiten, die aus ein paar Rohren, zusammengeschraubt mit Sperrholz für Hintern und Rücken, in millionenfacher Auflage irgendwo in diesem Land hergestellt wurden.
Verteilt über die gesamte Republik standen sie in jedem Betrieb, Büro oder Kantine und warteten auf ihre Opfer.
Peter zog den Stuhl an den Schreibtisch und nahm Platz. Stelter musterte ihn aufmerksam, bevor er ihn anbrummte:
„Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt, Junge. Es hilft uns hier überhaupt nichts, wenn du nach zwei Tagen alles wieder hinschmeißt und heulend wegrennst.”
Er holte noch mal Luft.
„Denn eines sage ich dir gleich, das ist kein Spaß in dieser Bude.”
Peter war beleidigt.
Was dachte der Kerl von ihm?
Gerade wollte er protestieren, als Stelter ihn mit einer Handbewegung daran hinderte.
„Glaub mir, ich weiß genau, was du mir sagen willst, ich habe das schon oft genug an diesem Tisch gehört. Aber ich weiß, wovon ich spreche, du noch nicht!”
Er richtete sich auf, warf einen Blick auf den Zettel, den er noch in der Hand hielt, und fuhr fort:
„Wir werden ja sehen. Du arbeitest in der Karbidmühle, in der 2. Schicht. Wann kannst du anfangen?”
Er erwartete keine Antwort, sondern schaute an die Wand rechts von ihm, an der ein großes Blatt befestigt war. Anscheinend so etwas wie ein Dienstplan.
„Die 2. Schicht hat heute die Nachtschicht. Also kannst du übermorgen in der Tagschicht anfangen. Da kann sich dann Achim um dich kümmern.”
Er ließ erst mal das Geheimnis, wer dieser Achim war, ungelüftet.
„Den Papierkram hast du mit der Kaderabteilung erledigt.”
Peter nahm an, dass das auch keine Frage, mehr eine vervollständigende Feststellung war, und wartete schweigend auf das Kommende.
„Soll das geheim bleiben, oder worauf wartest du?”
O. K., ein Irrtum.
Peter packte seinen Arbeitsvertrag aus und reichte ihn über den Tisch in die verlangend ausgestreckte Hand des Meisters.
„Hm“ und noch ein „Hm“ waren die einzigen Kommentare, bis Stelter auf Seite 3 des Dokumentes gekommen war.
Er blickte auf und fragte Peter mit jetzt doch etwas höherer Stimmlage:
„Was soll der Quatsch? Der Vertrag ist ja befristet. Wartest du auf einen Platz im Bau?”
Peter zuckte verlegen mit der Schulter.
Er konnte nicht wissen, dass die Karbidanlage ein beliebter Ort für die Beschäftigung rechtskräftig Verurteilter war. Sie verdienten sich hier so lange ihr Geld, bis eine Zelle im Gefängnis frei war.
Um die eingetretene Pause nicht peinlich werden zu lassen, sagte Peter:
„Eigentlich bin ich Student, Lehrer, Mathe und Physik.”
„Und was zum Teufel machst du dann hier?”
Eine berechtigte Frage, musste Peter zugeben.
In kurzen Sätzen erklärte er die Situation.
„Und deswegen brauche ich auch zwei Beurteilungen, eine Zwischenbeurteilung nach einem halben Jahr und dann am Ende des Jahres noch eine Abschlussbeurteilung.”
„Und beide müssen astrein sein, sonst lässt mich der Nauert nie wieder durch seine Tür“, schob er in Gedanken hinterher.
Peter hatte den Eindruck, als wäre Stelter diese Variante lieber als die mit der Zelle.
Es war bestimmt auch besser planbar.
„Also, so was wie dich hatten wir hier auch noch nicht“, konstatierte er, erhob sich mühsam und ging Richtung Tür.
Der sitzt auch auf so einem Stuhl, konnte Peter jetzt feststellen, war sich aber über die Bedeutung dieser Beobachtung noch nicht schlüssig.
Stelter riss die Tür auf und schaute in den angrenzenden kleinen Kantinenraum, in dem sich außer einer älteren Frau niemand weiter befand.
„Erika“, sprach Stelter sie an, „hol mir doch mal den Brenner her. Aber gleich!”
Die Frau, die gerade dabei war, den Boden der Kantine von dem permanenten Karbidstaub zu befreien, legte wortlos den Schrubber zur Seite und verließ den Raum.
„Das war Erika“, erklärte Stelter, „unsere gute Seele. Macht hier unsere Kantine. Die Hauptmahlzeiten kriegen wir ja von der Großküche, aber glaub mir, was Erika extra zaubert, kann man wirklich essen. Ist nicht überall so“, ergänzte er mit einem Anflug von Stolz.
Kurze Zeit später betrat ein Mann das Büro.
Peter sah ihn an und überlegte unwillkürlich, was an ihm nicht stimmte.
Der Mann hatte die sechzig überschritten, war dürr und trug seine wenigen Haare kurz geschnitten.
Seine Bewegungen waren auffallend langsam.
Plötzlich wurde Peter mit Erschrecken bewusst, was an dem Mann das Besondere war.
Die Farbe seiner Gesichtshaut, nein, der ganze Mensch sah aus, als hätte er gerade in Karbidstaub gebadet und so dessen Grauton angenommen.
Stelter hatte die Reaktion Peters bemerkt, ignorierte sie aber und stellte vor:
„Das ist Walter Brenner, unser Urgestein. Keiner kennt sich hier besser aus als er.”
Und sich direkt an Brenner wendend:
„Schnapp dir diesen Jüngling und erklär ihm die wichtigsten Dinge, vor allem, wovon er die Finger lassen soll. Und dann bringst du ihn noch zur Kleiderkammer, Asservatenraum und so weiter, du weißt schon, das Übliche.”
Brenner nickte.
„Acetylen-Fabrik?”
Er blickte Stelter fragend an.
„Nein, er kommt zu den Mühlen, in die 2. Schicht.”
Wieder nickte Brenner verstehend.
„Da wird sich Achim aber freuen, auch mal wieder einen zu bekommen. Wird auch Zeit.”
Stelter ging auf diese Bemerkung nicht weiter ein und machte es sich wieder hinter seinem Schreibtisch bequem; soweit man sich das auf diesen Stühlen machen konnte.
Als Peter zusammen mit Brenner das Büro verließ, vermisste er ein bisschen die Erhabenheit des Augenblicks.
Schließlich ging er jetzt in eine neue Welt, in die Arbeitswelt, in der er im Sinne der sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung gestählt und geformt werden sollte.
Drei Monate später stellte Peter fest, dass er mit der Zwölfstundenschicht immer noch keinen Frieden geschlossen hatte.
Vor allem jetzt im Herbst, als die Tage immer kürzer wurden, vermisste er das Tageslicht.
Wenn er zur Nachtschicht kam, war es dunkel, wenn er nach der Schicht ins Bett ging, war es dunkel, und wenn er aufwachte, war es meistens wieder dunkel.
So musste das Leben am Polarkreis sein.
Seine Kollegen mit Familie hatten natürlich genügend Gründe, die für dieses Schichtsystem sprachen.
Die Arbeitszeit pro Schicht sei zwar länger, argumentierten die, aber den vier Schichten, jeweils im Wechsel Tagschicht und Nachtschicht, folgten drei volle freie Tage.
Wo würde es so etwas noch geben?
Peter hatte die fruchtlose Diskussion irgendwann aufgegeben, sich auf seine Prioritäten, Kohle und Kumpel besonnen und befriedigt festgestellt, dass hier zumindest alles in den richtigen Bahnen lief.
Jede Woche bekam er einen gut gefüllten Briefumschlag in die Hand gedrückt, mit dem er, ein ungelernter Hilfsarbeiter, ein höheres Einkommen als ein diplomierter Lehrer in seinen Anfangsjahren bekam.
Die Wahl, Dreck oder Bildung, wurde damit nicht einfacher.
Auf dem Weg zur Frühschicht kam Peter zufällig einmal dazu, als die Lohngelder ins Werk gebracht wurden.
Ein einfacher weißer Kastenwagen parkte am Eingang des Hauptverwaltungsgebäudes und die Fahrer luden die Geldsäcke aus.
Nirgends gab es bewaffnete Sicherheitsleute, Polizei oder Absperrungen.
Später hörte er, dass das Geld in der Hauptkasse dann Schein für Schein auf Tausende Briefumschläge und die wiederum auf die einzelnen Abteilungen verteilt wurden.
Seinen Kollegen konnte er mit solchen Neuigkeiten nicht imponieren.
Die zuckten nur gelangweilt mit den Schultern.
„Und wenn der Transport mal überfallen wird? In den Säcken müssen doch Millionen sein“, hatte Peter versucht, Interesse zu wecken.
Die einzige Reaktion bestand in dem uralten Witz vom Fluchtauto mit den 20 Jahren Wartezeit.
Das Thema „geografische Nähe“ war komplexer.
Peter war in seiner neuen Welt angekommen.
Sein Interesse an dem Leben im Werk, in der Abteilung wuchs mit jedem neuen Arbeitstag.
Bei jeder Gelegenheit nervte er seine Kollegen mit seinen Fragen und mit jeder Antwort taten sich neue auf.
Seine bisherigen Kontakte mit der Arbeitswelt waren bisher auf Wochenendaktionen in der Brauerei oder auf Ernteeinsätze beschränkt gewesen.
Manches kannte er auch aus Erzählungen seines Vaters.
Es war Tradition in seinem Elternhaus, dass nach Feierabend jeden Nachmittag gemeinsam Kaffee getrunken wurde.
Dabei gab sein Vater immer die neuesten Eulenspiegeleien aus seinem Werk zum Besten.
Manchmal hatten sie Tränen gelacht.
Jetzt war er selbst mitten in dieser Welt angekommen und hatte feststellen dürfen, dass die Realität noch irrwitziger als jede Erzählung sein konnte.
Dann waren da noch seine neuen Kollegen, richtig gute Kumpel.
Am Anfang, nach dem Rundgang mit dem alten Brenner, hatte er gedacht, den Job kann jeder Trottel mit links machen.
Er wusste es bald besser.
Schon in der ersten Schicht verlor er alle Arroganz und bekam einen ordentlichen Respekt vor dem, was hinter den grauen Fassaden geleistet wurde.
In der Karbid-Mühlenanlage war, so wie überall, alles alt.
Es gab Aggregate aus den Dreißigerjahren, manche aus den Sechzigern.
Die Mühlen, riesige Schlagmühlen, zylinderförmig, auf einer waagerechten Achse sich drehend, waren undicht, sodass ständig feiner Karbidstaub aus ihnen hervorrieselte.
Da das Karbid direkt von den Brennöfen über Silos in die Mühlen kam, war es immer noch sehr heiß.
Die Mühlen wurden dann zu Öfen und strahlten eine unerträgliche Hitze aus.
Als seine Kollegen ihm erklärten, was zu tun sei, klang das erst einmal einfach.
Sie sollten den Staub mit einer Schaufel unter den Mühlen hervorholen und in eine Art Gully, der mit einem im Boden befindliches Fördersystem verbunden war, hineinwerfen.
Zwischen der Mühle und dem Einwurfsieb des Gullys war ein Abstand von etwa sechs Metern.
Die Mühle wurde angehalten und seine beiden Kollegen stellten sich mit ihm zu einer Kette auf.
Der Erste ging unter die Mühle und schaufelte den Staub unter ihr hervor.
Der Zweite schaufelte ihn weiter und er, Peter, als Dritter, brauchte nur noch den Staub in das Sieb zu werfen.
Nur noch!
Heute, als „alter Hase“, wusste Peter, wie gnädig die beiden mit ihm gewesen waren, als sie ihn an das Ende der Kette gestellt hatten.
Die Gefahr war das Schwitzen.
Das bedeutete Feuchtigkeit auf der Haut und die, zusammen mit dem feinen, in der Luft schwebenden Karbidstaub, machte aus dem menschlichen Körper eine eigene kleine Acetylen-Fabrik.
Die Haut verbrannte am ganzen Körper und so sah Peter am Ende der Schicht, im Gegensatz zu seinen Kollegen, wie ein roter Streuselkuchen aus.
Für ihn unbegreiflich, hatten sie gelernt, ihren Körper zu beherrschen.
„Irgendwann lernst du das auch“, war ihr, zugegebenermaßen etwas gönnerhafter, Kommentar unter der Dusche.
Sie konnten eben etwas, was der Student nicht konnte.
Peter war auf dem Weg zur Schicht.
Er war spät dran und beeilte sich, um nicht unpünktlich zu sein.
Er war an diesem Tag an den Mühlen als Anlagenfahrer eingeteilt und die Kollegen sollten sich darauf verlassen können, pünktlich abgelöst zu werden.
Darauf legte jeder Wert, es war einfach ein Zeichen von Höflichkeit und Respekt.
Es konnte aber auch sein, dass an diesem Tag noch gar nicht wieder gearbeitet werden konnte, denn an den Karbid-Brennöfen wurde gestreikt.
Peter hatte zuerst gedacht, es wäre ein Scherz.
Es gab keine Streiks im Sozialismus.
Streik war für ihn so wenig vorstellbar, wie einen Trabi im Konsum kaufen zu wollen.
Streiks gab es im Kapitalismus, da gehörte er hin.
So weit die Theorie.
Und doch war es am Vortag zur Arbeitsniederlegung an den Öfen gekommen.
Nach dem, was er verstanden hatte, ging es den Arbeitern nicht um Lohnerhöhungen, sondern um die Wiedereinstellung eines Kollegen.
Angeblich hatte der sich immer wieder über die Zustände in seiner Schicht beschwert.
Es gebe zu wenig Mitarbeiter für völlig überzogene Produktionsvorgaben, aber keine Partei- oder Werksleitung interessiere sich dafür.
Als er eine Unterschriftensammlung organisierte, bekam er die Kündigung.
Blitzartig war die Geschichte Topthema im ganzen Werk.
Wo immer wenigstens zwei Leute zusammenkamen, hatten sie durch die sich überschlagenden Neuigkeiten ihren Gesprächsstoff.
Dabei war es schwer, Wahrheit und Fantasie voneinander zu trennen.
Peter war von dieser Art Kameradschaft schwer beeindruckt.
Seine romantische Ader ließ die vier Musketiere wiederauferstehen: Einer für alle und alle für einen.
Sein Meister, Kurt Stelter, holte ihn von seiner Wolke wieder runter.
„Wenn du dein Studium irgendwann beenden willst“, hatte er zu ihm gesagt, „dann halte dich da raus!“
Peter kam in der Anlage an und sah sofort, dass wieder gearbeitet wurde.
Die Silos waren voll mit heißem Karbid.
Er geduldete sich, bis er zu seiner ersten Pause abgelöst wurde.
In der Kantine traf er Achim, seinen Brigadeleiter.
„Also haben sie aufgegeben?“
„Wie kommst du denn darauf?“, erwiderte Achim.
„Na, vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass drüben wieder gearbeitet wird.“
Peter mochte es nicht, wenn Fragen mit Gegenfragen beantwortet wurden.
„Nein, die Kündigung wurde zurückgezogen.“
„Das gibt’s doch nicht!“, brach es aus Peter heraus, wobei er mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. Erschrocken zuckten beide zusammen.
Peter musste an Stelters Worte denken.
„Doch, das gibt’s.“
Achim streckte sich ein wenig, lächelte und fuhr fort:
„Ich denke, da wollten erst mal ein paar Leute verhindern, dass die Geschichte große Kreise zieht, Richtung Berlin.“
Achim machte das Gesicht eines Wissenden.
Er war, ähnlich wie Brenner, ein Langgedienter.
Seit mehr als 35 Jahren arbeitete er in BUNA, kannte jede Schraube und vor allem die richtigen Leute.
Peter schätzte an ihm besonders seine ruhige Art, mit Menschen umzugehen.
In so einer Schicht konnten die Emotionen auch mal hochgehen, dazu brauchte es keinen besonderen Anlass.
Achim war dann immer Garant, die Streithähne wieder runterzubringen.
„Und jetzt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen?“
Peter wollte das nicht so richtig glauben.
„Interessante Frage.“
Achim schaute Peter aufmerksam an.
„Ich denke, man sollte in der Schicht eine Weile gut aufpassen“, formulierte er auffallend vorsichtig.
„Ich habe schon erlebt, dass Kollegen plötzlich nicht mehr da waren, auch ohne Kündigung.“
Achim ignorierte Peters fragenden Blick.
Er hatte genug gesagt.
Die Tür zur Kantine öffnete sich und sein Kollege Werner Bauer trat ein.
Werner war ein noch junger Mann von 27 Jahren, groß und kräftig gebaut.
Das war ihm auch bewusst und seine Haltung und seine Bewegungen strahlten ein entsprechendes Selbstbewusstsein aus.
Er erinnerte ihn an einen seiner ehemaligen Kommilitonen an der Hochschule.
Der machte aktiv Judo in einem Kampfsportverein und ließ auch ständig die Muskeln spielen.
Zu Hause schrieb er Gedichte und Liedertexte.
Werner war verheiratet und hatte ein Kind, ein kleines Mädchen namens Gloria, vier Jahre alt.
Die kleine Familie wohnte in zwei Zimmern bei den Eltern seiner Frau in Halle-Trotha.
Bad und Küche mussten sie sich teilen. In der Ehe kriselte es.
Es gab ständig Streit mit den Eltern. Es waren einfach zu viele Menschen zu eng aufeinander.
Seit drei Jahren bemühte Werner sich um eine Neubauwohnung, doch obwohl in Halle-Neustadt Hunderte von Wohnblöcken extra für die Chemiearbeiter gebaut worden waren, hatte er bisher keinen Erfolg gehabt.
Auch Stelter und sogar der Parteisekretär der Abteilung hatte Briefe an die Verteilungsstelle geschickt.
Selbst das hatte nichts gebracht.
Werner setzte sich zu ihnen und sprach Peter an.
„Hast du Montag Zeit?“
Montag kam er aus der Nachtschicht und hatte dann die folgenden drei Tage frei.
Er wollte sich mit ein paar Studenten in Kröllwitz treffen, ein paar Bierchen trinken, quatschen.
„Wieso fragst du?“, entgegnete Peter erst mal vorsichtig.
„Ich wollte wissen, ob du mir beim Umzug helfen willst. Irgendwann am Nachmittag.“
Werner strahlte über alle Gesichtspartien.
Achim begriff am schnellsten.
„Hey, es hat doch nicht etwa geklappt?“
Man konnte sehen, wie er sich für Werner freute.
Der grinste.
„Doch, aber du wirst lachen“, sagte er mit gewichtiger Miene, „wenn du hörst, wieso.“
Er genoss kurz die Aufmerksamkeit, die seinen Worten gefolgt war, dann rief er:
„Mein Schwiegervater war’s!“
Peter schaute verständnislos zu Werner, dann zu Achim.
Der fragte direkt nach.
„Eigentlich ganz einfach“, erklärte Werner, „er ist mit Gloria hingegangen und hat denen gesagt, er hätte es satt und würde uns samt dem Balg rausschmeißen. Das, was er ertragen müsste, hätte nichts mehr mit sozialistischer Lebensweise zu tun, und als man das natürlich nicht ernst nahm und ihn abblitzen lassen wollte, setzte er dem Mitarbeiter unsere Tochter auf den Schoß und sagte, dass er schon mal auf sie aufpassen solle. Er würde nur noch die restlichen Klamotten von zu Hause holen.“
Werner gluckste vor sich hin.
„Ich war ja nicht dabei, aber er muss die ganz große Show abgezogen haben. Am nächsten Tag hatten wir unsere Wohnungszuweisung!“
Zufriedenheit breitete sich auf seinem Gesicht aus.
„Also, kannst du mir helfen?“, kam er auf seine Frage zurück.
Verlegen drückte sich Peter um die Antwort.
„Wenn du schon was vorhast, kein Problem, wir schaffen das schon. Ich wollte dich aber auf jeden Fall fragen.“
Plötzlich begriff Peter, dass es Werner gar nicht darum ging, ihn als Hilfsarbeiter anzuwerben.
Er wollte ihm mit der Frage zeigen, dass er ihn als einen Freund sah.
„Nein, nein“, beeilte sich Peter zu sagen.
„Das ist überhaupt kein Problem, ich komme gern.“
Die Kneipen in Kröllwitz konnten auch mal ohne ihn auskommen.
„Prima“, stellte Werner sichtlich erfreut fest, bevor er sich verabschiedete und zurück an seine Arbeit ging.
Auch für Peter war es Zeit geworden, sich wieder um seine Mühlen zu kümmern.
Im Schaltraum angekommen, merkte er sofort, dass irgendetwas nicht stimmte.
Die Anlage war abgestellt worden.
Seine Pausenablösung war nirgends zu sehen.
„Hey, wo steckst du?“, rief Peter.
Er konnte ihn nicht entdecken.
Dafür hörte er über sich Stimmen.
Peter begann zu ahnen, was los war.
Das frisch gebrannte Karbid durchlief einen einfachen Behandlungsweg.
Über ein Förderband aus Stahl gelangte es von den Öfen kommend in fünf oben offene Silos.
Unter jedem dieser Silo stand eine Mühle, in die das Karbid zum Mahlen dosiert wurde.
Ein Schieber regelte die Zufuhr, ansonsten löste der freie Fall die Einfüllaufgabe.
Dementsprechend waren zwei Mitarbeiter auf zwei Etagen zur Bedienung der Anlage nötig.
Die Arbeiter nannten sie das Ober- und das Unterhaus.
Die Aufgabe des Oberhaus-Kollegen war es, das Karbid auf die Silos zu verteilen. Dazu hatte er Abstreifer auf dem Hauptförderband, die er so einstellte, dass das Karbid möglichst im Verhältnis des Verbrauchs durch die Mühlen verteilt wurde.
Für diese Aufgabe gab es weder Arbeitsanweisungen noch Vorgaben, man brauchte ausschließlich Erfahrung und jede Menge Fingerspitzengefühl.
Peters erste Einsätze in diesem Teil der Anlage waren, genau wie bei jedem anderen Neuling, sehr anstrengend gewesen.
Immer, wenn er geglaubt hatte, endlich auch den letzten der Abstreifer richtig eingestellt zu haben, wurde am ersten das Silo leer oder drohte überzulaufen.
Irgendwann war das einzige Ziel, das Ende der Schicht zu erreichen. Heute musste er lachen, wenn er daran zurückdachte.
Der Unterhaus-Kollege bediente die Mühlen, indem er dafür sorgte, dass die immer mit der richtigen Menge Karbid gefüllt waren.
Peter stieg die Treppen nach oben und als er die Siloebene erreicht hatte, wurde seine Vermutung bestätigt.
Silo drei war voll bis in die Schurre und auf dem Förderband türmte sich das Karbid.
Zum Glück war am Förderband kein Schaden zu erkennen.
„Ich konnte das Band rechtzeitig abstellen“, sagte Bernd Hammer, der heutige Oberhaus-Kollege, der dem Blick Peters gefolgt war.
„Wenn ich alle Mühlen auf Maximum laufen lasse, haben wir schnell Platz in den Silos“, überlegte Peter laut.
Der Kollege nickte:
„Ich werde sehen, dass ich das Zeug so schnell wie möglich vom Band runterschiebe.“
Peter ging zurück in die Schaltwarte. Nach 20 Minuten hörte er von oben rufen:
„Ist alles frei, du kannst wieder normal fahren!“
„O. K.“, rief er zurück, „ich sage am Ofen Bescheid!“
Peter trat zu dem Telefon, das an der Wand des Schaltraumes befestigt war.
Diese Apparate, schwer und klobig, genossen im Gegensatz zu dem Rest der Technik den Ruf der Unzerstörbarkeit und wurden darum überall, wo Dreck und Staub Technik stören könnten, eingesetzt.
Peter wählte die Nummer vom Leitstand der Karbid-Öfen und rief in die Sprechmuschel:
„Ihr könnt das Band wieder anstellen, es ist wieder frei.“
Peter hörte etwas wie „Idioten, da drüben“ aus dem Hörer, dann war die Verbindung beendet.
„Denen haben wir den Tag gleich mit versaut“, stellte er mit einem Grinsen fest.
Er hängte den Hörer wieder in die Gabel.
Ein Blick auf die großen Amperemeter der Schalttafel zeigte ihm über den Stromverbrauch den optimalen Lauf der Mühlen an.
Es gab erfahrene Kollegen, die nur an dem Geräusch der Mühle hörten, ob an der Dosierung des Karbids nachgeregelt werden musste.
„Vielleicht haben wir den Rest der Schicht unsere Ruhe“, hoffte er mit einem Anflug von Optimismus.
Ein Blick auf die Uhr sagte Peter, dass es noch mehr als zwei Stunden bis zur nächsten Pause waren.
„Zwei Kapitel könnte ich schaffen“, überlegte er und zog einen Taschenkrimi aus der Jacke.
An dem darauffolgenden Montag befand sich Peter wie versprochen auf dem Weg zu Werners neuer Wohnung in Halle-Neustadt.
Es war sein erster Besuch in der „Satellitenstadt“ und er empfand diese Bezeichnung mehr als passend.
Unzählige Wohnblocks reihten sich neben- und hintereinander, dazwischen gab es Kaufhallen, Schulen und Kindergärten, Friseur und Reinigung.
„Alles topfunktional“, stellte Peter fest, „nur bei den Fassaden hätten sie sich mehr anstrengen sollen. Ein Klecks Farbe hätte nicht geschadet.“
Die Menschen, denen er begegnete, schien das nicht zu stören.
„Vielleicht empfindet man nur so“, vermutete er, „wenn man wie ich in einer Kleinstadt aufgewachsen ist.“
Peter konzentrierte sich auf sein Ziel.
„Du wirst uns ohne Probleme finden“, hatte Werner behauptet und ihm eine blumenreiche Wegbeschreibung mitgegeben.
Er war mit der S-Bahn bis Station Halle-Neustadt gefahren und in die beschriebene Richtung marschiert.
Da es überall gleich aussah, hatte er nur die Nummerierungen der Blocks als Orientierung.
Nach einiger Zeit bekam er das Gefühl, dass etwas nicht stimmen könnte.
Er hätte längst da sein müssen.
Der Passant, den er ansprach, nickte wissend und erklärte den Weg.
Zu Peters Verdruss zeigte er dabei in die Richtung, aus der er gerade gekommen war.
Fünf Minuten später stand er im gesuchten Hauseingang und studierte die Klingelleiste.
„Fam. Bauer“ stand da und man sah dem Namensschild an, dass es neu war.
Werners Wohnung lag im zweiten Stock. Für ein Haus ohne Aufzug noch erträglich.
In der Wohnung wurde er mit großem Hallo begrüßt.
Es waren mindestens zehn Leute, die sich dort drängten. Ein paar seiner Kollegen aus der Schicht waren dabei, er erkannte auch Achim im Gespräch mit einer älteren Frau.
Die anderen hatte Peter noch nie gesehen.
Werner kam auf ihn zu. Er strahlte wie nach einem Sechser im Lotto.
„Schön, dass du da bist.“
Er klopfte ihm auf die Schulter.
„Das Auto muss jeden Moment kommen. Mein Schwiegervater ist ihm mit dem Trabi vorausgefahren.“
Dabei nickte er in die Richtung eines Mannes, der, eine Flasche Bier in der Hand, mit einem jüngeren Mann im Gespräch war.
Ehe er sich versah, war auch Peter mit Bier versorgt.
Er schaute sich um und ging langsam zu seinem Brigadeleiter.
„Hallo Achim“, begrüßte er ihn.
Achim stellte ihm die Frau an seiner Seite als Werners Schwiegermutter vor.
„Ich freue mich, Sie kennenzulernen“, antwortete er unter Nutzung seiner ganzen Kinderstube.
Auch sie wirkte überglücklich.
„Es wurde höchste Zeit, dass die drei bei uns rauskommen“, sagte sie und es schien ihr wichtig, dass sie nicht missverstanden wurde, deshalb fuhr sie fort:
„Aber jeder braucht seine eigenen vier Wände. Das ist doch auf Dauer kein Leben. Vielleicht hätten wir schon längst ein zweites Enkelkind.“
Bei den letzten, leiser gesprochenen Worten wurde sie doch tatsächlich ein bisschen rot.
„Wer weiß“, grinste Achim, „wir werden ja bald erleben, wie das neue Umfeld wirkt.”
Der guten Frau war das Thema nun doch sichtlich peinlich und sie lenkte ab:
„Ich glaube, ich habe die Gardinen im Auto liegen lassen. Ich hole sie schnell, dann kann mein Mann sie noch anbringen!”
In der Zwischenzeit war der Umzugswagen angekommen und Peter packte mit den anderen zusammen an.
Das ging schnell, die Familie Bauer hatte nicht viel eigenen Hausrat. Die paar Möbel waren nach einer guten Stunde aufgestellt, die Wäschekörbe mit Geschirr und Kleidung in den Räumen verteilt.
Jetzt war auch Werners Frau Sabine mit der Kleinen da. Sie reichte einen großen Teller mit belegten Broten herum.
„Ihr müsst euch doch erst mal stärken, so wie ihr schuftet.”
Obwohl Peter es für Übertreibung hielt, hier von „schuften“ zu sprechen, langte er kräftig mit zu.
Dann half er dem Schwiegervater beim Anbringen der Gardinen.
Er hatte gerade die letzten Löcher gebohrt und die Dübel eingesetzt, als er fragte:
„Wie haben Sie das denn nun tatsächlich angestellt mit der Wohnung?”
Er bekam einen misstrauischen Blick von seinem Gegenüber.
„Na ja, ich meine“, Peter wollte nicht als neugierig gelten, „vielleicht brauche ich ja auch mal eine Wohnung und da ist es doch gut zu wissen …”
„Ist schon gut.”
Der Mann hob abwehrend die Hände.
„Ich nehme an, du hast die Geschichte von Werner gehört.”
Peter nickte und der Schwiegervater fuhr fort:
„Ich hatte einfach Glück. Wenn der Kollege in dem Amt weniger Humor gehabt hätte …“, er zuckte kurz mit den Schultern, „wahrscheinlich hätte er mich einfach rausgeschmissen. So allerdings, denke ich“, fuhr er fort, „hatte ihn meine Aktion einfach beeindruckt.“
Er wandte sich ab und begann die Gardinenhalterung mit den Schrauben zu befestigen.
Peter sah, dass er dazu nicht gebraucht wurde, und machte sich auf den Weg in die Küche, wo er Werner vermutete.
Tatsächlich werkelte der an der Spüle.
Sein Oberkörper war fast vollständig in dem Unterschrank verschwunden.
Wie der Chefarzt bei einer Operation in der Klinik rief er seiner Frau die Instrumentenfolge ab: Zange, Dichtung, Flansch.
Nach gut fünf Minuten war die Operation erfolgreich beendet und Werner tauchte wieder auf.
„So“, konstatierte er, „müsste jetzt dicht sein!”
„Sag mal“, fragte Peter ihn nun, „hattest du nicht immer von einer Dreiraumwohnung gesprochen?”
Werner suchte verlegen nach einer Antwort.
„Ja, klar, hatte ich gesagt. Aber weißt du, es ist so.”
Er holte tief Luft.
Die folgende Erklärung sollte wohl über einen Satz hinausgehen.
„Auf dem Wohnungsamt haben die genau erklärt, wie viel Wohnraum wem und wann zusteht. Demzufolge hätten wir entweder ein älteres Kind haben müssen oder mindestens zwei, besser noch drei kleine Kinder. Da wir beides nicht haben, noch nicht“, betonte er mit einem vielsagenden Blick zu seiner Frau, „gab’s jetzt erst mal diese Zweiraumwohnung.”
Sabine mischte sich ein:
„Sie ist ein Traum und, unter uns gesagt, im Moment hätte ich auch den Keller genommen.”
„Stimmt“, bestätigte Werner und nahm seine Frau in den Arm.
„Und außerdem bin ich jetzt auch viel schneller im Werk.”
Wenn man bedachte, dass er keine fünf Minuten bis zur S-Bahn brauchte und die direkt vor dem Werkstor hielt, ging es tatsächlich nicht viel besser.
Er selbst brauchte für das eine Jahr keine eine Wohnung, also war er im werkseigenen Wohnheim eingezogen, das in einer Baracke direkt gegenüber dem Werk untergebracht war.
Normalerweise wohnten dort Arbeiter, die auf Montage im Werk waren, oder irgendwelche Spezialisten von außerhalb.
Es war die Ausnahme, dass mal einer von ihnen längere Zeit blieb, und so war es schwierig, neue Leute kennenzulernen.
Den fehlenden Komfort konnte man verschmerzen.
Er hatte ein Bett, einen Nachttisch und einen Schrank.
Alles einfachste Ausführung, Pressplatte mit hellem Furnier, ohne irgendeinen Farbtupfer, aber es reichte.
Positiv war, dass er, im Vergleich zum Studentenwohnheim allein untergebracht war.
Mit acht Mann im Zimmer konnte es zwar durchaus lustig sein, oft genug aber auch sehr nervig.
Als sich Peter am Abend von den neuen Wohnungsbesitzern aus Halle-Neustadt verabschiedete, hinterließ er eine glückliche Familie.
Drei Tage später startete er wieder mit der Frühschicht. Laut Dienstplan war er als Springer eingeteilt.
Eine Schicht bestand theoretisch aus fünf Personen, durch Urlaub und Krankheit waren vier Mann Besetzung der Normalfall. Zwei führten jeweils eine der Anlagen, die beiden anderen waren Springer.
Deren Aufgaben bestanden darin, die Anlagenfahrer zu ihren Pausen abzulösen und dazwischen Reinigungs- oder einfache Reparaturarbeiten auszuführen.
Peters Partner an diesem Tag hieß Roland und war ein Mann von circa 35 Jahren.
Er war zwar nicht verheiratet, hatte aber zwei Kinder, beide von je einer anderen Frau.
Roland war berüchtigt dafür, ständig seinen Frust über die Gier seiner Ex-Frauen an den Kollegen auszulassen.
Seinen Erzählungen zufolge gab es für seine Weiber keinen anderen Lebensinhalt, als ihm das Dasein zu vergällen.
Umso erstaunlicher war es zu erleben, mit welcher Zuneigung und Begeisterung er von seinen Kindern sprach.
Der Stolz auf seine beiden ließ ihn fast platzen.
Roland hatte nur einen Achte-Klasse-Abschluss und das ärgerte ihn gewaltig.
„Mann, ich war so bescheuert“, hatte er Peter einmal anvertraut, „ich hätte nicht abgehen müssen. Ich war einfach nur zu faul, weiterzumachen.“
Sie wollten gerade in das Mühlengebäude gehen, um dort mit den Reinigungsarbeiten zu beginnen, als Kurt, ihr Schichtmeister, nach ihnen rief.
„Hey, ihr zwei, mit den Mühlen könnt ihr nach der ersten Pause anfangen“, empfing er sie.
„Im Moment habe ich was anderes für euch. Seht ihr dort die Pumpe auf dem Aufbau?”
Die beiden folgten mit ihrem Blick seinem ausgestreckten Fin-ger.
An der Hallenwand der Acetylen-Fabrik erkannten sie das bezeichnete Aggregat.
Es bestand aus einer Art Tragegestell aus Winkelstahl, mindestens 1,50 Meter hoch.
Darauf war eine Pumpe mit entsprechendem Antrieb installiert.
Peter hatte sich bereits erklären lassen, warum das Teil außerhalb des Gebäudes stand.
Die Acetylen-Fabrik war ein explosionsgefährdeter Betrieb, da mochte man nicht gern Funken in der Halle.
Aber die Frage, warum nicht wenigstens ein Dach über Motor und Pumpe war, konnte ihm niemand beantworten.
„Ich möchte“, sagte Kurt, „dass ihr das Ding endlich mal von dem Dreck befreit. Man kann ja nicht mehr hinschauen.”
Das gesamte Gestell einschließlich des Pumpenkörpers war mit einer dicken Kruste aus fest gewordenem Karbidstaub bedeckt.
Peter fand, dass es sich so gut in die Umgebung einpasste, sagte es aber nicht.
Er hatte sich abgewöhnt, ästhetische Themen anzusprechen.
Seine kurze Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass er mit solchen Gedanken nur Verwirrung stiftete.
Also nickte er dem Meister einfach zu und machte sich mit Roland daran, ans Werk zu gehen.
Nach gut 20 Minuten waren sie so weit, dass neben Pumpe und Gestell ein kleiner Berg Karbiddreck aufgehäuft war.
Sie wollten gerade mit ihren Hämmern den Rest abklopfen, als Achim auf sie zugelaufen kam und rief:
„Was zum Teufel macht ihr da?”
Roland sah ihm verwundert entgegen und Peter sagte:
„Was sollen wir denn schon machen, wir klopfen den Dreck ab.“
„Sofort aufhören, ihr Idioten“, schrie er jetzt, „seht ihr denn nicht, was ihr da anstellt?”
Beide, Roland und Peter, schauten hilflos auf ihren Brigadeleiter.
So aufgeregt hatten sie ihn noch nie erlebt.
„So seht doch hin“, kam es in unverändertem Tonfall von ihm.
Plötzlich erkannte Peter den Grund für Achims Aufregung.
Im selben Moment riss er Roland von seiner Arbeit weg, keine Sekunde zu früh.
Das ganze Untergestell war offensichtlich nur noch von dem mit der Zeit hart gewordenen Karbidstaub zusammengehalten worden und brach nun in sich zusammen.
„Den Dreck“, konstatierte Peter, „haben wir erfolgreich entfernt.“
Bleich vor Schreck sagte Roland:
„Verfluchte Scheiße, das hätte auch ins Auge gehen können.”
Achim war kaum zu beruhigen.
„Wie kommt ihr nur auf eine solche Schnapsidee? Euch muss doch sonst was geritten haben!”
Peter fühlte sich unschuldig und wollte das auch sagen, hielt sich dann aber doch damit zurück.
Der Krach, mit dem der Zusammenbruch begleitet wurde, hatte einige Kollegen aus der Halle gelockt.
„Vielleicht können wir das Ganze intern klären“, hoffte Peter.
Es stellte sich heraus, dass die Pumpe Teil eines Kühlwasserkreislaufes war und deswegen die Produktion in der Acetylen-Fabrik unterbrochen werden musste.
Damit war „intern“ erledigt.
Die sozialistische Produktion der DDR wurde grundsätzlich geplant und in dieser Planung kam ein Produktionsausfall nicht vor.
Wenn dann doch der nicht vorgesehene Fall eintrat, wurde er zum BV, zum besonderen Vorkommnis.
Und dafür gab es jede Menge Funktionäre, die sich dieser BV anzunehmen hatten.
Es wurden Berichte für die Abteilungsleitung, den Parteisekretär der Abteilung, den Parteisekretär des Betriebes und an die Werkleitung verfasst. Der FDGB bekam natürlich immer einen Durchschlag, meist auch die DSF, die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.
Je nach Bedeutung des BV gingen Berichte an die Kreisleitung der Partei, an die Bezirksleitung der Partei, an den Rat des Kreises und an den Rat des Bezirkes.
Bei ganz bedeutenden Ereignissen wurde Berlin eingeschaltet.
Die Quelle aller dieser Informationslawinen war üblicherweise der Tagesbericht des verantwortlichen Schichtleiters.
Und da lag diesmal das Problem.
Eine Stunde nach dem Vorfall saß der, unruhig einen Stift in der Hand drehend, in seinem Büro, Roland und Peter ihm gegenüber.
„So ein Scheiß.”
Kurt war sonst kein Freund von Kraftausdrücken.
„Was schreibe ich denn nun?”
Peter war sich nicht sicher, wo genau Kurts Problem lag.
„Hast du Angst zu schreiben, dass das Ding nur noch vom Dreck gehalten wurde oder dass du den Auftrag erteilt hast, daran herumzuklopfen?”
Kurt sah wütend zu Peter.
„Angst“, erwiderte er trotzig, „wie kommst du denn darauf?“
Sein gequälter Gesichtsausdruck strafte ihn Lügen.
Kurt tat ihm leid, vor allem, weil es ihn gleich zweimal treffen würde.
Sein direkter Chef war der Abteilungsleiter Acetylenproduktion, zu der auch die Mahlanlage gehörte. Der würde ihm als Erster die Hölle heiß machen.
Und Kurt war Mitglied der SED.
Peter hatte davon gehört, dass auch in deren Parteigremien und -versammlungen solche Vorkommnisse ausgewertet wurden.
Für ihn waren diese Zuständigkeiten irrational, Führungsrolle der Arbeiterklasse hin oder her.
Er wusste sich mit dieser Meinung auch nicht allein.
Vor allem bei den Meistern und Abteilungsleitern breitete sich oft genug Unmut aus, wenn sich Parteifunktionäre in technische Entscheidungsprozesse einmischten, von denen sie keine Ahnung hatten.
Allerdings änderte sich deswegen nichts. Kurt musste damit rechnen, dass es zu einem Parteiverfahren kommen würde und das hieße, dass das arme Schwein wird gleich zweimal hingerichtet würde.
Die einzige Chance, seinen Kopf aus der Schlinge zu bekommen, war, nachzuweisen, dass der desolate Zustand des Pumpengestells schon lange vorher bekannt war.
„Dann wäre der Abteilungsleiter der Instandhaltungstruppe der Dumme“, dachte Peter und sagte es auch.
Kurt sah die beiden vor sich nachdenklich an, sagte aber nichts.
Dann stand er auf, öffnete die Tür und sah zu Peter.
„Weißt du, das ist nicht mein Stil und ich fange heute auch nicht damit an! Wir werden sehen, was kommt.”
„Heldenhaft klingt trotzdem anders“, sagte Peter nachdenklich und sah ihm nach.
Die kommenden Tage war das zusammengebrochene Gestell Thema Nummer eins im Werk.
Erst sprach man über Sondersitzungen der Werkleitung, dann über den Besuch der Genossen aus der Bezirksparteileitung. Selbst Mitglieder aus dem Zentralkomitee waren angeblich aufgetaucht, um, wie es offiziell hieß, die hiesigen Genossen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Jeder erwartete den großen Rundumschlag und – es passierte nichts, rein gar nichts.
Das führte erst recht wieder zu wilden Spekulationen unter den Kollegen.
Tagelang wurde durchgekaut, woran es liegen konnte, dass die Herren Funktionäre nichts taten.
Peter hatte unter der Vielfalt von Erklärungen einen Favoriten.
Die Diskussion über den Vorfall hatte nicht am Werkstor haltgemacht. Die Mitarbeiter erzählten zu Hause oder in der Kneipe davon. „Der Dreck hält bei uns alles zusammen“, hörte man an den Biertischen. Es sollte sogar eine Kabarettgruppe nachgefragt haben, die die Geschichte in ihr Programm aufnehmen wollte.
Werkleitung und Parteiführung standen vor der Entscheidung, den Betrieb weiter der Lächerlichkeit preiszugeben oder sich auf Schadensbegrenzung zu konzentrieren.
Das war für Peter das wahrscheinlichste Szenario.
Der tatsächliche Grund, warum der Vorfall still und heimlich totgeschwiegen wurde, blieb ein Geheimnis.
„Glück gehabt, Kurt“, freute sich Peter.
„Wie es aussieht, dürfen wir dich als Meister behalten.“
Die einsetzende Ruhe bedeutete aber nicht, dass auch unter den Kollegen der Karbidabteilung die Geschichte schnell vergessen war.
Die Erinnerung an sein und Rolands Missgeschick schien nicht verblassen zu wollen.
Der Gipfel war mit der Einführung des Begriffs „Bomberkommando“ erreicht.
Selbst Wochen später, als Roland und Peter wieder einmal zusammen als Springer eingesetzt waren, hörten sie die Kollegen einander zurufen: „Vorsicht, passt auf eure Anlagen auf! Das Bomberkommando ist unterwegs!”
2. Kapitel
Das neue Schuljahr begann 1977 für alle Schüler der DDR am 1. September, einem Donnerstag.
Roland Meißner war 13 Jahre alt und alles andere als begeistert, wieder in sein muffiges Klassenzimmer zurückkehren zu müssen.
Im Gegensatz zu vielen seiner Mitschüler hatten die vergangenen zwei Ferienmonate bei ihm keine Langeweile aufkommen lassen.
Solange man ihn an seine Maschinen ließ, war er glücklich.
Es spielte keine Rolle, ob es sich dabei um irgendein Fahrzeug oder ein anderes technisches Gerät handelte.
Für ihn war es wichtig, die Technik vor sich zu verstehen.
Die Schule war nur vertane Zeit.
Wenn es nach ihm ginge, würde er sie nie wieder betreten.
Das hatte er auch seinem Vater gesagt, kurz vor Ende des letzten Schuljahres, nachdem sein Klassenlehrer, Herr Hopf, sich über seine schlechten Ergebnisse beschwert hatte.
Er sei versetzungsgefährdet und nur seine guten Noten in Physik und Sport hätten ihn gerettet.
„Das ist auch das Einzige“, hatte er erwidert, was an dieser Schule auszuhalten ist.
Das war dann zu viel, zuerst für den Lehrer, dann für seinen Vater.
Es hatte die übliche Auseinandersetzung gegeben.
Sein Vater, ein Mann von fast 1,90 Meter Körpergröße und massiger Gestalt, tobte und schrie.
In solchen Augenblicken bot er einen bedrohlichen Anblick.
Rolands Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass Widerspruch in dieser Phase völlig sinnlos war.
Also wartete er, bis sich sein Vater abreagiert hatte.
Dann folgte die Verkündung des Strafmaßes.
Üblicherweise gab es Stubenarrest, mal für drei Tage, manchmal für eine ganze Woche.
Auch das ließ er immer unkommentiert, denn diese Strafen wurden selten bis zum Ende durchgezogen.
Meistens kümmerte sich schon am folgenden Tag niemand mehr darum.
Roland hatte einen Lieblingsplatz, die MTS, die eigentlich schon lange Kreisbetrieb für Landtechnik, kurz KfL, hieß.
Das kümmerte aber niemanden.
Für die Leute im Ort blieb das Gelände mit den beiden großen Hallen und dem Vorplatz weiter die MTS.
Mit der Einführung der LPGs vermietete die Station auch keine Landmaschinen mehr.
Ihre Aufgabe bestand jetzt darin, landwirtschaftliche Geräte zu reparieren und zu warten.
Roland war überglücklich, als er in diesen Sommerferien dort einen Ferienarbeitsplatz bekommen hatte.
Ursprünglich sollte er zusammen mit zwei Mitschülern den Zaun um das Gelände erneuern.
Aber Löcher graben und Pfosten setzen waren nichts für ihn.
Am zweiten Tag ließ er die beiden allein buddeln, ignorierte die darauffolgenden Proteste und meldete sich in der Maschinenhalle.
Die Schlosser kannten ihn, wussten, dass er ihnen eine Hilfe sein würde, und so kam er damit durch.
Das wären ja Fähigkeiten vor die Säue geworfen, meinte Erich, der so eine Art Vorarbeiterfunktion innehatte.
Ein Getriebe in seine Einzelteile zu zerlegen, zu säubern und, nachdem das defekte Teil ausgetauscht war, es wieder zusammenzusetzen, so etwas war Rolands Welt.
Als ein Traktor, an dessen Reparatur er mitgearbeitet hatte, am Ende wieder vom Hof fahren konnte, war er stolz auf sich.
Er wurde gebraucht.
Roland lernte mit der Drehbank umzugehen und die Fräsmaschine zu bedienen.
Natürlich war es offiziell nicht gestattet, dass Schüler an den Maschinen arbeiteten.
„Er ist ja unter Aufsicht“, war stets Erichs Kommentar, wenn sich tatsächlich mal jemand aufregte.
So war es für niemanden, der Roland kannte, eine Überraschung, dass er als einer der wenigen in seiner Klasse schon genau wusste, was er einmal werden wollte: Landmaschinenschlosser!
Und damit schloss sich wieder der Kreis zur Schule.
Bedingung für seinen Traumberuf war der Abschluss der 8. Klasse, in die er gerade versetzt worden war.
Der erste Schultag begann traditionsgemäß mit einem Fahnenappell.
Die Klassen stellten sich in einem Rechteck auf dem Schulhof auf und der Direktor hielt eine Rede.
Roland kannte das alles schon.
Es war immer das Gleiche.
Zuerst freute sich die Schulleitung, dass alle wieder da waren, dann freute sie sich auf das kommende Schuljahr und die Lösung der kommenden Aufgaben.
Interessant wurde es erst, als der Direktor neue Lehrer vorstellte.
In diesem Jahr waren es drei.
Da waren zwei ältere Fachlehrer, einer für Chemie und Mathematik, der andere für Biologie und Erdkunde.
Die dritte neue Lehrkraft war eine junge Frau, die Kunst und Deutsch unterrichten sollte.
Sie hieß Irene Gebhardt und war zu Rolands Überraschung auch seine neue Klassenlehrerin.
„Was war mit Hopf passiert?“, fragte er sich.
Seine Mitschüler sahen genauso überrascht aus.
Der Direktor beendete den Appell wie üblich mit dem sozialistischen Gruß: „Für Frieden und Sozialismus, seid bereit“, dem ein „Immer bereit“ der Schüler zu folgen hatte.
Zufrieden gab er ein Zeichen und die Klassen verschwanden nacheinander im Schulgebäude.
Von seiner Oma wusste er, dass dieses Gebäude vor dem letzten Krieg ein Gutshaus gewesen war.
Sie hatte dort als Dienstmagd gearbeitet.
Nach dem Krieg stand es eine Zeit lang leer. Der Besitzer war in den Westen verschwunden.
Er wollte, so seine Oma, wohl nichts mit der Roten Armee zu tun haben und hatte bestimmt auch seinen Grund dafür.
Als die Bodenreform kam, wurde das zugehörige Land an die Bauern verteilt.
Später, nach Gründung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, wurde das gleiche Land wieder eingesammelt.
Nur mit dem Gebäude wusste man anfangs nichts Richtiges anzufangen.
Erst 1949 kam irgendjemand auf die Idee, eine Schule daraus zu machen.
So erklärte es sich, dass die einzelnen Räume unterschiedlich groß und durch den Mangel an Fenstern manchmal sehr dunkel waren.
Der Klassenraum der 8. Klasse war im dritten Stock untergebracht.
Als Roland eintrat, waren seine Mitschüler gerade dabei, die Sitzordnung im Klassenraum nach ihren Wünschen zu gestalten.
Alte Freunde wollten natürlich zusammensitzen, beste Freundinnen brauchten körperliche Nähe, vor allem zwischen Mund und Ohr.
So gab es ein wildes Gerangel, bis jeder seinen Platz gefunden hatte.
Roland hatte keinen besten Freund.
Er saß am liebsten allein.
Frau Gebhardt kam in das Klassenzimmer, stellte ihre Tasche auf dem Lehrertisch ab und wartete.
Als der Lärmpegel ein für sie akzeptables Maß erreicht hatte, sagte sie:
„Freundschaft.“
Dem folgte eine kurze Verwirrung bei den Schülern.
„Ich hatte angenommen“, sagte sie, „dass ihr mit der 8. Klasse zur Freien Deutschen Jugend gehört. Die Pionierzeit ist vorbei.“
Sie probierte es noch einmal:
„Freundschaft.“
„Freundschaft“, tönte es ihr jetzt entgegen.
Sie setzten sich und die Klassenlehrerin begann, den neuen Stundenplan an die Tafel zu schreiben.
Roland stöhnte leise.
An vier Tagen hatte er sechs Stunden, zweimal bis zum Nachmittag. Mittwochs waren es sogar sieben Stunden.
Nur der Samstag hielt sich mit vier Stunden in Grenzen.
Bei dem Gedanken an diese endlose, sinnlos abzusitzende Zeit wurde Roland schlecht.
Nachdem alle den Stundenplan in ihr Hausaufgabenheft übertragen hatten, begann Frau Gebhardt sich mit jedem Einzelnen bekannt zu machen.
Sie forderte einen nach dem anderen auf, sich vorzustellen und etwas über sich zu erzählen.
Bei 28 Schülern in der Klasse fielen die Beiträge kurz aus.
Roland war das recht.
„Ich interessiere mich für Technik“, sagte er, als er an der Reihe war.
Frau Gebhardt horchte interessiert auf.
„Bist du in einer Technik-AG?“
„Nein“, antwortete Roland, „aber öfter in der MTS. Dort helfe ich ein paarmal in der Woche mit.“
Frau Gebhardt schien beeindruckt.
„Da müssen wir noch mal drüber reden. Das interessiert mich.“
Als sie mit der Fragerunde durch war, sagte sie:
„Nun zu mir.“
Sie lächelte in ihre neue Klasse und begann:
„Ich bin 26 Jahre alt und arbeite seit zwei Jahren als Lehrerin. Ich habe in Dresden studiert, Lehrerin für Kunst und Deutsch. Ich mag vor allem den Expressionismus und die klassische Moderne. Ich fürchte, das werdet ihr noch zu spüren bekommen.“
Niemand lachte.
„Noch irgendwelche Fragen?“
Franz Engel, ein sommersprossiger Junge, meldete sich und fragte:
„Sind Sie verheiratet?“
Einige der Mädchen kicherten los, ein paar Jungs schauten Franz seines Mutes wegen anerkennend an.