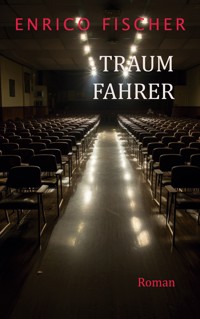
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als souveräner Geschäftsmann steht Jan Dietrich mit seiner Lebenserfahrung und Cleverness als Garant für Erfolg. Ganz anders sieht es in seinem Privatleben aus. In der DDR aufgewachsen, trifft er in dieser Zeit auf die beiden Menschen, die sein Leben entscheidend prägen sollen: seinen Freund Uwe und Laura, die ihm eine glückliche Ehe und seine Tochter Alina schenken wird. Die Freundschaft der beiden Männer scheint lange Zeit unverbrüchlich, bis sie durch ihre konträren Lebensentwürfe auf eine harte Probe gestellt wird und sich ihre Wege trennen. Die Nachricht von Uwes Tod wirft eine Fülle von Fragen auf ... Für Jan hat die Wiedervereinigung Deutschlands alles auf Anfang gesetzt und zusammen mit Laura und Alina startet er noch einmal durch. Das Glück scheint perfekt - da verstirbt Laura unerwartet an einer heimtückischen Krankheit. Vater und Tochter bewältigen den Verlust auf je eigene Weise. Während Alina mit Sorge das Einsiedlerdasein ihres Vaters beobachtet, verfolgt Jan die leidenschaftlichen Auseinandersetzungen seiner Tochter und ihrer akademischen Freunde, in denen sie um eine neue, bessere Zukunft ringen. Ein Prozess, der für Jan zum Spiegel seiner ureigensten Träume wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Erfurt, Freitag, der 22. Oktober 2010
2. Kapitel: Bad Salzungen, Freitag, der 15. Mai 1964
3. Kapitel: Thüringer Wald, Dienstag, der 26. Oktober 2010
4. Kapitel: Bad Salzungen, Samstag, der 16. August 1980
5. Kapitel: Erfurt, Mittwoch, der 3. November 2010
6. Kapitel: Bad Salzungen, Sonntag, der 8. Juni 1986
7. Kapitel: Erfurt, Sonntag, der 26. Dezember 2010
8. Kapitel: Erfurt, Dienstag, der 1. März 2011
9. Kapitel: UNI Erfurt, Dienstag, der 1. November 2011
10. Kapitel: Erfurt, Dienstag, der 6. Dezember 2011
11. Kapitel: Suhl, Mittwoch, der 8. Oktober 1986
12. Kapitel: Erfurt/ Paris, Samstag, der 3. März 2012
13. Kapitel: Erfurt, Freitag, der 9. März 2012
14. Kapitel: Erfurt, Samstag, der 10. März 2012
15. Kapitel: Erfurt, Sonntag, der 13. Mai 2012
16. Kapitel: Kreuzebra, Mittwoch, der 06. August 1986
17. Kapitel: Erfurt, Sonntag, der 13. Mai 2012
18. Kapitel: Erfurt, Montag, der 14. Mai 2012
19. Kapitel: Erfurt, Samstag, der 19. Mai 2012
20. Kapitel: Nordseeküste Dänemark, Samstag, der 2.Juni 2012
21. Kapitel: Erfurt, Dienstag, der 5.Juni 2012
22. Kapitel: Erfurt, Freitag, der 13. Juli 2012
23. Kapitel: Erfurt, Mittwoch, der 3. Oktober 2012
24. Kapitel: Vejers, Dänemark, zehn Jahre später
1. Kapitel
Erfurt, Freitag, der 22. Oktober 2010
»Er kann nicht mehr weit weg sein.«
Ohne seine verkrampfte Haltung aufzugeben, murmelte Daungeber leise seine Antwort: »Hoffentlich.«
Jan Dietrich warf einen kurzen Blick auf seinen Beifahrer. Bernd Daungeber, der Mischmeister der hiesigen Anlage, eigentlich ein Mann, den nichts so leicht erschüttern konnte, umklammerte mit beiden Händen die Seitenwangen seines Sitzes, den Blick starr geradeaus gerichtet.
Lichter kamen auf sie zu. Jan reagierte blitzschnell, bremste scharf und zog nach links auf die zweite Spur. Kaum dass sie an dem einparkenden Auto vorbei waren, gab er wieder Gas.
Die Verfolgungsjagd dauerte bisher nur wenige Minuten, aber je mehr sie in die Nähe des Stadtzentrums kamen und der Verkehr zunahm, umso verwegener wirkte Jan Dietrichs Fahrweise.
»Da vorne, das müsste er sein, oder?«
Daungeber sah in die angegebene Richtung und nickte erleichtert.
Es war nicht sein Tag. Nicht nur, dass ihn dieser Trottel in dem Fahrzeug vor ihnen die ganze Zeit in seinem Container mit sinnlosen Sprüchen genervt hatte, er hatte auch noch die Trommel seines Betonmischers falsch eingestellt und verteilte seitdem in schöner Gleichmäßigkeit die graue Masse auf die Straße; und als wäre das nicht schon genug, musste gerade in diesem Augenblick auch noch der Chef auftauchen. Daungeber versuchte verstohlen festzustellen, wie sauer Jan Dietrich war, konnte seiner Miene aber nichts entnehmen. Vielleicht hatte Jan Dietrichs Anwesenheit und dessen Initiative auch etwas Gutes, versuchte er sich zu beruhigen.
Jetzt jagten sie gemeinsam diesem Vollidioten hinterher, der sich mit seinem Beton speienden Vierzig-Tonner immer mehr der Innenstadt näherte. Egal wie das ausging, eines stand für Daungeber jetzt schon fest: Diese Sache würde in die Annalen der Firmengeschichte eingehen und es würde Monate dauern, bis der Spott der Kollegen und Fahrer wieder verebbt war.
»Wieso erreicht den niemand über Funk?«
Sein Unverständnis demonstrierend, schüttelte Jan Dietrich den Kopf. Jedes Fahrzeug, auch das seiner Vertragsunternehmer, war mit Betriebsfunk ausgerüstet. Trotzdem konnten die beiden Verfolger nicht verhindern, dass der Fahrer vor ihnen, völlig ahnungslos, welchen Schaden er anrichtete, immer weiterfuhr. Die Reinigung der Straßen wird ein Vermögen kosten, dachte er und gab wieder Gas.
Als er es endlich geschafft hatte, bis an den LKW heranzufahren, versuchte er auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer blieb davon ungerührt. Erst als Jan die Geduld verließ und er ein ununterbrochenes Hupkonzert veranstaltete, begriff der Mann im Führerhaus, dass der Radau seinetwegen veranstaltet wurde. Er fuhr rechts ran und hielt.
Bernd Daungebers Starre war wie weggeblasen. Er sprang aus dem Auto, baute sich vor der Fahrerkabine auf und schrie durch das sich öffnende Fenster:
»Bist du bescheuert? Hast du schon mal in den Rückspiegel gesehen? Du Volltrottel verteilst den Beton in der ganzen Stadt!«
Der Fahrer starrte verdattert den Mischmeister an, den er erst vor wenigen Minuten in bester Stimmung verlassen hatte, und schien dessen plötzliche Gegenwart nicht einordnen zu können. Langsam, so als müsste sein Gehirn das überraschende Gebaren des Mannes vor ihm erst einmal erfassen, kletterte er aus seiner Fahrerkabine und ging zum Heck seines Fahrmischers. Mit großen Augen sah er zu, wie sich unter dem Auslauf der Trommel ein immer größer werdender Haufen aus grauem Beton bildete. Während nun auch Jan dazutrat, konnte Daungeber beobachten, wie sich die Physiognomie des Fahrers mit dem schrittweisen Erfassen der Situation veränderte. Als der Prozess beendet war, sprach er seine ersten Worte: »Ach du Scheiße!«
Der Satz wirkte wie ein Ventil. Daungeber beruhigte sich schlagartig, auch die Passanten, die von der Hupaktion neugierig geworden und stehengeblieben waren, spürten die plötzlich eingetretene Entspannung und schienen jetzt wissen zu wollen, wie es weiterging.
»Ich denke, Sie sollten die Trommel endlich anhalten«, sagte Jan in die eingetretene Stille. Die Hand des Fahrers griff zum Steuerhebel und schob ihn auf die Nullposition. Sofort endete die Rotationsbewegung und der Betonfluss aus dem Auslauf kam zum Stillstand.
»Sie sichern Ihren Parkplatz hier und warten, bis Unterstützung aus Ihrer Firma da ist«, brummte Jan in Richtung des Unglücksraben. »Ich werde Ihren Chef informieren. Hoffentlich ist der ordentlich versichert.« Den letzten Teil sprach er leise genug, sodass ihn keiner der Umstehenden, der Fahrer eingeschlossen, verstehen konnte.
Mit einem kurzen, nicht unfreundlichen Kopfnicken verabschiedete sich Jan von dem trotz klarer Anweisung immer noch unschlüssig wirkenden Mann, gab Daungeber einen Wink, mit ihm einzusteigen, und fuhr los.
Ein Blick auf seine Uhr beruhigte ihn. Es war noch früh am Morgen und bis zu seinem ersten Termin an diesem Tag war noch eine gute halbe Stunde Zeit. Für den Rückweg brauchte er mehr Zeit, schließlich musste er niemanden mehr verfolgen. Ab und zu warf er einen kurzen Blick auf die Gegenspur, wo sich Passanten noch immer über die ungewöhnliche Straßenbelegung echauffierten.
Der Inhaber der Spedition, zu dem der Pechvogel gehörte, war schon lange einer seiner Partner. Seit ihrer Gründung fuhren dessen Fahrzeuge für die TBT, die Transportbeton Thüringen GmbH.
Noch nie hatte es mit ihm irgendwelche nennenswerte Probleme gegeben, weder hier noch in einem der anderen, über das ganze Bundesland verteilten elf Transportbetonwerke der Gesellschaft, die Jan Dietrich als Geschäftsführer leitete.
In der Mischanlage angekommen, stieg Daungeber aus dem Auto. Seine Mimik zeigte einen Wechsel zwischen Erleichterung über den für ihn glimpflichen Ausgang der Episode und Besorgnis über die kommende Häme.
»Sie rufen in der Stadtverwaltung an und melden den Schaden.« Mit diesen Worten verabschiedete sich Jan und fuhr los. Er hatte es nicht weit zu seinem Büro, das in direkter Nachbarschaft zur Anlage in einem ehemaligen Wohnhaus untergebracht war. Obwohl sich das Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Zentrum der Thüringischen Landeshauptstadt befand, war es als Industriegebiet ausgewiesen, ein zum Zeitpunkt der Standortentscheidung für Jan wichtiges Kriterium.
Er parkte auf seinem reservierten Parkplatz und betrat das Gebäude. Das kaum unterdrückte Lächeln seiner Mitarbeiterin Nele Kämpfer verriet ihm, dass sich das kleine Abenteuer schon herumgesprochen hatte.
»Verbinden Sie mich mit ihm.«
Jan hätte mit jedem gewettet, dass die Angesprochene genau wusste, wen er zu sprechen wünschte, und er hätte gewonnen.
Keine Minute später klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch und er hatte den Fuhrunternehmer in der Leitung. Jan informierte ihn mit kurzen Worten über den Vorfall. Er hatte mit einem Wutausbruch oder Ähnlichem gerechnet, doch es blieb still.
»Bist du noch dran?«
»Ja, ja«, kam es zögerlich aus dem Hörer. »Der Mann ist neu und ich weiß natürlich, dass das keine Entschuldigung ist. Es wird nur immer schwerer, vernünftige Leute für diesen Job zu finden.«
Obwohl sein Gesprächspartner es nicht sehen konnte, nickte Jan. Er kannte das Problem nur zu gut.
Nachdem sie aufgelegt hatten, brachte Frau Kämpfer eine Kanne mit Kaffee und seine personengebundene, mit dem Bild eines in der Tonne schlafenden Diogenes versehene Tasse und drapierte beides auf den Schreibtisch.
»Herr Glücklich hat angerufen. Er wird sich um fünf Minuten verspäten. Es ist wohl viel los in der Stadt.«
Jetzt war es an Jan, zu lächeln. Er hatte sich daran gewöhnt, dass sein Versicherungsvertreter Glücklich hieß. Vielleicht war der Name tatsächlich Programm und seine Klienten bekamen so eine Art atheistischen Segen? Wie auch immer, bisher hatte er keinen Grund, sich über dessen Arbeit zu beschweren und gerade jetzt war das wichtig.
Die TBT hatte den Beton für eine der Landeflächen des Erfurter Flughafens geliefert. Nach dem Einbau des Materials durch die Baufirma hatte man festgestellt, dass es zu einer Vielzahl von kleinen Kraterbildungen in der Betonfläche gekommen war. Es sah so aus, als hätte sich innerhalb des Materials ein Gas gebildet, welches beim Entweichen an der Oberfläche Auswürfe entstehen ließ, die an Maulwurfshügel erinnerten. Nun stand zu befürchten, dass Wasser in die Öffnungen eindrang und der Frost seine zerstörerische Arbeit begann. Eine Katastrophe – der Flughafen verlangte den Rückbau.
Die bisherigen Verhandlungen hatten nicht viel gebracht. Die entscheidende Frage war: Lag es am Beton oder an dessen Einbau?
Alle drei Beteiligten, der Flughafen, die Baufirma und die TBT, hatten Gutachten zur Schadensursache in Auftrag gegeben, aber Jan bezweifelte, damit eine für alle zufriedenstellende Antwort zu kommen.
Als Herr Glücklich ihm gegenübersaß, berichtete er zunächst von seinem Termin mit der Haftpflichtversicherung der Baufirma.
»Die gehen natürlich davon aus, dass die Ursache beim Beton und nicht an ihrer Einbauweise zu suchen ist, und offen gesagt, bei der Masse an Straßenbeton, den die jedes Jahr schadensfrei einbauen, würde es mich wundern, wenn es anders wäre.« Er machte ein zerknirschtes Gesicht, als wollte er sich selbst nicht glauben.
»Wie weit sind unsere Gutachter?«
»Ich denke, die werden mindestens noch vier Wochen brauchen, um ein Ergebnis zu bekommen. Wenn überhaupt.«
Jan überlegte. Wenn die Gutachten vorlagen, würde es wieder Wochen dauern, bis die Auswertung abgeschlossen war. Dann erst begann das Gericht mit seiner Arbeit. Der Flughafen verklagt die Baufirma auf Ersatz, die Baufirma den Flughafen auf Zahlung der ausstehenden Rechnungen und die TBT musste entscheiden, ob sie sich mit ihrem Auftraggeber, der Baufirma, zusammenschloss oder gegen sie ebenfalls auf Vertragserfüllung klagte. Jan sah zu seinem Gegenüber und seufzte. Im Moment sah der Mann ganz und gar nicht nach dem aus, was sein Name versprach.
Plötzlich schoss Jan ein Gedanke durch den Kopf. Er griff zum Telefonhörer und wählte eine der Kurzwahlnummern auf dem Display.
»Herr Bauer, sind Sie in ihrem Büro? Okay, kommen Sie bitte mal zu mir. Ja, jetzt gleich.«
Gerd Bauer war der Werkleiter der hiesigen Transportbetonanlage, aus der auch die Hauptmengen zum Flughafen geliefert wurden. Er war der richtige Mann für seine Idee.
Der hochgewachsene Mittvierziger betrat kurze Zeit später Jans Büro, begrüßte die beiden Anwesenden und nahm am Besprechungstisch Platz.
»Ich möchte«, begann Jan ohne jede Vorrede, »dass Sie mir eine tabellarische Aufstellung über den gesamten Herstell-, Transport und Entladevorgang machen. Jedes Detail wird aufgeführt. Wenn das erledigt ist, machen Sie das Gleiche für eine analoge Lieferung für eine andere Baustelle der Firma mit Straßenbeton. Genug Auswahl dafür haben Sie. Wenn Sie so weit sind, kommen Sie damit zu mir.«
Gerd Bauer kannte seinen Chef lange genug, um zu wissen, dass dieser Erklärung nichts mehr folgen würde. Mit einem kurzen Nicken verabschiedete er sich wieder und verließ den Raum.
»Was versprechen Sie sich davon?«, wollte Glücklich wissen. Jan lächelte etwas verlegen.
»Es gibt Situationen, da muss man einfach alles versuchen, selbst das Einfachste.«
Als es Mittag wurde, fuhr Jan in die Stadt. Einer seiner Zementlieferanten hatte ihn eingeladen und ihm die Restaurantauswahl überlassen. Der Italiener, bei dem sie sich trafen, war berühmt für seine Scampi mit Pfeffersauce.
Während des Essens wurde ihm bewusst, dass er wahrscheinlich gerade den Höhepunkt des Tages genoss. Die Sauce war wie immer phänomenal.
Sein Gastgeber hatte sich für Nudeln entschieden. Jan hatte es aufgegeben, solche kulinarischen Entgleisungen zu kommentieren. Unangenehmer war das schleppende Gespräch. Vielleicht, überlegte Jan, liegt es am Altersunterschied. Der Mann ihm gegenüber war höchstens Mitte dreißig. Das grenzte die Themenauswahl für den Small Talk automatisch ein.
Was blieb, war der Zement. Der junge Mann war gekommen, um eine Preiserhöhung anzukündigen. Jan nahm es gelassen. Er war mit seinen elf Werken kein kleiner Spieler und er würde wie immer einen Lieferanten finden, der umfiel und Zugeständnisse machte. Zement war eben ein homogenes Massengut und keine Schokolade, die man am Geschmack unterscheiden sollte.
Es war früher Nachmittag, als er wieder in seinem Büro ankam. Dort wurde er von Gerd Bauer erwartet.
»Herr Dietrich, ich habe Ihnen die gewünschte Aufstellung auf den Tisch gelegt.«
Jan sah ihn überrascht an. So schnell hatte er nicht damit gerechnet.
»Na ja«, druckste Bauer herum, »offen gesagt, habe ich mich ganze Zeit gefragt, wozu das gut sein soll. Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen, was uns weiterbringen könnte.«
Jan antwortete nicht. Er war sich selbst nicht klar darüber, was genau er erwartete, aber ein Gefühl sagte ihm, dass so ein Vergleich sich lohnen könnte. Im Grunde folgte er einfach seiner Art, strukturiert an eine scheinbar nicht lösbare Aufgabe heranzugehen.
Er betrat sein Büro, ließ aber wie immer, wenn er keinen Besuch hatte, die Tür zu seinem Vorzimmer geöffnet. Amüsiert beobachtete er, wie sich Gerd Bauer an der Kaffeemaschine herumdrückte. Er will sein Feedback, dachte Jan und musste lächeln.
Es dauerte einige Minuten, bis er die Auflistung durchgesehen hatte. Ohne Erfolg. Ihm fiel genauso wenig etwas Ungewöhnliches auf wie seinem Werkleiter. Gerade als er ihm das mitteilen wollte, blieb sein Blick auf einer Zeile der Tabelle hängen.
»Herr Bauer«, rief er in das Vorzimmer, »kommen Sie bitte mal.«
Mit der Kaffeetasse in der Hand kam der Werkleiter zu ihm an den Schreibtisch.
»Sagen Sie mal, der Straßenbeton wird doch grundsätzlich in Kippmulden, nicht in Fahrmischern geliefert, richtig?«
Gerd Bauer sah seinen Chef aufmerksam an. Noch hatte er keine Ahnung, worauf der hinauswollte.
»Das stimmt. Der Beton ist erdfeucht und wird zum Einbau direkt vor dem Fertiger abgekippt.«
»Sie haben hier vermerkt, dass die Baufirma den Beton abgeholt hat. Er ist also mit deren Fahrzeugen transportiert worden. War das am Flughafen auch so?«
»Nein. Der Mengenbedarf war dort viel größer. Wir haben über fünfzehn LKW angemietet.«
Bauer war es immer noch ein Rätsel, wohin diese Fragerei führen sollte.
»Von wem haben Sie die gemietet?«
»Vor allem von unseren Kieslieferanten.«
Jan Dietrich lehnte sich langsam in seinen Sessel zurück, während Bauer auf weitere Fragen wartete. Die blieben aus. Stattdessen griff Jan zum Telefon und rief im Betonlabor an.
»Ich möchte, dass Sie frischen Straßenbeton mit feinem Aluminiumpulver versetzen und dann den Abbindeprozess mit allen Einzelheiten und Auffälligkeiten dokumentieren.«
Es waren noch einige Ergänzungen nötig, bis der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung verstanden hatte, was Jan von ihm wünschte. Bevor er auflegten konnte, hörte er noch dessen Frage:
»Und was soll dabei rauskommen?«
»Im schlimmsten Fall lauter kleine Krater!«
Zwei Tage später hatte sich das Rätsel um den Schaden auf dem Flughafengelände gelöst, zumindest für Jan Dietrich. Für das Gericht würden die primitiven Tests eines kleinen Transportbetonherstellers natürlich nicht ausreichen, um Recht zu sprechen, da würden sicher noch ein paar kostbare Gutachten erstellt werden müssen. Trotzdem sprach es sich in der Branche sehr schnell herum, dass man Beton nicht mit Aluminium-Mulden transportieren sollte. Der beim Beladen und Abkippen entstehende Metallabrieb reichte aus, chemische Reaktionen auszulösen, die letztlich auch für die Schäden am Flughafen verantwortlich waren.
Während der Fall für Jan zum Tagesgeschäft gehörte, hinterließ seine Demonstration genialer Einfachheit bei seinen Mitarbeitern einen nachhaltigen Eindruck. Auch Herr Glücklich konnte sich nicht zurückhalten, seiner Begeisterung über die plötzlich auf dem Tisch liegende Lösung Ausdruck zu geben, auch wenn ihm im Grunde damit nicht geholfen war. Die Schuldfrage stand nach wie vor im Raum, musste nur anders gestellt werden.
Jans Reaktion auf die verschiedenen Elogen bestand maximal in einem verlegenen Lächeln, ansonsten ging er einfach darüber hinweg.
Für Nele Kämpfer bedurfte es sowieso keinerlei Beweise der Vorzüge ihres Chefs. Sie herrschte in seinem Vorzimmer und wurde sie von Außenstehenden nach ihrem Arbeitsplatz gefragt, sprach sie nicht von der TBT, sondern sagte stets: Ich arbeite für Jan Dietrich.
Es hatte schon etwas Skurriles an sich, wenn man Nele Kämpfer, mit Mitte dreißig jung genug, um seine Tochter zu sein, ihn in mütterlicher Art und Weise umsorgen sah. Jan ließ es sich gefallen, zumal ihr Fürsorgeinstinkt nach Dienstschluss glücklicherweise abrupt auf ihre Familie überging.
Für Mitte Oktober war es empfindlich kalt geworden und Jan hatte beschlossen, seine jährliche Kontrollfahrt zu den Standorten durchzuführen.
»Frau Kämpfer, informieren Sie bitte die Werkleiter, dass ich mir nächste Woche den Stand der Umstellung auf Winterbetrieb anschauen werde.«
Der Kopf der Sekretärin erschien an der offenen Bürotür.
»Sind Sie sicher, dass die schon fertig sind?«
Jans Blick fiel auf den Kalender. Die Werke hatten klare Anweisungen, dass bis Mitte Oktober sämtliche entsprechende Arbeiten abzuschließen waren.
»Ich bin mir sicher.«
Ihre Mimik deutete noch auf einen Rest an Zweifeln, doch Nele Kämpfer diskutierte nicht. Sie setzte sich zurück an ihren Schreibtisch und begann sofort eine Mail an die Werkleiter zu verfassen.
So, dachte sie grinsend, diese Warnung wird auch die letzte Schlafmütze in Bewegung bringen, und klickte auf den Butten Senden.
Pünktlich zum Feierabend stand sie zusammen mit der Buchhalterin Doris Schröder wieder in der Tür. Sie verabschiedeten sich mit einem »Schönes Wochenende« und Nele Kämpfer ergänzte: »Denken Sie daran, dass Sie nicht noch einmal ins Büro kommen wollten. Also alle Unterlagen bitte gleich ins Auto legen.«
Jan nickte ergeben und hob bestätigend die Hand. Als er allein war, ließ er sich Zeit. Er hatte keine Eile. Seit dem Tod seiner Frau und dem Auszug seiner Tochter Alina bewohnte er allein seine Vier Zimmer Wohnung. Er hatte sich langsam an den Lebensrhythmus eines Singles gewöhnt, nur die Einsamkeit machte ihm zu schaffen.
Auf dem Weg zu seiner Wohnung hielt er bei dem üblichen Discounter an und kaufte ein paar Kleinigkeiten für das Wochenende. Ein Brot, Butter, Wurst, eine Flasche Primitivo. So extravagant seine Geschmacksnerven in einem guten Restaurant die Küche forderten, so anspruchslos war er bei der Auswahl für das tägliche Überleben. Er kochte auch nicht. Für eine Person machte es keinen Sinn und erst recht keinen Spaß.
In der Wohnung war es kalt, er hatte vergessen, die Heizung hochzustellen. Nachdem er seinen Einkauf verstaut hatte, schaltete er den Fernseher im Wohnzimmer ein und ging zurück in die Küche, um sich ein belegtes Brot zu machen. Die Tür zum Wohnzimmer hatte er offen gelassen und so konnte er dem Sprecher der Tagesschau zuhören, der in seiner üblichen monotonen Sprechweise die Tageshöhepunkte verkündete: Mexiko – 13 Tote bei einem Überfall, Türkei – Grundsteinlegung für eine Deutsch-Türkische Universität durch Christian Wulff, Stuttgart – Schlichtungsrunde zum umstrittenen Bauprojekt Stuttgart 21 mit Heiner Geißler.
Jan lächelte. Die werden noch ihren Spaß haben, bevor da unten bei den Schwaben wieder Ruhe eingetreten ist.
Während er mit dem Messer penibel die Butter auf der Brotscheibe verteilte, schweiften seine Gedanken, wie so oft in letzter Zeit, zurück in die Vergangenheit. Er dachte daran, mit welchem Eifer er in seiner Jugend losgezogen war. Was war er penetrant gewesen, manchmal richtig stur, wenn es um seine Ideale ging. Er war damals nicht wie die Kids heute auf Demos marschiert, aber am Ende wollten sie trotzdem das Gleiche: Die Welt verbessern. Nur hatte ihn dabei die Geschichte überrollt. Die auftauchenden Bilder formten sich mit dem Geschenk an das Altern, der Verklärung, welche den Erinnerungen an Niederlagen und Rückschläge ein wenig Farbe gab.
Jan sah auf seine Hände. Sie hatten aufgehört, das Buttermesser zu führen. Es war Alinas Kindermesser, das sie bei ihrem Auszug vergessen hatte. Er brummte leise ein »Werde jetzt nicht albern« vor sich hin, dann beendeten die Hände ihre Arbeit. Plötzlich erschien ein neues Bild, unerwünscht und aufdringlich.
Nein, schüttelte er abwehrend seinen Kopf, ich will das nicht. Er ist tot.
2. Kapitel
Bad Salzungen, Freitag, der 15. Mai 1964
Die Kirchturmuhr schlug bereits viermal. Der Junge mit dem Igelschnitt wurde immer ungeduldiger. Seit mehr als einer Stunde wartete er nun schon auf seinen Freund.
Es war Sonntag und, wenn man den Eltern und Lehrern glauben konnte, ein bedeutender Tag. Am Vormittag hatte ihre Jugendweihe stattgefunden und Uwe Schlüter, der Junge mit den kurzen Haaren, hatte zum ersten Mal in seinem Leben einen Anzug getragen. Es war ein einschneidendes Erlebnis gewesen, auch im wörtlichen Sinn, und er war sich sicher, dass diese Art Kleidung so schnell nicht wieder seinen Körper umschließen würde.
Er war kein Freund von solchen Zeremonien. Das von dem Schritt in die Welt der Erwachsenen war doch nur eine Phrase. So ein Blödsinn. Nichts würde sich durch diese alberne Vorstellung ändern.
Außerdem hasste er es, im Mittelpunkt zu stehen, und wenn er sich daran erinnerte, wie er am Morgen auf der Bühne gestanden hatte, wurde ihm wieder ganz schlecht. Das war eher etwas für seinen Freund Jan, Jan Dietrich. Der war in seinem Element, wenn alle auf ihn schauten.
Einzig die Geschenke versöhnten Uwe ein wenig mit der ganzen Prozedur.
Während der Weihe hatten sie ihm und seinen Mitschülern zusammen mit einer Urkunde einen dicken Wälzer mit dem Titel Weltall, Erde, Mensch in die Hand gedrückt. Uwe hatte nach dem Mittagessen eine Weile darin geblättert, es dann aber erst einmal zur Seite gelegt. Seine Verabredung mit Jan war wichtiger. Wenn der doch endlich auftauchen würde.
Die familiären Präsente bestanden in seinem Fall vor allem aus Kleidung. Seine Eltern dachten eben praktisch und so hatten sie jedem Onkel und jeder Tante versichert, wie sehr er sich über ein neues Hemd oder einen Pullover freuen würde, selbstverständlich mit Angabe der Konfektionsgröße.
Ein weiterer Blick auf die Uhr steigerte Uwes Nervosität. Sollte er allein anfangen?
Nein! Das konnte er nicht machen. Mehr als drei Wochen hatten sie zusammen an dem Aquarium gebaut. Das Erste, das nicht aus Vollglas, sondern aus fünf miteinander verklebten Glasscheiben bestand. Endlich Schluss mit den verzerrten Bildern. Die Mitschüler würden platzen vor Neid.
Die Idee stammte von Jan. Dessen Vater hatte ihm erzählt, dass sie im Betrieb ein neues Dichtungsmittel einsetzen würden, Silikon. Da hatte er so lange gebettelt, bis der ihm zwei Kartuschen mitbrachte. Die Scheiben hatten sie vom Glaser bekommen, natürlich nicht umsonst. Einen ganzen Samstag mussten sie dafür beim Aufräumen der Werkstatt helfen. Ihren Berechnungen nach war die weiße Wundermasse heute endlich ausgehärtet und sie konnten Wasser einfüllen.
Die Tür seines Kinderzimmers öffnete sich. Es wurde aber auch Zeit. Jan kam hereingestürmt, vor Eifer rot im Gesicht.
»Du glaubst nicht, was ich bekommen habe.«
Mit diesen Worten schwenkte er eine Art Tragetasche in der Luft, die Uwe an die Lederhülle eines technischen Gerätes erinnerte. Er bekam umgehend die Bestätigung.
»Ein Kassettenrecorder. Ein super Ding, sag ich dir. Hier, mit Batterie und Stromanschluss. Damit kann man auch unterwegs Musik hören.«
Uwe dachte an seine Pullover.
»Du bist ein Glückspilz.« Es gelang ihm, den Satz ohne Anflug von Neid herauszubringen. Jan reagierte prompt.
»Was soll der Quatsch. Wenn, dann sind wir Glückspilze.«
Jan nahm die Sache mit der Blutsbrüderschaft sehr ernst. Durch die Westkontakte seiner Familie, vor allem die seiner Großmutter, befanden sich im Hause Dietrich auch für DDR-Verhältnisse ungewöhnliche, sogar unerwünschte Gebrauchsgegenstände. Darunter war auch eine vollständige Sammlung der Bücher von Karl May.
Jan konnte kaum lesen, da hatte er begonnen, Buch für Buch zu verschlingen, und so war es für ihn nur logisch, dass er eines Tages mit seinem besten Freund Blutsbrüderschaft schließen musste. Mit Omas schärfstem Küchenmesser in der Hand hatten sie in ihrem Baumhaus die magischen Worte gesprochen. Der Blutfluss hielt sich dabei in Grenzen und heute zeugten nur noch ganz kleine Narben von ihrer heldenhaften Tat.
»Du kannst den Recorder natürlich auch haben, wann immer du willst.«
»Lass mal hören«, bat Uwe und sah zu seiner Überraschung in ein verlegenes Gesicht.
»Was ist?«, fragte er ungeduldig, doch die Antwort ließ auf sich warten.
»Ich habe nur eine Kassette.«
Uwe beschlich eine Ahnung.
»Mit Musik?«, fragte er vorsichtig.
»Das schon, irgendwie.« Ohne ein weiteres Wort zog Jan eine Kassette hervor, auf dessen Cover das Foto eines etwa gleichaltrigen Jungen prangte.
»Heintje?«
Die beiden sahen sich an und prusteten los. Als sie sich wieder beruhigt hatten, forderte Uwe:
»Ich will aber als Erstes Mamma hören!« Jan winkte ab und flüsterte jetzt verschwörerisch:
»Ich weiß, dass mein Onkel auch eine Kassette mit Fips Asmussen mitgebracht hat, und ich weiß auch, wo sie ist. Natürlich nur für die Erwachsenen. Aber das sind wir ja seit heute, oder?«
Sie lachten wieder, bis Uwe ihr Projekt in Erinnerung brachte. Er hatte die Wartezeit genutzt und ihr Prachtstück im Waschhaus deponiert. Sie gingen über den Hof und entriegelten die schwere Holztür. Im hinteren Teil des Raumes, auf dem Holzdeckel der Waschmaschine, stand ihr Aquarium. Fachmännisch betrachteten beide noch einmal ihr Werk, testeten den Aushärtungsgrad des Silikons und prüften mit einem vorsichtigen Druck nach außen die Haftfestigkeit. Die Klebestellen sahen zwar nicht sonderlich professionell aus, aber sie schienen zu halten.
Zufrieden mit ihrem Abschluss Test fragte Jan:
»Wollen wir?«
Uwe nahm einen bereitstehenden Eimer, stellte ihn unter den Wasserhahn und ließ ihn volllaufen, dann schüttete er den Inhalt vorsichtig in das Glasgebilde. Es schien dicht, nirgendwo war auslaufendes Wasser zu sehen. Die beiden Jungen grinsten zufrieden. Uwe ging zurück zum Wasserhahn.
»Was meinst du, wie viel Wasser in den Eimer geht?« Jan überlegte kurz.
»Ich denke, das sind zehn Liter.«
»Und wieviel passt in unser Aquarium?«
Diesmal brauchte Jan länger für die Antwort. Uwe hörte ihn murmeln: »Achtzig lang, vierzig breit und fünfzig hoch, das macht …« Jans Gesichtsausdruck verklärte sich langsam, bis er ausrief: »Einhundertsechzig Liter!«
Uwe schien nicht überzeugt.
»Es ist doch aber schon fast voll. Meinst du nicht, dass es eher sechzehn Liter sind?« Jan winkte mit einer großzügigen Geste ab.
»Kann auch sein.«
Sie füllten weiter nach, bis das Wasser den oberen Rand erreicht hatte. Uwe deutete wortlos, blass im Gesicht, auf das Aquarium. Die beiden Frontscheiben hatten begonnen, ihre Form zu ändern. Der Druck aus dem Inneren des Aquariums war offensichtlich so groß, dass das Glas ausbeulte. Keiner von beiden sprach ein Wort. Mit geöffneten Mündern standen sie da und warteten auf das Unausbleibliche.
Mit einem erst leisen Knacken, dann mit dem Lärm splitternden Glases zerbarst ihr Konstrukt und das Wasser verteilte sich zusammen mit einer Unmenge Scherben auf dem Boden der Waschküche.
»Wow! Ich glaube, die Scheiben waren nicht dick genug.« Mit diesen salomonisch anmutenden Worten unterbrach Jan die nach dem Bruch eingetretene andächtige Stille.
»Das denke ich auch«, sagte Uwe und fügte hinzu: »Lass uns die Reste wegschaffen, bevor uns hier noch einer erwischt.«
Sie hatten Glück. Unbehelligt beendeten sie ihre Reinigungsaktion. Zurück in Uwes Zimmer, hörten sie sich Heintje an. Während Uwe der hellen Stimme des Jungen lauschte, hörte er plötzlich Jan sagen:
»Und wenn wir statt einer zwei Scheiben nehmen?«
Er sprang auf und ging zu dem alten Chaiselongue, auf dem sich Jan ausgestreckt hatte.
»Und die Frontscheiben machen wir etwas niedriger. Da ist der Druck nicht mehr so groß.«
Heintje war vergessen.
3. Kapitel
Thüringer Wald, Dienstag, der 26. Oktober 2010
Nach dem zweiten Tag seiner Rundreise zog Jan ein erstes Resümee. Fünf seiner elf Transportbetonwerke hatte er bereits besucht, ohne viel beanstanden zu müssen. Natürlich war das auch ein Ergebnis von Nele Kämpfers Kommunikationspolitik, aber das spielte letztlich keine Rolle. Die Mitarbeiter hatten ihr Erfolgserlebnis und seine Existenzberechtigung musste er nicht beweisen.
Jan war auf dem Weg zu seiner Unterkunft. Wie immer auf dieser Route übernachtete er in einem kleinen, von Wald und Kuhkoppeln umgebenen Landhotel in der Nähe des Rennsteiges. Die Fahrt dorthin führte über Serpentinenstraßen mit teilweise herausfordernden Nadelkurven. Jan war auf die Straße konzentriert, als sein Handy klingelte. Das Display zeigte eine unbekannte Nummer und er war geneigt, den Anrufer wegzudrücken, doch die Neugierde war größer.
»Dietrich!«
»Hallo Herr Dietrich«, sagte die Stimme aus der Freisprechanlage, »Sie kennen mich nicht, aber ich rufe wegen Ihrer Tochter an.«
Jan durchzuckte ein Schmerz. Was war mit Alina? War sie verletzt oder sogar …
»Was ist passiert?« Jan wunderte sich, wie beherrscht seine Stimme klang.
Der Mann am anderen Ende der imaginären Leitung war aufgeregt, aber nicht panisch. Er ist bestimmt weit unter vierzig, ging es Jan durch den Kopf, während er immer noch auf eine Antwort wartete.
»Keine Sorge, Herr Dietrich, sie ist gesund und munter.«
Jan atmete hörbar aus. »Das ist toll, aber warum spreche ich dann mit Ihnen?«
Jan schaffte es nicht, seinen Unmut aus seiner Stimme herauszuhalten.
Es dauerte einen Moment, bis der junge Mann weitersprach:
»Eigentlich weiß sie auch gar nicht, dass ich Sie anrufe. Ich denke, sie wird sogar ziemlich sauer auf mich sein, aber ich halte es doch für das Beste, wenn Sie Bescheid wissen.«
Jan begann der bekannte Faden zu reißen.
»Das würde ich auch gern einzuschätzen wissen, aber dazu müssten Sie mir endlich sagen, was los ist!«
»Ihre Tochter wurde verhaftet.«
Im ersten Moment war Jan so überrascht, dass er fast im Straßengraben gelandet wäre. Er riss sich zusammen, sah sich nach eine Haltemöglichkeit um, bog in einen Waldweg ein und stellte den Motor ab. Die ganze Zeit während seiner Parkaktion kam kein Ton mehr aus der Freisprecheinrichtung.
»Sind Sie noch da?«
Der Unbekannte gab einen bestätigenden Laut von sich.
»Wieso wurde meine Tochter verhaftet?« Jan, befreit von der Konzentration auf das Fahren, verlor jetzt endgültig die Geduld.
»Und wieso erfahre ich das von Ihnen und nicht von Alina? Wer sind Sie überhaupt?«
Es dauerte einen Moment, bis sein Gesprächspartner sich wieder meldete:
»Ich werde versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Mein Name ist Jakob Messerschmidt und ich bin ein Kommilitone Ihrer Tochter. Wir haben verschiedene Kurse zusammen belegt. Wir waren zusammen auf einer Demo, bis wir von ein paar linken Vollidioten angepöbelt wurden. Irgendwann tauchte dann Polizei auf.«
»Aber das ist doch kein Grund, Alina zu verhaften.«
Ein kurzes Lachen ertönte im Innern des Fahrzeugs. Es klang nicht wirklich lustig.
»Das stimmt schon, soweit. Hätte Alina den einen der Polizisten nicht tätlich angegriffen und ihn einen verkrüppelten Kapitalistenarsch genannt, würden wir jetzt auch nicht telefonieren.«
Jan begann ein Bild von dem zu bekommen, was da gelaufen war. Diplomatie gehörte nicht zu Alinas Stärken. Ihr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl war leider mit einer kaum zu kontrollierenden Gefühlsoffenheit verbunden. Jan stöhnte leise.
»Wo ist sie?«
»Landespolizeidirektion Erfurt Nord. Und um Ihre dritte Frage noch zu beantworten: Ich denke, sie wird richtig Ärger bekommen, solchen Ärger, bei dem deeskalierende Unterstützung sehr hilfreich sein würde.« Wieder war einen Moment Ruhe, dann hörte Jan noch:
»Wissen Sie, ich mag nämlich Ihre Tochter, sogar sehr.«
Jakob Messerschmidt hatte aufgelegt. Jan saß in seinem Auto und bemühte sich, so ruhig wie möglich über das Gehörte nachzudenken. Der Vorfall an sich war nicht sein eigentliches Problem. Niemand in diesem Land wurde wegen Beamtenbeleidigung tatsächlich weggeschlossen. Wahrscheinlich würde ihr eine Geldstrafe oder die Ableistung von Sozialstunden aufgebrummt. So einen Schuss vor den Bug könnte das Mädchen durchaus einmal vertragen. Schlimm wäre es, wenn sie verurteilt würde. Als Vorbestrafte könnte sie dann ihr Studium und damit ihre Zukunftsträume als Sozialpädagogin vergessen.
Jan wendete und fuhr zurück Richtung Erfurt.
Die Beamten in der Polizeistation machten einen müden, desinteressierten Eindruck, als er, selbstsicher und energisch auftretend, seine Tochter zu sehen verlangte.
»Sie ersparen uns eine Taxifahrt«, war der einzige Kommentar eines älteren Polizisten, der ihn in einen kleinen Nebenraum führte. Dort saß Alina auf einem der Bürostühle und telefonierte mit ihrem Handy. Als sie ihren Vater erkannte, hörte er sie sagen:
»Es hat sich erledigt.« Alina stand auf und ging langsam auf ihn zu.
»Wie kommst du denn hierher?«
»Die Frage sollte eigentlich mein Part sein, meinst du nicht?« Alina wirkte weder verlegen noch schuldbewusst. Ihr Auftreten erinnerte ihn an ihre Kinderzeit, nur dass der Trotz, der ihn früher so oft rasend gemacht hatte, verschwunden war.
»Es tut mir leid, Papa.«
Es waren weniger die Worte, es war das Bittende in ihrer Stimme, das Jan aufhorchen ließ. Sie wünschte sich tatsächlich seine Vergebung. Das war neu.
Er wandte sich zu dem Polizisten um.
»Was muss ich tun, um meine Tochter mitnehmen zu können?«
»Nichts. Wir haben alles, Personalien, Protokoll.« Mit einem traurig anmutenden Blick auf Alina ergänzte er:
»Es hätte nicht so lange dauern müssen.«
Jan nickte dem Beamten verstehend zu, dann schaute er zu seiner Tochter: »Wollen wir?« Sie ging an den Männern vorbei über den Flur auf den Ausgang zu. Jan ging ihr nach. Am Auto wartete sie auf ihn.
»Ich wollte nicht, dass du mir hilfst.« Es war kein Vorwurf, nur eine Feststellung.
»Ich bin dein Vater, helfen gehört zu dem Job.«
»Ach ja?« Alina stieg ein und schnallte sich an. »Steht in deiner Stellenbeschreibung auch, dass du nur hilfst, wenn dir danach ist?«
Alina war gerade siebzehn geworden, als ihre Mutter starb. Diagnose Brustkrebs, die Krankheit war viel zu spät erkannt worden, um noch etwas für sie tun zu können. In den wenigen Wochen, die Laura noch leben durfte, war Jan so verzweifelt, dass er das Leiden seiner Tochter übersah. Als sie ihn am nötigsten gebraucht hatte, war er nicht für sie da gewesen. Nicht nur in ihren Augen hatte er versagt.
Jan setzte sich hinter das Steuer und startete den Wagen.
»Ich nehme an, du möchtest nach Hause.« Alina schüttelte den Kopf.
»Nein. Lass mich bitte an der UNI raus.«
»Du hast noch Lehrveranstaltungen? Oder wirst du dort erwartet?« Alina sah ihn misstrauisch von der Seite her an.
»Vielleicht von Jakob?«
Es war ein Schuss ins Blaue gewesen, doch er traf.
»Welcher Jakob?« Ihr Misstrauen schien sich zu verstärken.
»Ich dachte, er wäre einer deiner Freunde. Jakob Messerschmidt.«
»Ach der!« Bevor sie ihr Desinteresse weiter bekunden konnte, kam ihr ein Verdacht auf.
»Von dem weißt du, wo ich war, richtig?« Sie wartete seine Antwort gar nicht erst ab. »So ein hirnverbrannter Spießbürger. Hat der nichts anderes zu tun, als dich anzurufen.« Sie redete sich in Rage. »Nicht nur, dass der Kerl ständig wie eine Klette an einem hängt, mischt der sich auch noch in mein Leben ein. Der spinnt doch.«
»Ich hatte den Eindruck, dass er sehr besorgt um dich war.«
Alina drehte sich jetzt vollständig zu ihrem Vater. »Dazu hat er kein Recht. Niemand hat das Recht, um mich besorgt zu sein, nicht mehr.«
Die letzten Worte hatte sie zwar leiser, aber immer noch klar und deutlich ausgesprochen. Ein erster Impuls riet Jan, nicht darauf zu reagieren. Es konnte nur wieder zum Streit führen, trotzdem sagte er:
»Du bist und bleibst meine Tochter und damit geht mich dein Leben etwas an.«
Sie war die Einzige, die ihm geblieben war, aber das sagte er nicht. Sie hätte es als Egoismus verstanden.
Zu seiner Überraschung blieb Alina ruhig. Vielleicht ist sie zu müde, dachte er. Es muss ein schwerer Tag für sie gewesen sein.
Sie schwiegen, bis sie vor dem Haupttor der UNI ankamen. Alina löste den Gurt, zögerte einen Moment, dann stieg sie aus. Jan hatte wenigstens auf eine Verabschiedung gehofft, doch selbst die schien auszubleiben. Plötzlich beugte sie sich zurück in den Wagen.
»Weißt du, es ist eigentlich schon lange nicht mehr wegen Mama. Sie ist jetzt seit neun Jahren tot und ich glaube, ich habe mich langsam damit abgefunden. Aber du sagst immer, dass du für mich da bist, dabei willst du einfach nicht sehen, dass wir in zwei ganz verschiedenen Welten leben.« Er wollte etwas erwidern, doch sie war schneller:
»Ich will doch nur, dass du ab und zu einen Blick über den Zaun wirfst und vielleicht versuchst zu verstehen, warum ich nicht einfach bei den vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt zuschauen kann.«
Er schaute ihr noch nach, als sie längst aus seinem Blickfeld verschwunden war. Ihr überraschendes Statement hatte ihn beeindruckt. Aber wieso Zaun?
Alina rannte fast, während sie den Campus überquerte. Sie war sauer, sauer auf ihren Vater, auf Jakob, vor allem aber auf sich selbst. Es gelang ihr einfach nicht, diese Wand zwischen ihr und ihrem Vater niederzureißen. Sie wünschte sich so sehr in die Vertrautheit ihrer Kindertage zurück, wollte ihm von ihren Sorgen und Erfolgen erzählen, aber irgendetwas hielt sie immer wieder zurück.
Sie hatte den Seminarraum erreicht und schaute auf die Uhr. Es war 19.12 Uhr, damit hielt sie zumindest das akademische Viertel noch ein.
Ohne anzuklopfen, dafür mit ordentlichem Schwung, öffnete sie die Tür und trat ein. Im Raum befanden sich mehr als zwanzig Studenten, die offensichtlich in eine hitzige Debatte verwickelt waren. Sie schauten kurz zu dem Störenfried, registrierten Alina als eine der ihren und machten weiter. Alina ließ ihren Blick über die kleine Versammlung gleiten. Es waren alles bekannte Gesichter, von den meisten kannte sie die Namen. In der letzten Bank sah sie Jakob Messerschmidt sitzen. Mit dem würde sie noch ein ernstes Gespräch führen müssen, aber das hatte Zeit.
Auf der Kante des Lehrertisches hatte sich ein junger Mann platziert, der den Kurs als Dozent leitete. Sein Blick verweilte ungewöhnlich lange auf ihr, dann forderte seine Handbewegung sie zum Setzen auf. Sie folgte der Aufforderung. Ihre Banknachbarin gab ihr die gewünschte Auskunft:
»Wir diskutieren gerade darüber, wie wir weitermachen wollen.«
Alina nickte.
Ihr Dozent hieß Daniel Kreisler. Er war ein dunkelhaariger Typ mit schlaksiger Gestalt, der es mit seiner für die UNI ungewöhnlich lockeren, oft provozierenden Herangehensweise geschafft hatte, sie mit der großen Frage nach der Gestaltung ihrer Zukunft zu fesseln.
Dabei war das nach den ersten Zusammenkünften gar nicht absehbar gewesen. Sie hatten wie üblich damit begonnen über Themen wie Arm und Reich, Machtkonzentrationen, auch über die zunehmende Kontrolle durch den Staat zu diskutieren, kamen allerdings schnell auf einen Konsens: Der Kapitalismus war zwar unstrittig das Treibmittel der letzten Jahrhunderte gewesen, aber er war nicht die Lösung für das Jetzt und das Morgen. Jakob hatte es in einer seiner ironischen Anwandlungen zusammengefasst: Er ist das Pferd, das, längst schon tot, noch immer geritten werden wollte.
Von da ab begannen sie damit, das Wesen dieses von der Industrialisierung hervorgebrachten Wirtschaftssystems auseinanderzunehmen, wobei weder Adam Smith, der Urvater des Kapitalismus, noch Karl Marx vor ihnen sicher war, und mit der Zeit verschob sich ihr Fokus von der Unfähigkeit und den Problemen des alten Systems auf die Suche nach Alternativen und deren Prüfung auf ihr Realisierungspotenzial.
Der Geduld und dem Fingerspitzengefühl Daniel Kreislers hatten sie es zu verdanken, einen gelungenen Spagat zwischen Theorie und Praxis hinzulegen. Er hatte sie dazu gebracht, Philosophen nicht als antiquiert, sondern als Quelle für Antworten zum Heute zu schätzen. Das Ergebnis saß im Raum: Motivierte junge Leute, die sich gemeinsam um ihre Zukunft kümmern wollten.
Der Grund für ihre heutige Zusammenkunft war allerdings ein anderer. Kreislers Kurs war seitens der UNI ein Seminar mit experimentellem Charakter, was bedeutete, dass es keine Fortsetzungen geben würde.
Damit waren aber die Teilnehmer nicht einverstanden und so saßen sie nun zusammen, um einen Ausweg zu finden.
»Wir wollten uns als Nächstes Nietzsche vornehmen. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Der Mann versteht was vom Leben, so etwas darf uns doch nicht entgehen.«
Der Sprecher, Ben Völler, ein Philosophiestudent aus dem dritten Semester schaute Beifall erheischend in die Runde, wurde aber enttäuscht. Niemand stand im Moment auf Scherze.
»Ich war so froh, endlich einmal diese sture Pennäler-Methodik los zu sein. Was hilft es mir denn, wenn ich die alten Theoretiker alle durchhabe? Ich habe schon genug totes Wissen unter meinem Schädeldach.«
Marcel Wolf war ein ungewöhnlich belesener Kommilitone aus dem fünften Semester, den Alina vor allem seiner sprachlichen Gewandtheit wegen bewunderte. Er hatte, so fand sie, absolut recht. Endlich wurde einmal etwas Neues geboten, schon sollte es wieder vorbei sein. Auch sie wollte gern weitermachen, die Hochschule nicht, was ihr Kursleiter bestätigte:
»Es ist aber nun einmal Fakt, dass die Studienplanung keine Verlängerung vorsieht.«
»Und wenn wir darauf pfeifen? Wir treffen uns trotzdem, einen Raum finden wir immer.« Der Sprecher kam von den SOWI`s, der sozialwissenschaftlichen Fakultät, und war immer einer der Aktivsten in der Gruppe gewesen. Jetzt sah er mit einem Lächeln zu dem Dozenten.
»Und für Ihr Gehalt legen wir alle zusammen. Sind Sie sehr teuer?«
Einige Kursteilnehmer lachten, Daniel Kreisler verzog keine Miene. Die Blicke der Studenten folgten ihm, als er sich langsam aus seiner Sitzhaltung erhob und gedankenversunken zum geöffneten Fenster ging. Dort lehnte er sich mit dem Rücken an die Wand und musterte nachdenklich jeden einzelnen von ihnen, so als wollte er seine Optionen abschätzen.
Alina glaubte zu wissen, was in Kreislers Kopf vorging. Dass Kursteilnehmer für die Fortführung einer Lehrveranstaltung rebellierten, war sicher auch für ihn ein Novum. Es wird ihm schmeicheln, da war sie sich sicher, aber es wird ihn auch reizen.
Sie fand den Gedanken aufregend. Was würde er tun, um seinen Heiligenschein zu behalten?
»Wie versprochen habe ich mich mit dem Dekan in Verbindung gesetzt, leider erfolglos.« Er zuckte bedauernd mit den Schultern. Es blieb still im Raum. Sie spürten, dass das noch nicht alles war.
»Wir können uns demzufolge nur außerhalb der UNI treffen. Das wäre dann aber unsere Privatangelegenheit. Es würde weder Leistungspunkte noch Benotungen geben.«
Schweigen. Er deutete es als Zustimmung.
»Wenn ihr es also tatsächlich alle wollt, führen wir den Kurs als inoffizielles Treffen weiter. Einen Raum werde ich schon irgendwie auftreiben.«
Alina kam ein Gedanke.
»Vielleicht sollten wir eine Art Klub gründen.« Sie erinnerte sich daran, dass ihr Vater ihr einmal aus seiner Studentenzeit von etwas Ähnlichem erzählt hatte. Sie spürte den Blick Jakob Messerschmidts in ihrem Nacken, auch die anderen sahen sie jetzt erwartungsvoll an.
»Soweit ich weiß«, fuhr sie fort, »gab es in der DDR die KdIs, sogenannte Klubs der Intelligenz. Dort sind Studenten, aber auch Lehrer, Professoren oder Ingenieure zusammengekommen, um über Politik und Gesellschaft zu diskutieren.«
»Diese Klubs hat der damalige Kulturbund gegründet und das vor allem, um die Intelligenz unter Kontrolle zu haben.«
Marcel Wolfs Einwurf wurde von beifälligem Gemurmel begleitet. Alina hatte nichts zu erwidern und schwieg. Sie nahm an, damit sei das Thema erledigt, als ihr Kreisler zu Hilfe kam.
»Das ist richtig, was Marcel vorbringt, ändert aber nichts daran, dass sich diese Einrichtungen tatsächlich in vielen Orten zu intellektuellen Zentren entwickelt hatten.«
Er zog seine hohe Stirn in Falten.
»Was versprechen Sie sich von so einem Klub?«
Er sprach Alina direkt an und es war ihr unangenehm, sodass sie dabei rot anlief.
»Zusammenhalt, eine Heimstatt gleicher Ideen.«
Kreislers Falten schienen seine Stirn nicht wieder verlassen zu wollen.
»Gleiche Ideen? Und was machen wir mit denen, die andere haben? Die Heimstatt entziehen?«
Alina fühlte sich bewusst missverstanden und wurde ärgerlich, was das Rot in ihrem Gesicht noch verstärkte.
»Mit den Ideen meine ich die Idee, etwas zu schaffen, zu handeln, statt nur zu lamentieren.«
»Also mir gefällt der Vorschlag. Gründen wir einen Klub, von mir aus auch einen Klub der Intelligenz. Entscheidend ist doch, was wir daraus machen.«
Es war Jakob Messerschmidt, der sich auf diese Weise bemerkbar machte. Alina drehte sich zu ihm um und sah, wie er sie erwartungsvoll anschaute. Er hatte sie unterstützen wollen, doch Alina wollte keine Hilfe, schon gar nicht von so einem Verräter, aber ob sie es nun wollte oder nicht, Jakob hatte mit seiner Wortmeldung das allgemeine Schweigen beendet. Immer mehr der Kommilitonen griffen die Idee eines Klubs auf und Alina hatte den Eindruck, aus dem jetzt eingesetzten Stimmengewirr eine Mehrheit für ihren Vorschlag herauszuhören.
Daniel Kreisler ließ, wie es seine Gewohnheit war, die Studenten einige Zeit untereinander diskutieren, bis er um Ruhe bat.
»Wir waren uns einig, unsere, ich nenne sie einmal Treffen, fortzusetzen, und ich erkläre mich auch gerne bereit, euch in meiner bisherigen Rolle zu unterstützen.« Mit Blick auf den SOWI ergänzte er: »Kostenfrei!« Er ging zurück zu dem Schreibtisch und nahm wieder seine Sitzposition auf dessen Ecke ein. »Die Idee mit einer Klub- oder auch Vereinsgründung muss allerdings wohl überlegt sein. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung davon habt, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Man braucht Statuten, Organisationsstrukturen und vor allem ein paar Leute, die sich darum kümmern. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ihr euch vorstellt.«
Die Euphorie wich betretenem Schweigen. Alina sah, dass Kreisler lächelte. Der macht sich über uns lustig, dachte sie und merkte, wie sie schon wieder wütend wurde. Warum bringt mich dieser Kerl nur so in Wallung? Dieser Mensch war höchstens sechs oder sieben Jahre älter als sie. Wahrscheinlich ist das überhaupt seine erste Dozentenstelle und wir schmieren ihm noch ordentlich Honig um den Bart. Kein Wunder, dass der größenwahnsinnig wird.
Bevor sie etwas erwidern konnte, fuhr Kreisler fort:
»Das soll nicht heißen, dass ich eure Idee für schlecht oder für nicht durchführbar halte. Ich denke nur, wir sollten uns Zeit lassen und alles noch einmal überdenken. Bis dahin können wir es bei dem Vorschlag belassen, uns hier in der UNI zu treffen. Sowie ich einen Termin und einen Raum habe, schicke ich euch eine Mail. Okay?«
Die Studenten signalisierten Einverständnis und Kreisler beendete das Treffen. Alina war eine der Letzten im Raum und wartete eigentlich nur darauf, dass Jakob endlich gehen würde. Sie war nicht in der Stimmung, sich mit ihm auseinanderzusetzen, doch Jakob schien es genau darauf anzulegen. Kreislers Bitte löste die Situation:
»Frau Dietrich, mit Ihnen wollte ich, wenn möglich, noch kurz sprechen.« Er blickte zu Jakob: »Unter vier Augen.«
Das half. Zusammen mit den beiden letzten verbliebenen Kursteilnehmern verließ er den Raum und Alina folgte, heute schon zum zweiten Mal, Kreislers Aufforderung, Platz zu nehmen. Der verließ nun seinen Stammplatz auf dem Tisch und begann das Zimmer mit großen Schritten zu durchmessen. Dabei machte er ein derart ernstes Gesicht, dass Alina begann, ihr Sündenregister durchzugehen. Was sollte das werden?
Sie hatte sich gerade entschlossen, ihrerseits das Schweigen zu brechen und einfach zu fragen, als er sein Herumtrigern aufgab und sie mit ungewohnt aggressivem Ton anfuhr:
»Was zum Teufel sollte diese Nummer heute? Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass Sie ihre ganze Zukunft mit solchem Firlefanz aufs Spiel setzen?«
Sein Ausbruch kam so überraschend, dass ihr im ersten Moment die Luft wegblieb. Er kam auf sie zu, bis er unmittelbar vor ihrer Bank stand. Er beugte sich zu ihr herunter und sein Tonfall war plötzlich fast flehend:
»Machen Sie das nie wieder. Sie dürfen nicht die Kontrolle über sich verlieren.«





























