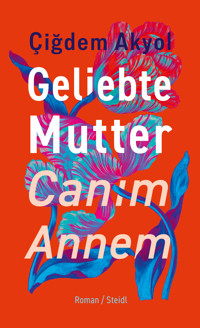
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Aynur mit Alvin verheiratet wird, blühen in Istanbul die Tulpen. Aynur ist 19 Jahre alt, trägt gerne Schlaghosen und taillierte Blusen und hat für Frauen mit Kopftuch nur Spott übrig. Alvin, ein Mann vom Dorf, ungebildet und aus einer frommen Familie, arbeitet in Deutschland unter Tage. Almanya ist eine Verheißung, die Aynur nie gelockt hat, doch ihr Bruder will sie aus dem Haus haben und sie muss sich fügen. Die Geschwister Meryem und Ada sind längst erwachsen als Alvin stirbt. Für sie ist es ein glücklicher Tag. Zu tief sind die Wunden, die ihnen beide Eltern in ihrem gemeinsamen Unglück zugefügt haben. Çiğdem Akyol erzählt von den Folgen einer erzwungenen Ehe, vom Verlust von Identität und einer andauernden Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Heimkehr. Die Geschichte zeigt aber auch, wie es Ada und Meryem gelingt, aus Klassenschranken auszubrechen, sich selbst zu behaupten und aufzusteigen. Tragik, Hoffnung und Freude stehen in diesem Roman eng nebeneinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Çiğdem Akyol
Geliebte Mutter
Canım Annem
Roman / Steidl
Für meine Mutter
Inhalt
Cover
Titel
Teil 1
Teil 2
Impressum
What happens to a dream deferred?
Does it dry up
like a raisin in the sun?
Or fester like a sore—
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over—
like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
like a heavy load.
Or does it explode?
Langston Hughes, Harlem
»Ich will ihn brennen sehen«, sagte meine Mutter während eines Telefonats, als ich in Berlin im Taxi saß. »Ich werde deinen Vater anzünden«, kündigte sie an. »Wenn er im Bett liegt, werde ich einen Kanister Benzin über ihn ausschütten und ein Streichholz auf ihn fallen lassen.« Das klang so überzeugend, dass ich eine Panikattacke wegatmen musste. Wie wurde sie zu so einer Frau? Schon früh, dafür gibt es Gründe – und das ist die Geschichte.
Wenn in Istanbul die Tulpen blühen, dann fängt der Frühling an. Im Himmel schwebten kleine zerfledderte Wolken, als gegen Aynurs Willen ihr neues Leben begann. Am Morgen begrüßten Nebelschwaden die Menschen, am Abend verabschiedete eine blutorangenrote Sonne den Tag. In jenem Frühling stand Aynur jeden Morgen besonders früh auf, um die Vögel im Innenhof zu beobachten, die von Blüte zu Blüte flatterten, ihren Schnabel in die Kelche tauchten, um später den Nektar mit ihren Jungen zu teilen.
Aynur wurde 1954 in der südöstlichen Provinzstadt Erzincan geboren. Als zwanzig Jahre zuvor das Gesetz jeden Bürger dazu verpflichtete, einen Nachnamen anzunehmen, hatte sich ihr Großvater für den Namen Güvenilir – »zuverlässig« – entschieden. Ihr Vater kam eines Tages nicht mehr von seinem Ausflug vom Karanlık Kanyon zurück. Tagelang wurde er gesucht, doch er blieb verschwunden. Aynurs Mutter spürte, dass ihr Mann verstorben war, doch die Nachbarn fingen an, zu tuscheln. Der sei bestimmt mit einer anderen nach Istanbul durchgebrannt, hieß es. Und nachdem sie ein Jahr gewartet hatte und nicht mehr bei ihren Eltern leben wollte, erklärte sie sich selbst zur Witwe. Sie verkaufte all ihren Brautschmuck und entschied, ihren Sohn und ihre Tochter ganz alleine großzuziehen. »Wenn ich hierbleibe, dann zwingt ihr mich in die nächste Ehe«, sagte sie zu ihren Eltern, die staunend vor ihrem einzigen Kind standen. »Ich will mich nicht mehr an irgendwen binden«, befand Aynurs Mutter. Die Männer boten ihr Vieh an, damit sie sie heiratete – doch nie wieder wollte sie irgendwen um Erlaubnis bitten, nach acht Uhr das Haus verlassen oder morgens mit dem Milchmann sprechen zu dürfen. Sie konnte lesen und schreiben, und wünschte sich für ihre Kinder, dass sie die bestmöglichen Schulen besuchen. Sie fand Gefallen an der Idee, ganz alleine etwas Neues zu meistern. »Ich werde fortziehen«, kündigte sie an, und ihre Eltern lachten kurz hysterisch auf. Sie überlegten hektisch, ob sie ihre Tochter nicht eigentlich töten müssten, es war doch ihre Ehre, die sie verletzte. Doch als sie eines morgens aufwachten, war ihre Tochter mit den Kindern weg. »Wir sind in Istanbul, sucht uns nicht«, stand auf einem Zettel, der auf dem Küchentisch lag.
Die ersten Wochen wohnten sie in einem Hostel in Fatih. Nachdem Aynurs Mutter als Rezeptionistin in einem Fünf-Sterne-Hotel angefangen hatte, zogen sie in ein Appartement im noblen Viertel Kuruçeşme auf der europäischen Seite. Hier blühten die Judasbäume, und es gab ruhige Wege für lange Spaziergänge. Um die Miete zahlen zu können, arbeitete sie an den Wochenenden zusätzlich als Babysitterin für die Nachbarn und nähte Handtaschen, die sie sonntags auf dem Markt verkaufte. Familie Güvenilir hatte nicht viel Geld, die Kinder waren oft alleine, aber Aynur betonte immer, wie besonders ihre Kindheit gewesen sei. »Wir waren nicht reich, aber wir waren sehr glücklich.«
Wie alle Güvenilir-Frauen war auch Aynur klein und drall. Sie hatte milchweiße Haut und ein ovales Gesicht, mittendrin tiefbraune Augen, volle geschwungene Lippen, eine schmale gerade Nase. Dickes, pechschwarzes Haar umhüllte ihr Gesicht wie ein Schleier. Eine Schönheit, deren Wangen vor Lebensfreude glühten und der die Männer hinterhergafften.
Zwischen Stoffballen, Knöpfen, Bändern und Borten, Schneiderkreide, Faden und Garn, mit Maßband, Nadel und Schere machte sie eine Ausbildung in einer kleinen Schneiderei. Wenn Aynur im Nebelmorgen zur Arbeit in das Hafenviertel Eminönü unterwegs war, sah sie das Nebeneinander von dekadenter Geschichte und bedrückender Armut. Den restaurierten Prunk aus vergangenen Zeiten, die bunt angemalten oder oft schwarzverwitterten, verfallenden Holzkonaks; Anwesen, die leicht in Flammen aufgehen konnten und die nach Schnee und Regen einen Modergeruch entwickelten. Vorbei an Obdachlosen, die in verrosteten Mülltonnen nach Brauchbarem suchten, an Schülern, die schwarz-weiß uniformiert zum Unterricht trotteten, während der Slogan »Aygaz« auf einem Wagen Propangasflaschen anpries. Vorbei an versiegten Brunnen aus geädertem Marmor, deren Hähne gestohlen worden waren und die der Efeu überwuchs. Vorbei an Lastenträgern, die noch Kinder waren.
Vorbei an dürftig zusammengeschusterten Läden, an Händlern, die Zeitungen und Simit, Sesamkringel, feilboten, Wägelchen mit weichgekochten Maiskolben vor sich herschoben und »Saaaftiger Mais« riefen. Vorbei an den in Rudeln umherstreunenden Hunden mit ihren braun-grauen Fellen, die zur Stadt gehörten wie die Hagia Sofia, deren Minarette die Wolken berührten. Vorbei am Goldenen Horn, in dem sich der Abfall von allerlei Fabriken sammelte und wo Roma-Kinder in löchrigen Unterhosen zwischen angeschwemmtem Müll badeten. In der Luft der Geruch von Ruß, der von den Dampfern, Schwarzmeerkuttern, Segelyachten und Fischerbooten aufstieg. Vorbei an Friedhöfen, wo Zikaden zirpten und wo es nach wildem Wacholder und Jasmin roch. Im Winter musste Aynur auf jeden Schritt achten – im hügeligen Istanbul wurde auf den schiefen Gehsteigen nicht gestreut, der eisige Nordostwind konnte einem die Orientierung einfrieren. In der Luft der Kohlerauch, der aus langen, aus den Mauern nach außen ragenden Ofenrohren drang.
Vorbei an den Leuchtbuchstaben, die an religiösen Feiertagen mit Stahlseilen zwischen den Minaretten gespannt wurden. Darauf waren Sätze zu lesen wie »Ya Allah ve Muhammed« – »Oh Allah und Mohammed« – oder »Sevelim – Sevilelim« – »Lasst uns lieben und geliebt werden«. Vorbei an den wahren Herrschern der Stadt: den Katzen, denen die Einwohner Näpfe mit Milch und Futter aus Innereien vor die Türen stellten. Vorbei an den schnauzbärtigen Musikern mit ihrer Ney, der Rohrflöte, die auf ein paar Kuruş hofften, während aus den Nebengassen die Klingel eines Trödlers ihr Spiel überschallte.
An manchen Tagen waren die Straßen leer, weil wegen der Suche nach Terroristen eine Ausgangssperre herrschte. Auf Aynurs Heimweg am Abend, wenn sich das Nachtblau andeutete, wurden die wenigen Laternen mit ihrem warmen gelben Licht angeschaltet. Während sich die Dunkelheit in den Tausenden kleinen Nebenwegen festsetzte, war das Miauen räudiger Katzen zu hören.
Die Menschen hatten sich gerade erst von dem Militärputsch zwei Jahre zuvor, 1971, und dem Todesurteil gegen Deniz Gezmiş, den Anführer der Studentenproteste, erholt, als Aynur anfing, mit dem Teeverkäufer auf der Fähre zu flirten. Sie kaufte Çay und Simit bei ihm, lehnte sich auf dem Hinterdeck an die Reling, damit ihre Haare im Wind flatterten, wohlwissend, dass der Çaycı sie beobachtete. Sie schaute nach unten, nur blaues glitzerndes Wasser im Sichtfeld, die Sonne tanzte auf ihrem Rücken. Sie warf ein Stück Brot in die Luft, und im selben Moment schnappte sich eine Möwe den Krümel. Auch andere Männer machten ihr den Hof. Einmal schrieb ihr einer in der Mittagspause beim Pastaneci ein Gedicht auf eine Serviette und legte diese auf ihren Tisch, um dann still zu verschwinden.
Sie fühlte sich geschmeichelt, aber sie war erst achtzehn, noch konnte sie warten, erst ab Mitte zwanzig wurde es brenzlig. Natürlich durfte ihr Bruder Veysel all das nicht erfahren. Traditionen waren eine unleugbare Realität in alevitischen Kreisen. Eine Frau musste keusch bleiben, die Männer bestimmten über sie. Aynur widersprach selten, sagte kaum, was sie dachte oder sich wünschte. Sie nahm wenig Platz ein in ihrer Familie.
Die Bundesrepublik war der erste Staat, der mehr als zehn Jahre zuvor ein Anwerbeabkommen mit der Türkei unterzeichnet hatte. Aber Almanya versprach eine Verheißung, die Aynur nie lockte. Sie hatte alles, was sie glücklich machte: Wenn sich im Wasser der Mondschein spiegelte, dann nannten die Türken das »Yakamoz«. Dieses eine Wort beschrieb ihre Liebe zum Meer – und die konnte sie nur am Bosporus spüren, wo die Delfine Purzelbäume schlugen. Der Besitzer ihrer Lieblingsbuchhandlung, zu der Aynur etwa sechs Lieder brauchte, um dorthin zu gelangen, informierte sie immer über die neu erschienenen Romane. Sie trug selbstgeschneiderte Schlaghosen, taillierte Blusen, dazu einen Blazer und kobaltrote Kork-Plateauschuhe mit senfgelben Absätzen. Dezent geschminkt, die Haare nach außen geföhnt, genoss Aynur, Lieder von Ibrahim Tatlıses summend, Bootsfahrten auf dem Bosporus. Im Winter entspannte sie sich im Galatasaray-Hamam, wo sie sich mit Freundinnen bei Baklava und stundenlangem Klatsch über die Menschen in ihrer Mahalle, ihrer Nachbarschaft, amüsierte. Wenn es warm wurde, fuhr sie an den Wochenenden mit dem Dolmuş nach Ortaköy, um mit ihren Freundinnen ausgiebig zu frühstücken. Danach gingen sie an der Promenade spazieren, vorbei an den aus Holz gebauten Yalı-Villen, den Sommerhäusern, in denen sich die verwestlichte Bourgeoisie bedienen ließ. Die Fenster standen offen, und zu hören waren Gelächter und europäische Klassik. Unterwegs gönnten sie sich gebackene Quitten mit Sahne, um sich am Mittag bei einem Freiluftkonzert umringt von Zypressen zu entspannen. »Mein Leben war wunderbar«, erzählte Aynur später ihren Kindern.
Aynur liebte ihren Bruder über alles und vertraute ihm, wohingegen er vor allem auf sich selbst bedacht war. Sie, die folgsame Träumerin, er der Bestimmende und Strebsame. Aynur war eine durchschnittliche Schülerin, die mehr an der Farbe ihres Lippenstifts und dem Schnitt ihrer Kleider interessiert war als an den Siegen der Osmanen. Er hingegen lernte immerzu. Der frühe Verlust des Vaters hatte ihm eine Ernsthaftigkeit verliehen, die für sein Alter nicht vorgesehen war. Nicht seine Mutter war die Familieninstanz, er war das Zentrum des Güvenilir-Universums. Besonders streng war er nicht, ließ seine Schwester meist in Ruhe, gelegentlich schenkte er ihr eine Kleinigkeit. Sie stritten selten, beide hatten sich vorgenommen, der arbeitenden Mutter nicht zusätzlich zur Last zu fallen.
Veysel verstand früh, wer die Macht im Land hatte, und dass man sich dem System unterordnen musste, um etwas zu werden. Weil die Polizeiakademien auch Jungen aus armen Familien aufnahmen, bewarb er sich. Er bestand die Prüfung, und fortan gab er sich besondere Mühe, wenn er vor einer Büste von Mustafa Kemal Atatürk die Nationalhymne singen musste. Zwei Jahre später hing sein Abschluss goldgerahmt an der Wohnzimmerwand.
Wie ein Chamäleon war er, er passte sich an, niemand sollte ihm etwas anmerken. Noch immer hatte er diese zarte Haut und langgliedrige Finger wie ein Pianist. Eine feine Brille ließ ihn wie einen Intellektuellen aussehen, nicht wie einen Bewaffneten ohne Vaterland. Wenn er sprach, dann so eindringlich, als würde er auf einer Bühne stehen.
Er verdiente nun genug, um seine Mutter zu unterstützen, die jetzt ihre Arbeit an den Wochenenden aufgab. Von seinem ersten Gehalt kaufte er sich einen goldenen Siegelring mit einem Halbmond und einem Stern darauf und schenkte ihr ein Radio. »Mutter, kann ich heute etwas für dich tun?«, fragte er jeden Tag, bevor er seinen Dienst antrat.
»Ich bin so stolz auf dich«, antwortete sie. »Mehr brauche ich nicht.«
Weil es von ihm erwartet wurde, fing er an, sich ein wenig um seine Schwester zu kümmern. Wenn sich im Spätsommer die Störche in Richtung Süden aufmachten und im Winter die Wildgänse Einzug hielten, nahm er Aynur mit auf den Çamlıca-Hügel, spendierte ihr Maronen, und versuchte, mit ihr über die »Menschenlandschaften« von Nâzım Hikmet zu diskutieren. Dabei sprachen sie leise, denn seit 1964 war das Werk des türkischen Schriftstellers in seiner Heimat verboten. Aynur verstand die Texte von Hikmet nicht, dafür war sie zu jung. Bei den Gesprächen gab sie sich Mühe, ihr Lächeln nicht allzu gequält aussehen zu lassen. Als Veysel verstand, dass sie es nicht verstand, machte sich in ihm eine Lustlosigkeit breit. Erst die Liebe zu Ceyda, einer Cousine dritten Grades, ließ ihn aus seinem Alltag fliehen. »Siehst du mich fragte sie / Bleib bei mir forderte sie / Lass uns gemeinsam weitergehen sagte sie / Ich sah / Ich blieb / Ich will nie wieder ohne dich sein«, schrieb er nach ihrem ersten Kuss traumverloren in sein Tagebuch. Fortan widmete er sein Leben Ceyda und dem System.
»Endlich bin ich zufrieden, und das soll so bleiben«, sagte er zu Aynur, die ihm in einer lauen Sommernacht bei der Verbrennung seiner Hikmet-Bücher helfen musste.
»Willst du nicht wenigstens das behalten? Es ist doch dein Lieblingsbuch«, hielt sie ihm einen Band von »Menschenlandschaften« entgegen. »Nein, es ist zu riskant in meiner Position. Oder willst du mich im Gefängnis besuchen?«, nahm er es ihr aus der Hand und warf es in die Feuertonne. Eine Woche nach Ceydas achtzehntem Geburtstag heirateten sie.
Ceyda hatte flachsblond gefärbtes Haar. Auf den Wangen und dem Dekolleté hatte sie Sommersprossen, als hätte jemand Zimt darübergestreut. Sie war ein Einzelkind, ihr Vater unterrichtete Französisch am Robert College in Arnavutköy. Sie trug maßgefertigte Kleider, ihre Zigarettenspitze war aus Ebenholz, und alle drei Jahre tauschte sie die Wohnzimmermöbel aus. Nach ausgiebiger Zeitungslektüre am Morgen ging sie über zu Stickarbeiten, machte Spaziergänge und lud am Abend die Damen aus der Nachbarschaft ein, um Poker zu spielen. Nachdem das Paar innerhalb von drei Jahren zwei Söhne bekommen hatte, bezog Aynur ein Zimmer bei ihnen im Viertel Moda, um zu helfen.
»Aynur«, rief Ceyda. »Bring mir einen Tee.«
»Aynur«, mahnte sie. »Warum hat das Baby noch keine frische Windel?«
»Schwester«, kritisierte Veysel. »Warum hast du mir noch nicht das Geld von deinem Gehalt gegeben?«
»Schwester«, forderte er. »Die Kinder sollen nicht mit der ›Hürriyet‹ spielen. Ceyda will die Zeitung noch lesen.«
Samstags musste Aynur vor Einbruch der Dämmerung zurück sein, um ihre Neffen zu hüten, weil Veysel und Ceyda in das Lokal auf dem Pier von Moda gingen. Wenn es das Wetter zuließ, fuhr sie sonntags mit den Kleinen auf die Insel Büyükada, damit das Ehepaar ungestört sein konnte. Rieselte der Schnee, musste sie mit den kleinen Kindern stundenlang draußen spielen. Sie durften erst wieder hochkommen, wenn Ceyda sie vom Balkon rief. »Aynur, komm her«, weckte sie nachts ihre Schwägerin, wenn die Kinder schrien, und schloss die Tür hinter sich. Als die Kinder anfingen durchzuschlafen, redete Ceyda so lange auf ihren Mann ein, bis er verstand: Erst wenn er sich von seinem Dasein als Bruder verabschieden würde, wäre seine Frau zufrieden.
»Versprichst du mir, dass deine Schwester bald weg ist?«
Er nahm Ceydas Kopf in seine Hände, schaute in ihre honigfarbenen Augen und versprach: »Steiger dich nicht so hinein, meine Liebste. Die Aufregung schadet dir nur und lohnt sich nicht. Aynur wird bald heiraten. Ich kümmere mich darum.«
Als ein Bekannter ihm von einem Bekannten erzählte, der gerade ein neues Leben in Deutschland begonnen habe und momentan in Istanbul nach einer Frau suche, sah Veysel die Lösung gekommen. Er traf den Fremden in einem Café, musterte den hageren Sonderling im viel zu großen Jacket und mit Namen Alvin Güney und wollte wissen: »Warum haben Sie die Türkei verlassen?«
»In meiner Kindheit war ich dafür bekannt, der Sohn von Leuten zu sein, die knietief in Armut steckten. Wir mussten beim Krämer anschreiben lassen, wenn wir etwas wollten, was unsere bescheidene Ernte nicht hergab. Manche Winter musste ich mit den Terliks meiner Mutter in die Schule, weil ich keine eigenen Schuhe hatte. Meine nackten Zehen ragten heraus, und meine Hosen waren zu kurz. Ich will mich satt essen können, ohne Angst vor einem leeren Portemonnaie. Ich will nicht mehr frieren und ausgelacht werden. Ich bin weg, weil ich nicht mehr gedemütigt werden will, wenn ich den Menschen die Schuhe putze. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, vor Fremden auf die Knie zu gehen?«
»Nein, woher soll ich das wissen?«
»Manche Menschen geben mir das Geld nicht in die Hand, sondern werfen es auf den Boden, während ich noch meine Bürsten verstaue. Wie einem Hund, dem man Reste hinwirft.«
Veysel schwieg.
»Wissen Sie, wie es ist, wenn man den Launen eines Polizisten ausgeliefert ist?«
»Ich bin mir sicher, dass die Polizei Gründe für ihre Launen hat, wie Sie es nennen.«
Alvin stutzte, fuhr dann aber fort: »Hier gibt es keine Arbeit für mich, also bin ich meinem Vater gefolgt. Eines Tages, so Allah will, werde ich als reicher Mann mit einer schönen Frau und zwei prächtigen Söhnen in mein Dorf zurückkehren. Den Bewohnern werde ich zum Opferfest Schafe spendieren, und meine Kinder werde ich später auf die Universität schicken. Ich wünsche mir, dass meine Familie stolz auf mich ist und mir die Hand küsst.«
»Wie heißt die Stadt, in der Sie jetzt wohnen?«
»Herne.«
Veysel schaute Alvin forschend ins Gesicht. Von Herne hatte er noch nie gehört, nicht dass dieser Fremde Lügen erzählte.
»Was genau machen Sie beruflich?«, wollte er wissen.
»Ich arbeite in der Automobilbranche. Ich stehe am Fließband. Demnächst wechsle ich in den Bergbau, da verdiene ich noch mehr.«
Dieser Mann war ein Sunnit und ungebildet, dachte Veysel. Aber er lebte in Deutschland und würde ihn nicht mit ständigen Besuchen nerven – dafür fehlte dem das Geld. Seine Mutter würde dieser Ehe niemals zustimmen. In diesem Moment erinnerte er sich an Ceydas schweißnasse straffe Brüste, nachdem sie sich heute Morgen geliebt hatten. Noch nie hatte er so etwas Schönes gesehen.
»Herr Güney, ich möchte Sie zu uns einladen, damit Sie meine Schwester kennenlernen können.« Seiner Mutter würde er sagen, ein Mädchen, das wie Aynur nur brav zu Hause hocke, sei ein brachliegendes Feld, das bestellt werden müsse.
Alvin war verdutzt, wie reibungslos alles scheinbar funktionierte. Er fragte sich schon, ob Aynur debil sei, warum sonst sollte dieser Mann seine Schwester loswerden wollen? Dann zeigte Veysel ihm ein Foto der Unbekannten, und alle Bedenken waren zerstreut: Für ihn war Aynur die dunkelhaarige Version der blonden Schauspielerin Emel Sayın. Er, sonst mit Schmutzschlieren an seiner Kleidung, würde bald mit der schönsten Frau, die er je gesehen hatte, Tisch und Bett teilen. Außerdem würde ihn sonst nie eine Frau aus Istanbul heiraten, er müsste eine aus seinem Dorf entführen.
Jetzt konnte es dem 22-Jährigen nicht rasch genug gehen.
»Ich bedanke mich für die Einladung, die ich gerne annehme. Sagen Sie Ihrer Schwester bitte, dass ich mich darauf freue, sie bei Ihnen treffen zu dürfen«.
»Gut, dann sehen wir uns nächsten Montag«, sagte Veysel und schrieb seine Adresse auf einen Zettel. Er verabschiedete sich überstürzt, um Ceyda sogleich die gute Nachricht zu überbringen. »Bald können wir bis an unser Lebensende glücklich sein«, flüsterte er ihr ins Ohr und fuhr ihr mit den Lippen über den Hals.
Als Alvin später aus dem Kaffeehaus heraustrat, blendete ihn das Sonnenlicht. Er zog eine Zigarette hervor, zündete sie an und genoss jeden Zug.
Canım Annem – Geliebte Mutter, während ich diese Zeilen schreibe, habe ich Deine Stimme im Ohr: »Dein Vater war kein schlechter Mensch, er war nur naiv.«
Für Dich war Vaters Beerdigung ein unglücklicher Tag. Die Liebe Deines Lebens war fort. Für mich war es ein glücklicher Moment. Eine Hitzewelle schoss durch meine Wirbelsäule hinauf zu meinem Gehirn. Dezember 2017, endlich war der Kampf zu Ende. Ihr beide, Vater und Du, ja, auch Du, konntet mir nicht mehr den Hals mit einem Strick zuschnüren.
Wir zwei Geschwister übernahmen sein letztes Geleit. Du warst zu müde für den langen Weg nach Burmageçit. Bevor unsere Reise losging, hattest du Vaters Klamotten in mehrere Koffer gepackt. Wir sollten sie als Spende bei einer Moschee abgeben. Auch wenn ich froh war über seinen Tod, war dieser Anblick doch schwierig für mich. Das greifbare Leben eines Menschen lässt sich so einfach entsorgen. Du hattest Vater in seinen letzten Monaten ständig neue Schlafanzüge gekauft. Es war Deine Art, ihm etwas Gutes zu tun. An den meisten Pyjamas hingen noch die Etiketten.
Lass mich Dir erzählen, Mutter, dass ich in jenem Moment während seiner Beisetzung auch beschämt war. Es wurde von mir erwartet, dass ich mich dramatisch auf den Boden werfe, um Vaters Tod zu betrauern. Aber es kamen keine Tränen. Stattdessen breiteten sich die vergangenen Jahre wie eine Wüste vor mir aus. Vaters wenige Erzählungen zogen in meinen Gedanken vorbei. Ich sah ihn mit zehn: dünne Hosen und den Schulweg auch im Winter zu Fuß. Türkisch hatte er erst in der Grundschule gelernt. Und ein Klassenzimmer zuletzt mit zwölf Jahren betreten.
Ich sah Vater, wie er morgens um fünf Uhr aufstand, um Feuerholz zu sammeln, damit das Steinhäuschen nicht auskühlte. In einem Moment sah ich den jungen Mann, der allein nach Istanbul abgehauen war. Ich sah den Arbeiter, der, so beeindruckt von der deutschen Mark, nicht wusste, wohin mit seinem neuen Reichtum. Ich sah meinen Baba, der uns Kinder liebte und überfordert war. Erinnerte mich an seine Stimme, die so gnadenlos sein konnte. An seine Barthaare, die mich im Gesicht piksten, wenn er mich küsste. Ich spürte fast schon körperlich den Sohn, der sich von seiner konservativen Familie abnabelte und uns Kindern Freiheiten ermöglichte. Den Spieler, der uns verkauft hätte. Den Mann, der mit einer Gebetskette in der Hand durch Herne tigerte, um Geld aufzutreiben. Nun wo er tot ist, kann ich mich wieder daran erinnern, dass er mich auf seine Art auch geliebt hat. In zärtlichen Momenten nannte er mich »Benim kara kızım – Meine dunkle Tochter«, weil ich so dickes, schwarzes Haar habe.
Ich sah Alvin, wie er sich vor wenigen Wochen zitternd an mir festhielt, während ich ihn duschte. Er fasste sich ungeniert in den Schritt, um sich zu waschen, und drehte sich um, wenn ich es ihm sagte. Mit einem Waschlappen massierte ich seinen Rücken. Dein Mann war kaputt, dass hattest Du Dir doch immer gewünscht. »So ein Ende hat er nicht verdient«, befandst Du aber, als es so weit war. »Warum sagst du das jetzt?«, habe ich Dich gefragt, und Du hast Dich hingesetzt und aus dem Küchenfenster geschaut. »Ich wusste nicht, dass ich Mitleid für ihn empfinden kann.«
Erst an Alvins Grab konnte ich damit beginnen, Eure Verbrechen nicht mehr zu verurteilen. Hier wurde mir klar, in welch seelischer Not Ihr beiden gelebt habt, und in welcher Verbitterung Baba gestorben ist.
Den Toten kann man nur noch verzeihen, sonst würde die Bitterkeit für immer wie Sand zwischen den Zähnen knirschen. Ich wollte diese Bitterkeit nicht mehr schmecken. Mutter, ich atmete den kalten Wind von den Flüssen ein. Ich war glücklich: das Glück einer Frau, die es geschafft hat, einen fast vierzig Jahre andauernden Hindernislauf zu überstehen. Ich bin Mensch, ich bin Frau, ich bin Tochter, ich bin Aus- und Aufsteigerin, Migrantin. Ich bin Meryem, mit Alvins Tod endlich angekommen.
Am Morgen kurz vor der Abfahrt zu Alvins Beerdigung raucht Meryem hinter einem Werbeschild für Kopftücher eine Zigarette. Ein frostiger Dezemberwind jagt durch die Straßen, am Himmel hängen trübe Wolken. Die Schneespitzen auf den Bergen leuchten, als sie die glühende Zigarette wegwirft und zu ihrem Bruder Ada in das wartende Taxi steigt.
Auf dem Friedhof angekommen, schlängelt Meryem sich durch die Gruppe der Männer zu den Frauen, über die sich ihre Mutter immer lustig gemacht hatte, weil sie so fromm waren. Sie stolpert über einen Stein, knickt ein wenig um, humpelt weiter. Etwa fünfzig Menschen sind gekommen, um ihren Vater Alvin zu verabschieden. Als der Wind durch ihre Jacke dringt und durch das Kopftuch nach ihrem Nacken greift, fröstelt sie. Bei jeder Böe verrutscht das Tuch. Niemand stört sich daran, für Vaters Familie ist sie das verlorene Kind, das sich nie um ihn gekümmert hat und das sie nun liebevoll wieder in den Schoß der Gemeinde aufnehmen konnten.
»Stell dich neben mich«, fordert eine von Alvins Schwestern Meryem freundlich auf, doch sie humpelt weiter und starrt in das leere Grab.
Als Meryem wenige Tage zuvor in der Kantine des Hospizes einen Kaffee trinkt, geht Alvin voraus. Sein Gesicht, als schlafe er. Meryem berührt seine Hände, sie sind kalt, sie küsst seine kalte Stirn, sie küsst seine kalten Wangen, die Haut seltsam ledrig. In der Kapelle betet sie für ihre Mutter.
Der Abschiedsraum ist winzig. Es gibt nur einen Stuhl und einen kleinen Tisch, darauf eine Kerze, eine Christbaumkugel und ein Tannenzweig. Ein Weihnachtsstern welkt auf der Fensterbank vor sich hin. Über ihm ein Kreuz. Sein Unterkiefer ist hochgebunden, ein anderes Tuch liegt um seine Fesseln. Aynur hat ihm Minuten zuvor die Nägel geschnitten. Meryem versteht nicht wieso.
Am nächsten Morgen holen zwei Männer vom Islamverband Ditib Alvins Leichnam ab und bringen ihn in eine Moschee, die in einem Herner Hinterhof liegt. Gewaschen und gesalbt wird er in drei weiße Leinentücher gewickelt.
Während die Männer seinen Körper für den Weg zu Allah vorbereiten, sitzen Meryem und Ada mit Alvins Bruder Barış und dessen Frau Hêlan im Flieger nach Istanbul, um von dort aus weiter nach Burmageçit zu reisen.
Sie fahren in die Ferienwohnung von Barış und Hêlan, die noch ganz beseelt sind von ihrer kürzlichen Hadsch nach Mekka. Aynur rollte mit den Augen, als die Schwägerin ihr auf Whatsapp Bilder von dort schickte: »Niemand mit gesundem Verstand läuft tagelang um einen schwarzen Stein herum«, sagte sie zu Meryem.
Trotz der späten Stunde ist die Wohnung voller Gäste. »Wer sind diese Menschen?«, flüstert Ada. Meryem weiß es nicht, aber alles hier fühlt sich natürlich an, obwohl ihre Welt eine ganz andere ist als diese. Überall brennt Licht, dicke Teppiche auf den Böden, im Wohnzimmer Sessel mit dickweicher Füllung und bestickten Überdecken, an den Wänden gerahmte Koransuren, der Fernseher viel zu laut, im Badezimmer plattgelatschte Gummisandalen für diejenigen, die vor einem Gebet ihre Füße waschen müssen. Ein Hin und Her von verschleierten Frauen, Männern mit Gebetsketten, die stirnrunzelnd Suren murmeln. Die Geschwister hocken verunsichert nebeneinander, dampfende Teegläser in der Hand. Ständig spricht ihnen irgendwer ihr Beileid aus. »Danke«, nicken sie, und wenn das Gegenüber fragt: »Beni tanımadınız mı?« – »Erkennt ihr mich nicht?«, schütteln sie verlegen die Köpfe. Ein Cousin aus Istanbul, eine Cousine aus Bordeaux. Die Kinder haben nicht viel Zeit mit ihrer Familie verbracht, entschuldigt Hêlan.
Weit nach Mitternacht können sie sich endlich ins Schlafzimmer zurückziehen. Die Heizkörper sind gerade erst angeworfen worden, und Meryem kuschelt sich schlotternd in die Decke auf einer Matratze am Boden. Von irgendwoher hört sie Schüsse. Das kraftvolle Zischen der Kampfjets, auf ihrem Weg in den Nordirak, lässt sie zusammenzucken. Im Traum erscheint ihr Baba. Er schwebt als Engel im schwarzen Gewand und mit großen weißen Flügeln zu ihr herab. Seine braunen Augen sind liebevoll, Meryem schmiegt sich an seinen Körper, er hält sie fest.
Burmageçit ist über fünfzig Jahre nach Alvins Wegzug noch immer der Ort, der keine falschen Versprechungen macht. Hier in Ostanatolien fällt noch regelmäßig der Strom aus. Im Sommer ist es so heiß, dass die Menschen nicht alle Früchte ernten können, die an den Zweigen hängen. Das Obst kullert über den Asphalt, die Autos rollen darüber und hinterlassen Matsch. Im Winter schiebt der Wind den Schnee zu Hügeln zusammen, so dass die Bewohner nur mühsam vorankommen. Der Wind ist hier so heftig, dass er Steine wegfegt. Zum Frühstück isst man Mehlsuppe, die ist billig und wärmt.
Am Stadtrand die Gebäude der Geisterviertel, leerstehende Häuserblocks, in die sich die aufständischen Kurden zurückgezogen haben. Im Zentrum ein Brunnen, zwei Kaffeehäuser, Bäckereien mit Süßspeisen, Krämerläden mit buntem Küchenzeugs aus Plastik, Schmuckhändler, in deren Schaufenstern das Gold blinkt. Die Menschen hier verlassen selten ihr Dörfchen. Sie träumen von einem Leben in Europa. Sie träumen von dem Leben, dass die Geschwister führen. In den Internetcafés drucken sich die Jugendlichen die Unterlagen für einen Visaantrag in Deutschland aus, der ohnehin abgelehnt wird.
Der Leichenwagen fährt nah an das frisch ausgehobene Grab heran, und vier Männer in viel zu dünner Kleidung treten nach vorne, um den Sarg aus dem Auto zu heben. Meryem holt Luft, schaut Sekunden lang auf den Boden, bevor sie gemeinsam mit den Trauernden die Hände nach oben richtet. »Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīm. al-ḥamdu lillāhi rabbi l-ʿālamīn«, die ersten Verse der Al-Fātiḥa, der ersten Sure, sind leise zu hören. Die Männer stellen den Sarg auf den Boden, der Imam steht vor dem Kopfende.
»Hakkınızı helal ediyor musunuz?«, fragt er die Geschwister. Ob Meryem und Ada ihren Vater in Frieden mit Vergebung von allen Sünden ziehen lassen? »Hakkımızı helal ediyoruz«, antworten beide. Verziehen ist alles Unrecht. Meryem fühlt die stechenden Blicke in ihrem Rücken. Die Männer öffnen den Sarg und lassen den eingewickelten Leichnam mit Seilen in die Erde hinab, die Füße in Richtung Mekka. »Willst du einen letzten Blick auf ihn werfen?«, fragt Hêlan Meryem, aber sie schüttelt den Kopf. Stattdessen schaut sie in den Himmel, hört die mit den Zungen schnalzenden Frauen hinter sich, die um ihren Vater trauern. Die Luft ist klar und frisch, der Wind weht von den nahen Bergen und Wäldern herüber. Ringsum kahle Bäume und Felder. Meryem schließt die Augen. Sie spürt Lippen auf ihren Wangen, die Umarmungen. Die Menschen sprechen Kurdisch, sie versteht nichts. Kurdisch haben ihre Eltern den Kindern nicht beigebracht. Sie sollten politisch niemals auffallen, Türkisch musste ausreichen.
Aus Meryems Mund schallt ein erleichtertes Lachen, der Wind trägt es über die Grabsteine in die Berge davon und wieder zurück. Verblüfft schaut Hêlan sie an, sie erblickt die Leib gewordene Sünde einer Tochter.
Ada steht in Gedanken versunken ein wenig abseits, mit undurchdringlichem Gesicht, seine Augen wie matte Steine. Es ist, als weilte er an einem anderen Ort … Achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig … eine halbe Minute später fängt er an zu weinen. Fünf Jahre lang hatte er den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Er ignorierte Aynurs Anrufe, und als seine Mutter unangemeldet vor seiner Tür stand, öffnete er nicht. Aynur hatte aus tiefstem Herzen gehofft, dass ihr Sohn sie vermisste und sich freute, sie zu sehen. Sie vermissten ihren Sohn so sehr, und sie hoffte, dass er dennoch glücklich ist. Sie verstand nicht, warum ihr Sohn so wütend auf sie war. Sie war sich sicher, alles richtig gemacht zu haben. Stundenlang wartete sie im Treppenhaus – doch ihr Kind kam einfach nicht heraus. Aynur war nicht böse auf ihren Sohn, nie war sie böse auf ihn. Sie legte eine Tupperdose mit Dolma vor seine Tür, sein Lieblingsessen. Sie wollte, dass ihr Baby etwas Gutes zu essen hat.
Am nächsten Tag wird das Mevlüt, die Trauerfeier,





























