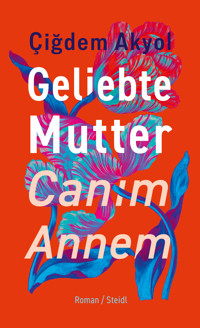Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Recep Tayyip Erdoğan ist eine der umstrittensten Figuren auf der internationalen politischen Bühne. Unter ihm erlebte die Türkei eine nie da gewesene Phase der Stabilität und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Doch sein Aufstieg zum Alleinherrscher stürzt das Land in zahlreiche Konflikte, die Türkei ist auf dem Weg in eine Autokratie. Erdoğan befindet sich in einem rücksichtslosen Kampf gegen politische Gegner und kritische Medien. Den gescheiterten Putsch des Militärs nutzt er für Säuberungsaktionen, Tausende Menschen werden aus dem Staatsdienst entlassen oder landen im Gefängnis. In ihrer erweiterten und aktualisierten Biografie zeichnet Cigdem Akyol den Weg Erdoğans von einer Kindheit in ärmlichen Verhältnissen bis ins höchste politische Amt der Türkei nach. Sie beschreibt die Familienstruktur der Erdoğans ebenso wie das Verhältnis zu politischen Vertrauten und Weggefährten und beleuchtet kritisch Erdoğans Rolle in den Ereignissen der jüngsten Zeit – den vereitelten Putsch und den Volksentscheid über die Stärkung seiner Macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Çiğdem Akyol
Erdoğan
Die kritische Biografie
vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe 2018
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © picture alliance/AA
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein
ISBN (E-Book) 978-3-451-81250-7
ISBN (Buch) 978-3-451-60064-7
Für Deniz
Inhalt
Impressum
Widmung
Einleitung
Atatürks langer Schatten
Der Gründer der Republik
Die Revolutionäre
Innere Modernisierung
Diktierter Fortschritt
Im Schnelldurchlauf
Atatürks Frauenbild: Erfolgreich, selbstbewusst, unverschleiert
Alle Wege führen nach Westen
Das Ende des »Vaters der Türken«
Atatürks Vermächtnis
Eine türkische Kindheit
Das Schweigen des Präsidenten
Die Enge von Kasımpaşa
Ein strenges Elternhaus
Die Türkei in den Fünfzigern: ein Land in Unruhe
Lernen fürs Leben
Macht der Generäle – Ohnmacht der Massen
Vom Imamschüler zum Politnovizen
Der islamistische Mentor
Erste Schritte auf dem politischen Parkett
Die Frau im Hintergrund
Eine schrecklich erfolgreiche Familie
Aufstieg, Fall und Wiederauferstehung
Der Konkurrent als Lehrmeister – Turgut Özal
Erste Risse in der Beziehung zu Erbakan
Der fromme Bürgermeister
Die Haft
Der Erdrutsch
Gegen alle Widerstände
Anfang und Ende einer Männerfreundschaft
»Ein großer Reformer« (Gerhard Schröder)
Machtprobe mit den Generälen
Militär contra Regierung
Der »Baba« gewinnt erneut
Das neue Selbstbewusstsein
Der Mann an seiner Seite
Ende einer Achterbahnfahrt
Wahlkampfauftritt in Deutschland
Juristischer Schlagabtausch mit den alten Eliten
Der Eklat von Davos
Go East – außenpolitischer Kurswechsel
Demokratisierung nach EU-Geschmack
Jetzt wird durchregiert
Wahnsinnsprojekte für das Volk
Die Zielgerade zur Präsidentschaft
Der Sultan aus Ankara
Wiederaufflammen des Kurdenkonflikts
Anlauf mit mageren Bilanzen
Die Generation Erdoğan
Berkin Elvan, 14
Der Feind im Exil
Der Wahlkampf zur Präsidentschaft
Der Allmächtige
Der Kampf um Kobanê
Der kurdische Bezwinger
Tage des Terrors
Ein Wahlkampf der Angst
Minderheiten und historische Konflikte
Die ewige Angst vor den Kurden
Erdoğans Kurdenpolitik: ergebnisorientierte Ambivalenz
Der Hassausbruch
Erdoğans Albtraum »Staat im Staat«
Der neue Liebling der EU
Beidseitige Ermüdungserscheinungen
Erdoğan und die Armenier: Öffnung und Leugnung
Viele Tabubrüche
Das verbotene G-Wort
Erdoğan und die Aleviten
Der Terror nebenan
Die Armee kapituliert vor Erdoğan
Die Selbstherrlichkeit schwindet
Ergenekon: folgenschwerer Glücksfall
Das islamische Wirtschaftswunder
Der oberste Zensor
Das Mediensystem Erdoğan
Der getriebene Medienzar
Kritisieren darf nur einer
Konservativ, aber kein Islamist
Kulturkampf um den Alkohol
Träume von einem untergegangenen Weltreich
Ein Stück Textil spaltet das Land
Gegen die »unnatürliche Gleichberechtigung«
Ihr Bauch gehört ihm
Zar gegen Sultan
Der Putschversuch – ein »Segen Gottes«
Die Säuberungen nach der Revolte
Anschreiben gegen die Repression
»Angst macht uns angreifbar«
»Cumhuriyet wird am Leben bleiben«
Referendum zur Verfassungsänderung: Schicksalstag für die Türkei
Erdoğan, überall Erdoğan
Wahlen im Ausnahmezustand
Deutsch-türkische Spannungen: Armenien, Böhmermann, Nazi-Vergleiche
Mit Drohgebärden zum Sieg
In den Großstädten überwiegt das Nein
Wie weiter im Erdoğan-Land – Nachwort
Anhang
Aussprachehilfe für das Türkische
Wichtige türkische Parteien von 1923 bis heute
Die Regierungen der Türkei seit 1923
Zeittafel
Literatur
Glossar
Abbildungsnachweis
Dank
Über die Autorin
Einleitung
»Du bist die Türkei: Denke groß!«, steht auf Plakaten, die in der Türkei landesweit mit Recep Tayyip Erdoğans Gesicht aushängen. Einerseits ist er allgegenwärtig, in der Türkei sowieso, und auch in den europäischen Medien produziert er große Schlagzeilen. Andererseits wissen wir in Europa immer noch wenig über den Mann, den der Großteil der Auslandstürken wählt, wo er gelegentlich bei Auftritten ganze Hallen füllt, stets rote Nelken in die Scharen wirft und wie ein Messias gefeiert wird. Wenn er dem Volk Versprechungen macht, legt er seine Hand auf die Brust.
»Üstat! Üstat« – »Lehrmeister! Lehrmeister!«, jubeln sie ihm dann zu. Seine Anhänger – sunnitisch, konservativ – verehren den Populisten. Die Menschen, die ihn wählen, identifizieren sich mit ihm: ein dynamischer, nationalistischer Präsident. Endlich wird die Türkei nicht mehr belächelt, nein, manch Westler fürchtet Erdoğan sogar. Den Auslandstürken ruft er immer wieder zu: »Wir sind stolz auf euch.« Sie skandieren zurück: »Die Türkei ist stolz auf dich!«
Für Außenstehende ist die Grundkonstellation klar: Erdoğan hat sich die Türkei untertan gemacht. Hierzulande ist es zu einer Art Volkssport geworden, Erdoğan, den großen Unbekannten, zu psychologisieren. Dabei fallen die seelenkundlichen Diagnosen im Detail unterschiedlich aus, doch selten wird sein Name ohne die Attribute »autoritär« und »unberechenbar« erwähnt.
In Deutschland erscheint er wie eine undurchsichtige, ferne Figur im Fokus der Weltöffentlichkeit. Ein unermüdlicher Verkünder seiner eigenen Agenda, der für deren Durchsetzung auch Gewalt in Kauf nimmt und dem deswegen von seinen Kritikern eine fast mephistophelische Rolle zugetragen wird. All das ist wahr, doch natürlich ist die Geschichte Erdoğans und der Türken nicht so einfach. Die Türken kennen Erdoğan schon seit dessen Jugend, die Deutschen vor allem seit seinem ersten Amtsantritt als Ministerpräsident 2003. Das Bild, das hier von ihm vorherrscht, entspricht nur in Teilen der Realität, die viel umfassender und vielschichtiger ist.
Denn wenn man sich auf die Suche nach dem Menschen hinter dem Präsidenten macht, nach seiner Herkunft, dann wird einem klar, wie unwahrscheinlich sein Weg zur Macht gewesen ist. Er kommt aus kärglichen Verhältnissen, immer wieder versucht die Opposition, ihn kleinzuhalten, sogar sein Ziehvater Necmettin Erbakan stellt sich dem Polittalent in den Weg. Doch sie alle scheitern und machen Erdoğan, der nie aufgegeben hat, am Ende sogar noch stärker.
Recep Tayyip Erdoğan arbeitet sich empor aus einem Armenviertel, überwindet das kemalistische System, das Männer wie ihn nicht vorgesehen hat, zunächst als Bürgermeister, dann als Verlierer, dann als Sieger – und nun als Staatspräsident. Er ist der facettenreichste Politiker der Republik, der in den Wirren der türkischen Geschichte politisch geprägt wurde, dessen Karriere zweifellos beeindruckt und dessen Leben durch eine Konstante geprägt ist: den unbedingten Willen, unbegrenzte Macht als Staatspräsident zu haben.
Wie hat es dieser Emporkömmling geschafft, der mächtigste Politiker der Türkei nach Atatürk zu werden? Erdoğans Laufbahn ist die ernüchternde Historie türkischer Politiker, die ihrem Land keinen Fortschritt bringen konnten und so seinen Aufstieg ermöglichten. So muss sein Leben auch in die komplexe Geschichte und die politischen Entwicklungen des Landes eingeordnet werden.
Es ist aber gleichwohl die Erzählung eines wendigen Mannes, der sich den Begebenheiten der Zeit anpasst und dessen Widerspruch nicht auf Kräften oder Institutionen beruht, sondern vor allem auf seiner Persönlichkeit. Er ist ein rapide lernender Charakter, der Fehler selten ein zweites Mal macht. Dabei orientiert er sich nur an seiner eigenen Person und nicht, wie immer suggeriert wird, am Glauben. Erdoğan ist ein Besessener. Er verfügt über eine manipulative Kraft, die Kraft der einlullenden rhetorischen Gewalt. Ein Narziss und ein Verführer, zweifellos selbstsicher, aber gleichsam ängstlich – denn nur wer sich fürchtet, baut solch ein repressives System auf.
Bislang sind auch Erdoğans Verdienste zu würdigen. Tatsächlich brachte er dem zerrütteten Land über Jahre hinweg ungewohnte politische und wirtschaftliche Stabilität, führte die Republik vor die Tore Europas, wagte einen Neuanfang in der Kurdenpolitik, baute die Infrastruktur auf, demilitarisierte das Land und ließ die Leistungen der Sozialversicherungen erheblich ausweiten. So verbinden viele Türken Erdoğan zwar mit Unterdrückung und auch mit Korruption, aber vor allem mit neuen Straßen, Sicherheit und Konsum. Aus dieser Perspektive werden die Oppositionsparteien hingegen als größeres Übel oder schlicht als zu schwach gesehen, um dem Machthaber etwas entgegenzusetzen. Deswegen wird Erdoğans Unberechenbarkeit bis an die Grenzen des Entschuldbaren hingenommen. »Seine« Türkei ist ziviler und moderner geworden, nicht aber demokratischer.
Politiker der AKP-Partei Erdoğans sprechen selten mit der westlichen Presse. Es wird geschickt abgewiegelt, vertröstet, hingehalten. Und wenn sie doch einmal reden, dann dürfen sie nicht zitiert werden. Sie misstrauen zutiefst der Presse und fürchten Konsequenzen, wenn sie ohne Genehmigung reden. So bleiben Anfragen an die Regierung für ein Interview mit Erdoğan bedauerlicherweise unbeantwortet, auch bei mir ist keine Antwort eingegangen.
Wer Erdoğan kennenlernen und über ihn schreiben will, muss ihm also hinterherreisen und die etlichen Veranstaltungen besuchen, bei denen er auftritt. Der muss die Stationen seines Lebens anschauen, sich herantasten, ihn umkreisen, seine Persönlichkeit studieren. Mit Vertrauten, mit Befürwortern, Gegnern und Zeitzeugen reden, Dutzende Archive besuchen und all das Medienmaterial auswerten, das es über Erdoğan gibt. Ich habe rund fünfzig Gespräche mit Menschen geführt, die Erdoğan entweder persönlich kennen oder aber von seiner Politik direkt betroffen sind – mit Freund und Feind. Doch nur die allerwenigsten wollen als meine Gesprächspartner genannt und zitiert werden.
In Europa werden diese Menschen, die es nicht wagen, öffentlich ihre Meinung zu sagen, rasch als »Feiglinge« abgeurteilt und Journalisten, die sich selbst zensieren, als unfähig abgestempelt. Aber könnte sich nicht jeder selbst fragen, was er machen würde, wenn er in einer defekten Demokratie mit einem gelenkten Rechtssystem und einem löchrigen Sozialstaat leben würde? Zu groß ist mittlerweile die Angst, vom Staatspräsidenten persönlich angezeigt zu werden, das freie Wort ist gefährlich.
Allein in den ersten vierzehn Monaten nach Erdoğans Amtsantritt als Präsident wurden 236 Ermittlungsverfahren wegen »Beleidigung des Präsidenten« eingeleitet. Bei einem Schuldspruch drohen bis zu vier Jahre Haft. Kritik – mag sie auch harmlos als Satire daherkommen – entgegnet Erdoğan vehement. Dabei sind schon Banalitäten ausreichend, um ins Visier der Justiz zu geraten – etwa der Vergleich Erdoğans mit dem »Herr der Ringe«-Wesen Gollum.
Selbst zu Hause ist man nicht mehr sicher. Im Februar 2016 zeigt ein Mann seine eigene Ehefrau wegen Beleidigung des Staatspräsidenten an. Die Frau habe Erdoğan immer beschimpft, wenn er im Fernsehen auftaucht, berichtet die regierungsnahe Zeitung Yeni Safak. Der Ehemann habe seine Frau mehrfach ermahnt, dies zu unterlassen. Weil sie aber nicht damit aufhört, nimmt er ihre Kritik auf Tonband auf und zeigt sie an.
Dazu kommen die Tausenden Menschen, die nach dem vereitelten Putschversuch im Juli 2016 inhaftiert werden, die Pässe entzogen, die Jobs verloren. Deswegen haben sich viele Mutige bereits zurückgezogen. Die wenigen, die ihre Kritik doch noch tapfer äußern, müssen im Wochentakt miterleben, wie ihresgleichen durch Gerichtsverfahren zermürbt oder unter fadenscheinigen Gründen in langjährige Untersuchungshaft gesteckt werden.
Doch nahezu jeder, der Erdoğan je persönlich getroffen hat, sagt, er sei ein Seelenfänger. Sein Charisma beeindruckt gleichermaßen Erdoğan-Hasser oder -Unterstützer.
Die zahlreichen türkischsprachigen Erdoğan-Biografien und Bücher über ihn sind ebenfalls wichtige Quellen für eine Annäherung an den Politiker, doch ist dabei kritisch zu berücksichtigen, dass keines dieser Bücher sachlich-distanziert ist. Um drei Beispiele zu nennen: Muhammed Pamuk, Autor des Buches Yasaklı Umut. Recep Tayyip Erdoğan (Verbotene Hoffnung. Recep Tayyip Erdoğan), ist Journalist bei regierungsnahen Medien und macht aus seiner Begeisterung für seinen Protagonisten auch überhaupt kein Geheimnis. Mustafa Hoş, Verfasser des Bestsellers Big Boss, geht in seinem Buch von der These aus, Erdoğan sei ein »guter Schauspieler«, für die er verschiedene Biografien, die er nach Widersprüchen durchsucht hat, heranzieht. Zwar ist Hoş insgesamt sachlich, doch auch er hat eine eindeutige politische Agenda: Hoş gehörte zu den prominentesten Journalisten des Landes, dann wurde er von Erdoğans Anhängern dermaßen unter Druck gesetzt, dass er mit seiner journalistischen Tätigkeit aufhörte. Ruşen Çakır und Fehmi Çalmuk haben zwar mit Recep Tayyip Erdoğan. Bir Dönüşüm Öyküsü (Recep Tayyip Erdoğan. Die Geschichte eines Wandels) eine sachliche Studie vorgelegt, doch ist diese 2001 erschienen und somit veraltet.
Setzt man die biografischen Mosaiksteine zusammen, lässt sich erkennen, dass Erdoğan kein Islamist ist, wie in der deutschen Öffentlichkeit oft unterstellt, sondern ein Taktiker erster Güte – oder aber übelster Sorte, je nach Sichtweise. Seine politische Agenda ist er selbst. Er kann mahnen, provozieren, belehren und begeistern. Er will eine Gehorsamsgesellschaft: Sie soll kaufen, hinnehmen und nicht gegen seine Vorstellungen aufbegehren. Vor allem aber will er uneingeschränkte Macht. Und er möchte gewürdigt werden für seine Leistungen. Auf dieser Grundlage gedeihen die Kränkungen gleichermaßen weiter wie sein Ehrgeiz, den nur ein Außenseiter haben kann.
Freundschaften halten bei ihm nur so lange, wie sie ihm auch nützen. Seinen jahrzehntelangen Weggefährten Abdullah Gül etwa hat er einfach »entsorgt«, als das politische Kalkül dies erforderte. Ihn interessiert die Meinung aus dem Ausland wenig, mehrheitsfähige Positionen bei seinen Stammwählern sind seine Maßgabe – gelegentlich verspricht er ihnen die Einführung der Todesstrafe. Während Freunde schnell vergessen sind, sind es Feinde aber nie – Erdoğan ist nachtragend und zornig auf alle, die es wagen, ihn zu hinterfragen, und rechnet irgendwann mit ihnen ab.
So wächst der Autoritarismus. Erdoğan hat es geschafft, dass aus der Türkei ein Land der Angst geworden ist. Jugendliche müssen sich fürchten, wegen eines Erdoğan-kritischen Facebook-Postings hinter Gittern zu kommen. Die Türkei unter Erdoğan hat sich zu einem Land entwickelt, in dem kritische Bücher aus den Geschäften verbannt werden. Menschen verschwinden spurlos. Oppositionspolitikern wird die Immunität abgesprochen, um sie anschließend mit politischen Justizverfahren zu zermürben.
Kurden sind nicht mehr sicher – weder vor Ankara noch vor der Terrororganisation PKK. Und die Europäer schrecken in der Flüchtlingskrise vor Erdoğan zurück, der die vor Bürgerkriegen Geflohenen wie Schachfiguren einsetzt. Dazu kommt, dass die Menschen mit dem Terror des »Islamischen Staates« (IS) rechnen müssen und sich ein Attentäter neben ihnen in die Luft sprengt. Die Regierung kündigt nur hilflose Maßnahmen an.
Kritische Medien haben nachgezählt, dass in der zweiten Jahreshälfte 2015 rund 44 Kinder bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungskritikern und Sicherheitskräften oder bei Terroranschlägen ums Leben kamen. Einer Studie des Global Peace Index von 2017 über die friedlichsten Länder der Welt zufolge, rangiert die Türkei auf Platz 146 – von 163 Ländern. Zum Vergleich: Deutschland befindet sich auf Platz 16. Allein zwischen Oktober 2015 und der Silvesternacht zu 2017 sterben rund 365 Menschen durch Terroranschläge von kurdischen Gruppen oder mutmaßlich durch Mörder des »Islamischen Staates«.
Wie geht es weiter mit Erdoğan? Zwischen März 2013 und April 2017 gab es fünf Wahlen, letztere, um endlich das Präsidialsystem einführen zu können, das ihn zum Alleinherrscher macht. Erdoğan hat all die Krisen seiner Amtszeiten überstanden, die Gezi-Proteste, die Korruptionsaffäre, das Bergwerksunglück in Soma, den Machtkampf mit Fethullah Gülen, die gescheiterte Außenpolitik mit den Nachbarn, die Terrorwelle durch mutmaßliche Dschihadisten des IS, das Ende des Friedensprozesses mit den Kurden, den niedergeschlagenen Putsch, den Einmarsch in Nordsyrien – doch viele Probleme werden weitergetragen.
So hat seine Außenpolitik die Türkei nicht sicherer gemacht, denn mit all ihren Nachbarstaaten ist die Türkei im Clinch, mit Zypern ist keine Regelung in Sicht, mit Armenien gibt es kaum Austausch. Die Menschenrechtssituation verschlechtert sich zusehends. Die Wirtschaft schwächelt, Erdoğan hat nur noch Claqueure um sich herum versammelt, die Kurden im Südosten des Landes kämpfen wieder gegen die Regierung. In keinem westlichen Land sitzen so viele Journalisten im Gefängnis wie in der Türkei. Der Geheimdienst wird immer wieder mit neuen weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Und Erdoğan? Der donnert seinen Kritikern ein »Haddini bil« (»Kenne deine Grenzen«) entgegen.
Doch es gibt keine Alternative zu Erdoğan. Tausende Oppositionelle sitzen in den Gefängnissen, nach der gescheiterten Revolte von Teilen des Militärs im Juli 2016 hat Erdoğan jegliche Hemmungen verloren und sich mit einer gigantischen »Säuberungswelle« jeglicher Kritiker entledigt. Seine Kernwähler – die Konservativ-Frommen – erfahren sowieso nichts von all den Negativschlagzeilen, weil Erdoğan die meisten Medien kontrolliert und weil ihnen die rhetorische Feindmarkierungen auch gefallen. Sie wollen Teil sein von Erdoğans hyperzentralistischem System, dessen Institutionen mittlerweile bis in die Kapillaren mit seinen Leuten besetzt sind.
So ist die Türkei ein tief gespaltenes Land. Zwischen denen, die Erdoğan verehren, die an ihm festhalten, weil sie weitere Wirren befürchten. Denen, die aus Sorge schweigen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Und denen, die auf den Straßen »Erdoğan, tritt ab!« rufen.
Die Türkei ist die Republik der toten Kinder: wo dem vierzehnjährigen Berkin Elvan während der Gezi-Proteste ein Polizist von hinten in den Kopf schießt.
Die Türkei ist ein Land der politischen Pragmatiker: wo der Kurde Dengir Mir Mehmet Fırat, einst AKP-Vize, in die HDP wechselt, um doch noch etwas bewirken zu können.
Die Türkei ist ein Land voller besonderer Geschichten: wo der deutschtürkische HDP-Politiker Ziya Pir, Neffe eines PKK-Mitbegründers, nun gegen Erdoğan kämpft.
Die Türkei ist ein Land der Verwundeten: wo der Künstler Mehmet Aksoy um seine Skulptur trauert, die Erdoğan abreißen ließ, weil sie ihm nicht gefiel.
Die Türkei ist ein Land der Verletzten: wo der Maler und strenge Kemalist Bedri Baykam von einem Islamisten niedergestochen wird und weiterhin gegen Erdoğan wettert.
Istanbul, im Januar 2018
Atatürks langer Schatten
Recep Tayyip Erdoğan ist ohne Zweifel der innen- und außenpolitisch einflussreichste türkische Politiker der modernen Türkei – seit Mustafa Kemal Atatürk. Der Republikgründer ist nach wie vor das personifizierte Selbstverständnis dieses Staates, Erdoğan will in dessen historische Fußstapfen treten. Für Erdoğan ist die Frage der eigenen »Bedeutsamkeit« im Vergleich zu Atatürk ein zentrales Motiv seiner Selbstdarstellung – und damit auch seiner politischen Entscheidungen. Denn zwischen beidem gibt es bei Erdoğan keine Trennung. Um Erdoğan zu verstehen, muss man auch Atatürk verstehen – und dessen Prinzipien nachvollziehen, welche die moderne Türkei geprägt haben.
Und auch wenn zwischen den Geburtsjahren der beiden Präsidenten fast ein Dreivierteljahrhundert liegt, gibt es biografische Parallelen. Sie begannen ihr Leben nicht als Vertreter der herrschenden Eliten, sondern als Kind der »kleinen Leute«. Dass es beide mit diesen Startbedingungen nach ganz oben geschafft haben, liegt unter anderem an einer weiteren Gemeinsamkeit: Die Zwei verbindet das unbedingte Ziel, es zu etwas Großem zu bringen, der sich schon in jungen Jahren deutlich zeigt. Atatürk brachte dieser Ehrgeiz vom Halbwaisendasein in der Provinz erst zu militärischem Ruhm und dann an die Spitze eines neuen Staates. Bei Erdoğan, der es aus einem Istanbuler Arbeiterviertel an die Staatsspitze schaffte, zeigt sich dieser Wille in der Verbissenheit, mit der er alles daran setzt, eine historische Legende zu werden – wie Atatürk. Der eine schuf einen neuen Staat – der andere baute sich ein neues System; beide verschoben die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten.
Dieses Ziel trieb Erdoğan auf seinem bisherigen Weg nach oben an. Der Hunger nach Bedeutsamkeit und Stärke machte ihn zum harten, kernigen Alleinherrscher, der sich in seine selbst erschaffene Welt immer weniger hineinreden lässt – sein Land, seine Leute, seine Regeln. Sein Weg ist noch nicht zu Ende: Erdoğans großes Ziel lautet »Präsident im Jahr 2023« zu sein. Dann feiert die Türkische Republik ihren 100. Geburtstag. Sollte er dann tatsächlich noch Präsident sein, könnte er endlich aus dem ewigen Schatten des Republikgründers treten. Der wird nicht nur auch heute noch in der ganzen Türkei verehrt, er ist noch immer zentraler Bestandteil des nationalen Selbstverständnisses, das seit seinen »Kemalistischen Reformen« auf Säkularismus, Fortschrittsglauben und türkischem Nationalismus basiert. Diese Prinzipien galten – allem zwischenzeitlichen politischen Chaos im Land zum Trotz – jahrzehntelang als sakrosankt. Bis Erdoğan kam, diese aushöhlte und demontierte.
Der Gründer der Republik
Generationen von Historikern, Politikwissenschaftlern, Journalisten, Autoren und Turkologen aus aller Welt haben die Archive durchforstet und über Atatürk geforscht. An sachlichen Biografien, deren historische Faktensammlungen und Interpretationen zweifelsohne sauber sind, herrscht kein Mangel.
Mustafa kommt entweder im Winter 1880/81 oder im Frühjahr 1881 im osmanisch kosmopolitischen Salonica (dem heutigen griechischen Thessaloniki) auf die Welt – bisher ist es nicht gelungen, sein genaues Geburtsdatum herauszufinden. Als »offizieller« Geburtstag hat sich später der 19. Mai 1881 durchgesetzt. Der Geburtsname lautet lediglich »Mustafa«, erst die »Kemalistischen Reformen« zwingen Jahrzehnte später die Türken dazu, sich Familiennamen zuzulegen.
Der Sohn eines Finanzbeamten und einer Bauerntochter lebt mit den Eltern und fünf Geschwistern zunächst in bescheidenen Verhältnissen – nur er und eine Schwester werden das Erwachsenenalter erreichen. Nach dem frühen Tod des Vaters um das Jahr 1888 zieht die Mutter mit den beiden verbliebenen Kindern zu ihrem Bruder, wo sie weiterhin in Armut leben. »Meine wichtigste Pflicht war die Feldhüterei. Nie werde ich vergessen, wie ich mit meiner kleinen Schwester in der Mitte eines Bohnenfeldes unter einem Schutzdach saß und wir mit dem Vertreiben der Krähen beschäftigt waren.«1 Nach zwei Jahren Feldarbeit wird Mustafa zu einer Tante nach Saloniki geschickt und kann wieder eine Schule besuchen.
Schon früh vom Militär fasziniert, bewirbt er sich an einer militärischen Vorbereitungsschule in Saloniki und besteht 1893 die Aufnahmeprüfung. Hier, so heißt es, habe er wegen seines mathematischen Talents den Beinamen Kemal (von arabisch kamāl: Reife, Vollkommenheit) von einem Lehrer erhalten. Von dort aus wechselt er auf eine höhere Militärschule. Am 13. März 1899 geht es weiter nach Istanbul auf die »Kriegsschule«. Im Anschluss daran folgt ab 1902 die Ausbildung an der Militärakademie der damaligen Hauptstadt. Die schließt er 1905 als Fünftbester mit dem Rang eines Generalstabsoffiziers ab. Anschließend tritt Mustafa Kemal in den Dienst der osmanischen Armee.
Zur damaligen Zeit sind Militärschulen Keimzellen des Patriotismus und des Liberalismus – was dem amtierenden Sultan Abdülhamid II. missfällt. Strikte Zensur ist fester Bestandteil seiner Herrschaft, Kritiker werden in die Verbannung geschickt, freies Denken ist unerwünscht. Der Herrscher regiert autokratisch, und beansprucht sowohl die weltliche Macht (Sultanat) als auch die geistliche Führerschaft (Kalifat). Auch ein 1877 eingesetztes Parlament ändert wenig an diesem Allmachtsanspruch. Der Sultan, damals noch ganz frisch im Amt, löst es bereits nach nur einem Jahr auf. Demokratische Hoffnungen keimen erst auf, als die revolutionären Jungtürken die Herrschaft übernehmen und das Parlament wieder einsetzen.
Die Revolutionäre
Die Jungtürken sind eine nationalistisch gesinnte Geheimgesellschaft. Zu ihnen gehört auch der junge Mustafa Kemal. Die Geheimbündler stören sich an der fortschreitenden Zerbröckelung des Reichs – die Schuld daran geben sie dem Sultan, wenn sie in konspirativen Zirkeln debattieren. Für den jungen Offizier Mustafa Kemal ist im Jahre 1907 der Sultan »eine hassenswerte Existenz«. Dieser dekadente Vertreter eines Herrscherhauses, das seinen goldene Ära längst hinter sich hat und international quasi ohne Einfluss ist, kann den gut ausgebildeten, aufstrebenden jungen Männern wenig entgegensetzen: 1908 ergreifen die Jungtürken mit ihrem »Komitee für Einheit und Fortschritt« die Macht.
Die Revolutionäre führten die konstitutionelle Monarchie ein, 1909 muss Sultan Abdülhamid II. den Thron an seinen Bruder Mehmet V. abgeben. An der Spitze der Revolutionäre gibt ab 1913 ein Triumvirat den Ton an: Ismail Enver, Ahmed Cemal und Mehmet Talât. Doch in den hinteren Reihen der Revolution steht schon ein von den Ideen der französischen Revolution beeindruckter Mann bereit. Der damals 27-jährige Offizier Mustafa Kemal hat nicht vor, in der Bedeutungslosigkeit zu verbleiben.
Abb. 1: Mustafa Kemal Atatürk – offizielles Bild des jungen Atatürk
Der Wunsch, eine historische Figur zu werden, begleitet den späteren Jungtürken Mustafa Kemal schon seit den Anfängen seiner Militärzeit, die er noch im Dienste des Sultans absolvierte. Dieser ausgeprägte Ehrgeiz ist auch einer der Gründe, die ihn zum jungtürkischen Revolutionär machten. Denn: im osmanischen Heer schien sein Übereifer eher hinderlich. Statt ins Zentrum der Macht, wurde der als zu ambitioniert geltende junge Mann von einem entlegenen Militärposten zum nächsten geschickt – bis sich der Enttäuschte schließlich der jungtürkischen Opposition unter Enver Pascha anschließt.
Nachdem dieses Engagement in der geheimen oppositionellen Jungtürkenbewegung auffliegt, wird Mustafa Kemal nach Syrien versetzt. Im dortigen Exil treibt er seine konspirativen Aktivitäten voran und gründet die Geheimorganisation »Vaterland und Freiheit«.
Zusätzlich fällt Mustafa Kemal auch durch militärisches Talent auf – und das legt schließlich den Grundstein für seinen Aufstieg in der Armee: Unter Beweis stellt er es beim Konflikt von Libyen und Italien (1911–1912), in dem die Osmanen auf der Seite der Italiener kämpfen. Auch während der Balkankriege (1912–1913) ist er im Einsatz und schließlich als Ende Oktober 1914 das zunächst neutrale Osmanische Reich auf der Seite der »Mittelmächte« Deutschland und Österreich-Ungarn in den Ersten Weltkrieg eintritt. Atatürk ist kommandierender Offizier der auf der Halbinsel Gallipoli westlich von Istanbul stationierten Truppen – eine entscheidende Station für die Zukunft Mustafa Kemals. Denn dort ereignet sich zwischen Februar 1915 und Januar 1916 die »Gallipoli-Schlacht«, die heute Teil des Gründungsmythos der modernen Türkei ist.
In dem Kampf gegen die Truppen der Entente um die strategisch wichtige Meerenge der Dardanellen gelingt es Kemals Truppen, die Angriffe einer Allianz aus französischen, britischen, neuseeländischen und australischen Truppen abzuwehren.
Der militärische Sieg verhilft dem 34-jährigen Kemal zum langersehnten Ruhm und ist das Sprungbrett für eine Karriere in der Politik. Den Türken gilt er seitdem als der »Retter von Istanbul«, er erhält den Ehrentitel Pascha. Auch außerhalb der Türkei ist sein Name nun erstmals zu hören. Nach der erfolgreichen Verteidigung der Dardanellen wird Mustafa Kemal zum General befördert, anschließend dient er im Kaukasus und in Syrien. Zudem hat der Einsatz einen weiteren Effekt: Während er siegreich bei Gallipoli kämpft, beteiligen sich andere Militärführer an einem Verbrechen unter Federführung des jungtürkischen »Komitees für Einheit und Fortschritt« – dem Völkermord an den Armeniern. Atatürk selbst bezeichnete diesen 1919 zwar als von den Jungtürken »begangene Katastrophe«, erkannte aber Zeit seines Lebens nie die Realität eines armenischen Völkermords an.
Generell erweist sich die Jungtürken-Regierung für die zahlreichen Minderheiten im Land als Katastrophe. 1915 beginnt sie mit der systematischen Vertreibung und Vernichtung der christlichen Minderheit der Armenier, die Ende des 19. Jahrhunderts im Osmanischen Reich rund zwei Millionen Angehörige zählt. Die Jungtürken misstrauen ihnen als potenziellen inneren Feinden, deren Loyalität im Krieg gegen das christliche Russland als zweifelhaft gilt. Den Vertreibungen und Ermordungen fallen nach unterschiedlichen Schätzungen 1915 und 1916 zwischen 200 000 und 1,5 Millionen Menschen zum Opfer. Viele Armenier werden gezwungen, zum Islam überzutreten.
Zu diesem Zeitpunkt gilt das einstige Weltreich schon lange als »kranker Mann«. An der inneren Stabilität nagen immer häufigere Autonomieforderungen der verschiedenen Nationalitäten, aus denen sich das Reich noch immer zusammensetzt – auch wenn dessen Fläche stark geschrumpft ist.
Vom europäischen Teil des osmanischen Herrschaftsgebietes ist nur ein schmaler Streifen geblieben. Er erstreckt sich von Albanien über Mazedonien bis Thrakien. Im Südosten sind noch der Irak, der Libanon, Palästina und Teile der arabischen Halbinsel unter osmanischer Verwaltung. Sie bilden den kläglichen Rest eines einst glanzvollen Imperiums, das zu seiner Blütezeit Mitte des 17. Jahrhunderts seine maximale Ausbreitung erreicht hatte. Die reichte von Ägypten, über weite Teile der Arabischen Halbinsel bis zum Jemen und an den Persischen Golf. In Europa waren die Osmanen einst bis Wien und an die polnische Grenze vorgedrungen.
Nun, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, bricht auch das Osmanische Reich zusammen. Weite Teile sind durch die Alliierten besetzt oder im Krieg verloren gegangen. Am 30. Oktober 1918 muss die Türkei die Kapitulation im Waffenstillstand von Mudros unterzeichnen – die Niederlage ist besiegelt. Im Pariser Vorort Sèvres teilen am 10. Oktober 1920 die Alliierten das geschlagene Imperium unter sich auf. Übrig bleiben nur fünfzehn Prozent seines einstigen Territoriums.
Für die Nationalisten, wie Mustafa Kemal, begeht der Sultan mit der Kapitulation einen unverzeihlichen Verrat. Als siegreicher General in einem besiegten Land beginnt er mit der Organisation des militärischen Widerstands. Endlich bietet sich für ihn die Gelegenheit, in die erste politische Reihe aufzurücken. Sein Befreiungskrieg richtet sich gegen die Besatzung durch alliierte Truppen, die Aufteilung des anatolischen Kernlandes und gegen den als Schmach empfundenen Vertrag von Sèvres 1920.
Am 19. Mai 1919 landet der General in Samsun an der Schwarzmeerküste und beginnt ohne Rücksicht auf die Befehle des Sultans das Volk um sich zu scharen – dieser Tag gilt als Beginn des Türkischen Befreiungskrieges. Er endet 1923 mit einem Sieg für die Türkei im Friedensvertrag von Lausanne, der den demütigenden Vertrag von Sèvres außer Kraft setzt. Die Alliierten ziehen ab, die Türkei in ihren heutigen Grenzen wird unabhängig und völkerrechtlich anerkannt. Der neue Friedensvertrag, in der Türkei als Sieg gefeiert, ist nicht für alle Bewohner des jungen Staates ein Grund zur Freude: Die größte Minderheit des Landes, die Kurden, geht darin leer aus. Während die Sieger des Ersten Weltkriegs im Friedensvertrag von Sèvres den Kurden noch einen eigenen Staat versprochen hatten, werden diese im neuen Vertrag nicht einmal erwähnt. Stattdessen werden ihre Siedlungsgebiete zwischen der Türkei, dem Irak, dem Iran und Syrien aufgeteilt.
Der Vertrag von Lausanne erschüttert das ethnische Mosaik des Osmanischen Reichs, zumal unmittelbar nach seiner Ratifizierung ein sogenannter »Bevölkerungsaustausch« zwischen Griechenland und der Türkei vereinbart wird. Den meist orthodoxen Christen des Landes wirft man vor, auf der Seite der Invasoren zu stehen. Rund 1,2 Millionen von ihnen müssen die Republik in Richtung Griechenland verlassen. Umgekehrt siedeln rund 400 000 Muslime zwangsweise von den ägäischen Inseln und Westthrakien in die Türkei um. Ihre Häuser werden konfisziert, sie dürfen nur mitnehmen, was sie tragen können.
Am 19. September 1923 gründet Atatürk seine »Volkspartei« (Halk Fırkası, HF), die am 10. November 1924 in »Republikanische Volkspartei« (Cumhuriyet Halk Fırkası, CHF) unbenannt wird und inzwischen Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, heißt. Ein Elitenprojekt, bestehend aus Militär- und Zivilbürokraten. Ihr erster Vorsitzender ist selbstverständlich Mustafa Kemal, der nun beginnt, die junge Republik nach seinen Vorstellungen zu formen. Eine Opposition gibt es nicht, Regierung und Partei bilden eine geschlossene Einheit, die wenig liberal herrscht. Fast alle Staatsbeamten sind Mitglieder der CHF (später CHP) und müssen deren Anordnungen Folge leisten.
Innere Modernisierung
Als Mustafa Kemal am 29. Oktober 1923 die neue Republik ausruft, wird er mit 42 Jahren deren erster Präsident – und leitet eine geistige, gesellschaftliche und politische Rundumerneuerung ein, die er der mehrheitlich agrarisch geprägten Gesellschaft rücksichtslos von oben verordnet. Diese Umbruchsphase wird bis in die Fünfzigerjahre dauern. Ziele der Reformen sind ein nationales Selbstbewusstsein und Fortschrittlichkeit: »Hierfür wird der Zeitmaßstab nicht nach den schlaffen Ansichten der Vergangenheit, sondern nach Ansichten der Geschwindigkeit und Bewegung unseres Jahrhunderts gesetzt«, erklärt Atatürk vor der Nationalversammlung. »Türkei, sei stolz, arbeite und habe Vertrauen«, impft er den Menschen ein. Mit dem Laizisten Atatürk gründet also ein ehemaliger Soldat die »neue Türkei«, der ehemalige Islamist Erdoğan wird später an seiner »neuen Türkei« bauen.
Der ideologische Bruch und die damit verbundene Abgrenzung vom historischen Ballast erschaffen neue Klassenverhältnisse. Die Spaltung zwischen »schwarzen Türken« (Siyah Türkler) und »weißen Türken« (Beyaz Türkler) – eine Definition, die erst in den Achtzigerjahren durch die Soziologin Nilüfer Göle geprägt wurde – wird unter Mustafa Kemal gefördert. Ein diskriminierendes System, welches erst durch Erdoğans Aufstieg endgültig abgeschafft wird: Zu den »weißen Türken« zählt die kemalistische Elite, die das Land über Jahrzehnte regiert, und ab der Republikgründung Militär, Justiz und Medien dominiert. Streng dem Säkularismus verpflichtet, behalten sich die »weißen Türken« vor, über das Zusammenleben und die Gestaltung der politisch-kulturellen-Strukturen zu entscheiden. Dabei schauen sie auf die »schwarzen Türken« herab. Diese sind arm, religiös-konservativ und ungebildet. Politische Teilhabe wird ihnen verweigert. »Schwarze Türken« durften die Häuser der »weißen Türken« putzen, ansonsten hatten sie darin nichts verloren. Diese von Atatürk begründete Gesellschaftsstruktur beginnt erst Jahrzehnte später zu bröckeln. Endgültig verschoben werden die Machtverhältnisse, als der »schwarze Türke« Erdoğan die Regierung 2003 übernimmt.
Diktierter Fortschritt
Mustafa Kemals Maßnahmen gehen als »kemalistische Reformen« in die Geschichte ein. Er setzt sie in den Anfangsjahren der Republik um, ohne sich um die Akzeptanz der Massen zu scheren. Sie umfassen auch die »Türkisierung« der Minderheiten: Das Osmanische Reich war multikonfessionell und multinational, und auch in der neuen Türkei leben Muslime, Christen und Juden, Türken, Griechen, Armenier, Araber, Kurden und Slawen. Im Vertrag von Lausanne werden zwar die Rechte von Nichtmuslimen garantiert, aber bis heute hat einer der Leitsätze Mustafa Kemals – »Ne mutlu Türküm diyene« (Glücklich derjenige, der sich als Türke bezeichnet) – seine Gültigkeit. Es gilt: Ein Volk, eine Sprache, eine Nation. Entsprechend wenig Platz ist für religiöse und ethnische Minderheiten. Mustafa Kemal möchte einen homogenen Nationalstaat nach europäischem Vorbild. Die Nationalversammlung definiert am 20. April 1924 in der republikanischen Verfassung den Begriff »Türke« so: »Die Einwohner der Türkei heißen ohne Ansehen der Religion und Rasse ›Türke‹ im Sinne der Staatsangehörigkeit.«
Atatürk verlangte der Gesellschaft mit seinen Reformen viel ab – zu viel. Er handelte schnell – zu schnell – und erntete dafür Respekt, gepaart mit Furcht. Die westliche Welt war das Ideal. Um die türkische Gesellschaft auf deren vermeintlich höheres Niveau zu heben, formte er das Land väterlich-bevormundend und in atemberaubendem Tempo um. Sein Weggefährte Ismet Inönü, der »Zweite Mann«, befand, das ganze Land sei ein Klassenzimmer und Atatürk der Oberlehrer. Atatürk selbst sagte: »Ich diktiere meinem Volk die Demokratie.«
Im Schnelldurchlauf
In keinem anderen sunnitisch-islamischen Land wurde je in so kurzer Zeit so stark mit Vergangenheit und Traditionen gebrochen, wie in Atatürks Türkei. Der muslimische Glauben gilt plötzlich als Hauptgrund für alle bisherigen Niederlagen und als Ursache für Rückständigkeit und Gehemmtheit. Geduldet wird Religiosität fortan nur noch im Privaten. Sein Credo auf dem Weg in die Moderne: »Der Islam gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Diese Gotteslehre eines unmoralischen Beduinen ist ein verwesender Kadaver, der unser Leben vergiftet.« Die arabischen Nachbarn betrachten die türkischen Brüder und Schwestern bald »als vom Glauben Abgefallene«. Denn für die gilt fortan die kemalistische Devise: »Die einzig wahre Rechtleitung im Leben ist die Wissenschaft.«
So werden Reformen umgesetzt, die bis heute einzigartig sind in der islamischen Welt. Zunächst einmal wird, um sich auch vom osmanischen Erbe zu distanzieren, Ankara zur Hauptstadt erklärt. Der erste Artikel der am 20. April 1924 verabschiedeten Verfassung des jungen Staates lautet: »Das Türkische Reich ist eine Republik«, die Große Türkische Nationalversammlung wurde als »alleiniger Vertreter des Volkes« bestimmt. Laut Atatürk hat sich die Regierung nur an der Verfassung und nicht an dem Koran zu orientieren.
Nachdem am 1. November 1922 gesetzlich schon das Sultanat (die weltliche Herrschaft des Sultans als Monarch) abgeschafft worden war, greift Kemal 1924 nach dem Herzstück des osmanischen Reichs, dem Kalifat, dem Anspruch auf die geistige Führerschaft der Muslime in der Tradition des Propheten. Denn: das »Kalifat ist ein Märchen der Vergangenheit, das in unserer Zeit keinen Platz mehr hat. Religion und Staat müssen getrennt werden«, erklärt Mustafa Kemal. Als am 3. März 1924 die Nationalversammlung verkündet, dass das Amt des Kalifen abgeschafft werde, bricht Atatürk mit einer fast 1300 Jahre alten Tradition – der Verbindung von weltlicher und geistlicher Macht des Staatsoberhauptes. Für den Staatsgründer gibt es nur »eine Zivilisation«, die des Westens.
Der letzte osmanische Kalif, Abdülmecid II. und alle Mitglieder der ehemaligen osmanischen Sultansfamilie werden ins europäische Exil geschickt. Im selben Jahr werden die Şeriatgerichte, die nach sunnitisch-islamischer Tradition Recht sprachen, aufgelöst – ebenso wie religiöse Stiftungen. Dafür entsteht die auch heute noch bestehende Religionsbehörde Diyanet (Diyanet İşleri Başkanlığı, Präsidium für Religionsangelegenheiten). Sie organisiert die Pilgerfahrt nach Mekka, ist zuständig für die Imame, die Religionsauslegung, das Theologiestudium und die Verwaltung der religiösen »Imam-Hatip-Schulen«. Ihr Vorsitzender ist die höchste religiöse Autorität im Staat. Für Atatürk dient die Diyanet vor allem dazu, den Glauben zu kontrollieren. Erdoğan wird später das Budget der Behörde erheblich ausweiten.
1924 stellt Mustafa Kemal alle Schulen unter staatliche Kontrolle. Im November 1925 werden die Derwischkloster, ihre Medressen und Orden als »Horte der Reaktion« geschlossen. Viele Symbole der – aus Sicht des Präsidenten – rückständigen islamischen Vergangenheit werden verbannt.
Wie verbissen der neue Staatschef gegen einzelne Elemente der Tradition vorgeht, zeigt die von ihm initiierte Hutrevolution, sie ist Teil seiner Kampagne, seinen Landsleuten »international übliche Bekleidung« zu verordnen. Darunter fällt auch der Fez, die traditionelle Kopfbedeckung, die Mustafa Kemal als »Zeichen der Unwissenheit« schmäht. Weil die Türken den Fez mit dem Islam, den westlichen Hut dagegen mit dem Christentum verbinden, fällt ihnen die geforderte Umstellung nicht leicht. Am 25. November 1925 wird das »Gesetz über das Tragen von Hüten« (Şapka Kanunu) verabschiedet, welches das Tragen des Fez verbietet. Beamten werden Frack und Zylinder für offizielle Festlichkeiten vorgeschrieben, zudem befiehlt ihnen Atatürk, sich mit ihren Frauen auf Bällen zu amüsieren.
Atatürks Frauenbild: Erfolgreich, selbstbewusst, unverschleiert
Nach den Kopfbedeckungen der Männer sind die Schleier der Frauen an der Reihe, wobei Mustafa Kemal weniger drastisch vorgeht. Zwar galt ihm der Schleier als ein Symbol der weiblichen Unterdrückung. Ein radikaler Angriff auf die »Ehre« der Frau hätte jedoch einiges an sozialem Konfliktpotenzial mit sich gebracht und wurde deswegen nicht gesetzlich verankert.
Der Zwang zum Schleier und zu einem Ganzkörperumhang für Musliminnen wird zwar aufgehoben und in einer Kleiderverordnung festgehalten, dass Beamtinnen und Angestellte des öffentlichen Dienstes während der Dienstzeit mit unbedecktem Haar erscheinen sollten. Aber das berüchtigte Kopftuchverbot in Bildungseinrichtungen wird erst 1982 von den Militärs eingeführt. Kemal versucht es mit Ansprachen, in denen er an die Fortschrittlichkeit seiner Landsleute appelliert, so etwa 1925: »An manchem Ort sehe ich Frauen, die über ihren Kopf ein Hals- oder Badetuch oder etwas Ähnliches werfen und ihren Kopf von an ihnen vorbeigehenden Männern abwenden oder sich mit geschlossenen Augen hinsetzen. (…) Meine Herren, darf die Mutter, die Tochter einer zivilisierten Nation sich in eine solch barbarische Haltung begeben? Das ist ein Anblick, der die Nation äußerst lächerlich erscheinen lässt.«2 Rund neunzig Jahre später, im Juli 2014, fordert Erdoğans Stellvertreter Bülent Arınç, Frauen sollten sich »schamhafter« zeigen. »Wo sind unsere Mädchen, die leicht erröten, ihren Kopf senken und die Augen abwenden, wenn wir in ihre Gesichter schauen, und somit zu einem Symbol der Keuschheit werden?«, fragt Arınç.
Die »neue Türkei« ist für Mustafa Kemal nicht vorstellbar ohne starke Frauen. So werden 1926, angelehnt an das Vorbild Italiens und der Schweiz, ein neues Zivil- und Strafrecht eingeführt, und die rechtliche Gleichstellung der Frau durch die Übernahme des schweizerischen Zivilrechts und des italienischen Strafrechts in Angriff genommen. Bis dahin wurden Frauen nicht als vollwertige Rechtsperson anerkannt, ein Mann durfte mehrere Frauen heiraten, und nur der Mann durfte sich scheiden lassen. Natürlich hatte er auch mehr Rechte, was die Kinder, das Eigentum und das Erbrecht betraf.
Es werden die Polygamie und das Verstoßen von Ehefrauen verboten und durch die Zivilehe, gleichberechtigte Ehescheidung und formale Gleichberechtigung von Mann und Frau abgelöst. Muslimische Frauen erhalten das Recht, Nichtmuslime zu heiraten. Der Mann gilt fortan nicht mehr als das Oberhaupt der Familie und darf auch nicht mehr alleine den Wohnsitz der Familie festlegen. Zudem brauchen Frauen keine Zustimmung des Ehemannes mehr, wenn sie arbeiten gehen wollen. Das Heiratsalter wird auf achtzehn Jahre festgelegt, bei Sorgerechtsstreitigkeiten hat nicht mehr automatisch der Mann das letzte Wort. 1934 wird das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt – fünfzehn Jahre später als in Deutschland, aber elf Jahre vor Frankreich, der Wiege von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ein Jahr später dürfen Frauen auch in die Nationalversammlung einziehen.
Im Privaten lebt Mustafa Kemal allerdings die Gleichberechtigung bei weitem nicht so, wie er sie öffentlich propagiert. Zwar adoptiert er, der nie leibliche Kinder hatte, acht Töchter. Von seiner Ehefrau Latife Uşşaki, einer Juristin und modernen First Lady nach europäischem Vorbild, trennt er sich nach nur einem Jahr Ehe – die standesamtlich geschlossen worden war. Die Scheidung vollzieht er 1924 nach islamischen Recht – durch eine schriftliche Kündigung seinerseits. Und: auch wenn die neuen Gleichstellungsgesetze zweifelsohne fortschrittlich sind, entsprechen sie längst nicht überall der Realität. Vielerorts bestimmt weiterhin das patriarchalische Gesellschaftsideal von der Hausfrau und Mutter den Alltag. Und der Weg zur vollkommen Gleichberechtigung ist bis heute nicht zu Ende: Erst 1990 wurde der Zivilrechtsartikel für verfassungswidrig erklärt, der dem Ehemann das Recht auf Einspruch bei der Berufsausübung seiner Partnerin gestattete.
Die forschen Vorstöße des Staatsoberhauptes erschüttern die weitgehend ländliche und von religiösen Werten geprägte Gesellschaft. Seine teils mit Brutalität durchgepeitschten Reformen traumatisieren diese Gesellschaft teils regelrecht. Kemal hat für seine Reformen auch deshalb freie Bahn, weil es auch nach den Anfangsjahren keine politische Opposition gibt, die seine Politik hätte hinterfragen können. Selbst Gewerkschaften sind verboten. Als im Juni 1926 in Izmir ein Attentatsversuch gegen den Präsidenten auffliegt, der als »Verschwörung von Smyrna« bekannt wird, nutzte er dies politisch aus. Er beginnt, das Bild einer inneren und äußeren Bedrohung für die Türkei zu inszenieren. Ein Instrument, dessen sich auch Erdoğan Jahrzehnte später bedienen wird. Einige der Verschwörer – ehemalige Jungtürken von »Union und Fortschritt« – enden nach einem Schauprozess vor einem Sondergericht am Galgen.
Alle Wege führen nach Westen
Der strikte Westkurs wird fortgesetzt, der Islam noch radikaler verbannt. Stand in der Verfassung von 1924 noch in Artikel 2: »Die Religion des türkischen Staates ist der Islam«, so wird dieser Passus im April 1928 gestrichen. Keine Regierung nach Atatürk hat diese Entscheidung bisher zurückgenommen. Am 8. April beschließt die Nationalversammlung die Trennung von Religion und Staat, seitdem ist die Türkei das einzige islamische Land mit einem säkularen System – bis heute. Vorbild ist Frankreich, das 1905 als erstes Land der Welt die Laïcité in der Verfassung verankerte. Ebenfalls 1928 lässt er die islamische Freitagspredigt auf Türkisch statt wie vorher üblich auf Arabisch sprechen.
Auch andere gesellschaftliche Bereiche nimmt er ins Visier: Eine Bildungsreform unterstellt alle Ausbildungs- und wissenschaftlichen Institutionen dem Bildungsministerium. Ab dem 1. Januar 1926 gelten der gregorianische Kalender und die Uhrzeitreform. Nach der alten Uhrzeit mussten sich die Menschen immer nach der Sonne richten. 1928 werden die internationalen Zahlen eingeführt, das osmanische Türkisch wird verbannt. Zudem ist es nun verboten, Arabisch zu lesen und zu lehren.
Die arabische Schrift wird im Alltag abgeschafft, fortan wird in lateinischen Buchstaben geschrieben. Eine Expertenkommission empfiehlt die Umsetzung dieser Reform binnen weniger Jahre. Soviel Geduld hat Mustafa Kemal nicht, stattdessen müssen die Türken rasch die neue Schriftsprache lernen, denn das Arabische verschwindet aus dem öffentlichen Raum. Wer das lateinische Alphabet nicht beherrscht, kann plötzlich weder Schilder noch Zeitungen oder Behördenschreiben lesen, die die neuen »türkischen Buchstaben« verwenden müssen. Journalisten und Beamte bekommen drei Monate Zeit, die neue Schrift zu lernen. Wer durch die dann folgende Prüfung fällt, verliert seine Arbeit. Atatürks volkserzieherischen Autokratismus sollte auch Erdoğan übernehmen. Auch neue Münzen und Geldscheine werden geprägt und gedruckt.
Der ideologische Überbau der von oben diktierten Revolution entsteht auf dem CHP-Parteitag zwischen dem 10. und 18. Mai 1931: Als »Sechs Pfeile« des Kemalismus (Altı Ok) gehen die sechs Prinzipien – Etatismus, Revolutionismus, Republikanismus, Populismus, Nationalismus und Säkularismus – in das Parteiprogramm ein. Sie gelten bis heute, und noch immer zieren sechs weiße Pfeile das rote CHP-Emblem. Ein sichtbarer Geburtsfehler der Republik, denn die Demokratie wird nicht erwähnt. Der Laizismus grenzt die frommen Muslime aus, der ethnische Nationalismus verbannt Minderheiten wie die Kurden.
Ein Gesetz vom 21. Juni 1934 zwingt die Türken, sich einen Familiennamen zuzulegen. Ausgeschlossen sind ausländische, lächerliche und sittenwidrige Namen und Namen, die einen militärischen Rang bezeichnen. Weil auch dies innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden musste, lassen sich viele Überforderte einfach einen Namen vom zuständigen Beamten geben. Mustafa Kemal bekommt den Beinamen Atatürk (»Vater der Türken«) zugesprochen, ein Ehrentitel, der bis heute nur ihm zusteht.
Die Übernahme des westlichen Gesellschaftsmodells geht weiter, statt dem Freitag wird der Sonntag zum Ruhetag. Geistliche dürfen ihre traditionelle Kleidung nur noch während der Ausübung ihrer Arbeit tragen. Am 5. Februar 1937 wird schließlich das Prinzip des Laizismus in die Verfassung aufgenommen. Dabei versteht sich Atatürk perfekt auf die Selbstinszenierung: Legendär ist bis heute seine Marathonrede, die er zwischen dem 15. und 20. Oktober 1927 zum vierten Republikjubiläum hält. In der 36-stündigen »Nutuk« (Rede) erzählte er, in einen Frack gekleidet, über sechs Tage verteilt sein eigenes Epos. 900 Seiten umfasst das historische Dokument dieses Auftritts, in dem er die Geschichte der Türkei zwischen 1919 und 1926 darstellte.
Das Ende des »Vaters der Türken«
Atatürks letzte Jahre sind geprägt von Krankheit, zeitweise fällt er ins Koma. Er stirbt mit nur 57 Jahren am 10. November 1938 um 9.05 Uhr im pompösen Dolmabahçe-Palast in Istanbul. Gemunkelt wird, sein ausgiebiger Rakikonsum habe zu seinem frühen Ende geführt. Kurz nach seinem Tod wurde er zum »Ewigen Anführer« (Ebedi Şef) seiner Partei, der »Kemalismus« (Atatürkçülük) zur Staatsideologie ernannt.
»Das Herz des Landes ist stehen geblieben«, schreiben die Zeitungen. Millionen Türken gehen auf die Straßen, um dem verstorbenen Feldherr, Gründer der jungen Republik und ihrem Präsidenten das letzte Geleit zu geben.
Doch der physische Tod Atatürks ist nicht das Ende des Personenkultes, der schon zu Lebzeiten begonnen hatte. Noch während er das Land umkrempelte, entstanden landesweit Atatürk-Denkmäler. Bis zur Republikgründung hatte es kaum Standbilder oder Büsten Herrschender oder historischer Figuren, gegeben. Mit Atatürk aber änderte sich dies. Plötzlich wetteiferte jede Gemeinde darum, das schönste Denkmal des Politikers zu errichten. Am 8. August 1928 wird das Atatürk-Denkmal am Istanbuler Taksim-Platz eingeweiht, wo Erdoğan mehrfach den erfolglosen Versuch unternahm, eine osmanische Kaserne nachbauen zu lassen oder gar eine Moschee zu platzieren.
Atatürks Vermächtnis
Bis heute ist die Verehrung für den Republikgründer ungebrochen. Sein Geburtshaus im griechischen Thessaloniki wurde originalgetreu in Ankara nachgebaut, um Atatürk-Fans die Wallfahrt zu erleichtern. Schon Grundschulkinder müssen seine Ideologie verinnerlichen. In jedem Schulbuch sind die Nationalhymne, der İstiklâl Marşı (Freiheits- bzw. Unabhängigkeitsmarsch), ein Atatürk-Porträt und dessen berühmte »Rede an die Jugend« vom 20. Oktober 1927 abgedruckt. Darin fordert er die Jungen auf: »Es ist stets deine erste Aufgabe, die türkische Unabhängigkeit und die türkische Republik bis in alle Ewigkeit zu schützen und zu verteidigen.«
Auf jedem Schulhof steht eine Atatürk-Büste. Jedes Jahr am 10. September um 9.05 Uhr legen die Türken eine Schweigeminute ein. Überall sind Sirenen zu hören, alle halten inne, der Verkehr steht still. Die Türkei müsse man sich vorstellen wie einen Baum, mit Wurzeln und Ästen in viele Richtungen, schrieb einmal der britische »Economist«. Atatürk sei der Mann, der diesen Baum gepflanzt, aufgezogen und gestutzt habe.
Dafür, dass das Andenken an den Republikgründer unbeschädigt bleibt, sorgt das Gesetz Nummer 5816 des türkischen Strafgesetzbuches. Jedem, der es wagt, den »Vater der Türken« zu kritisieren oder zu beleidigen, droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe: Als 2004 ein türkischer Journalist die unwahre Behauptung aufstellt, Atatürk sei ohne religiöses Gebet beerdigt worden, wird er zu fünfzehn Monaten Haft verurteilt, trotz öffentlicher Entschuldigung. Nur einer wagt es, den Republikgründer öffentlich zu diskreditieren: Erdoğan nennt Atatürk 2013 einen »Säufer«. Auch wenn er dessen Namen nicht erwähnt, ist der Bezug klar. Konsequenzen: keine.
Der stellenweise schon manische Personenkult um Atatürk wird jedoch nicht nur von der AKP-Regierung mehr oder weniger durch Zwang hochgehalten, sondern gleichzeitig vor allem in AKP-kritischen Kreisen gepflegt. Wer heute in der Türkei eine türkische Flagge mit dem Atatürk-Konterfei aus seinem Fenster hängen lässt, grenzt sich damit von Erdoğan ab. Der Kemalismus erscheint wie die einzige Rettung vor dem freiheitsraubenden konservativen islamisch-geprägten Weg, für den Erdoğan steht. Atatürk wird zum Helden einer Nation, die Erdoğan so nicht mehr haben will.
Zweifelsohne hat die Gesellschaft dank Atatürks reformerischem Heißhunger spektakuläre Fortschritte gemacht. Doch war er eben nicht nur, wie die türkische Geschichtsschreibung betont, ein genialer Visionär, sondern auch ein aufgeklärter Despot. Natürlich war er ein Erneuerer, aber kein Demokrat. Er herrschte totalitär und duldete keinen Widerspruch – Parallelen, die sich später auch durch Erdoğans Politikstil ziehen sollten.
Dass unter Atatürk Minderheiten wie Kurden, Griechen oder Armenier zu einem ungeliebten Fremdkörper degradiert wurden, dass er seine Gegner erhängen ließ, dass die Reformen von ihm rücksichtslos durchgedrückt wurden, und dass er ein Alkoholproblem hatte, darüber wird in der Türkei oft hinweggesehen.
Seit dem 10. November 1953 ruht Atatürk in einem Mausoleum, das die Ausmaße einer Kleinstadt hat. Millionen Türken pilgern jährlich zu dem gigantischen Bau namens »Anıtkabir« auf einem Hügel am Rande von Ankara. In der monumentalen Säulenhalle sind in einem Museum mit lebensgroßen Figuren die wichtigsten Schlachten Atatürks nachgebaut. Eine Atatürk-Wachsfigur ist zu bewundern – ebenso seine vollständige Garderobe. Im September 2015 wird in der Hauptstadt ein Gebäude mit noch gigantischeren Ausmaßen für ein neues Staatsoberhaupt eingeweiht: Der Ak Saray (weißer Palast), der neue Amtssitz Erdoğans, der kurz zuvor zum Präsidenten gewählt wurde. Mit rund 1100 Zimmern ist er rund zwanzigmal größer als der Pariser Élysée-Palast.
Einen Tag nach Atatürks Tod wird in Ankara Inönü zu Atatürks Nachfolger gewählt. Die Amtszeit des zweiten Präsidenten der Republik ist vor allem geprägt durch das Ende des Zweiten Weltkriegs und die fortgeführte Diskriminierung von Nichtmuslimen und Nichttürken. So werden 1942 die Varlık Vergisi – eine »Vermögenssteuer« – für diese Gruppen eingeführt, mit der unter anderem Geld für die Kriegsausgaben herangeschafft werden soll, aber vor allem eine nationale Homogenisierung vorangetrieben wird. Diese Zwangsabgabe wird zwar zwei Jahre später wieder gestrichen, aber während dieser Zeit wird die Steuer gewaltsam eingetrieben, wer sie nicht zahlen kann oder will, wird in Viehwaggons deportiert.
Obwohl der neue Staat 1923 die Rechte der christlichen Minderheiten – mehrheitlich Griechen und Armenier – völkerrechtlich garantiert, werden diese Minderheitenrechte im Alltag nicht umgesetzt. Der Staat impft dem Volk den Nationalismus ein, das Türkentum wird grotesk überhöht, es wird drohend wiederholt, dass jeder, der in der Türkei lebe, ein Türke sei – Töne, die Erdoğan auch übernehmen wird.
Inönü genehmigt erstmals eine Oppositionspartei. Zwar hatte Atatürk bereits 1924 und 1930 die Gründung einer Oppositionspartei zugelassen, um den Meinungsaustausch in der Politik anzuschieben und sich der Illusion seiner westlichen Demokratievorstellung kurzzeitig hinzugeben. Doch die »Republikanische Fortschrittspartei« (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, TCF) überlebt nur ein Jahr, und weil die »Freie Republikanische Partei« (Serbest Cumhûriyet Fırkası, SCF) bei den Kommunalwahlen beachtliche Erfolge erzielt, wird das Demokratie-Experiment schon nach drei Monaten wieder beendet. Erst neun Jahre später wird auf dem fünften Parteikongress der CHP die Zulassung von Oppositionsparteien beschlossen, um Parlamentsdebatten zu stimulieren. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verzögert sich jedoch die Öffnung hin zum Mehrparteiensystem.
Am 19. Mai 1945 kündigt Staatspräsident Inönü ein Mehrparteiensystem an. Denn im Land werden immer wieder Stimmen laut, die Kritik an der kemalistischen Elitenregierung wagen und die strenge Verbannung des Glaubens aus der Öffentlichkeit nicht hinnehmen wollen.
Einstige Weggefährten Atatürks ergreifen die Gunst der Stunde, und verlassen die CHP, um in die Opposition zu gehen. Zu ihnen gehören etwa Celâl Bayar, von 1937 bis 1939 Ministerpräsident, und Adnan Menderes. Beide gründen im Januar 1946 zusammen mit anderen Dissidenten aus der CHP die »Demokratische Partei« (Demokrat Parti, DP), eine konservative Partei, die zu einem Sammelbecken unzufriedener Kleinbürger wird. Zudem fordert die DP die Liberalisierung der Wirtschaft und des politischen, gesellschaftlichen und religiösen Systems. Einiges an der DP erinnerte später auch an die AKP.
Die DP wendet sich bei den Parlamentswahlen speziell an die Landbevölkerung und vermarktet sich als Sprachrohr der Massen, die von den Sozialdemokraten nicht vertreten werden würden. Die DP betrachtet sich als »Anti-Establishment-Bewegung«, kann aber mit dieser Haltung bei den Wahlen im Juli 1946 nicht gewinnen.
Doch die CHP bleibt in ihrem starren kemalistischen Korsett stecken. Die DP schafft es in den Folgejahren hingegen, sich als populistische Bauernpartei zu etablieren. So gelingt es schon bei den darauffolgenden Parlamentswahlen am 14. Mai 1950 der Opposition, nach 27 Jahren die Herrschaft der CHP zu beenden. Der Parteivorsitzende Menderes tritt mit dem Wahlslogan auf »Es reicht, das Wort hat nun das Volk« und holte rund 55,2 Prozent der Stimmen.
Damit endet das Diktat der CHP, die mit 39,6 Prozent auf die Oppositionsbank verbannt wurde, und es begann die zweite Periode der Republik. Bayar wurde Staatspräsident und ernannte Menderes zum Ministerpräsidenten. Das Tandem Bayar – Menderes sollte für die nächsten zehn Jahre die Geschicke des Landes lenken.
Der 1899 geborene Menderes gilt als erster »islamischer« Ministerpräsident der Republik. »Wir haben unsere bis jetzt unterdrückte Religion von der Unterdrückung befreit«, verkündete der neue Regierungschef dem Volk. Als erster frei gewählter Premier machte Menderes zunächst einmal einige der laizistischen Reformen rückgängig. Der »Ezan«, der Aufruf zum Gebet, durfte wieder auf Arabisch gesprochen werden. Es wurden der Moscheebau und die Gründung der religiösen Prediger- und Vorbetergymnasien gefördert, der Islam wurde von dem bekennenden Muslim Menderes ins politische Tagesgeschäft eingebracht. »Wir haben unsere bis jetzt unterdrückte Religion von der Unterdrückung befreit. Ohne das Geschrei der besessenen Reformisten zu beachten, haben wir den Gebetsruf wieder auf das Arabische umgestellt, den Religionsunterricht an den Schulen eingeführt und im Radio die Rezitation des Koran zugelassen. Der türkische Staat ist muslimisch und wird muslimisch bleiben«, so Menderes.
Als Begründung, warum der Gebetsruf wieder auf Arabisch erklingt, wird gesagt, es werde ja auch auf Arabisch in der Moschee gebetet. Derwischorden werden wieder zugelassen. Die von der Atatürk-Regierung ins Leben gerufenen Dorfinstitute und Volkshäuser – die die Funktion hatten, gute Nachrichten der Partei unter die Menschen zu bringen – werden abgeschafft
Der Regierungswechsel, der auch als »weiße Revolution« bezeichnet wird, begann hoffnungsvoll, die DP konzentrierte sich auf die Modernisierung des Agrarsektors und die Liberalisierung der Wirtschaft. So werden heute diese Jahre auch die »goldenen Menderes-Jahre« genannt. Menderes regierte durchgehend bis zu seinem Tod, nur Erdoğan sollte eine solch lange Regierungszeit als Ministerpräsident Jahrzehnte später schaffen.
Der Aufstieg von Menderes, und später von Süleyman Demirel, symbolisierte die Verlagerung des politischen Gewichts weg von der elitären Minderheit, hin zu der mittellosen Mehrheit, dem Bürgertum und den ländlichen Schichten. Diese Karrieren wurden aber in den nächsten Jahrzehnten immer wieder von Militärs gewaltsam gestoppt. Erdoğan sollte es als erster schaffen, die Militärs zu entmachten. Der Politiker wird einen Klassenkampf ausfechten, der das Land so tiefgreifend verändert, wie seit Atatürks Tagen kein Wandel mehr stattgefunden hat. Erdoğan wird, das ist schon jetzt absehbar, als der erste türkische charismatische Staatslenker nach Atatürk eingehen.
1 Kreiser, Klaus: Atatürk. Eine Biographie, München 2008, 27
2 Ebd., 261
Eine türkische Kindheit
»Islamist«, »Faschist«, »Autokrat«: Als Erdoğan am 28. August 2014 zum Präsidenten gewählt wird, sind seine Gegner außer sich. Nun trete der türkische Albtraum ein. »Führer«, »Vater«, »Demokrat«: Für seine Anhänger hingegen ist dieser Spätsommertag ein Wunder. Ihr Mann, der sich gegen alles und jeden durchgesetzt hatte, ist endlich am Ziel, und nun steht er auf dem Balkon der AKP-Zentrale in Ankara, um mit ihnen diesen Triumph zu feiern. »Im Namen der Türkei und unserer Nation erfahren wir einen frohen Beginn«, beginnt der Noch-Ministerpräsident, aber zukünftige zwölfte Staatspräsident der Türkei seine Rede, neben ihm steht seine lächelnde Ehefrau Emine. Polarisierung ist noch ein viel zu schwaches Wort, um die Reaktionen auf seine Person zu beschreiben. Selbst ausgeglichenen Türken geht jegliche Diplomatie verloren, wenn es um Erdoğan geht – er wird gehasst oder geliebt.
Erdoğan, groß, athletisch, kurze Haare, Schnauzbart, der Charismatiker mit den haselnussbraunen Augen, hat in den vergangenen Jahren immer verbissenere Züge entwickelt und höchst selten öffentlich Freude gezeigt. An diesem milden Abend ringt er sichtlich um Fassung – so bedeutsam ist der Moment. Er ist gerührt und zufrieden mit dem Wahlergebnis, mit seinem Volk. Diese Wahl sei ein »Meilenstein für die Türkei«, eine »Wiedergeburt aus der Asche«, sagt er und verspricht, der Präsident aller Türken zu sein und »nicht nur jener, die mich gewählt haben. Ich werde ein Präsident sein, der für die Fahne, für das Land, für das Volk arbeitet.« Tausende Anhänger zu seinen Füßen jubeln, blicken begeistert nach oben und strecken ihm ekstatisch die Hände entgegen.
Seine Worte klingen fast schon wie eine Friedenserklärung. Denn als er vom Balkon herab eine neue Ära verspricht, steht es schlecht um das Land: Rund ein Jahr zuvor, im Sommer 2013, ließ Erdoğan als Ministerpräsident die Gezi-Proteste niederschlagen, ein gewaltiger Korruptionsskandal erschütterte kurz darauf seine Macht, beim größten Bergwerksunglück in der Geschichte des Landes am 13. Mai 2014 waren 301 Kumpel ums Leben gekommen, und noch im Spätsommer waren die Kurden landesweit auf die Straßen gegangen, weil die nordsyrische Stadt Kobanê vom »Islamischen Staat« überrannt wurde und Erdoğan deren kurdische Verteidiger mit den Dschihadisten gleichsetzte.
Dennoch steht er jetzt hier als Sieger. Seinen Weg nach oben konnte keine der Krisen stoppen. Erdoğan hatte elf Jahre lang das Amt des Ministerpräsidenten bekleidet, und nach jeder der drei in Folge gewonnenen Parlamentswahlen war er vor sein Volk getreten, um zu ihm zu sprechen. Doch diese Ansprache war etwas ganz Besonderes: Jetzt ist Erdoğan mit 51,8 Prozent der Stimmen der erste direkt vom Volk gewählte Präsident der Türkei. Noch dazu hat er den Wahlsieg mit absoluter Mehrheit bereits in der ersten Runde errungen.
Der in vielen Teilen der Welt als autoritär, unbeherrscht und unkontrollierbar geltende Volkstribun hat alle seine Gegner abgehängt. In diesem Moment muss er niemandem mehr etwas beweisen, er hat seinen langen Marsch beendet und den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Doch das ungetrübte Glück währt nur kurz, denn den salbungsvollen Worten folgt rasch der Absturz in die Realität der Politik eines Landes, die seit 2003 von dem verbissenen Machtmenschen bestimmt worden war.
Das Schweigen des Präsidenten
Bereits wenige Monate später ist der Nimbus der Unbesiegbarkeit und der Friedensvisionen dahin, und Erdoğan ist wieder derjenige, der durch Drohungen, Diskreditierung und Demütigungen Politik macht – ein Mann, dem es trotz höchsten Staatsamtes schlichtweg an Gravitas fehlt. Am 7. Juni 2015 warten die Türken vergebens auf eine Balkonrede. Diesmal gibt es keinen großen Auftritt, es gibt überhaupt keinen Auftritt. Was war passiert?
Erdoğan, der sich nicht mit den laut Verfassung vorgeschriebenen repräsentativen Aufgaben seines Amtes begnügen kann, wollte ein Präsidialsystem nach amerikanischem oder französischem Vorbild einführen und damit seine Befugnisse ausbauen. Doch um dafür die Verfassung zu ändern, brauchte die von ihm 2001 mitgegründete Regierungspartei AKP eine Zweidrittelmehrheit.
Hinter ihm liegt ein Marathon. Wochenlang ist er vor den Parlamentswahlen als oberster Wahlkämpfer durch die Lande gezogen. Bei seinen Auftritten wedelte er mit dem Koran in der Hand, als sei dieser eine Parteibroschüre. Der Dauereinsatz ist ihm deutlich anzumerken: Manchmal ist er so heiser, dass er je nach Tagesform entweder ins Mikrofon krächzt oder mit einer Stimme brüllt, die an eine Comicfigur erinnert. Die Spötter in den sozialen Netzwerken vergleichen ihn mit Micky Maus. Dass er mit diesem Wahlkampf gegen die Verfassung verstieß, interessierte ihn nicht. Denn: sein Volk brauchte jetzt einen starken Führer – ihn, Recep Tayyip Erdoğan.
Nun jedoch, an diesem 7. Juni 2015, ist der sonst so unermüdliche Redner verstummt, weil das Drehbuch eine unerwartete Wendung genommen hat. Erdoğans AKP, die seit 2002 ununterbrochen die absolute Mehrheit im Parlament hält, muss erstmals einen herben Verlust hinnehmen: Die Wähler haben sich bei diesen Parlamentswahlen gegen Erdoğans Alleinherrschaft entschieden. Nur 40,9 Prozent von ihnen haben der AKP ihre Stimmen gegeben. Und damit nicht genug: Mit einem ebenso überraschenden wie sensationellen Ergebnis von 13,1 Prozent hat die prokurdische HDP die Allmachtsfantasien Erdoğans zerstört. Die Verachtung seiner Gegner lässt nicht lange auf sich warten. Die linke Zeitung »Bir Gün« zeigt am Tag nach den Wahlen ein Foto der Gezi-Proteste vom Sommer 2013 und titelt: »Wir sind auf dem Balkon gewesen, aber warum haben wir dich nicht gesehen, Väterchen«.
Dass die AKP die stärkste politische Kraft bleibt, ist kein Trost, denn nach mehr als zwölf Jahren an der Macht kann die AKP aus eigener Kraft nicht mehr weiterregieren. So verzichtet Erdoğan nicht nur auf seine traditionelle Balkonrede, sondern vermeidet für ein paar Tage lang jedes laute Wort. Die Öffentlichkeit, allen voran die Journalisten, beginnen sich zu fragen, wie lange der Vollblutredner das durchhalten kann. Im Internet taucht eine Seite mit einer Stoppuhr auf, die die Erdoğan-freie Zeit zählt. »Das ist das Ende der Ära Erdoğan«, sagt der Historiker Ahmet Insel auf dem Sender CNN-Türk. Er irrt sich. Es ist ein Neuanfang.
Die Enge von Kasımpaşa
Wer nach Erklärungen für den Kampfgeist Erdoğans sucht, wird im Istanbuler Stadtviertel Kasımpaşa fündig. Hier liegen seine Wurzeln, hier verlebt er die erste Phase seines Lebens. Denn Erdoğan wächst in einem von islamischer Frömmigkeit geprägten Milieu auf, an das nur die ihm Zugehörigen glauben, nicht die Außenstehenden. Die schauen auf die einfachen Menschen von dort herab. Sein Vater muss die Familie mit harter Arbeit durchbringen, viel Geld hatten die Erdoğans nicht. Wer wissen will, von wo aus Erdoğans Aufstieg begann, der muss zurück in die stinkenden Straßen und Gassen von Kasımpaşa. Die Rolle des Durchbeißers im Kampf gegen die Elite liegt ihm schon von seiner Biografie her.
Das Viertel liegt nur wenige Gehminuten von der imposanten İstiklâl Caddesi (»Unabhängigkeitsstraße«) entfernt. Die berühmte Flaniermeile auf der europäischen Seite Istanbuls ist vergleichbar mit dem Berliner Kurfürstendamm – ein Geschäft reiht sich ans nächste, Einheimische und Touristen aus aller Welt strömen bis spät in die Nacht hinein diese Einkaufsmeile entlang, in deren Seitenstraßen sich Hunderte Kneipen, Discotheken und Restaurants befinden. Die historische Straßenbahn, die entlang der İstiklâl den Taksim-Platz mit der Zahnradbahn »Tünel« verbindet, ist in jedem Reiseführer abgebildet. Will man vom republikanischen Symbol »Taksim-Platz«, der das nördliche Ende der İstiklâl markiert, nach Kasımpaşa laufen, durchquert man dabei ein Potpourri türkischer Identitäten. Über die von westlichen Ketten geprägte Wegstrecke geht es vorbei an den Geschäften der griechischen Minderheit, an pittoresken Jugendstilgebäuden, vorbei an den vornehmen Galerien und Clubs von Pera und schließlich durch den ebenfalls im Stadtteil Beyoğlu liegenden schrillen Heterosexuellen-, Schwulen- und Transvestitenstrich.
Kasımpaşa liegt direkt am Goldenen Horn, dem Meeresarm, der Beyoğlu im Norden von der historischen Altstadt trennt. Ausgerechnet von hier aus – dem sogenannten »Tal der Quellen« – begann 1493 die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, die das Ende des Byzantinischen Reichs einläutete. Fast 500 Jahre später, am 26. Februar 1954 wird hier in einem Holzhaus der heute mächtigste Mann der Türkei geboren. Das Heim seiner Familie hat zwei Zimmer und knarzende Dielen. Später überlässt Erdoğans Vater das Haus einem Bauunternehmer – dafür erhält die Familie zwei Stockwerke des Neubaus. Tayyip ist das jüngste von fünf Geschwistern, seine Geschwister verkaufen diese Wohnung erst Anfang der Neunzigerjahre.
Die Verhältnisse in Kasımpaşa, in die Recep hineingeboren wird, sind ärmlich und konservativ – und wirken im Vergleich zu den räumlich nahen Touristenmagneten wie eine andere Welt. Reisende verirren sich so gut wie nie in diese Straßen – und umgekehrt schaffen es die Einwohner Kasımpaşas in der Regel auch mit schwerer Arbeit nicht, ihren widrigen Umständen zu entkommen. Erdoğan wächst mit dem Gestank der damals weitgehend ungepflasterten Straßen auf, auf denen häufig Müll vor sich hin verrottet. Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung sind keine Seltenheit. Rundherum befinden sich besonders viele Geschäfte, die Möbel und Innendekoration verkaufen. Neben alten Holzhäusern stehen neue Wohnhäuser, Wäscheleinen werden von einem Haus zum nächsten herübergespannt, sodass die Kleidung der Anwohner über den Straßen flattert. Immer noch ist Kasımpaşa ein konservatives Viertel, Alkohol mag zwar fester Bestandteil der Feiernden in den nahen Ausgehstraßen sein – in Kasımpaşa hingegen ist diese Sünde kaum zu haben. Hier wohnen vor allem Zugezogene vom Schwarzen Meer und Roma. Die muslimischen Frauen des Viertels sind entweder voll verschleiert oder tragen zumindest ein Kopftuch. Die Männer sitzen vor den Teestuben, spielen Tavla, ein türkisches Brettspiel, und lassen Gebetsketten durch die Finger gleiten. Die Gesellschaft ist homogen: fromm, konservativ, mittellos und bildungsfern. Das macht sie zum beliebten Wahlvolk der zu dieser Zeit regierenden DP – und zum Ziel der Verachtung der Kemalisten. Das Misstrauen, das die Kemalisten später dem hemdsärmeligen Aufsteiger Erdoğan entgegenbringen, fußt also tief – ebenso wie dessen Haltung gegenüber den alten Eliten. Der nutzt später jede Gelegenheit, sich an den »weißen Türken« zu rächen.